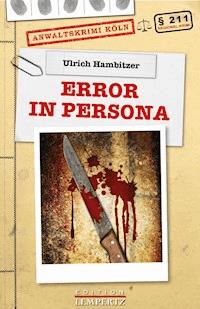
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung
- Kategorie: Krimi
- Serie: Regional-Krimi
- Sprache: Deutsch
Mitten in der Kölner Innenstadt wird einer Frau am hellichten Tag die Kehle durchgeschnitten. Die Täterschaft scheint eindeutig: Zeugen haben den mehrfachen Straftäter Peter Kussowski erkannt. Doch als ein junger Rechtsanwalt dessen Pflichverteidigung übernimmt, entdeckt er bald mehr und mehr Ungereimtheiten. Und dann ist da noch Kussowskis Hündin Emma, um die er sich kümmern muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Error in Persona
Anwaltskrimi Köln
vonUlrich M. Hambitzer
Impressum
Math. Lempertz GmbHHauptstraße 35453639 KönigswinterTel.: 02223 / 90 00 36Fax: 02223 / 90 00 [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus zu vervielfältigen oder auf Datenträger aufzuzeichnen.
1. Auflage – April 2015© 2015 Mathias Lempertz GmbH
Text: Ulrich M. Hambitzer
Umschlaggestaltung, Satz: Ralph Handmann, BonnLektorat: Laura Liebeskind-Weiland, Philipp GierensteinTitelbild: fotolia
Quellenvermerk zu den Zitaten:
S. 95: „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“, aus: Bertolt Brechts Hauspostille, in Bertolt Brecht, Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11: Gedichte 1.© Bertolt Brecht-Erben / Suhrkamp Verlag 1988S. 52/53: Botho Strauß, Der Aufstand gegen die sekundäre Welt. Aufsätze © Carl Hanser Verlag München 2012S. 183 und 193: Pablo Neruda, Das lyrische Werk III, hrsg. von Karsten Garscha © Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Übersetzung: Monika Lopéz und Fritz Vogelsang
Print ISBN: 978-3- 945152-89-8E-Book ISBN: 978-3-945152-01-0
Error in Persona
Anwaltskrimi Köln
vonUlrich M. Hambitzer
Ulrich M. Hambitzer, geboren am 10.10.1954 in Bonn-Beuel, Sternbild und Aszendent Waage, hat sich nach abgebrochenem Kunst- und Literaturstudium den Rechtswissenschaften zugewandt. Er arbeitet seit 30 Jahren in eigener Anwaltskanzlei. Auch privat schätzt er Krimis, kulinarische Genüsse und – natürlich – Hunde.
In Erinnerung an Alice,für Heinrich und natürlich für Emma.
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Weitere Krimis in der Edition Lempertz
Vorwort
Der Leser wird bemerken, dass der Erzähler seine Bildungsabenteuer und Lesefrüchte oft in einer Art Privatsprache zum Besten gibt, die vielleicht nicht jedem rückzuübersetzen leichtfällt. Deshalb hier einige Hilfen:
Mit dem Olympier ist Goethe, mit Pulverkopf, dem Dichter des Zarathustra, ist offenbar Friedrich Nietzsche gemeint, mit Holder, einem seiner Lieblingsdichter, Friedrich Hölderlin. Der vergessene Dichter ist Stefan George. Der Königsberger bucklige Pedant ist Kant. Schlomo ist einer der ursprünglichen Vornamen des großen Wiener Seelenbeschwörers, der natürlich Sigmund Freud ist. Der große chilenische Dichter ist Pablo Neruda, der „Ein Hund ist gestorben“, ein wunderbares Gedicht auf seinen verstorbenen Freund, geschrieben hat. Hieraus sind einige Gedichtzeilen entnommen.
Die weiteren Zitate, die die Ich-Figur freigiebig über ihre Erzählung hinstreut, wird der Leser sicher erkennen. Zu Sicherheit sei darauf hingewiesen, dass die Gedichtstrophe, mit der er Kussowski zu einem Gespräch bewegt, von Eichendorff und die beiden nachfolgenden Zitate von Goethe stammen. Die Passage aus dem „Anschwellenden Bocksgesang“ stammt selbstverständlich von Botho Strauss. Das Kirchenlied, das zu traurigem Anlass gesungen wird und auszugsweise wiedergegeben ist, hat Johann Major 1654 gedichtet. Das allerletzte Zitat – „Wer spricht vom Siegen? Überstehen ist alles.“– stammt von Rilke.
1.
Der Zweck heiligt die Mittel. Seitdem die Ereignisse, in die ich an dem denkwürdigen 28. August 1995 eingebunden wurde und die wenigstens einen Menschen in eine vorübergehende und zwei in die endgültige Katastrophe führten, ihren seltsamen Höhepunkten zustrebten, habe ich oft über diesen Satz nachgedacht. Heiligt der Zweck tatsächlich die Mittel oder ist dies nur eine uns seit Kindertagen immer wiederholte verlogene Phrase, die wir aus Gewohnheit nicht mehr hinterfragen? In der Kunst gilt das Gegenteil. Im Leben ist damit gemeint, dass auch schlechte Mittel gerechtfertigt sind, wenn sie zu einem guten Ergebnis führen. Um die Mittel heiligen zu können, muss allerdings der Zweck heilig sein. Von welchem Zweck lässt sich das schon behaupten? Und was, wenn ein Mittel mehreren Zwecken dient, die sich im Extremfall widersprechen? Oder wenn sich hinter dem offensichtlich verfolgten Zweck ein anderer, zweiter oder gar dritter verbirgt?
Ein Strafverfahren ist das Mittel, ein gerechtes Urteil herbeizuführen, also ein solches, bei dem die Strafe nach geltendem Strafrecht der Schuld entspricht. Das Prozessrecht soll außerdem einen geordneten Ablauf garantieren und formal die Rechte des Angeklagten wahren. Deshalb kann aus prozessrechtlichen Gründen ein Urteil geboten sein, das der Gerechtigkeit nicht genügt, aber trotzdem unangreifbar ist. Dann heiligen die Mittel, wie in der Kunst, den Zweck. Im Prozessrecht eine Kunstform zu sehen, scheint allerdings etwas hochgegriffen.
Am Vormittag des 28. August 1995 begann die Katastrophe mit einem Telefonanruf. Ich hatte zu dieser Zeit seit knapp sechs Jahren meine Anwaltszulassung und gerade mal wieder nicht genügend Arbeit. Mein Büro und meine darüber liegende Wohnung befanden sich in einem alten Haus am Rand des Belgischen Viertels, von dem der Putz abblätterte. Dafür war die Miete niedrig. Ich nahm den Hörer ab, am anderen Ende sprach Richter Dr. Legatz in die Muschel. Ich war ihm in einem drittklassigen Verfahren aufgefallen, in dem ich versucht hatte, ein wahres Schwein so gut wie möglich und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln seiner gerechten Strafe zu entziehen. Der Einsatz war groß gewesen, der Erfolg mäßig. Möglicherweise hatte ihm meine Verteidigung gefallen, denn er offerierte mir eine Pflichtverteidigung. Schon damals hatte ich eine Abwehrhaltung gegenüber solcher Anwaltstätigkeit. Dass der Staat, um sein Strafverfolgungsinteresse durchzusetzen, selber den Anwalt bestellt und bezahlt, der hiergegen verteidigen soll, ist mir zutiefst suspekt. Umso mehr, wenn der am Ende des Verfahrens urteilende Richter den Verteidiger auswählt. Hätte ich mehr zu tun gehabt, hätte ich das richterliche Ansinnen ohne Überlegung abgelehnt. Stattdessen überlegte ich.
Der Fall, den mir Dr. Legatz jetzt schilderte, war einfach gelagert, in seinen Konsequenzen allerdings erheblich und für mich möglicherweise werbeträchtig. Ein Tatverdächtigter saß in Untersuchungshaft und bedurfte eines Pflichtverteidigers. Man warf ihm Mord vor. Während des Telefonats versuchte ich, mir meinen Gesprächspartner Dr. Legatz vorzustellen. Ein intelligenter, verschmitzt wirkender, kahlköpfiger Familienvater mit einem selbstzufriedenen Hang zur Fettleibigkeit und auf dem sicheren Weg zur Pension, der vielleicht nicht ohne Wohlwollen, bestimmt jedoch nicht ohne Eigeninteresse einen leicht zu handhabenden Verteidiger suchte. Oder ging es ihm darum, eine optimale Verteidigung für einen einfach gelagerten, in seinen Auswirkungen allerdings beträchtlichen Fall sicherzustellen? Vielleicht, dies allerdings als letzte denkbare Möglichkeit, wollte er mir einfach nur einen Gefallen erweisen.
Er schilderte mir kurz und präzise die Situation. Peter Kussowski saß seit drei Monaten in Untersuchungshaft. Man hatte ihn betrunken in einer Kneipe aufgegriffen. Am Mittag desselben Tages war einer 75 Jahre alten Dame in der sonntäglich unbelebten Kölner Innenstadt mit einem Stilett die Kehle durchgeschnitten worden. Ein Zeuge hatte den Täter identifiziert, der jetzt in der Untersuchungshaft auf seinen Prozess wartete. Da er keinen Verteidiger benannt hatte, sei ihm nach Ablauf von drei Monaten einer zu bestellen und er, der Herr Richter Legatz, habe an mich gedacht. Die Verfahrenseröffnung sei so gut wie sicher, die Besuchserlaubnis läge mit der Akte im Geschäftszimmer für mich bereit. Auch sparte er nicht mit Direktiven für die Verteidigung. Diese könne sinnvollerweise nur auf das Strafmaß abzielen, weil Alkohol im Spiel war; der Sachverhalt sei klar und so gut wie erwiesen. Es sei nun an mir, abzulehnen oder anzunehmen.
Ich sagte zu, holte mir Besuchserlaubnis und Akte aus der Geschäftsstelle und begab mich in den Knast, um die Tatversion meines Mandanten, der bisher zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, und ihn selbst kennen zu lernen. Vor allem Letzteres war maßgeblich, denn schließlich verteidigt man nicht die Tat, sondern den Täter.
Die Fahrt zum Gefängnis in Köln-Ossendorf nahm etwa 45 Minuten in Anspruch. Köln versteckt sein Klingelpütz hinter Baumbepflanzung; andere Städte verbergen Gefängnisse hinter Industriegebieten. Jeder weiß, dass sie da sind, sehen möchte sie keiner. Jeder weiß, dass sie da sind, sehen möchte sie keiner. Während ich die übliche Prozedur über mich ergehen ließ, Ausweis und Besuchserlaubnis überprüft wurden, ich drei Schleusen mit je zwei Schlössern an den doppelten Türen passierte, hinter denen mich jeweils ein anderer Beamter weiterbegleitete, nahm ich die Atmosphäre dieses mit vermeintlicher Heilwirkung versehenen Mikrokosmos auf und erreichte die Besucherzelle. Diese besitzt zwei gegenüberliegende Stahltüren, eine für den Besucher und eine zum Gefangenentrakt, ferner einen abgeschabten Tisch mit einem schmutzigen Aschenbecher, zwei ebensolche wackeligen Stühle und eine Klingel, die der Besucher betätigen muss, damit ihm bei Besuchsende geöffnet wird. Zweck dieser Justizvollzugsanstalt ist es, Freiheitsstrafen sinnvoll und human zu vollstrecken und Untersuchungshäftlinge ihrem Verfahren zuzuführen. Zweck der Freiheitsstrafe ist, wie der Jurist schon im ersten Semester erfährt, auch in unserem aufgeklärten Säkulum ein dreifacher: Schutz der Allgemeinheit vor dem Täter, Abschreckung der Allgemeinheit, Straftaten zu begehen, und Abschreckung des Täters, solche zu wiederholen. Das gerechte Strafmaß ist das der Schuld angemessene. Die Resozialisierung soll auch ein Strafzweck sein. Aber die Strafe macht diese unmöglich. Denn nicht der mehr oder weniger lang andauernde Freiheitsentzug ist es, der den Täter am empfindlichsten trifft, sondern die damit einhergehende Totalvernichtung seiner bürgerlichen Existenz. Schulden können nicht mehr bezahlt werden, Vermögenswerte, falls vorhanden, werden zerschlagen, Wohnung und Arbeit sind weg, Beziehungen gehen in die Brüche, so dass der Täter schließlich als dauerhaft Ausgestoßener vor den Scherben seiner Vergangenheit steht, die durch nichts mehr zu kitten ist. Freilich ist dies bei einer lebenslangen Haftstrafe nicht mehr bedeutungsvoll. Aber der, der aus dem Gefängnis wieder herauskommt, gerät zwangsläufig erneut hinein, und wenn sich dieser Rhythmus lange genug wiederholt hat, bleibt er schließlich für immer drin. Müsste nicht die Strafe das Gegenteil bewirken? Wäre nicht bei richtiger Betrachtungsweise die soziale Reintegration, mit welchen Mitteln auch immer, das vordringliche Ziel jeder Strafe?
Solche Gedanken wurden drastisch unterbrochen, als mein zukünftiger Mandant durch die für ihn bestimmte Tür in die Besucherzelle geführt wurde. Zunächst fiel der typische Gefängnisgeruch auf, den jeder Inhaftierte schon nach kurzer Gefangenschaft ausdünstet, als ob er nie anders gerochen hätte: Eine Synthese aus Kohl, Kernseife, Fett und Schweiß. Zum Teil Folge der physischen Haftbedingungen, zum Teil Folge der Angstsituation, die sich durch die Poren schlägt.
Kussowski betrat den Raum, musterte mich teilnahmslos und setzte sich grußlos auf den mir gegenüberstehenden Stuhl, während mit brutalem Schlüsselgeklapper die Tür hinter ihm verschlossen wurde. Ich stellte mich als sein ausgewählter Pflichtverteidiger vor. Er erwiderte: „Mit Ihnen habe ich nichts zu besprechen.“
Er nahm nicht das Privileg der Untersuchungsgefangenen, eigene Kleidung zu tragen, in Anspruch, sondern war mit dem blauen Anstaltsdrillich der Gefangenenuniform bekleidet. Ich deutete dies als Zeichen, dass er keinerlei Hoffnung auf Freiheit hegte, sondern den nahtlosen Übergang der Untersuchungshaft in die Strafhaft erwartete. Deswegen war es aus seiner Sicht sinnvoll, sich so früh wie möglich nicht mehr von den anderen Häftlingen zu unterscheiden und seine Integration in dieser abgeschlossenen Welt schnell voranzutreiben.
Man soll eine Situation oder einen Menschen nie vorschnell beurteilen, sondern sich gründlich ein eigenes Bild machen. Alles andere führt fast immer zu einer ungerechten Wertung. Dies fiel mir nach Einsicht in die angenehm dünne Ermittlungsakte schwer. Vor mir saß einer, der von vornherein chancenlos auf die Welt gekommen war und der einen Schicksalsweg abzuschreiten hatte, der notwendigerweise an einem Ort wie diesem enden musste. Er übertraf meine negativen Erwartungen bei Weitem. Aus dem der Akte in einem Sonderumschlag beigefügten Vorstrafenregister ergab sich vor dem Hintergrund des in Hellgrün aufgedruckten Bundesadlers ein verheerendes Bild: im zarten Alter von zwölf Jahren die ersten Ladendiebstähle, dann Einbrüche, dann die üblichen Verkehrsdelikte – Fahren ohne Fahrerlaubnis mit geknackten Autos und erheblichem Sachschaden. Schon mit sechzehn hatte er einen Schuldenberg angehäuft, von dem sicher war, dass er ihn bis an sein Lebensende nicht würde abtragen können. Die Möglichkeit der Privatinsolvenz mit Restschuldbefreiung nach sieben Jahren Wohlverhalten gab es damals noch nicht, stattdessen verjährten titulierte Forderungen erst in dreißig Jahren. Sozialstunden und Ermahnungen, dann Jugendhaft. Danach Beleidigungen, Körperverletzungen in allen Abstufungen, nach der Pubertät zwei Vergewaltigungen, eine begangen an einer 61 Jahre alten Rollstuhlfahrerin, der man einen Fuß amputiert hatte, mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, der erste Raubüberfall mit dreiundzwanzig, schließlich fahrlässige Tötung. Ein Vorsatz war nicht nachweisbar gewesen. Der Mann war ein Monster. Bis zu seinem vor wenigen Wochen erreichten vierzigsten Lebensjahr hatte er ein gutes Drittel seines Lebens in Gefängnissen zugebracht. Zwischendurch gab es trotz der dort geknüpften Verbindungen mit anderen Straftätern eine fünfjährige Pause, in die eine gescheiterte Ehe, die Geburt eines unehelichen Sohnes und einer ehelichen Tochter fiel, deren Unterhaltsansprüche er nicht bediente und mit denen er auch sonst keine Verbindung pflegte. In seinem Vernehmungsbogen, der außer Angaben zur Person nichts enthielt, fand sich als Berufsbezeichnung „Sozialhilfeempfänger“, eingetragen von einem klugen Kriminalbeamten. Richtig müsste es heißen „Arbeiter“, denn das war er während der fünf Jahre gewesen, in denen er strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten war. Nun saß er vor mir und bestätigte den spärlichen kalten Akteninhalt durch seine Erscheinung. Alles das, was auf dieser Welt schön sein kann, war ihm verschlossen. Besuch der Hauptschule ohne Abschluss. Intelligenz, Empathie und Sozialfähigkeit verkümmert. Aufgewachsen in einer Vorstadtsiedlung bei einer Mutter, die ab und zu auf den Strich ging, damit etwas in die Haushaltskasse kam, bevor sie hierfür zu fett und unansehnlich wurde, und bei einem ständig alkoholisierten Stiefvater, dessen Zuwendung an den Sohn in täglichen Prügelorgien bestand.
Mit über der Brust verschränkten Armen saß er vor mir. Seine Nägel waren bis aufs Blut abgekaut, die Augen umrändert, mit strähnigen öligen Haaren, die bis in den Nacken reichten, den Blick auf einen Punkt über meinem Kopf gerichtet. Für ihn war ich Teil des Systems, das ihn wegsperren wollte. Ein bestellter Verteidiger, der ihn möglichst schnell und einfach einer Strafe zuführte, der das Pflichtverteidigerhonorar kassieren wollte und dessen Interesse allenfalls darin bestand, durch geschickte Prozessführung die Verhandlung zu verzögern und zu verlängern, um dieses zu erhöhen.
Ich legte ein Päckchen Tabak und Zigarettenpapier vor ihn auf den Tisch, denn im Knast dreht man selbst und kleine Geschenke sind hier immer willkommen. Statt eine Zigarette zu rauchen und damit ein Gespräch einzuleiten, steckte er den Tabak wortlos in die Hemdtasche und verschränkte wieder die Arme, ohne mich anzusehen. Wir schwiegen einige Sekunden. Um irgendeinen Anfang zu machen, fragte ich ihn, wo er am Tattag gewesen sei. Er reagierte, indem er die Hände hinter dem Kopf verschränkte, seinen Oberkörper zurücklehnte, seine Beine lang ausstreckte und zur schmutzigen Decke sah. Ich bereute spätestens jetzt, mich auf diese Sache eingelassen zu haben, und unternahm dann einen letzten Versuch. Ich zitierte diesem Menschen, der wahrscheinlich außer dem EXPRESS und seinem monatlichen Sozialhilfebescheid nichts las, eine Gedichtstrophe:
„Es singen und klingen die Wellen
Des Frühlings wohl über mir
Und seh´ ich so kecke Gesellen;
Die Tränen im Auge mir schwellen –
Ach Gott, führ uns liebreich zu dir!“
An die Macht der Dichtung habe ich nämlich schon immer geglaubt. Natürlich trug ich mit ironischen Überbetonungen vor. Er schaute mich halb erstaunt und halb bösartig an. Während ich noch überlegte, wie lange es dauern würde, bis ich in diesem nicht überwachten Elendsraum die Klingel gedrückt hätte, und wie viele Blessuren er mir beibringen könnte, bevor mich ein Wärter befreien würde, setzte ich ein Zweites hinterher:
„Allein der Vortrag macht des Redners Glück.“
Mir war klar, wenn er jetzt nicht zuschlägt, könnte ein Gespräch gelingen. Er beugte sich vor, legte seine Pranken auf den Tisch und schaute mir zum ersten Mal frontal ins Gesicht. Ich trieb die Sache auf die Spitze und zitierte ein Drittes:
„… Jegliche Rede,
Wie sie auch weise sei, der erdgeborenen Menschen
Löset das Rätsel nicht der undurchdringlichen Zukunft.“
Damit war das Maß voll und mein Zitatenvorrat erst einmal erschöpft. Ich erwartete, wie damals als Schüler, als mich der Mathematiklehrer dabei ertappte, dass ich während der Unterrichtsstunde in den unter der Bank liegenden Hyperionroman vertieft war, allerdings erheblich Empfindlicheres als die damalige Kopfnuss. Er beugte sich vor und ich mich zurück, in Erwartung des ersten Faustschlags. Stattdessen verzog sich sein Gesicht zu einem Lächeln. „Sie sind aber ein komischer Vogel“, sagte er. Damit war der Kontakt hergestellt, der Rest war ein Kinderspiel. Die poetischen Beschwörungsformeln hatten sich, wie schon oft in meinem Leben, bewährt.
Er kramte den Tabak aus seiner Tasche, drehte sich geübt eine Zigarette, steckte sie an und paffte mit sichtlichem Genuss den Rauch in meine Richtung. Dann schob er mir den Tabak zu und ich tat dasselbe. Wie in alten Indianerritualen löste sich der Bann zwischen uns langsam in Rauch auf. Während seines Verfahrens würde ich meinen Vorsatz, endlich mit dem Rauchen aufzuhören, nicht umsetzen können.
Ich stellte zunächst keine Frage mehr. Vor allem nicht die nach seiner Täterschaft, die jeder Laie erwarten würde. Diese Frage stellt der gute Verteidiger nie. Denn ihn hat entgegen landläufigem Aberglauben auf der beruflich-sachlichen Ebene nicht zu interessieren, ob sein Mandant schuldig ist oder nicht. Schließlich ist er kein Moralapostel, sondern der Wahrer und Sachwalter ihm anvertrauter dringender Interessen. Er hat die Beweissituation zu klären und mit welcher Strategie ihr für den Angeklagten am günstigsten Rechnung zu tragen ist. Hiernach richtet sich dann zunächst die grundsätzliche Frage, ob zu gestehen ist. Denn ein frühes Geständnis kann strafmindernd wirken. Wenn dies nicht in Betracht kommt, weil die Beweislage noch offen ist, hat er abzuwägen, ob der Angeklagte während des Verfahrens schweigt, was nicht zu seinem Nachteil gewertet werden darf, oder ob er sich zur Tat bestreitend erklärt, was das Strafmaß erhöht, wenn das Gericht letztendlich von seiner Täterschaft überzeugt sein sollte. Die sinnvolle Verteidigung besteht nun zunächst darin, die in der Akte enthaltenen Ermittlungsergebnisse zu würdigen und hiernach frühzeitig das Verhalten des Angeklagten optimal, das heißt zu dem für ihn bestmöglichen Ergebnis führend, einzurichten.
Ich fragte also nichts, sondern ging mit Kussowski Stück für Stück den Inhalt der angenehm dünnen Akte durch. Diese enthielt im Wesentlichen, außer dem erwähnten beeindruckenden Vorstrafenregister, dessen Erörterung ich lieber erst einmal zurückstellte, bis wir uns besser kennengelernt haben würden, drei umfangreiche Ermittlungsberichte, zwei maßgebliche und einige unwichtige Zeugenaussagen, einen Obduktionsbericht, eine Blutalkoholbestimmung Kussowskis, einen zusammenfassenden Abschlussbericht und die Anklage.
Der Bericht des KOK Möller und des KK Müller leitete knapp den Sachverhalt ein. Tattag war Sonntag, der 28.5.1995, Tatzeit 13.39 Uhr. Das Wetter war sommerlich heiß und schwül, einer der ersten Tage, die die dann später eintretende Sommerhitze vorwegnahmen. In einer ruhigen Straße der unbelebten Kölner Innenstadt wurde die 75-jährige Frau von Loewen-Kampen sehr prosaisch, aber nicht undramatisch mit einem einzigen gezielten Messerschnitt durch die Halsschlagader vom Leben zum Tod befördert. In einem sich anschließenden Vernehmungsprotokoll bekundete ein Zeuge namens Dietrich Bunsch auf die jeweiligen Fragen des Vernehmungsbeamten KOK Möller seine Beobachtungen. Bunsch war 31 Jahre alt und von Beruf Versicherungsagent. Die Tat hatte sich in der Kleinen Budengasse ereignet, eine Straße, die direkt auf eine von Kölns beliebtesten Fußgängerstraßen, die Hohe Straße, zuführt. Vom Standort der Hauptakteure des Verbrechens gesehen, stand Bunsch auf der anderen Straßenseite. Dort liegt ebenerdig eine auf irisch stilisierte Kneipe, in der das gute Stout frisch gezapft wird. Der Zeuge hatte den verhängnisvollen Vorfall aus einer Entfernung von etwa 10 bis 15 Metern beobachtet. Er beschrieb zunächst auf Befragung des Vernehmungsbeamten den Tathergang und dann den Täter.
Wieder einmal fragte ich mich, ob dieser Frage-und-Antwort-Stil eines drittklassigen Librettos mit vertauschten Rollen eigentlich Authentizität vermitteln soll oder eine besondere Glaubwürdigkeit der Vernehmung suggerieren will.
„War Ihr Standpunkt zum Beobachtungszeitpunkt in dem dem Fußgängerverkehr gewidmeten öffentlichen Verkehrsbereich oder befanden Sie sich in einem dem Privateigentum der Anwohner zugehörigen Privatbereich?“ – „Mein Standort war im öffentlichen Fußgängerverkehrsbereich.“- „Haben Sie gesehen, wie ein mutmaßlicher Schädiger der mutmaßlich Geschädigten mit einer genau gezielten 180 Grad-Bewegung die Kehle mit einem scharfen Gegenstand auf gefährliche Weise zerschnitt und hierdurch ursächlich den Tod der Geschädigten willentlich und wissentlich bewirkte?“ – „Ich habe gesehen, wie der Täter den Kopf der Geschädigten nach hinten drückte und dann mit einem scharfen Gegenstand waagerecht den Schnitt durchführte. Dabei muss er ersichtlich gewusst haben, dass er die Geschädigte hierdurch verletzte.“ – „Wie viele Minuten lagen zwischen dem vom Ihnen anvisierten Sachverhalt und dem Eintreffen der ermittelnden Beamten?“ – „Nur sehr kurze Zeit“.
Das holprige Frage- und Antwortspiel im teilweise unerträglichen Polizistendeutsch, das wahrscheinlich mühselig und von langen Pausen unterbrochen mit zwei Fingern in die Schreibmaschine getippt worden war, dokumentierte zunächst den Tathergang.
Alles war blitzschnell gegangen. Eingreifen konnte Bunsch nicht, zumal er in einen Schockzustand geriet. Der Täter hatte sich von hinten dem Opfer genähert, ihre Stirn mit der linken Hand nach hinten gedrückt, während die rechte mit einem Messer blitzschnell den Kehlenschnitt von links nach rechts führte. Das Blut schoss wie eine Fontäne nach vorne heraus. Blutstillende Maßnahmen schienen bereits auf den ersten Blick sinnlos.
Dann folgte eine detaillierte Beschreibung des Opfers und vor allem des Täters. Zunächst dessen Kleidung: Unter einer blauen Jeansjacke ein weißes T-Shirt, eng geschnittene Jeanshosen und Westernstiefel aus Leder, auf deren Beschreibung der Zeuge besondere Mühe verwandte. Anscheinend waren sie wirklich etwas Besonderes. Ihre Farbe war schwarz, das Leder aufgerautes Antik, handvernäht, in der Form liefen sie vorne spitz zu, mit einem breiten höheren Absatz, der nach hinten abgeschrägt war und in einem leichten Winkel nach innen lief. „Könnte man sagen er trug Westernstyle, also war gekleidet wie ein Cowboy?“, lautete daraufhin die trefflich formulierte Frage des Ermittlungsbeamten, der hierdurch die Vernehmung mit seiner weltoffenen Kenntnis folkloristischer Trachten bereicherte. Dann die Statur des Täters: circa 1,80 m bis 1,85 m groß, höchstens 85 Kilo Körpergewicht, breitschultrig, schmal in den Hüften, athletischer Typus. Alter um die 40. Dichte schwarze Haare, die vorne mit einem wirren Mittelscheitel ins Gesicht hingen und hinten knapp über den Kragen reichten. Das Gesicht markant mit einem starken, männlichen Kinn. Zur Augenfarbe konnte der Zeuge, anders als zur Farbe der Schuhe, aufgrund der Entfernung nichts sagen. Die Beschreibung passte exakt auf Kussowski.
Die Aussage der zweiten Zeugin, die einen schwer auszusprechenden ausländischen Namen trug, war wesentlich kürzer. Wahrscheinlich hatte KOK Möller zu diesem Zeitpunkt schon die Lust verlassen, zumal er inzwischen durch die erste Vernehmung alles Wichtige wusste. Die Kleidung, einschließlich der Stiefel, an denen ihr vor allem der Absatz aufgefallen war, dessen Höhe sie mit mindestens 6 Zentimeter angab, schilderte sie ebenso wie ihr Vorgänger, allerdings weniger detailliert. Dafür beschrieb sie Statur, Haare, Frisur des Täters sehr viel genauer und sparte ungewöhnlicherweise auch nicht daran, seine Bewegungen und seine Körperhaltung zu schildern. Im Vernehmungsdeutsch ergab dies seltsame Blüten wie „ungewöhnliche raubtierhafte Geschmeidigkeit in seiner Körpermotorik, betont katzenhafter Beinauftritt“ und ähnliche Alltagslyrismen. Sie konnte sein Gesicht lediglich im Profil sehen – und auch das nur teilweise von schräg hinten – und seine Rückenansicht beschreiben. Sie befand sich auf derselben Straße wie Täter und Opfer und hatte Tat und Täter aus etwa 25 Metern Entfernung gesehen. Den Täter hatte sie erst relativ spät bemerkt, da sie zunächst in die Betrachtung des Brunnens vor dem Spanischen Bau vertieft gewesen war.
Nach dem Vorfall rannte der Täter in eine Seitenstraße; die Zeugin suchte verzweifelt eine Möglichkeit zu telefonieren und wurde schließlich in einem etwa 200 Meter entfernten Café auf dem Alter Markt fündig, von dem aus sie die Polizei alarmierte. Der Zeuge dagegen rannte in seine nahe gelegene Wohnung, um von dort aus anzurufen. Im schönen stillen Sommer 1995 waren Handys in Deutschland noch nicht verbreitet. Notarzt und Polizei trafen gleichzeitig exakt neun Minuten nach der Tat am Tatort ein. Das Opfer war zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Minuten tot.
Der ermittelnde Leitende Oberstaatsanwalt hatte an den Zeugenvernehmungen teilgenommen.
Bunsch hatte, nachdem er sechs Stunden lang die einschlägigen Karteien durchsucht hatte, Kussowski unzweifelhaft identifiziert. Die zur selben Zeit vernommene Zeugin konnte ihn anhand der Karteien nicht ermitteln. Kussowski konnte nicht in seiner Wohnung in einem Wohnblock in Neubrück festgenommen werden, die KOK Möller und KK Müller mithilfe einer Einsatztruppe von neun geschulten Polizeibeamten und nicht unerheblichem Sachschaden am 28.5.1995 gegen 19.00 Uhr stürmten, als auf ihr Klingeln nicht geöffnet wurde. Ein erst anschließend befragter Nachbar erklärte, Kussowski sei um diese Zeit höchstwahrscheinlich im „Halben Stier“, seiner Stammkneipe, die sich zwei Straßenzüge von seiner Wohnung befand. Dort griffen ihn die Ermittlungsbeamten um 20.09 Uhr in volltrunkenem Zustand mit einer später festgestellten Blutalkoholkonzentration von über drei Promille auf. Sein Vernehmungsprotokoll vom nächsten Morgen enthielt lediglich Angaben zur Person, zur Tat hatte er die Aussage verweigert. Einen Anwalt wünschte er nicht.
Daran schloss sich eine ausführliche Gegenüberstellungsdokumentation an, in der der Zeuge Bunsch Kussowski unter sechs Personen eindeutig identifizierte, während die Zeugin ihn nicht als Täter erkannte.
„Blödsinn“, kommentierte Kussowski entrüstet, nachdem ich ihm den Akteninhalt vorgelesen hatte. „Schwachsinn! Ich würde niemals solche Tuntenschuhe mit Sechszentimeterabsätzen anziehen. Meine haben höchsten drei Zentimeter.“ Der Mann verstand es, mich zu verblüffen. Dass man ihm solches Schuhwerk zutraute, schien für ihn eine noch größere Zumutung zu sein, als ihm einen Mord zu unterstellen.
„Ich habe am Sonntag wie immer einen Waldspaziergang mit dem Hund gemacht. Gegen 15.00 Uhr war ich wieder zu Hause, hab mir ein paar Bier gezischt und ein paar Klare, und als es nichts mehr zu trinken gab, bin ich irgendwann eingepennt, und als ich wieder wach wurde, in den ‚Halben Stier’ gegangen. Da wollt ich noch einen kippen.“ Er neigte offenbar dazu, sich über die Bewusstseinsgrenze hinaus zu betrinken. Weder an seine Festnahme noch an die ärztliche Blutalkoholkontrolle und an seine hierzu erklärte Einwilligung, welche Rechtswirkungen diese auch immer haben mochte, konnte er sich erinnern. Auch nicht, wie er die Nacht in der Zelle verbracht hatte.
Ich wandte ein, dass ihn immerhin ein Zeuge identifiziert habe, und fragte nach seinem Alibi. Kussowski lebte allein. Freunde hatte er keine, nur ein paar Saufkumpane, die er im „Halben Stier“ traf. Niemand konnte bestätigen, dass er am Nachmittag des 28.5.1995 während der Tatzeit im Wald gewesen war.
Ich wollte ihn nicht überstrapazieren. Immerhin war seine Weigerung, mit mir zu sprechen, gerade einmal anderthalb Stunden her. Außerdem hielt ich die Knastatmosphäre, an die man sich bei jedem Fall neu und am besten in kleinen Dosen gewöhnen muss, allmählich nicht mehr aus. „Also gehen wir auf Freispruch“, sagte ich, um meinen Abgang wirkungsvoll einzuleiten. Kussowski lachte trocken und hämisch auf. „Das ist doch nicht Ihr Ernst, wo die so einen Passenden wie mich gefunden haben.“
Ich erwiderte mit betonter Selbstsicherheit: „Warten Sie ab, ich werde diese Akte auseinandernehmen. Kein Buchstabe wird hinterher mehr derselbe sein. Ich werde nichts unversucht lassen, Ihre Unschuld zu beweisen.“
Um noch stärkere Verbindlichkeit aufkommen zu lassen, fragte ich ihn, wie er hier zurechtkomme. „Der Fraß ist furchtbar! Gäb’s doch mal eine Currywurst mit diesem irren Ketchup, wie in der Bude bei mir um die Ecke und hinterher ‘ne Frikadelle mit ‘nem kühlen Blonden und ‘nem Klaren wie im ‚Halben Stier’", sagte er leise mit sehnsüchtiger Stimme. Das traf. Nicht ein erlesenes Menü mit den entsprechenden Getränken, keine Kresseschaumsuppe, deren Konsistenz und zarte zitronige Aromen die Deftigkeit grüner saftiger Kleewiesen erahnen ließ, kein nachfolgender, sorgsam in edlem Chablis angedünsteter Saibling mit dem Zusatz von Zitronengras, das dessen zarten Eigengeschmack ins Unendliche steigert. Kein Gedanke an das dazu unerlässliche Glas Champagner aus einer kleinen Winzerei in Le Mesnil-sur-Oger, dessen fruchtig herber Geschmack sich jeder Beschreibung entzieht, den aber keiner vergisst, der ihn einmal genossen hat. Nicht auf einer glatt gebügelten, weißen Leinentischdecke von einem freundlichen, unaufdringlichen Ober serviertes, sanft mit frischem Estragon auf den Punkt gebratenes Rinderzwischenstück, dessen Zartheit sich beim ersten Bissen offenbart, in Begleitung einer exakt passenden, dunklen, aus einem Fond von Rinderknochenmark unter dem behutsamen Zusatz einer erlesenen Balsamicomischung komponierten Soße von ungeahnter Aromenfülle, kredenzt mit einem edlen Burgunder aus der flachen Côte d’Or. Auch nicht den darauf folgenden Baba, der, mit jahrzehntelang gelagertem Jamaika getränkt, die vorangegangenen Genüsse abrundet und nicht an den heißen, schaumigen Espresso mit dem wohltemperierten edlen Calvados zum Abschluss. Nein, an all das dachte Kussowski nicht, würde an Derartiges nie denken, weil er eine solche Mahlzeit nicht kannte und auch nie kennen lernen würde. Seine Wünsche und seine Vorstellung äußerster Genüsse beschränkten sich auf eine Currywurst, gebraten in billigem, abgestandenem Fett, deren Geschmack durch alle möglichen Verstärker wie Saccharose, Dextrose, Ascorbin, Superwasserstoffoxid erreicht und deren Verfall durch die Konservierungsmittel E 250 und E 252 herausgezögert wurde. Dann als zweiten Gang eine abgelagerte, zusammengepanschte Frikadelle aus undefinierbarem Fleisch, braun verbrannter Zwiebel und altem, in Wasser aufgeweichtem Brot. Dazu immerhin ein frisch gezapftes Kölsch, missmutig serviert auf der verschmutzten Theke von dem nach Schweiß stinkenden, übel gelaunten, übernächtigten Wirt. Kussowskis Sehnsüchte lösten eine Art Rührung und verhaltene Wehmut über das Verteilungssystem unserer Welt aus, gegen die auch das Wissen nicht half, dass gutes Essen keine Frage des Geldes, sondern des guten Geschmacks ist, weil die Ungerechtigkeit nicht nur in der Verteilung der materiellen Güter liegt, sondern jede Möglichkeit der Entwicklung und Lebensgestaltung betrifft, die – nach welchen Maßstäben auch immer – dem einen eingeräumt werden und dem anderen versagt bleiben. Bevor sich dies bemerkbar machte, fragte ich, ekelhaft professionell, ob ich etwas für ihn tun könne. Üblicherweise kommen dann Bitten um Rücksprache mit dem Vermieter oder mit Gläubigerbanken, Grüße an die Ehefrau oder Verwandte oder Ähnliches.
Kussowski dagegen hatte anderes im Sinn. Er griff umständlich in die Gesäßtasche seiner Gefängnishose und wühlte ein zerknittertes Foto hervor. Darauf war ein mittelgroßer, weißer Hund in sitzender Stellung abgebildet. Es war sicher nicht einfach gewesen, dieses Bild durch die Gefängniskontrolle zu bringen. Dass ihm dies gelungen war, verriet jahrzehntelange Knastroutine.
„Das ist Emma“, sagte er. „Sie war bei mir, als ich verhaftet wurde. Ich wüsste gerne, wo sie jetzt ist.“ Dabei bekamen seine Augen einen bekümmerten Ausdruck. Ich schaute mir das Foto genau an, damit ich das Tier wiedererkennen würde und versprach ihm, herauszufinden, was aus ihm geworden war. Kussowski nahm stetig menschlichere Züge an, hinter denen das Monster aus der Ermittlungsakte zurücktrat. Ich verabredete mit ihm, binnen der nächsten Woche mit einer ausgearbeiteten Verteidigungsstrategie wiederzukommen, und betätigte die Klingel. Die Tür hinter Kussowski wurde zuerst geöffnet. Ich streckte ihm die Hand hin, die er ungewöhnlich kräftig drückte. Vielleicht hatte er Vertrauen zu mir gefasst. Dann wurde er abgeführt. Ich hatte noch 2 Minuten zu warten, bevor der Schließer den Weg in die andere, für mich bestimmte Richtung eröffnete, und ich dachte mit Befriedigung und einem gewissen Stolz daran, welch günstige Wendung das Gespräch mit Kussowski genommen hatte. Knapp 2 Minuten hatte es gedauert, bis Frau von Loewen-Kampen nach dem Schnitt verblutet war.
Als sich die Außenknasttore hinter mir schlossen, war es früher Abend. Die Sonne stand noch am Himmel, die Schwüle wich langsam und die Luft begann, angenehme Kühle aufzunehmen und weiterzuverbreiten. Während noch die Bilder, die ich bei unserem Gespräch aufgenommen hatte, bruchstückhaft durch meine frische Erinnerung der Verarbeitung entgegenflossen, verspürte ich Hunger. In der Nähe befand sich eine Imbissbude. Auf einer Plastiktafel wurden Döner, Pommes frites und Currywurst angeboten. Ich entschied mich zur Feier meines neuen Mandats für Letztere und führte experimentell die vorgeschnittenen, mit gelbem Curry bestreuten Wurststücke von einem rechteckigen, an den Seiten gewellten Pappteller mit einer kleinen Plastikgabel zum Mund. Gar nicht so übel, stellte ich fest, während ich die sauber geschnittenen, kross gebratenen Stücke in dem würzigen, scharfen Ketchup wälzte. Der Pappteller war an allen vier Ecken mit sanften Rundungen ornamentiert. Dahinter steckte der Wille zur Verschönerung. Also auch hier ein kleines Stück Kultur. Alles ist eine Frage der Perspektive. Nach dem Verzehr fuhr ich zurück in die Altstadtcity und ging in ein in Tatortnähe liegendes Szenebistro. Da ich öfter dort bin und immer dasselbe bestelle, stellte der junge Student hinter der Theke einen Espresso und ein Glas Leitungswasser vor mich hin, nachdem wir uns vertraut kommentarlos zugenickt hatten. Ich fasste den Entschluss, mir auch Kussowskis zweiten Traumgang zu Gemüte zu führen und zwar im „Halben Stier“, um gleichzeitig den Verbleib seines Hundes zu klären. Als ich dort eintraf, war die Dämmerung eingebrochen. Ich setze niemals ohne zwingenden Grund meinen Fuß in diese Asyle der Elenden und Vereinsamten. Die Einrichtung solcher Tränken und ihre Atmosphäre sind überall in Europa gleich. Ein paar einsame Männer hocken auf Barhockern, in sich gekehrt, versammelt um einen hoffentlich erbarmungsvollen Wirt, der über ihr Glück oder Unglück entscheidet, welches davon abhängt, ob er ihnen noch etwas zu trinken gibt oder nicht. Getrunken wird Bier und Schnaps und zwar solange, wie sich der Gast aufrecht halten und bezahlen kann. Die allabendliche Besetzung der Handvoll Gäste unterscheidet sich kaum. Hagere Gestalten, die zum Teil merkwürdigerweise trotz ihrer Dürre dicke Bäuche tragen, wahrscheinlich als Folge einer Lebererkrankung. Die herrschenden Rituale sind, vor allem für einen Fremden, der hier fast eine Sensation darstellt, zu beachten. Das geringste falsche Wort kann Anlass für einen handfesten Streit werden. Untereinander verhält man sich immer gleich. Man trinkt in rasantem Tempo, redet kaum, und die wenigen untereinander gewechselten Worte werden wie die Blicke je nach Höhe des Alkoholpegels immer inhaltsloser, bis geistleeres Nirwana und vollständige Sprachlosigkeit eintreten. Hinter der Theke war ein altes ausrangiertes oder irgendwo gestohlenes Autoradio unter der Decke installiert. Hieraus drang das die Stille übertünchende, blechern klingende Schlagergemisch, das gesellige Dynamik vortäuschen soll und von Liebe, Hoffnung, rassigen Frauen und dem Lebensglück handelt, kurz von alledem, was die traurige Belegschaft dieses Etablissements bitter nötig hatte und nie bekommen würde.
Ich schlug den verdreckten Filzvorhang am Eingang zurück und betrat den dämmrig beleuchteten Raum. Ich grüßte selbstbewusst in die Runde, ohne dass jemand etwas erwiderte, und setzte mich auf einen leeren Hocker neben eine mit rotgeäderten Augen stumpfsinnig in ihr halb leeres Bierglas stierende, hagere Gestalt.
„Was darf’s sein?“, fragte der sich von seinen Gästen allenfalls durch den Grad seiner Trunkenheit unterscheidende Wirt.
„Gedeck“, sagte ich, worunter man das aus dem Hausmarkenbier und einem Schnaps zusammengesetzte Hausgericht versteht, um vorzugaukeln, wie heimisch ich in solcher Umgebung war. Wenn Kussowski sich hier wohlfühlte, würde er den Knast ohne weiteren Schaden überstehen. Auch dort gab’s nahezu täglich die auf unbekannten Wegen hineingelangte Flasche Klaren und Drogen aller Art. Sie sind dort zwar teurer, aber leichter zu beschaffen als draußen. Die Mithäftlinge, die man beim täglichen Umschluss besuchen konnte, waren auch nicht schlimmer als die Gäste des „Halben Stiers“ und die Beziehungen zu ihnen nicht weniger herzlich.
Das Radio im „Halben Stier“ spielte mit einem Mal unvermittelt den 3. Satz der 4. Symphonie Beethovens. Anscheinend war der Sender nach den Verkehrsdurchsagen mit den Staumitteilungen nicht umgesprungen. Ich nahm dies als gutes Zeichen; der erhebend heitere Heroismus der Klänge erfüllte selbst diesen Elendsort und hob meine Stimmung. Als der Wirt den Schlagersender wieder einstellen wollte, rief ich ihm zu: „Wenn Sie die Musik lassen, gebe ich meinen Einstand mit einer Lokalrunde.“ Dies war nur ein kleines Opfer, denn außer dem Wirt befanden sich nur drei Gestalten in der Kaschemme. Die neben mir prostete mir mit dem spendierten Bier zu, begleitet von beschwingten Beethovenklängen. Ich sagte ihm meinen Vornamen und stieß mit ihm an. „Scheißzeiten“, sagte ich. „An der Sozialkohle wollen se jetzt wieder knappsen.“
„Die Arschlöcher machen mit uns sowieso, was sie wollen“, war die zu erwartende richtige Antwort.
„Kennst du vielleicht Kussowski?“, fragte ich ihn.
Der Hagere schaute mich misstrauisch an. „Wieso willst du das wissen?“ Im Grunde wahrheitsgemäß antwortete ich, wir wären zusammen im Knast gewesen und ich hätte ihm versprochen, mich um seinen Hund zu kümmern. Wie dieser heiße, wollte der andere wissen, wohl als Beweis für den Wahrheitsgehalt meiner Erklärung.
„Emma“, sagte ich und damit sowie durch meine guten Referenzen waren die Zweifel an meiner Glaubwürdigkeit beseitigt.
„Wie geht’s ihm?“, fragte der Hagere.
„Heute gegen Mittag bevor ich raus bin, war ein Pflichtverteidiger bei ihm, den sie ihm gestellt haben.“
„Die sind nix! Wieso hat er denn nicht den Zülpiger?“
„Keine Ahnung“, sagte ich. „Wahrscheinlich zu teuer.“
Verständnisvoll und konform mit den Gesetzen der freien Marktwirtschaft erklärte der Hagere: „Zülpiger ist der Beste und deshalb auch der Teuerste. Umsonst kann der nix machen.“
Ich erwiderte: „Nein, eine gute Verteidigung ist eine teure Sache, aber allemal die Kohle wert, eh man sich mit der Kreisliga abgibt und eine saftige Packung einfängt.“ Wiederum waren wir uns einig. Er war im „Halben Stier“ gewesen, als Kussowski verhaftet wurde. Dessen Hund war von einem Polizisten eingefangen und ins Tierheim gebracht worden, wie dieser dem Hageren seinerzeit erklärt hatte.
Nachdem der Zweck meines Besuchs erfüllt war, aß ich noch eine Frikadelle, die, wie ich zugeben muss, den herben Geschmack des Bieres aufs Trefflichste ergänzte. Ich kaufte noch zwei, die ich für Kussowski in den Knast schmuggeln wollte, wünschte allseits Guten Abend und verließ diesen glücklosen Ort, in dem die Einsamen und Gescheiterten ihre traurige Geborgenheit oder Erlösung suchten.
Draußen stand ein sich erbarmender Vollmond leuchtend am aufgeklarten Himmel und breitete sein Licht über die Neubrücker Betonhäuserklötze mit ihren schmutzigen Graffiti und über die Straße, deren Schwarzdecke breite, notdürftig geflickte Risse aufwies. Mir kamen die unsterblich schönen und tröstenden Verse des Olympiers an den Mond in den Sinn.
„Selig, wer sich vor der Welt
Ohne Hass verschließt,
Einen Freund am Busen hält
Und mit dem genießt,
Was, von Menschen nicht gewußt
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.“
Unbewusstes oder nicht Bedachtes ohne Hass gemeinsam zu genießen, war nicht Sache der Kumpels im „Halben Stier“. Ihnen spendete der Mond keinen Trost. Hier war jeder sich selbst der nächste Beste und keine Erlösung in Sicht. In der Nacht schlief ich tief und traumlos; nichts nächtlich durch das Labyrinth meiner Brust Wandelndes störte meine Ruhe.





























