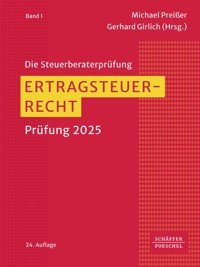
Ertragsteuerrecht E-Book
149,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Die Steuerberaterprüfung
- Sprache: Deutsch
Band 1 der Lehrbuchreihe verschafft einen konzentrierten Überblick über das Ertragsteuerrecht. Er behandelt die Kernbereiche und übergreifenden Komplexe der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und des Internationalen Steuerrechts. Neben der Vermittlung des Grundlagenverständnisses und des examensrelevanten Wissens werden auch steuerliche Gesamtzusammenhänge aufgezeigt. Die einzelnen Rechtsgebiete werden anhand vieler Beispiele, Übungsfälle, Schaubilder und Übersichten dargestellt. Der Band ist ideal für eine gezielte Vorbereitung auf den Prüfungsteil "Ertragsteuern". Rechtsstand: 30. November 2024 Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: - Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte - E-Book direkt online lesen im Browser - Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1469
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumDie HerausgeberDie AutorenVorwort der Herausgeber zur 24. Auflage (Prüfung 2025)Vorwort der Autoren zur 24. Auflage (Prüfung 2025)Inhaltsübersicht »Die Steuerberaterprüfung« Bände 1 – 3Themen des Prüfungsstoffs, geordnet nach PrüfungstagenAbkürzungsverzeichnisA Einkommensteuer I – KernbereicheI Grund- und Strukturfragen bei der Einkommensteuer1 Einleitung2 Übersicht Einkommensteuerrecht – Einkommensermittlung nach § 2 EStG2.1 Einzelveranlagung2.2 Zusammenveranlagung3 Überblick über die Tarifnormen des EStG3.1 Grundtarif nach § 32a Abs. 1 EStG3.2 Splittingverfahren nach § 32a Abs. 5 EStG3.3 Weitere Fälle der Anwendung des Splittingtarifs (§ 32a Abs. 6 EStG)3.4 Zusammenfassung3.5 Überblick über weitere wichtige Tarifvorschriften4 Die persönliche Steuerpflicht4.1 Der Wohnsitz im Inland (§ 8 AO)4.2 Der gewöhnliche Aufenthalt (§ 9 AO)5 Grundfragen zum Handlungstatbestand, insbesondere zu den Überschusseinkünften (Darstellung der §§ 8, 9 und 11 EStG)5.1 Stellung im Dualismus – System der Einkunftsarten (§ 2 Abs. 2 EStG)5.2 Einnahmen5.2.1 Grundsätze (Einnahmen/keine Einnahmen)5.2.2 Der Sachbezug5.2.2.1 Steuerliche Behandlung der Privatnutzung von Dienstwagen5.2.2.1.1 Grundsätzliches5.2.2.1.2 Private Kfz-Nutzung des GmbH-Geschäftsführers (AN)5.2.2.1.3 Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit eines Fahrtenbuches5.2.2.1.4 Tatsächliche Nutzung5.2.2.1.5 Kostenbeteiligung des Arbeitnehmers5.2.2.1.6 Weitere Besonderheiten5.2.2.1.7 Elektrofahrräder5.2.2.2 Privates Internetsurfen5.2.2.3 Die überlassene Wohnung an den Arbeitnehmer5.2.2.4 Die Jahreswagenregelung nach § 8 Abs. 3 EStG (Personalrabatt)5.2.3 Die Kausalitätsdichte5.2.4 Zufluss5.2.5 Negative Einnahmen5.3 Erwerbsaufwendungen, insbesondere die Werbungskosten5.3.1 Gemeinsamkeit und Unterschied zwischen Werbungskosten und Betriebsausgaben5.3.2 Aufwendungen als Werbungskosten sowie allgemeine Auslegungsfragen zu § 9 EStG5.3.3 Die Pauschalierungsregelung nach § 9a EStG5.4 Der maßgebliche Zeitpunkt beim Handlungstatbestand5.4.1 Systematische Stellung und Tragweite des § 11 EStG5.4.2 Einnahmen und Ausgaben und die wirtschaftliche Verfügungsmacht5.4.2.1 Zufluss und Abfluss bei bargeldloser Zahlung5.4.2.2 Erfüllungssurrogate (sonstige Zahlungsmodalitäten)5.4.2.3 Verfügungsbeschränkungen5.4.2.4 Bank- und bautechnische Besonderheiten5.4.3 Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und AusgabenII Der Zustandstatbestand – Überschusseinkünfte1 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (inklusive Grundzüge der Lohnsteuer)1.1 Aufteilung in materielles und formelles Recht1.2 Materiell-rechtliche Einkünfte nach § 19 EStG1.2.1 Der Arbeitgeberbegriff1.2.2 Der Arbeitnehmerbegriff1.2.3 Der Arbeitslohn1.2.3.1 Steuerpflichtige Komponenten1.2.3.1.1 Vermietungen des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber (Abgrenzung zu § 21 EStG)1.2.3.1.2 Aufmerksamkeiten aus persönlichem Anlass (R 19.6 Abs. 1 LStR)1.2.3.1.3 Betriebsveranstaltung1.2.3.1.4 Fortbildungsveranstaltungen (allgemein)1.2.3.1.5 Sozialversicherungsbeträge und weitere Abgrenzungsfälle1.2.3.2 Steuerbefreite Komponenten (§ 3 EStG)1.2.4 Werbungskosten bei § 19 EStG1.2.4.1 Einführung1.2.4.2 Fortbildungs- und Ausbildungskosten1.2.4.3 Reisekosten des Arbeitnehmers1141.2.4.3.1 Begriffe und Grundsatz1.2.4.3.2 Die »erste Tätigkeitsstätte« im Detail1.2.4.3.2.1 Dauerhafte Zuordnung1.2.4.3.2.2 Ortsfeste Einrichtung als Tätigkeitsstätte1.2.4.3.2.3 Zuordnung mittels dienst- oder arbeitsrechtlicher Festlegung des Arbeitgebers1.2.4.3.3 Zuordnung der Tätigkeitsstätte1.2.4.3.3.1 Höchstens eine erste Tätigkeitsstätte je Dienstverhältnis1.2.4.3.3.2 Mehrere Dienstverhältnisse1.2.4.3.3.3 Mehrere Tätigkeitsstätten und ihre Zuordnung1.2.4.3.3.4 Erste Tätigkeitsstätte ohne arbeits-/dienstrechtliche Festlegung (quantitative und zeitliche Zuordnungskriterien)1.2.4.3.4 Zeitliches Kriterium1.2.4.3.5 Zeitliches Kriterium und Zukunftsprognose1.2.4.3.6 Mehrere Tätigkeitsstätten1.2.4.3.7 Bildungseinrichtung als erste Tätigkeitsstätte1.2.4.3.8 Behandlung von Kosten im Zusammenhang mit der Auswärtstätigkeit1.2.4.3.9 Pauschale für Berufskraftfahrer § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5b EStG1.2.4.4 Arbeitsmittel des Arbeitnehmers1.2.4.5 Entfernungspauschale1.2.5 Darlehensgewährungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer1.2.5.1 Darlehen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer1.2.5.2 Darlehen des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber1.3 Die Pauschalierung der Lohnsteuer1.3.1 Einleitung1.3.2 Lohnsteuerrechtliche Folgen der Pauschalierung1.3.2.1 Pauschalierung von arbeitstäglichen Mahlzeiten im Betrieb1.3.2.2 Pauschalierung von Mahlzeiten während einer Auswärtstätigkeit1.3.3 Pauschalierung von Betriebsveranstaltungen (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG)1.3.3.1 Pauschalierung von Erholungsbeihilfen (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 EStG)1.3.3.2 Pauschalierung von Verpflegungsmehraufwendungen (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 EStG)1.3.3.3 Pauschalierung von Datenverarbeitungsgeräten1.3.3.4 Pauschalierung von Internetzuschüssen1.3.3.5 Pauschalierung von Ladevorrichtungen1.3.3.6 Pauschalierung der Übereignung eines Fahrrades1.3.3.7 Pauschalierung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte1.3.3.7.1 Zuschüsse im Rahmen der Fahrten mit einem Kraftfahrzeug1.3.3.7.2 Zuschüsse im Rahmen der Fahrten mit einem Jobticket1.3.4 Sachzuwendungen (§ 37b EStG)1.3.5 Sachzuwendungen an Geschäftsfreunde (§ 37b EStG)2 Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 i. V. m. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 EStG)2.1 Einleitung und Überblick zum geltenden Recht2.1.1 Überblick über § 20 und § 32d EStG2.1.2 Vorbemerkung zur weiteren Darstellung2.2 Die Gesetzestechnik bei den Einkünften aus Kapitalvermögen2.2.1 Die Erhebung der Steuer – Die Kapitalertragsteuer2.2.1.1 Grundzüge2.2.1.2 Steuerbescheinigung und Freistellungsauftrag2.2.2 Einschränkungen bei der Anrechnung der Kapitalertragsteuer nach § 36a EStG2.2.3 Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 9 EStG)2.2.3.1 Der Sparerpauschbetrag oder das Werbungskostenabzugsverbot2.2.3.2 Ausnahmen2.2.3.3 Verlustverrechnung bzw. Verlustausgleich (§ 20 Abs. 6 EStG)2.2.4 Besonderheiten bei der Ermittlung der Einkünfte (§ 20 Abs. 4, 4a EStG)2.2.4.1 Der Gewinn i. S. d. § 20 Abs. 2 EStG (§ 20 Abs. 4 EStG)2.2.4.2 Besonderheiten bei Kapitalmaßnahmen (§ 20 Abs. 4a EStG)2.2.5 Der besondere Steuersatz (§ 32d EStG im Detail)1522.2.5.1 Grundsatz2.2.5.2 Ausnahmen von der Abgeltungsteuer2.2.5.3 Günstigerprüfung (§ 32 Abs. 6 EStG)2.2.5.4 Unternehmerische Beteiligungen (§ 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG)2.2.5.5 Weitere Verfahrensfragen (§ 32d Abs. 3 und 4 EStG)2.2.5.6 Die Berücksichtigung ausländischer Quellensteuer (§ 32d Abs. 5 EStG)2.3 Die einzelnen Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 bis 3 EStG)2.3.1 Der Haupttatbestand (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 EStG)2.3.2 Sonstige »Beteiligungserträge«2.3.3 Sonstige Kapitalforderungen; Zinsen aus Lebensversicherungen (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG)2.3.3.1 Überblick und rechtliche Entwicklung2.3.3.2 Weitere Einzelheiten zur aktuellen Besteuerung2.3.4 Sonstige Kapitalforderungen, insbesondere gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG2.3.4.1 Die Grundaussage2.3.4.2 Einzelfälle und Zuflusszeitpunkt2.3.5 Einkünfte aus Stillhalterprämien (§ 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG)2.3.6 Die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen (§ 20 Abs. 2 EStG)2.3.6.1 Grundtatbestand2.3.6.2 Der Veräußerungsbegriff und -inhalt des § 20 Abs. 2 Nr. 1 und 7 EStG2.3.6.3 Überblick über Spezialfälle zum Veräußerungsbegriff2.3.6.4 Die Veräußerung von Lebensversicherungsverträgen (§ 20 Abs. 2 Nr. 6 EStG)2.3.6.5 Zusammenfassendes Beispiel2.3.7 Besondere Entgelte und Vorteile3 Vermietung und Verpachtung (§ 21 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 6 EStG)3.1 Überblick3.2 Der gesetzliche Grundtatbestand (§ 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG)3.2.1 Der Haupttatbestand: Die Vermietung einer Immobilie3.2.1.1 Erwerb bzw. Errichtung einer Immobilie (in Vermietungs- bzw. Überschuss-erzielungsabsicht)3.2.1.2 Abgrenzung zur Liebhaberei3.2.1.3 Besonderheiten bei verbilligter Miete nach § 21 Abs. 2 EStG3.2.2 Einnahmen und Werbungskosten3.2.2.1 Einnahmen3.2.2.2 Werbungskosten3.2.2.2.1 Die Anschaffung bzw. Herstellung und die Abschreibung3.2.2.2.2 Sonderfragen bei der Abschreibung3.2.2.2.3 Die Höhe der Abschreibung oder das Baujahr entscheidet3.2.2.2.4 Der anschaffungsnahe Herstellungsaufwand nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG3.2.2.2.5 Verteilung von Erhaltungsaufwendungen auf mehrere Jahre3.2.2.2.6 Schuldzinsen3.2.2.2.7 Fahrtkosten bei Vermietungseinkünften3.2.2.2.8 Vorab- und nachträgliche Werbungskosten2343.2.2.2.9 Vergebliche Werbungskosten3.2.3 Das Zusammenspiel von § 21 EStG mit den »eigenen vier Wänden«3.3 Weitere Vermietungs- und Verpachtungstatbestände4 Sonstige Einkünfte gemäß §§ 22, 23 EStG4.1 Der Anwendungsbereich der privaten wiederkehrenden Leistungen4.2 Die privaten wiederkehrenden Leistungen als »Gegenleistungsrente«4.3 Freiwillige wiederkehrende Bezüge4.4 Schadensersatzrenten und Versicherungsrenten4.4.1 Schadensersatzrenten – allgemein4.4.2 (Sozial-)VersicherungsrentenIII Der Zustandstatbestand – Gewinneinkünfte1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 i. V. m. § 15 EStG)2.1 Bedeutung des Gewerbebetriebs für die (Steuer-)Rechtsordnung2.2 Die positiven Tatbestandsmerkmale gemäß § 15 Abs. 2 EStG2.2.1 Die Selbständigkeit2.2.2 Die Nachhaltigkeit2.2.3 Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsverkehr2.2.4 Die Gewinnerzielungsabsicht2.3 Die negativen Tatbestandsvoraussetzungen2.3.1 Abgrenzung zur privaten Vermögensverwaltung (§ 14 AO)2.3.1.1 Der gewerbliche Grundstückshandel und die Drei-Objekt-Grenze2.3.1.2 Der Steuerpflichtige als Alleineigentümer (bzw. als Bruchteilseigentümer)2.3.1.3 Der Steuerpflichtige als Beteiligter einer Grundstücksgesellschaft2.3.2 Abgrenzung zu Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG)2.3.3 Abgrenzung zur selbständigen Arbeit (§ 18 EStG)3 Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 18 EStG)3.1 Vorbemerkung3.2 Die einzelnen freiberuflichen Tätigkeiten (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG)3.2.1 Die wissenschaftliche Tätigkeit3.2.2 Die künstlerische Tätigkeit3.2.3 Die schriftstellerische Tätigkeit3.2.4 Die unterrichtende und erzieherische Tätigkeit3.3 Die einzelnen freiberuflichen Berufsträger (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG)3.3.1 Die Heilberufe3.3.2 Rechts- und wirtschaftsberatende Berufe3.3.3 Technische Berufe (Architekten, Ingenieure, Vermessungsingenieure)3.3.4 Medienberufe3.3.5 Ähnliche Berufe3.4 Die Mithilfe anderer – die sog. Vervielfältigungstheorie3.5 Die sonstige selbständige Arbeit (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG)IV Der Erwerbsaufwand (das objektive Nettoprinzip) und § 12 EStG1 Vorbemerkung1.1 Gang der Darstellung1.2 Die »kausale« Betrachtungsweise bei den Werbungskosten bzw. der Zusammenhang mit den Einnahmen2 Einzelne unter § 4 Abs. 4 und 5 EStG fallende Erwerbsaufwendungen2.1 Geschäftsfreundegeschenke (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 EStG)2.1.1 Einführung in § 4 Abs. 5 Nr. 1 – 7 EStG3152.1.2 Materielle Aspekte zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG2.2 Bewirtungsaufwendungen (§ 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG)2.3 Aufwendungen nach § 4 Abs. 5 Nr. 3 (Gästehäuser) und § 4 Abs. 5 Nr. 4 (Jagd & Jacht) EStG2.4 Verpflegungsmehraufwand (§ 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG) und doppelte Haushaltsführung2.4.1 Die Unterscheidung beider Aufwandskategorien2.4.2 Grundaussage und aktuelle Fragen zum Verpflegungsmehraufwand2.4.3 Verpflegungsmehraufwendungen im Inland2.4.3.1 Verpflegungsmehraufwendungen im Ausland2.4.3.2 Flugreisen2.4.3.3 Schiffsreisen2.4.4 Die Drei-Monats-Frist (§ 9 Abs. 4a S. 6 EStG)2.4.4.1 Beginn der Drei-Monats-Frist2.4.4.2 Neubeginn der Drei-Monats-Frist (Unterbrechungszeitraum)2.4.5 Bewertung und Besteuerungsverzicht bei üblichen Mahlzeiten2.4.5.1 Was ist eine Mahlzeit?2.4.5.2 Lohnsteuerfreiheit der Mahlzeit2.4.5.3 Geschäftsfreunde-Bewirtung2.4.6 Mehrere Auswärtstätigkeiten2.4.7 Grundaussage und aktuelle Fragen zur doppelten Haushaltsführung2.4.7.1 Grundsätzlicher Begriff der doppelten Haushaltsführung (§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 S. 2, 3 EStG)2.4.7.2 Umfang der doppelten Haushaltsführung2.4.7.2.1 Anforderungen an den Haushalt des Steuerpflichtigen2.4.7.2.2 Berufliche Veranlassung2.4.7.2.3 Höhe der Unterkunftskosten2.4.8 Abzugsfähige Aufwendungen im Zusammenhang mit der doppelten Haushaltsführung2.4.9 Fazit2.5 Das häusliche Arbeitszimmer (§ 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG)2.5.1 Überblick zum geltenden Recht inklusive der Darstellung des Anwendungsschreibens des BMF2.5.2 Mittelpunkt der gesamten betrieblichen/beruflichen Betätigung2.5.3 Abziehbare Aufwendungen2.5.4 Wahlrecht zum Jahresbetrag2.5.5 Personenbezogener Höchstbetrag im Rahmen der Jahrespauschale2.5.6 Homeoffice-Pauschale2.6 Unangemessene Aufwendungen (§ 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG)2.7 Strafen und vergleichbare Sanktionen2.8 Steuern (u. a.) (§ 4 Abs. 5 Nr. 8a und 9 bzw. § 12 Nr. 3 EStG)2.9 Zuwendungen i. S. d. § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 10 EStG2.10 Interne Konkurrenz bei § 4 Abs. 5 EStG und externe Aufwands-Konkurrenz zwischen § 4 EStG und § 9 EStG2.10.1 Der Wettbewerb unter den verschiedenen Einzelfällen des § 4 Abs. 5 EStG2.10.2 Konkurrenz zwischen Betriebsausgaben und Werbungskosten2.11 Weitere Problemfelder bei § 4 Abs. 4 EStG2.11.1 Betriebsausgaben oder Ausgaben für ein Wirtschaftsgut (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)2.11.2 Der »umgekehrte« Fall: Aufwendungen vor Eigentumserwerb2.12 Der Schuldzinsenabzug gemäß § 4 Abs. 4a EStG3832.12.1 Allgemeines2.12.2 Die »überlagernde« Regelung des § 4 Abs. 4a EStG2.13 Die Zinsschranke (§ 4h EStG)3902.13.1 Begriff der Zinsaufwendungen und -erträge2.13.2 Maßgeblicher Gewinn2.13.3 Ausnahmen von der Zinsschranke2.13.3.1 Freigrenze (§ 4h Abs. 2 Buchst. a EStG)2.13.3.2 Nicht konzernangehörige Betriebe (§ 4h Abs. 2 Buchst. b EStG)2.13.3.3 Überblick Escape-Klausel (§ 4h Abs. 2 Buchst. c EStG)2.13.4 Besonderheiten für Kapitalgesellschaften2.14 Die »Lizenzschranke« des § 4j EStG2.15 Das Betriebsausgabenabzugsverbot des § 4k EStG3 Anteilige Abzüge nach § 3c EStG3.1 Einführung und Grundtatbestand3.2 § 3c EStG und das Teileinkünfteverfahren4 Die zentrale Stellung von § 12 EStG4.1 Fallgruppen4.1.1 Haushalts- und Unterhaltsaufwendungen (§ 12 Nr. 1 EStG) – Grundsätze4.1.2 Einzelfälle (Fallgruppen), insbesondere Abgrenzung zu § 9 EStG4.1.2.1 Reisen4.1.2.2 Gebühren für persönlichkeitsbildende Kurse4.1.2.3 Umzug4.1.2.4 »Hobbyaufwendungen«4.1.2.5 Weitere Fallgruppen4.2 Die Bedeutung des § 12 Nr. 2 EStG4.3 Personensteuern4.4 Zusammenfassung zu § 12 Nr. 4 EStGV Das subjektive Nettoprinzip inklusive der Berücksichtigung der Kinder und der Besteuerung der Alterseinkünfte1 Sonderausgaben1.1 Sonderausgaben als Aufwendungen1.2 Wirtschaftliche Belastung1.3 Zeitpunkt des Sonderausgabenabzugs1.4 Persönliche Abzugsberechtigung1.5 Einzelne Sonderausgaben1.5.1 Unterhaltsleistungen1.5.2 Vorsorgeaufwendungen1.5.2.1 Basisversorgung1.5.2.2 Grundförderung1.5.2.3 Gemeinsame Voraussetzungen für den Abzug von Vorsorgeaufwendungen1.5.2.4 Von privat Versicherten freiwillig selbst getragene Krankenbehandlungskosten1.5.3 Gezahlte Kirchensteuer1.5.4 Kinderbetreuungskosten1.5.5 Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung1.5.5.1 Kosten der ersten Berufsausbildung1.5.5.2 Studiumskosten1.5.6 Schulgeld1.5.7 Verrechnung erstatteter Sonderausgaben1.5.8 Abzug von Altersvorsorgebeiträgen nach § 10a EStG1.5.9 Ausgaben zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke1.5.9.1 Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien1.5.9.2 Ausgaben zur Förderung der sonstigen steuerbegünstigten Zwecke1.5.9.3 Sonderausgaben-Pauschbetrag nach § 10c EStG2 Außergewöhnliche Belastungen2.1 Grundtatbestand2.1.1 Allgemeines2.1.2 Aufwendungen, die den Steuerpflichtigen belasten2.1.3 Außergewöhnlichkeit der Belastungen2.1.4 Dem Grunde und der Höhe nach zwangsläufige Ausgaben2.1.5 Zumutbare Belastung2.1.6 Diätkosten2.1.7 Prozesskosten2.2 Aufwendungen für Unterhalt und Berufsausbildung i. S. v. § 33a Abs. 1 EStG2.2.1 Verhältnis zu § 33 EStG2.2.2 Definition von Unterhaltsleistungen2.2.3 Betrag der außergewöhnlichen Belastungen2.2.3.1 Begrenzung der Beträge für Aufwendungen für Unterhalt und Berufsausbildung2.2.3.2 Aufwendungen für die Berufsausbildung i. S. v. § 33a Abs. 1 EStG2.3 Freibetrag für den Sonderbedarf eines sich in der Berufsausbildung befindenden volljährigen Kindes gemäß § 33a Abs. 2 EStG2.4 Pauschbeträge für behinderte Menschen, Hinterbliebene und Pflegepersonen gemäß § 33b EStG2.5 Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Handwerkerleistungen2.6 Energetische Maßnahmen3 Kinder im Steuerrecht3.1 Bedeutung der Kinder im Einkommensteuerrecht3.2 Berechnung im Rahmen des Familienlastenausgleichs3.2.1 Das Kindergeld3.2.2 Die Kinderfreibeträge (§ 32 Abs. 6 EStG)3.2.3 Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag)3.3 Kindschaftsverhältnisse3.4 Berücksichtigung von Kindern i. S. d. Absätze 3 und 4 des § 12 EStG3.5 Kind bei Vollendung des 18. Lebensjahres3.5.1 Kind arbeitsuchend3.5.1.1 Arbeitsuchend gemeldet (§ 32 Abs. 4 Nr. 1 EStG)3.5.1.2 Ernsthafte Bemühungen um einen Ausbildungsplatz (§ 32 Abs. 4 Nr. 2c EStG)3.5.2 Berücksichtigung eines Kindes in Berufsausbildung (§ 32 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG)3.5.3 Berücksichtigung eines volljährigen Kindes in Berufsausbildung (§ 32 Abs. 4 S. 2 und 3 EStG)3.5.3.1 Erstmalige Berufsausbildung3.5.3.2 Erststudium3.5.3.3 Erwerbstätigkeit3.5.3.4 Mehraktige Berufsausbildung3.5.4 Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG)4 Die Regelung der Alterseinkünfte und der Altersvorsorge durch das Alterseinkünftegesetz4.1 Einteilung der Rentenarten4.2 Besteuerung von Leibrenten i. S. d. § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG4.3 Besteuerung von Leibrenten i. S. d. § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG4.3.1 Leistungen aus Altersvorsorgevertrag (Altvertrag)4.3.2 Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag (Neuvertrag)4.4 Sonderfall: Leistungen beruhen teils auf geförderten, teils auf ungeförderten Beiträgen aus einem AltersvorsorgevertragB Einkommensteuer II – Übergreifende KomplexeI Personelle Zurechnung (Drittaufwand, Nießbrauch/Treuhand, Angehörigenverträge u. a.)1 Einführung2 Die personelle Zurechnung im Bereich der Einnahmen2.1 Das gesetzliche »Leitbild« (§ 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ff. EStG sowie § 20 Abs. 5 EStG)2.1.1 Die Übertragung der Beteiligung (an einer Kapitalgesellschaft481) und § 20 Abs. 5 EStG2.1.2 Die Abtretung von Gewinnansprüchen nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a EStG2.1.3 Sonstige Fälle des § 20 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und § 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG2.1.3.1 Die isolierte Abtretung von Zinsscheinen (§ 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG)2.1.3.2 Kursdifferenzpapiere nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG4882.1.3.3 Erträge (u. a. Zwischengewinne) bei Investmentanlagen2.1.3.4 REITs2.1.4 Zusammenfassung2.2 Der (gesetzlich nicht geregelte) Fall der (allgemeinen) Abtretung und vergleichbare Fallgestaltungen2.3 Die Besteuerung nachträglicher Einkünfte gemäß § 24 Nr. 2 EStG2.3.1 Handlungstatbestand ohne (aktuellen) Zustandstatbestand: § 24 Nr. 2 EStG2.3.2 Die sonstigen Fälle des § 24 EStG (insbesondere Entlassungsentschädigungen, § 24 Nr. 1 EStG)3 Der steuerliche Drittaufwand3.1 Der »Dritte« im Steuerrecht – Anwendungsbereich, Hintergrund und Historie3.2 Die Beschlüsse in den Grundzügen – Drittaufwand heute3.2.1 Allgemeiner Anwendungsbereich (= H 4.7 EStH »Drittaufwand« und »Eigenaufwand für ein fremdes Wirtschaftsgut«)3.2.2 Erster Spezialfall: Objektfinanzierung bei Ehegatten (= H 4.7 EStH »Drittaufwand«)3.2.3 Zweiter Spezialfall: Unentgeltliche Nutzung eines Arbeitszimmers im »Ehegattenhaus« (= H 4.7 EStH 5. und 6. Spiegelstrich zu »Eigenaufwand für ein fremdes WG«)3.3 Bilanztechnische Behandlung des »Quasi-Wirtschaftsguts« (= H 4.7 EStH 1. und 2. Spiegelstrich zu »Eigenaufwand für ein fremdes WG«); alte Auffassung3.3.1 Aufteilung in selbständige Wirtschaftsgüter3.3.2 Bilanztechnische Behandlung als »Aufwandsverteilungsposten« (BMF vom 16.12.2016, BStBl II 2016, 1431); neue Auffassung3.3.3 Höhe der AfA-Beträge3.3.4 Beendigung der Nutzung3.3.5 Drittaufwand – Fazit3.3.5.1 Die Grundkonstellation3.3.5.2 Der Aufwandsverteilungsposten3.3.5.3 Die Beendigung der Nutzungsbefugnis3.3.5.4 Drittaufwand – allgemein3.4 Drittaufwand bei »eigenkapitalersetzenden Darlehen«4 Die Zuordnung bei komplexen Rechtsverhältnissen4.1 Überblick4.2 Der Nießbrauch (und vergleichbare Nutzungsrechte)4.2.1 Zivilrechtliche Vorgaben4.2.2 Der Nießbrauch bei Vermietung und Verpachtung – die Verwaltungslösung4.2.2.1 Rechtslage beim Zuwendungsnießbrauch4.2.2.2 Rechtslage beim Vorbehaltsnießbrauch4.2.2.3 Rechtslage beim Vermächtnisnießbrauch4.2.2.4 Erstreckung auf vergleichbare Rechte (Wohnrecht u. a.)4.2.2.5 Die Ablösung des Nießbrauchs4.2.3 Der Nießbrauch bei Kapitalvermögen4.2.3.1 Einführung in die Problemstellung4.2.3.2 Ausblick: Nießbrauch an Personengesellschafts-Beteiligungen4.3 Exkurs: Die Treuhand, insbesondere an Gesellschaftsbeteiligungen4.4 (Mögliche?) Übertragung der Einkunftsquelle bei Angehörigen4.4.1 Einführung in die Problematik4.4.2 Der Ehegattenarbeitsvertrag4.4.3 Die Familienpersonengesellschaften, insbesondere die Beteiligung der Kinder4.4.3.1 Die zivilrechtliche Wirksamkeit4.4.3.2 Der tatsächliche Vollzug der Familien-Personengesellschaft4.4.3.3 Der Fremdvergleich4.4.3.4 Die Mitunternehmerqualität4.4.3.5 Die Prüfung der Höhe nach (Quantifizierungsmaßstab)4.4.4 Sonstige Angehörigenverträge4.4.4.1 Darlehensverträge4.4.4.2 Angehörigen-Mietverträge4.4.4.3 SonstigesII Realisationstatbestände (Steuerentstrickung im Privatvermögen/Betriebsvermögen vs. betriebliche Umstrukturierung)1 Übersicht (§ 6 Abs. 3 ff. EStG vs. §§ 16 ff. EStG u. a.)1.1 Überblick über den gesetzlichen Regelungsbereich1.2 § 6 Abs. 3 EStG: Regelfall oder Ausnahme?1.2.1 Grundzüge1.2.2 Die unentgeltliche Übertragung von (Teilen von) Mitunternehmeranteilen1.2.3 Nießbrauchsgestaltung, vorweggenommene Erbfolge und § 6 Abs. 3 EStG1.3 Unentgeltliche Übertragung von Einzel-Wirtschaftsgütern (§ 6 Abs. 4 EStG)2 Betriebsveräußerung und Betriebsaufgabe (§ 16 i. V. m. § 34 EStG)2.1 Einführung2.2 Die Betriebsveräußerung (§ 16 Abs. 1 und 2 EStG)2.2.1 Der Grundtatbestand: Der ganze Betrieb wird veräußert6132.2.1.1 Das Übertragungsobjekt (»alle wesentlichen Betriebsgrundlagen«)2.2.1.2 Übertragungshandlung und Übertragungszeitpunkt2.2.1.3 Zurückbehaltene Wirtschaftsgüter2.2.1.4 Ermittlung des begünstigten Veräußerungsgewinnes2.2.1.4.1 Der Veräußerungsgewinn gemäß § 16 Abs. 2 EStG2.2.1.4.2 Die Begünstigung nach §§ 16 Abs. 4, 34 Abs. 3 EStG2.2.1.4.3 Die Trennung zwischen laufendem Gewinn und Veräußerungsgewinn2.2.1.4.4 Nachträgliche Ereignisse2.2.1.4.5 Veräußerungsgewinn und Teileinkünfteverfahren2.2.1.4.6 Übernommene, nicht in der Steuerbilanz passivierte Betriebsschulden2.2.1.5 Besondere Kaufpreis-Modalitäten2.2.1.5.1 Betriebsveräußerung gegen Ratenzahlung2.2.1.5.2 Betriebsveräußerung gegen wiederkehrende Bezüge2.2.2 Die sonstigen Realisationstatbestände bei § 16 Abs. 1 EStG2.2.2.1 (Redaktionelle) Zusammenfassung von § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und Nr. 3 EStG2.2.2.2 Die Veräußerung eines Teilbetriebs (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2. Alt. EStG)2.2.2.2.1 Einführung2.2.2.2.2 Einzelfälle zum Teilbetrieb/Versuch einer Systematisierung2.3 Die Betriebsaufgabe (§ 16 Abs. 3 EStG)2.3.1 Grundsätzliche Feststellung2.3.2 Abgrenzungsfragen2.3.2.1 Betriebsaufgabe und Betriebsverlegung2.3.2.2 Betriebsaufgabe und Betriebsunterbrechung2.3.2.3 Betriebsaufgabe und Strukturwandel (bzw. Beurteilungswandel)2.3.2.4 Betriebsaufgabe und Entstrickung im engeren Sinne6702.3.2.5 Zusammenfassung2.3.3 Sonstiges2.3.3.1 Räumungsverkauf und Sanierungsfälle2.3.3.2 Bedeutung der Aufgabeerklärung2.3.3.3 Der gemeine Wert bei der Entnahme (zugleich Aufgabegewinn)2.3.3.4 Die Teilbetriebsaufgabe2.3.3.5 Aufgabe bei selbständiger Arbeit2.3.4 Die Regelung aufgrund des JStG 2010 (»finale Entnahme«) 2.4 Betriebsverpachtung2.4.1 Standortbestimmung2.4.2 Voraussetzungen des Verpächterwahlrechts2.4.3 Folgen des Verpächterwahlrechts, insbesondere die Aufgabeerklärung2.4.4 Weitere Problemfelder3 Das Mitunternehmer- und Realteilungskonzept: § 6 Abs. 5 EStG und § 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG – Mittel zur Umstrukturierung3.1 § 6 Abs. 5 EStG i. d. F. UntStFG (2001)3.1.1 Historischer Rückblick und gesetzliche Wertung3.1.2 Die geltende Regelung3.1.3 Übersicht zu den Umstrukturierungsnormen im EStG3.2 Die Realteilung gemäß § 16 Abs. 3 S. 2 ff. EStG3.2.1 Rückblick3.2.2 Die Realteilung in den späteren Änderungsgesetzen4 Die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften4.1 Stellung des § 17 EStG im System des Einkünftedualismus4.1.1 Historie und Gegenwart des § 17 EStG4.1.2 Der eigentliche »Stellenwert« des § 17 EStG – systematische Auslegung4.1.3 Verwandte Bereiche4.1.4 Subsidiarität (oder Vorrang) von § 17 EStG gegenüber anderen Bestimmungen4.2 Der Zustandstatbestand bei § 17 Abs. 1 EStG4.2.1 Der persönliche Anwendungsbereich4.2.2 Die Beteiligungsvoraussetzungen4.2.2.1 Anteile an Kapitalgesellschaften4.2.2.2 Die 1 %-Grenze4.2.2.3 Die Fünfjahresfrist4.2.2.4 Die Nachfolger-Regelung des § 17 Abs. 1 S. 4 und Abs. 2 S. 5 EStG4.2.2.5 Mittelbare Beteiligung/unmittelbare Beteiligung4.2.3 Die verdeckte Einlage4.3 Der Handlungstatbestand4.3.1 Die Veräußerung gegen Einmalzahlung4.3.1.1 Der Grundtatbestand4.3.1.2 Spezifika4.3.2 Veräußerung gegen wiederkehrende Zahlungen4.4 Veräußerungsgewinn und Freibetrag4.4.1 Berechnungsformel für den Veräußerungsgewinn4.4.2 Die Abzugsgröße »Anschaffungskosten«4.4.3 Nachträgliche Anschaffungskosten, insbesondere bei eigenkapitalersetzenden Maßnahmen4.4.3.1 (Offene und verdeckte) Einlagen4.4.3.2 Eigenkapitalersetzende Maßnahmen (§ 32a GmbHG a. F.)4.4.4 Die Freibetragsregelung (§ 17 Abs. 3 EStG)4.4.5 Einlage einer wertgeminderten Beteiligung4.5 Der Ergänzungstatbestand des § 17 Abs. 4 EStG7394.5.1 Überblick über den Regelungsbereich des § 17 Abs. 4 EStG4.5.2 Konkurrenz zwischen § 17 Abs. 4 EStG und § 20 Abs. 1 Nr. 1 bzw. 2 EStG4.5.3 Auflösungsverluste742 (und Betriebsausgaben bei § 17 EStG)4.6 § 17 Abs. 5 EStG nach dem SEStEG7454.7 Zusammenfassung des Regelungsgehalts von § 17 Abs. 6 EStG5 Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG)5.1 Steuerentstrickung bei Immobilien (Privatvermögen)5.1.1 Der Grundtatbestand5.1.2 Erstreckung auf errichtete Gebäude5.1.3 Die Ausnahme: Selbstnutzung5.2 Der Handlungstatbestand bei § 23 EStG5.3 Freigrenze5.4 Kryptowährungen und § 23 EStG6 Schicksal der Anteile bei Einbringung in eine GmbH (Überblick)761III Einkommensteuer – Rechtsnachfolge (vorweggenommene Erbfolge, Erbfall und Erbauseinandersetzung)1 Einleitung2 Rechtsnachfolge in der Rechtsordnung2.1 Überblick und Eingrenzung2.2 Die Rechtsnachfolge im Zivilrecht2.2.1 Die Einzelrechtsnachfolge (Singularsukzession)2.2.2 Die Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession)2.2.3 Zivilrechtliches Fazit und Bedeutung für das Steuerrecht3 Die vorweggenommene Erbfolge3.1 Die Entwicklung zum »Sonderrechtsinstitut« (historische Darstellung) und Grundaussagen3.2 Die Grundfälle zur vorweggenommenen Erbfolge3.2.1 Die Übertragung von betrieblichen Einheiten3.2.2 Die Übertragung von Privatvermögen3.2.3 Die Übertragung von Mischvermögen bei mehreren Nachfolgern3.3 Einzelfragen im Anwendungsbereich der vorweggenommenen Erbfolge – allgemein –3.3.1 Die »geeigneten« Nachfolger bei der vorweggenommenen Erbfolge3.3.2 Die ertragbringende »Familien«-Grundlage (bzw. Wirtschaftseinheit)3.4 Das Sonderrechtsinstitut: Die wiederkehrenden Versorgungszusagen anlässlich der vorweggenommenen Erbfolge3.4.1 Generell: Vermögensübergang gegen wiederkehrende Bezüge3.4.2 Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen ab dem VZ 20083.4.2.1 Übertragungsobjekte3.4.2.2 Art und Umfang der (begünstigten) wiederkehrenden Leistungen3.4.2.3 Der Übertragungsvorgang3.4.2.4 Subjektive Voraussetzungen3.4.2.5 Aktuelle Rechtsprechung und Reaktion der Verwaltung3.4.3 Die (nachträgliche) Umschichtung sowie weitere Änderungen in Bezug auf das übertragene Vermögen4 Der Erbfall (und das Interimsstadium – bis zur Auseinandersetzung)4.1 Trennung zwischen Erbfall und Erbauseinandersetzung4.2 Erbfall, übergehende Steuerpositionen und steuerliche Konsequenzen4.2.1 Steuerobjekte4.2.2 Dem Steuerobjekt anhängende Steuerpositionen4.2.3 Unabhängige Steuerpositionen4.2.4 Zurechnung laufender Einkünfte zwischen Erbfall und Erbauseinandersetzung, insbesondere bei einer (Mit-)Erbengemeinschaft4.3 Zurechnung von Einkünften4.3.1 Zurechnung von laufenden Gewinneinkünften4.3.2 Zurechnung von laufenden Überschusseinkünften4.3.3 Rückwirkend abweichende Zurechnung laufender Einkünfte4.3.4 Ermittlung und Abgrenzung5 Die Erbauseinandersetzung (mehrere Erben)5.1 Grundzüge zur Erbauseinandersetzung5.1.1 Einführung in die erbrechtliche und steuerrechtliche Problematik5.1.2 Der Meinungswandel in der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs5.2 Miterben und übergehendes Kompetenzobjekt5.2.1 Allgemeine Überlegungen5.2.2 Miterbengemeinschaft und das (reine) Privatvermögen5.2.3 Die »wesentlichen« Beteiligungen an Kapitalgesellschaften5.2.4 Das Einzelunternehmen und die Miterbengemeinschaft5.2.5 Beteiligung an Personengesellschaften (Mitunternehmerschaft) im Nachlass (Tod des Mitunternehmers)5.3 Die Abwicklung der Miterbengemeinschaft5.3.1 Einführung5.3.2 Personenbestandsveränderungen bei bestehender Miterbengemeinschaft5.3.2.1 Die Übertragung des Anteils5.3.2.2 Das Ausscheiden des Miterben, insbesondere gegen Sachwertabfindung5.3.3 Die Beendigung der Miterbengemeinschaft in Form der »Naturalteilung«5.3.4 Die (eigentliche) Realteilung der Miterbengemeinschaft5.3.4.1 Dogmatische Grundzüge5.3.4.2 Realteilung (Betriebsvermögen) ohne Abfindungszahlung5.3.4.3 Realteilung (Betriebsvermögen) mit Abfindungszahlung (= Teilung mit Spitzenausgleich)5.3.4.4 Realteilung (Privatvermögen) ohne Abfindungszahlung5.3.4.5 Realteilung (Privatvermögen) mit Abfindungszahlung5.3.4.6 Realteilung eines Mischnachlasses5.3.4.7 Die (insbesondere gegenständliche) Teilauseinandersetzung5.4 Realteilung: Sachwertabfindung und die sog. unechte Realteilung5.5 Aktuelle Rechtslage aufgrund BMF-Schreiben vom 19.12.2018 (BStBl I 2019, 6) IV Verluste im Ertragsteuerrecht1 Einleitung2 Die Verlustverrechnung in der Einkommensteuer2.1 System und Terminologie der Verlustverrechnung – Einführung2.2 Der Verlustausgleich2.2.1 Der horizontale Verlustausgleich2.2.2 Der vertikale Verlustausgleich2.3 Der Verlustabzug gemäß § 10d EStG2.4 Sonderfragen bei der Verlustentstehung (Veräußerungsverluste)2.4.1 Verlustermittlung und Verlustberücksichtigung bei § 23 EStG2.4.2 Verlustermittlung und Verlustberücksichtigung bei § 17 EStG2.4.3 Gewerbliche Verluste2.4.4 Verluste bei Kapitaleinkünften (§ 20 Abs. 6 EStG)3 Spezielle Beschränkungen bei der Verlustverrechnung3.1 Negative Einkünfte mit Auslandsbezug gemäß § 2a EStG3.1.1 Änderungen durch das JStG 20098963.1.2 Die relevanten Fallgruppen nach § 2a EStG n. F.3.1.3 Internationalrechtliche Stellung und dogmatischer »Stellenwert« von § 2a EStG3.1.4 Der Hauptanwendungsbereich: Betriebsstättenverluste3.2 Verluste bei Verlustzuweisungsgesellschaften (§ 15b EStG)3.2.1 Die aktuelle Regelung des § 15b EStG9113.2.2 Begriff der modellhaften Gestaltung3.2.3 Die ersten Rechtsprechungskonturen3.2.4 Anwendungsbereich3.3 Verluste gemäß § 15 Abs. 4 EStG (gewerbliche Tierzucht/Termingeschäfte/stille Beteiligungen u. Ä.)3.3.1 Verluste aus gewerblicher Tierzucht3.3.2 Verluste aus betrieblichen Termingeschäften3.3.3 Verluste aus stillen Gesellschaften u. a. (§ 15 Abs. 4 S. 6 ff. EStG)3.4 Verluste gemäß §§ 22, 23 EStG3.5 Das negative Kapitalkonto des Kommanditisten gemäß § 15a EStG3.5.1 Der Grundtatbestand von § 15a Abs. 1 und Abs. 2 EStG3.5.1.1 Der Begriff »Anteil am Verlust« der Kommanditgesellschaft3.5.1.2 Der Begriff »Kapitalkonto des Kommanditisten«3.5.1.3 Wirkungsweise des § 15a EStG (§ 15a Abs. 2 EStG) und klausurtechnischer Bearbeitungshinweis3.5.2 Die überschießende Außenhaftung von § 15a Abs. 1 S. 2 und 3 EStG3.5.3 Einlage- und Haftungsminderung nach § 15a Abs. 3 EStG3.5.3.1 Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung3.5.3.2 Die Einlageminderung3.5.3.3 Die Haftungsminderung3.5.3.4 Die gesonderte Feststellung des verrechenbaren Verlustes3.5.4 Die Ausweitung des Anwendungsbereiches von § 15a EStG3.5.4.1 Vergleichbare Unternehmer im Sinne des § 15a Abs. 5 EStG3.5.4.2 § 15a EStG bei anderen Einkunftsarten9593.5.5 Konkurrenzfragen3.5.6 Ausscheiden des Kommanditisten und die Beendigung der Kommanditgesellschaft3.5.6.1 Behandlung der verrechenbaren Verluste3.5.6.2 Behandlung des negativen Kapitalkontos3.5.6.3 Behandlung beim Erwerber3.6 Besonderheiten3.6.1 Doppelstöckige Personengesellschaften3.6.2 § 15a EStG bei der GmbH & Co. KG4 Verluste im Recht der Unternehmenssanierungen (KapG) sowie in der Gewerbesteuer4.1 § 8c KStG (i. d. F. des WachstBeschlG 2009)967, inkl. BMF-Schreiben vom 28.11.2017, BStBl I 2017, 16454.1.1 Schädlicher Beteiligungserwerb4.1.1.1 Begriff der »Anteile« i. S. d. § 8c KStG4.1.1.2 Die Stimmrechtsübertragung 4.1.1.3 Die betroffenen Körperschaften4.1.1.4 Umfang und Form der Anteilsübertragung4.1.1.5 Nachträgliche Aufnahme eines Sanierungstatbestandes (§ 8c Abs. 1a KStG)4.1.2 Der Übertragungsmodus (entgeltlich/unentgeltlich)4.1.3 Mittelbare Anteilsübertragungen4.1.4 Die Konzernklausel4.1.5 Der Erwerber der Anteile4.1.6 Kapitalerhöhungen4.1.7 Sukzessive Anteilsübertragungen4.1.8 Die »Stille-Reserven«-Klausel (§ 8c Abs. 1 S. 6 KStG)4.1.9 Rechtsfolgen des § 8c KStG4.1.10 Die von § 8c KStG betroffenen Verluste4.1.11 Die Übergangsregelung4.1.12 Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften durch Einführung des § 8d KStG – zeitliche Voraussetzung4.1.13 Darstellung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 8d KStG4.1.13.1 Schädlicher Beteiligungserwerb4.1.13.2 Antrag4.1.13.3 Unterhaltung ausschließlich desselben Geschäftsbereiches4.1.13.4 Relevanter Beobachtungszeitraum4.1.13.5 Übersicht Relevanter Beobachtungszeitraum4.1.13.6 Einstellung des Geschäftsbetriebs4.1.13.7 Ruhendstellung des Geschäftsbetriebs4.1.13.8 Zuführung zu einer andersartigen Zweckbestimmung4.1.13.9 Aufnahme eines zusätzlichen Geschäftsbetriebs4.1.13.10 Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft4.1.13.11 Stellung als Organträger4.1.13.12 Ansatz übernommener Wirtschaftsgüter unter dem gemeinen Wert4.1.14 Rechtsfolgen des § 8d KStG4.2 Verluste im Umwandlungssteuerrecht4.2.1 Verluste des übertragenden Rechtsträgers4.2.2 Verluste des übernehmenden Rechtsträgers4.2.3 Verlustvortrag bei der Verschmelzung einer Gewinngesellschaft auf eine Verlustgesellschaft4.3 Der Verlustvortrag gemäß § 10a GewStG4.3.1 Unternehmensidentität und Unternehmeridentität4.3.2 Gewerbeverlust bei Mantelkauf4.3.3 Verfassungsrechtliche Bedenken (§ 10a S. 2 GewStG)C GewerbesteuerI Einführung und BerechnungsschemaII Steuergegenstand und Steuerpflicht1 Steuergegenstand der Gewerbesteuer1.1 Der Begriff des Gewerbebetriebes (unter Anknüpfung an das Einkommensteuerrecht)1.2 Steuerpflicht der Personengesellschaften1.3 Steuerpflicht der Kapitalgesellschaften1.4 Steuerpflicht eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs1.5 Inländischer Gewerbebetrieb2 Die sachliche Steuerpflicht im eigentlichen Sinne2.1 Beginn der Gewerbesteuerpflicht2.2 Ende der Gewerbesteuerpflicht2.3 Steuerbefreiungen3 Die persönliche Steuerpflicht (Steuerschuldner)3.1 Mehrheit von Betrieben3.2 Unternehmer- und Unternehmenswechsel10643.2.1 Der Gesellschafterwechsel3.2.2 Der eigentliche Unternehmerwechsel3.2.3 Die Verpachtung des GewerbebetriebsIII Die Besteuerungsgrundlage (§§ 6 bis 9 GewStG)1 Der Gewerbeertrag (§ 7 GewStG)1.1 Besonderheiten bei Personengesellschaften1.2 Besonderheiten bei Veräußerungsgewinnen2 Die Hinzurechnungen des § 8 GewStG2.1 Sinn und Zweck der Hinzurechnungen (und Kürzungen)2.2 Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 1 GewStG2.2.1 Entgelte für Schulden (§ 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG)2.2.2 Renten und dauernde Lasten (§ 8 Nr. 1 Buchst. b GewStG)2.2.3 Gewinnanteile des stillen Gesellschafters (§ 8 Nr. 1 Buchst. c GewStG)2.2.4 Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen (§ 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG)2.2.4.1 Allgemein2.2.4.2 Besonderheit: Hinzurechnung bei (Hybrid-)Elektrofahrzeugen und Fahrrädern2.2.5 Die (Sonder-)Behandlung von Erbbauzinsen2.2.6 Lizenzgebühren (§ 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG)2.2.7 Abgrenzung zwischen Nutzungsüberlassung und Übergang des wirtschaftlichen Eigentums2.2.8 Freibetrag2.3 Hinzurechnung um Gewinnanteile an Kapitalgesellschaften (§ 8 Nr. 5 GewStG)2.4 Berücksichtigung von Gewinn- und Verlustanteilen aus Mitunternehmerschaften (§ 8 Nr. 8 GewStG i. V. m. § 9 Nr. 2 GewStG; s. auch § 8 Nr. 4 GewStG1089)2.5 Weitere Hinzurechnungstatbestände2.6 Übung10913 Die Kürzungen des § 9 GewStG3.1 Die Kürzung bei betrieblichem Grundbesitz (§ 9 Nr. 1 GewStG)3.1.1 Die einfache Kürzung (§ 9 Nr. 1 S. 1 GewStG): Der Grundtatbestand der Grundbesitzkürzung3.1.2 Die erweiterte Kürzung (§ 9 Nr. 1 S. 2 ff. GewStG)3.2 Kürzung um Gewinnanteile an Kapitalgesellschaften (§ 9 Nr. 2a, 7 und 8 GewStG)3.3 Kürzung im Zusammenhang mit ausländischen Betriebsstätten (§ 9 Nr. 3 GewStG)3.4 Kürzungen wegen Spenden (§ 9 Nr. 5 GewStG)4 Berücksichtigung eines Gewerbeverlustes (§ 10a GewStG)5 Steuermesszahl und SteuermessbetragIV Spezifika der Gewerbesteuer1 Besteuerung der gewerbesteuerlichen Organschaft2 Festsetzung und Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags2.1 Das geteilte Festsetzungsverfahren2.2 Die Zerlegung im Einzelnen3 Die Korrekturvorschrift des § 35b GewStG4 Die Gewerbesteuerrückstellung als Bilanzproblem4.1 Reihenfolge und Berechnung der Steuerrückstellungen bei Kapitalgesellschaften4.2 Die Gewerbesteuerrückstellung bei Personengesellschaften bzw. Einzelunternehmen5 Die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer5.1 Grundlagen5.2 Steuerermäßigung bei Einkünften aus Mitunternehmerschaften5.3 Besonderheiten bei mehrstöckigen PersonengesellschaftenD Internationales SteuerrechtI Strukturierung der Fallgestaltungen im internationalen Steuerrecht (inklusive der Grenzpendlerproblematik)1 Grenzüberschreitende Sachverhalte und internationales Steuerrecht2 Die Grenzpendlerproblematik2.1 Fiktive unbeschränkte Steuerpflicht gemäß § 1 Abs. 3 EStG2.2 Staatsangehörige der EU/des EWR1146 (§ 1a EStG)2.3 Zusammenfassung und SchemaII Die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)1 Historie und derzeitiger Stand2 Multinationale Zusammenarbeit3 Wirkungsweise der Doppelbesteuerungsabkommen4 Systematik der Doppelbesteuerungsabkommen4.1 Ansässigkeitsbestimmungen in den Doppelbesteuerungsabkommen4.2 Besteuerungsregeln der Doppelbesteuerungsabkommen4.2.1 Die Anrechnungsmethode4.2.1.1 Die Anrechnungsmethode nach dem Recht der Doppelbesteuerungsabkommen4.2.1.2 Die Umsetzung der Anrechnungsmethode in nationalem Recht – Grundzüge4.2.1.3 Zusätzlicher Anwendungsbereich4.2.1.3.1 Abzug von Amts wegen gem. § 34c Abs. 3 EStG4.2.1.3.2 Die Steuerpauschalierung gem. § 34c Abs. 5 EStG4.2.1.3.3 Anrechnung bei Körperschaften (§ 26 Abs. 1 KStG)4.2.2 Die Freistellungsmethode4.2.2.1 Die Freistellungsmethode nach Doppelbesteuerungsabkommen4.2.2.2 Die Umsetzung der Freistellungsmethode in nationalem Recht – Grundzüge4.2.2.3 Der zusätzliche Anwendungsbereich4.2.2.4 Kritik und offene Fragen zu § 32b EStG4.2.2.4.1 Die zeitweise unbeschränkte Steuerpflicht4.2.2.4.2 Progressionsvorbehalt und Grundfreibetrag4.2.2.4.3 Erste Neuerung4.2.2.4.4 Zweite Neuerung4.2.3 Besondere Doppelbesteuerungsabkommen-Klauseln4.3 Aufbau der Doppelbesteuerungsabkommen am Beispiel des OECD-Musterabkommens4.4 Auslegungsregel für Doppelbesteuerungsabkommen4.5 Die Antwort auf DBA-Fragen (§ 50d EStG) – HinweisIII Auslandsbeziehungen eines Steuerinländers (Fälle der unbeschränkten Steuerpflicht)1 Einführung in die Thematik2 Inländisches Unternehmen mit Outbound-Aktivitäten (internationales Unternehmenssteuerrecht)2.1 Steuerliche Folgen mit einer Kapitalgesellschaft im Ausland2.2 Die Errichtung einer Betriebsstätte im Ausland2.2.1 Allgemein2.2.2 Der Betriebsstättenbegriff2.2.3 Steuerliche Folgen der Betriebsstätten-Gründung2.2.3.1 Errichtung einer Betriebsstätte im Ausland ohne Doppelbesteuerungsabkommen2.2.3.2 Errichtung einer Betriebsstätte im Ausland mit Doppelbesteuerungsabkommen3 Sonstige grenzüberschreitende Aktivitäten eines Steuerinländers3.1 Die Besteuerung von international tätigen Arbeitnehmern3.2 Die internationale Dividendenbesteuerung3.2.1 Grundzüge/Vorwegunterscheidung3.2.2 EinzelheitenIV Regelungsbereiche des Außensteuergesetzes (AStG)1 Allgemeines2 Gliederung des Außensteuergesetzes3 Einkunftsberichtigung nach § 1 AStG3.1 Voraussetzungen der Gewinnberichtigung nach § 1 AStG3.1.1 Geschäftsbeziehungen (bzw. Geschäftsvorfälle)3.1.2 Nahestehende Personen3.1.3 Vereinbarte Bedingungen, die einem Fremdvergleich nicht standhalten3.2 Durchführung der Berichtigung nach § 1 AStG3.2.1 Rechtsgrundlagen für die Korrektur der Verrechnungspreise3.2.2 Technik der Gewinnberichtigung3.3 Das Zusammentreffen von § 1 AStG und einem Doppelbesteuerungsabkommen4 Die Wegzugsbesteuerung (§§ 2 – 6 AStG)4.1 Allgemeines4.2 Die Wegzugsbesteuerung nach § 2 AStG4.2.1 Der Tatbestand des § 2 AStG4.2.2 Bagatellgrenze und Ausnahme von der erweitert beschränkten Steuerpflicht4.2.3 Rechtsfolge des § 2 AStG4.2.3.1 Ermittlung der Einkünfte nach § 2 AStG4.2.3.2 Konkurrenzfragen4.2.3.2.1 Verhältnis der erweitert beschränkten Steuerpflicht zur allgemeinen beschränkten Steuerpflicht4.2.3.2.2 Verhältnis der erweitert beschränkten Steuerpflicht zur unbeschränkten Steuerpflicht4.2.3.2.3 Auswirkungen von Doppelbesteuerungsabkommen auf die Wegzugsbesteuerung4.2.4 Fallstudie zu § 2 AStG4.3 Besteuerung des Vermögenszuwachses bei Wegzug4.3.1 Tatbestandsvoraussetzungen des § 6 AStG4.3.1.1 Persönliche Voraussetzungen4.3.1.2 Sachliche Voraussetzungen4.3.2 Rechtsfolgen des § 6 AStGV Besteuerung der Steuerausländer im Inland1 Sachlicher Umfang der beschränkten Steuerpflicht1.1 Überblick1.2 Konkurrenzen2 Inlandseinkünfte gemäß § 49 EStG2.1 Übersicht und grundlegende Verfahrensfragen2.2 Der Katalog des § 49 Abs. 1 EStG2.2.1 Die Hauptfälle2.2.2 Existenzberechtigung von exotischen Regelungen?2.2.2.1 § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Doppelbuchst. bb EStG: Gewerblicher Grundstückshandel sowie Immobilieninvestitionen ausländischer Objektgesellschaften2.2.2.2 § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Doppelbuchst. aa EStG: Vermietung und Verpachtung von inländischem unbeweglichen Vermögen als gewerbliche Einkünfte2.2.2.3 § 49 Abs. 1 Nr. 7 EStG: Wiederkehrende Bezüge2.2.2.4 § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG: Sonstige Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG2.2.3 Der Tatbestand des § 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG (Kapitalforderungen)2.3 Die isolierende Betrachtungsweise des § 49 Abs. 2 EStG3 Durchführung der Besteuerung sowie Verfahrensfragen3.1 Charakterisierung der §§ 50 und 50a EStG3.2 Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage bei § 50 EStG (unter Einbeziehung des § 49 EStG)3.2.1 Anwendbare Regelungen im Rahmen einer Veranlagung3.2.2 Tarif im Rahmen der Veranlagung3.2.3 Abgeltende Wirkung eines Steuerabzugs3.3 Der Sondertatbestand des § 50a EStG3.3.1 § 50a Abs. 1 – 3 und 5: Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen3.3.2 Besonderheiten: § 50a Abs. 44 Treaty Overriding4.1 Einordnung in das nationale Gesetzesgefüge4.2 Aufbau der Norm4.3 Die einzelnen Regelungsbereiche4.3.1 Das zweistufige Verfahren4.3.2 Das Freistellungsverfahren gemäß § 50c Abs. 2 Nr. 1 EStGIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ihr Portal für alle Online-Materialien zum Buch!
Arbeitshilfen, die über ein normales Buch hinaus eine digitale Dimension eröffnen. Je nach Thema Vorlagen, Informationsgrafiken, Tutorials, Videos oder speziell entwickelte Rechner – all das bietet Ihnen die Plattform myBook+.
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Materialien Ihres Buches zu gelangen
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bearbeiterübersicht:G. Girlich/K. Melzer: Teil AT. Maurer: Teil CJ. Missal: Teil DM. Preißer: Teil B
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6439-0
Bestell-Nr. 20469-0012
ePub:
ISBN 978-3-7910-6440-6
Bestell-Nr. 20469-0104
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6441-3
Bestell-Nr. 20469-0161
Michael Preißer/Gerhard Girlich
Ertragsteuerrecht
24., überarbeitete und aktualisierte Auflage, März 2025
© 2025 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Umschlag: Stoffers Grafik-Design, Leipzig
Produktmanagement: Rudolf Steinleitner
Lektorat: Thomas Stichler, conscripto, Stuttgart
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Die Herausgeber
Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Preißer
ist Rechtsanwalt und Steuerberater, seit 01.01.2012 Partner bei PRS Preißer von Rönn und Partner – Partnerschaftsgesellschaft mbB – in Hamburg (vormals Of counsel bei Graf von Westphalen in Hamburg) und war Professor für Steuerrecht und Wirtschaftsprivatrecht an der Leuphana Universität Lüneburg (bis Oktober 2015). Er war vorher in der bayerischen Finanzverwaltung, dann als Professor an der Beamtenfachhochschule in Hamburg tätig. Gastprofessuren in Paris (2004/2005), in Orel (Russland, 2007/2008) und Pinsk (Weißrussland) runden den Dozenteneinsatz ab. Herr Prof. Preißer war 2008 Mitbegründer des europäischen Steuerrechtsinstituts »2isf« mit Sitz in Paris. Er ist Autor zahlreicher Aufsätze und Monographien sowie Referent des BMF, des DAI und der BFA. Er war im UN-Sonderauftrag mit der Installierung des Steuerberater-Berufs in Weißrussland befasst, der 2017 erfolgreich abgeschlossen wurde. Seit Oktober 2015 fungiert er als Leiter des Studiengangs »Tax Master L. L. M.« an der Universität Lüneburg.
Prof. Dr. Gerhard Girlich
ist Professor für Rechnungswesen und Steuern an der Hochschule Biberach an der Riß. Zuvor war er als Prüfungsleiter in der Konzernbetriebsprüfung in der bayerischen Finanzverwaltung und als Mitglied der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Betriebsstättenbesteuerung tätig. Zudem ist er fachlicher Leiter der Steuerlehrgänge Dr. Bannas und als Referent in der Aus- und Fortbildung mit den Schwerpunkten nationales und internationales Bilanzsteuerrecht sowie Umwandlungssteuerrecht, Konzernsteuerrecht und internationales Steuerrecht tätig. Daneben ist er Lehrbeauftragter für internationales Steuerrecht an der Universität Augsburg und der Universität Freiburg i.Br. sowie Gastdozent an der Bundesfinanzakademie.
Die Autoren
Romy Anderlik, Diplom-Finanzwirtin
war nach Abschluss ihres Studiums an der Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Finanzwesen, einige Jahre als Betriebsprüferin in der bayerischen Finanzverwaltung tätig. Seit dieser Zeit unterrichtet sie zusätzlich an der Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Finanzwesen, Ertragsteuerrecht. Nach einigen Jahren im Bereich Einkommensteuerrecht beim Bayerischen Landesamt für Steuern ist sie inzwischen als Sachgebietsleiterin in einem bayerischen Finanzamt tätig. Zudem lehrte sie viele Jahre als Dozentin in der Ausbildung der Steuerfachwirte im Fach Ertragsteuerrecht. Romy Anderlik ist als Referentin für Fortbildungsseminare im Bereich Einkommensteuer tätig.
Dominik Bressler, LL. M.
ist selbständiger Steuerberater in Hamburg. Nach Studium in Lüneburg und Winterthur war er langjähriger Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Michael Preißer an der Universität Lüneburg und arbeitete in verschiedenen Hamburger Kanzleien, bevor er sich in 2017 selbständig machte. Von 2015 bis 2017 absolvierte er einen Vertiefungsstudiengang im Bereich Unternehmensnachfolge, Erbrecht und Vermögen in Münster. Herr Bressler ist Mitautor verschiedener fachlicher Publikationen und Dozent in der Steuerberater- und Steuerfachwirtausbildung.
Leonard Dorn, Diplom-Finanzwirt (StAkad)
ist Betriebsprüfer in der Niedersächsischen Finanzverwaltung. 2016 legte er mit Erfolg die Steuerberaterprüfung ab. Als Dozent ist Leonard Dorn für Steuerfachassistenten für Lohn und Gehalt, Steuerfachwirte und Steuerberater im Bereich Ertragsteuern tätig. Als Referent führt er deutschlandweit Einkommensteuerseminare im aktuellen Steuerrecht durch. Außerdem unterrichtet er an der IHK Ostwestfalen Bilanzbuchhalter im Lohnsteuerrecht.
Prof. Dr. Gerhard Girlich
s. oben: Die Herausgeber.
Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Preißer
s. oben: Die Herausgeber.
Vorwort der Herausgeber zur 24. Auflage (Prüfung 2025)
Mit drei Bänden unternehmen wir den Versuch, den umfangreichen Stoff für die Steuerberaterprüfung kompakt und umfänglich darzustellen. Mit der vorliegenden 24. Auflage ist das nötige Wissen zum einen gestrafft bzw. angepasst und zum anderen auf den prüfungsrelevanten Rechtsstand angehoben (u. a. Berücksichtigung des Wachstumschancengesetzes) sowie um aktuelle Beispiele erweitert worden.
So wichtig und richtig es ist, dass man in der Vorbereitung eine größere Anzahl von Klausuren (am besten 10 Arbeiten pro Einzelklausur, also insgesamt 30 Klausuren) schreibt, um ein Gespür für eine sechsstündige Arbeit – und für die Korrektur derselben – zu bekommen, so wenig darf man sich auf die lediglich thematische Wiederholung der einmal gestellten Aufgaben verlassen. Das Problem der »Sachverhaltsquetsche« bezieht sich auf alle drei Klausuren und führt zu einer entsprechenden Abwertung der Arbeiten.
Nur mit einem breiten steuerrechtlichen Grundlagenwissen sowie der Kenntnis fachgebietsübergreifender bzw. interdisziplinärer Zusammenhänge und nicht zuletzt mit dem notwendigen Klausuren-Know-how lassen sich die Arbeiten im schriftlichen Teil gut bewältigen. Dazu gehören ferner eine Portion Mut und die Gelassenheit, sich auf jede Aufgabe neu einzustellen. Das erlernte Wissen muss flexibel einsetzbar und frisch abrufbar sein.
Alle Autoren der vorliegenden drei Bände haben sich daher seit der ersten Auflage dem Ziel verschrieben, dem Leser flexibel einsetzbares Fach- und Klausurwissen als sichere Basis für den Prüfungserfolg zu vermitteln. Auch in dieser Auflage können die Flexibilität und das erlernte Wissen sogleich anhand der von den »Steuerlehrgängen Dr. Bannas« zur Verfügung gestellten Übungsklausuren auf myBook+ überprüft werden.
Die Herausgeber möchten sich bei allen Autoren bedanken, die teils seit nunmehr 20 Jahren ihre Beiträge abliefern und somit den Grundstein für das theoretische Bestehen einer der schwierigsten Prüfungen in Deutschland legen.
Stuttgart, im Januar 2025
Michael Preißer und Gerhard Girlich
Vorwort der Autoren zur 24. Auflage (Prüfung 2025)
Teil A und B Einkommensteuer
In kaum einer anderen Steuerrechtsdisziplin hat die Reduktion der Komplexität eine größere Bedeutung als in der Einkommensteuer. Komplizierte Sachverhalte aus allen Bereichen des Wirtschafts- und des Privatlebens müssen zunächst auf den Punkt gebracht werden, bevor hierauf ein (häufig kompliziert erscheinendes) Steuergesetz angewandt wird. Das Know-how zur einkommensteuerrechtlichen Subsumtion sowie die Grundstrukturen des EStG werden in diesem Band vermittelt.
Das Einkommensteuerrecht erfährt hier eine Zweiteilung. In Teil A werden die – stark überarbeiteten – sieben Einkunftsarten dargestellt. Zusammen mit den Abzugskomponenten, die das steuerliche Existenzminimum garantieren, wird das (zu versteuernde) Einkommen ermittelt.
Die Darstellung orientiert sich an den Leitbegriffen des objektiven und des subjektiven Nettoprinzips und erlaubt somit eine geschlossene Präsentation des Erwerbsaufwands sowie der privat indisponiblen Aufwendungen (Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen). Die Steuerthematik der Kinder und der alten Generation (inkl. der Behandlung der Vorsorgeaufwendungen) rundet den Komplex ab. Die Zusammenfassung von Werbungskosten und Betriebsausgaben ermöglicht eine konzentrierte Behandlung des Erwerbsaufwands mit allen Facetten auf der Tatbestandsebene. Gleichzeitig wird die Thematik unterlegt mit der dogmatischen Aufteilung in einen Zustands- und in einen Handlungstatbestand, die sämtlichen Einkunftsarten zugrunde liegen. Vor diesem Hintergrundverständnis werden viele Normen erst verständlich, deren Wesensgehalt sich sonst im bloßen Aufzählen erschließt.
Während bei Teil A die Interpretation der Lebenssachverhalte durch das Steuerrecht im Vordergrund steht und es vornehmlich um das Klausuren-Know-how geht, konfrontiert Teil B den Leser mit den ureigenen steuerrechtlichen Fragestellungen. Es wird methodisch ein neuer Weg eingeschlagen, indem vier übergreifende Komplexe gebildet werden, die – jeweils ausgelöst durch eine spezifische steuerliche Vorgabe – unterschiedliche Themenfelder beleuchten.
So werden etwa bei der Frage nach dem richtigen steuerlichen Zurechnungssubjekt so verschiedenartige Phänomene wie der Drittaufwand, Nießbrauchs- und Treuhandgestaltungen sowie die Angehörigenverträge besprochen. Die weiteren Themengebebiete lauten: Steuerliche Verluste, Realisationsfragen (§§ 16 f. EStG u. a.) inkl. der betrieblichen Umstrukturierung sowie die steuerliche Rechtsnachfolge. Die vier zusammengefassten Problemfelder spielten in den Prüfungen der letzten Jahre eine große Rolle.
Teil C Gewerbesteuer
Das Bundesverfassungsgericht hat die Gewerbesteuer wiederholt als solche in ihrer Grundstruktur und herkömmlichen Ausgestaltung als vornehmlich auf den Ertrag des Gewerbebetriebs gerichtete Objektsteuer auch neben der die Einkünfteerzielung erfassenden Einkommensteuer verfassungsrechtlich abgesegnet. Daher wird die Gewerbesteuer auch zukünftig ein nicht unerheblicher Bestandteil der ertragsteuerlichen Klausur der Steuerberaterprüfung bleiben. Die konventionellen Themen der Gewerbesteuer sollten daher beherrscht werden und sind im Teil C dargestellt.
Teil D Internationales Steuerrecht
Das internationale Steuerrecht nimmt nicht nur in der täglichen Praxis des Beraters einen immer größeren Raum ein, sondern auch – bedingt durch diese Entwicklung – in der Steuerberaterprüfung.
Der Autor hat die umfangreiche Materie traditionell entsprechend den möglichen grenzüberschreitenden Aktivitäten gegliedert. Getrennt nach Inbound- und Outboundaktivitäten wird unter Einbeziehung des Völkerrechts (Doppelbesteuerungsabkommen), des EU-Rechts sowie des nationalen Rechts (insbesondere des Außensteuergesetzes) der Komplex dargestellt.
Stuttgart, im Januar 2025
Romy Anderlik
Dominik Bressler
Leonard Dorn
Gerhard Girlich
Michael Preißer
Inhaltsübersicht »Die Steuerberaterprüfung« Bände 1 – 3
Band 1:
Ertragsteuerrecht
Teil A
Einkommensteuer I – Kernbereiche
Kapitel I
Grund- und Strukturfragen bei der Einkommensteuer
Kapitel II
Der Zustandstatbestand – Überschusseinkünfte
Kapitel III
Der Zustandstatbestand – Gewinneinkünfte
Kapitel IV
Der Erwerbsaufwand (das objektive Nettoprinzip) und § 12 EStG
Kapitel V
Das subjektive Nettoprinzip inklusive der Berücksichtigung der Kinder und der Besteuerung der Alterseinkünfte
Teil B
Einkommensteuer II – Übergreifende Komplexe
Kapitel I
Personelle Zurechnung (Drittaufwand, Nießbrauch/Treuhand, Angehörigenverträge u. a.)
Kapitel II
Realisationstatbestände (Steuerentstrickung im Privatvermögen/Betriebsvermögen vs. betriebliche Umstrukturierung)
Kapitel III
Einkommensteuer – Rechtsnachfolge (vorweggenommene Erbfolge, Erbfall und Erbauseinandersetzung)
Kapitel IV
Verluste im Ertragsteuerrecht
Teil C
Gewerbesteuer
Kapitel I
Einführung und Berechnungsschema
Kapitel II
Steuergegenstand und Steuerpflicht
Kapitel III
Die Besteuerungsgrundlage (§§ 6 bis 9 GewStG)
Kapitel IV
Spezifika der Gewerbesteuer
Teil D
Internationales Steuerrecht
Kapitel I
Strukturierung der Fallgestaltungen im internationalen Steuerrecht (inklusive der Grenzpendlerproblematik)
Kapitel II
Die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
Kapitel III
Auslandsbeziehungen eines Steuerinländers (Fälle der unbeschränkten Steuerpflicht)
Kapitel IV
Regelungsbereiche des Außensteuergesetzes (AStG)
Kapitel V
Besteuerung der Steuerausländer im Inland
Band 2:
Unternehmenssteuerrecht und Steuerbilanzrecht
Teil A
Besteuerung der Einzelunternehmen
Kapitel I
Grundfragen der Gewinnermittlung (inklusive § 4 Abs. 3-Rechnung)
Kapitel II
Die Bilanzierung
Kapitel III
Einzelne Aktivposten
Kapitel IV
Rechnungsabgrenzungsposten
Kapitel V
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Kapitel VI
Einzelne Passivposten
Kapitel VII
Übertragung von Wirtschaftsgütern auf andere Betriebsvermögen
Kapitel VIII
Technische Fragen
Teil B
Besteuerung der Personengesellschaft als Mitunternehmerschaft
Kapitel I
Grundfragen zur Mitunternehmerschaft inklusive Einkunftsermittlung
Kapitel II
Das Betriebsvermögen und die Ermittlung des laufenden Gewinns bei der Mitunternehmerschaft
Kapitel III
Die Doppelgesellschaften im Konzept der Mitunternehmer-Besteuerung
Kapitel IV
Anfang und Ende einer Personengesellschaft
Kapitel V
Die Beteiligung an einer Personengesellschaft inklusive Personenstandsänderungen, insbesondere die Veräußerung
Kapitel VI
Sonderfragen
Kapitel VII
Das KöMoG
Kapitel VIII
Das MoPeG
Teil C
Körperschaftsteuerrecht
Kapitel I
Grundlagen der Besteuerung von Körperschaften
Kapitel II
Die persönliche Körperschaftsteuerpflicht
Kapitel III
Die sachliche Körperschaftsteuerpflicht
Kapitel IV
Die steuerliche Behandlung der Ergebnisverwendung bei Kapitalgesellschaften
Kapitel V
Die Bedeutung der Organschaft
Kapitel VI
Die steuerliche Behandlung von Kapitalmaßnahmen
Teil D
Umwandlungssteuerrecht
Kapitel I
Zivilrechtliche Grundlagen der Umwandlung
Kapitel II
Steuerrechtliche Grundlagen der Umwandlung
Kapitel III
Umwandlung von der Kapitalgesellschaft auf die Personengesellschaft
Kapitel IV
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
Kapitel V
Spaltung
Kapitel VI
Einbringung in eine Kapitalgesellschaft
Kapitel VII
Formwechsel
Band 3:
Verfahrensrecht, Umsatzsteuerrecht, Erbschaftsteuerrecht
Teil A
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung
Kapitel I
Einführung
Kapitel II
Allgemeines Steuerschuldrecht
Kapitel III
Haftung
Kapitel IV
Steuerverwaltungsakte
Kapitel V
Das steuerliche Verwaltungsverfahren
Kapitel VI
Aufhebung, Änderung und Berichtigung von Steuerverwaltungsakten
Kapitel VII
Das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren
Kapitel VIII
Das finanzgerichtliche Verfahren
Kapitel IX
Vorläufiger Rechtsschutz
Kapitel X
Vollstreckung von Steueransprüchen (§§ 249 ff. AO)
Kapitel XI
Die Außenprüfung (§§ 193 ff. AO)
Kapitel XII
Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten
Teil B
Umsatzsteuerrecht
Kapitel I
Einführung
Kapitel II
Hinweise für die Bearbeitung von Umsatzsteuerklausuren
Kapitel III
Unternehmer und Unternehmen als Anknüpfungspunkte des Umsatzsteuerrechts
Kapitel IV
Leistungen (Lieferungen und sonstige Leistungen)
Kapitel V
Einzelfragen zum Leistungsaustausch
Kapitel VI
Inland/Ausland/Drittland/Gemeinschaftsgebiet
Kapitel VII
Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a UStG)
Kapitel VIII
Steuerbefreiungen entgeltlicher Inlandsumsätze (§ 4 UStG)
Kapitel IX
Bemessungsgrundlage (§ 10 UStG) und Steuersatz (§ 12 UStG)
Kapitel X
Steuerentstehung
Kapitel XI
Steuerschuldnerschaft
Kapitel XII
Besteuerung unentgeltlicher Wertabgaben
Kapitel XIII
Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis (§ 14c UStG)
Kapitel XIV
Grenzüberschreitende Warenbewegungen
Kapitel XV
Vorsteuerabzug (§ 15 UStG)
Kapitel XVI
Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)
Kapitel XVII
Besteuerungsverfahren
Teil C
Erbschaftsteuerrecht
Kapitel I
Das Erbschaftsteuerrecht inklusive der erbrechtlichen Grundlagen
Kapitel II
Schenkungsteuerrecht: Vermögensübertragungen zu Lebzeiten im Erbschaftsteuergesetz
Kapitel III
Das Binnenrecht des Erbschaftsteuergesetzes (inkl. Bewertung)
Themen des Prüfungsstoffs, geordnet nach Prüfungstagen
Tag 1: Gemischte Klausur
Tag 2: Klausur »Einkommensteuer- und Ertragssteuerrecht«
Tag 3: Klausur »Buchführung und Bilanzwesen«
Band 3
Band 1
Band 2
Teil A
Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung
Teil A
Einkommensteuer I
Teil A
Besteuerung der Einzelunternehmen
Teil B
Umsatzsteuerrecht
Teil B
Einkommensteuer II
Teil B
Besteuerung der Personengesellschaft als Mitunternehmerschaft
Teil C
Erbschaftsteuerrecht
Teil C
Gewerbesteuer
Teil D
Internationales Steuerrecht
Band 2
Teil A Kap. I
Grundfragen der Gewinnermittlung
Teil C
Körperschaftsteuerrecht
Teil D
Umwandlungssteuerrecht
Abkürzungsverzeichnis
A Abschnitt
a. A. anderer Ansicht
a. a. O. am angegebenen Ort
AB Anfangsbestand
Abs. Absatz
Abschn. Abschnitt
abzgl. abzüglich
AbzStEntModG Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz)
AdV Aussetzung der Vollziehung
a. E. am Ende
AEAO Anwendungserlass zur Abgabenordnung
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a. F. alte Fassung
AfA Absetzung für Abnutzung
AfaA Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung
AFG Arbeitsförderungsgesetz
AG Aktiengesellschaft; Arbeitgeber
agB außergewöhnliche Belastung/-en
AIG Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei Auslandsinvestitionen der deutschen Wirtschaft (Auslandsinvestitionsgesetz)
AK Anschaffungskosten
AktG Aktiengesetz
Alt. Alternative
AltEinkG Alterseinkünftegesetz
AmtshilfeRLUmsG Amtshilferichtlinieumsetzungsgesetz
AN Arbeitnehmer
AnfG Gesetz über die Anfechtung von Rechtshandlungen außerhalb des Insolvenzverfahrens vom 05.10.1994 (BGBl I 1994, 2911)
Anm. Anmerkung
AO Abgabenordnung
AOA Authorized OECD Approach
AP Außenprüfung
arg. argumentum
Art. Artikel
AStG Außensteuergesetz
ATADUmsG Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz)
AV Anlagevermögen
Az. Aktenzeichen
BA Betriebsausgabe
BaföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAG Bundesarbeitsgericht
BauGB Baugesetzbuch
BayLfSt Bayerisches Landesamt für Steuern
BayObLG Bayrisches Oberstes Landesgericht
BB Betriebs-Berater
BBauG Bundesbaugesetz
BE Betriebseinnahme/-n
BeitRLUmsG Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie
BEPS Base Erosion and Profit Shifting
BEPS I-UmsG Gesetz zur Umsetzung der EU-Amtsrichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnverkürzungen und -verlagerungen
BesitzG Besitzgesellschaft
BetriebsG Betriebsgesellschaft
BeurkG Beurkundungsgesetz
BewG Bewertungsgesetz
BfF Bundesamt für Finanzen
BFH Bundesfinanzhof
BFHE Bundesfinanzhof-Entscheidungen
BFH/NV Sammlung amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des Bundesfinanzhofes
BgA Betrieb gewerblicher Art
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl Bundesgesetzblatt
BGH Bundesgerichtshof
BGHSt Bundesgerichtshof in Strafsachen
BGHZ Amtliche Entscheidungssammlung des Bundesgerichthofs
BiRiLiG Bilanzrichtliniengesetz
BKGG Bundeskindergeldgesetz
BMF Bundesministerium für Finanzen
BMF-ErbA Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen zur Erbauseinandersetzung
BMF-RE Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen zum Rentenerlass
BMF-vE Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen zur vorweggenommenen Erbfolge
BMG Bemessungsgrundlage
BP Betriebsprüfung
BPO Betriebsprüfungsordnung
BRAGO Bundesgebührenverordnung für Rechtsanwälte
BRD Bundesrepublik Deutschland
BR-Drs. Bundesratsdrucksache
Brexit-StBG Gesetz über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz)
BS Betriebsstätte, Buchungssatz
BsGaV Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung
BStBl Bundessteuerblatt
BT-Drs. Bundestags-Drucksache
Buchst. Buchstabe
BV Betriebsvermögen
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Bundesverfassungsgericht-Entscheidungen
BVerfGG Bundesverfassungsgerichtgesetz
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVV Betriebsvermögensvergleich
BW Buchwert
bzgl. bezüglich
BZRG Bundeszentralregistergesetz
BZSt Bundeszentralamt für Steuern
bzw. beziehungsweise
CH Schweiz
DA-FamEStG Dienstanweisung zur Durchführung des Familienleistungsausgleichs
DB Der Betrieb (Zeitschrift)
DBA Doppelbesteuerungsabkommen
DepotG Depotgesetz
dgl. dergleichen
d. h. das heißt
DNotI Informationsdienst des Deutschen Notarinstituts
DStjG Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft e. V. (Band)
DStR Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
DStRE Deutsches Steuerrecht – Entscheidungsdienst (Zeitschrift)
DStZ Deutsche Steuer-Zeitung
EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz (Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien)
EFG Entscheidungen der Finanzgerichte
EFH Einfamilienhaus/-häuser
EG Erdgeschoss; Europäische Gemeinschaft
EGAO Einführungsgesetz zur Abgabenordnung
EGV Vertrag zur Neugründung der europäischen Gemeinschaft vom 25.03.1957
EigZulG Eigenheimzulagengesetz
ELStAM Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale
ErbbauVO Erbbaurechtsverordnung
ErbBstg Erbfolgebesteuerung (Zeitschrift)
ErbGleichG Erbrechtsgleichstellungsgesetz vom 16.12.1997, BGBl I 1997, 2968
ErbStG Erbschaftsteuergesetz
Erl. Erlass
ESt Einkommensteuer
EStDV Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG Einkommensteuergesetz
EStR Einkommensteuer-Richtlinien
ETW Eigentumswohnung
EU Europäische Union
EuG Gericht der Europäischen Union
EuGH Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
EURLUmsG EU-Richtlinien-Umsetzungsgesetz
E-USt Einfuhrumsatzsteuer
EV Eigentumsvorbehalt
e. V. eingetragener Verein
evtl. eventuell
EW Einheitswert
EWIV Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung
EZ Erhebungszeitraum
f., ff. folgende, fortfolgende
FA/FÄ Finanzamt/Finanzämter
FAGO Geschäftsordnung für die Finanzämter
FG Finanzgerichte
FGG Reichsgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 17.05.1898
FGO Finanzgerichtsordnung
FGO-ÄndG FGO-Änderungsgesetz
FinMin Finanzministerium
FinVerw Finanzverwaltung
FoStoG Fondsstandortgesetz
FN Fußnote
FörderGG Fördergebietsgesetz
FVerlV Funktionsverlagerungsverordnung
FVG Gesetz über die Finanzverwaltung
GA Gewinnausschüttung
GABl. Gemeinsames Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg
GAufzV Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GdE Gesamtbetrag der Einkünfte
geb. geboren
gem. gemäß
GenG Genossenschaftsgesetz
GewO Gewerbeordnung
GewSt Gewerbesteuer
GewStDV Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
GewStG Gewerbesteuergesetz
GewStH Gewerbesteuer-Hinweise
GewStR Gewerbesteuer-Richtlinien
GF Geschäftsführer
G’fter Gesellschafter
GFZ Geschossflächenzahl
GG Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHR Die GmbH-Rundschau (Zeitschrift)
grds. grundsätzlich
GrESt Grunderwerbsteuer
GrEStG Grunderwerbsteuergesetz
GrS Großer Senat
GrStG Grundsteuergesetz
GrStR Grundsteuer-Richtlinien
GruBo Grund und Boden
G+V Gewinn- und Verlustrechnung
GVG Gerichtsverfassungsgesetz
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter
H Hinweis (zu Richtlinien)
h. A. herrschende Auffassung
HB Handelsbilanz
HBeglG Haushaltbegleitgesetz
HFR Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung (Entscheidungssammlung)
HGB Handelsgesetzbuch
HK Herstellungskosten
h. L. herrschende Lehre
h. M. herrschende Meinung
H/H/R Hermann/Heuer/Raupach (Kommentar)
HR Handelsregister
HS Halbsatz
HV Handelsvertreter
i. d. F. in der Fassung
i. d. R. in der Regel
IdW Institut der Wirtschaftsprüfer
i. e. id est
i. e. S. im engeren Sinne
i. H. v. in Höhe von
inkl. inklusive
insb. insbesondere
InsO Insolvenzordnung
InvStG Investmentsteuergesetz
InvStRefG Investmentsteuerreformgesetz
InvZulG Investitionszulagengesetz
i. R. d. im Rahmen des/der
i. R. v. im Rahmen von
i. S. d. im Sinne des/der
i. S. e. im Sinne eines/einer
IStR Internationales Steuerrecht (Zeitschrift)
i. S. v. im Sinne von
i. Ü. im Übrigen
i. V. m. in Verbindung mit
i. w. S. im weiteren Sinne
jPdöR juristische Person(en) des öffentlichen Rechts
JStG Jahressteuergesetz
Kap. Kapitel
KapESt Kapitalertragsteuer
KapG Kapitalgesellschaft
Kfz Kraftfahrzeug
KG Kommanditgesellschaft
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien
KiSt Kirchensteuer
Kj. Kalenderjahr/-e
Komm. Kommentar
KÖSDI Kölner Steuerdialog (Zeitschrift)
KraftStG Kraftfahrzeugsteuergesetz
KroatienAnpG Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU
KSt Körperschaftsteuer
KStG Körperschaftsteuergesetz
KStH Körperschaftsteuer-Hinweise
KStR Körperschaftsteuer-Richtlinien
KWG Kreditwesengesetz
kWp Kilowattpeak
LAG Landesarbeitsgericht
LE Ländererlass
Lit. Literatur
LPartG Lebenspartnerschaftsgesetz
LSG Landessozialgericht
LSt Lohnsteuer
LStÄR Lohnsteueränderungsrichtlinien
LStDV Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
LStH Lohnsteuer-Hinweise
LStR Lohnsteuer-Richtlinien
lt. laut
L+F Land- und Forstwirtschaft
L+L Lieferungen und Leistungen
m. a. W. mit anderen Worten
m. E. meines Erachtens
MEG Miterbengemeinschaft
MFH Mehrfamilienhaus/-häuser
Mio. Millionen
MoMiG Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
MoPeG Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Mrd. Milliarden
MU Mitunternehmer
Mu-To-RL Mutter-Tochter-Richtlinie
MüKo Münchener Kommentar
m. w. N. mit weiteren Nachweisen
MwStSystRL Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie
nat. natürliche/-r/-s
ND Nutzungsdauer
n. F. neue Fassung
NJW Neue Juristische Wochenschrift
n. n. v. noch nicht veröffentlicht
Nr. Nummer
nrkr. nicht rechtskräftig
n. v. nicht veröffentlicht
o. Ä. oder Ähnliches
OECD-MA OECD-Musterabkommen
OFD Oberfinanzdirektion
o. g. oben genannte/-r/-s
OG Obergeschoss
OHG Offene Handelsgesellschaft
OLG Oberlandesgericht
OrgG Organgesellschaft
OrgT Organträger
OVG Oberverwaltungsgericht
OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
p. a. per annum
PartG Partnerschaftsgesellschaft; Parteiengesetz
PartGG Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PassG Passgesetz
PersG Personengesellschaft
PersHG Personenhandelsgesellschaft
PV Privatvermögen
R Richtlinie
RA Rechtsanwalt
RAP Rechnungsabgrenzungsposten
RennwLottAB Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz
RfE Rücklage für Ersatzbeschaffung
RFH Reichsfinanzhof
RG Reichsgericht
rkr. rechtskräftig
Rn. Randnummer
Rspr. Rechtsprechung
RStBl Reichssteuerblatt
Rz. Randziffer
S. Satz/Sätze
s. siehe
SA Sonderausgaben
S. à. r. l. Société à responsabilité limitée
SB Schlussbilanz
SEStEG Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerlicher Maßnahmen
SGB Sozialgesetzbuch
sog. sogenannte/-r/-s
SolZ Solidaritätszuschlag
StÄndG Steueränderungsgesetz
StB Steuerbilanz; Steuerberater; Der Steuerberater (Zeitschrift)
StBereinG Steuerbereinigungsgesetz
StBerG Steuerberatungsgesetz
StBG Steuerberatergesetz
StBGebV Steuerberatergebührenverordnung
StbJb Steuerberater-Jahrbuch
StBW Die Steuerberater Woche (Zeitschrift)
StEd Steuer-Eildienst
StEntlG Steuerentlastungsgesetz vom 24.03.1999, BGBl I 1999, 402
Steufa Steuerfahndung
SteuK Steuerrecht kurzgefaßt (Zeitschrift)
StGB Strafgesetzbuch
StKl. Steuerklasse
StMBG Gesetz zur Bekämpfung des Missbrauchs und zur Bereinigung des Steuerrechts
stpfl. steuerpflichtig
StPfl. Steuerpflichtige/-r
StPO Strafprozessordnung
str. strittig
StRefG Steuerreformgesetz
StSenkErgG Steuersenkungsergänzungsgesetz
StSenkG Steuersenkungsgesetz
StuW Steuern und Wirtschaft
StVBG Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz
StVereinfG Steuervereinfachungsgesetz
StVergAbG Steuervergünstigungsabbaugesetz
SvEV Sozialversicherungsentgeltverordnung
TabakStG Tabaksteuergesetz
TEV Teileinkünfteverfahren
TW Teilwert
Tz. Textziffer
u. a. unter anderem
u. Ä. und Ähnliches
Ubg Die Unternehmensbesteuerung (Zeitschrift)
UE Umwandlungssteuererlass
u. E. unseres Erachtens
UmwG Umwandlungsgesetz
UmwStErl Umwandlungssteuererlass
UmwStG Umwandlungssteuergesetz
UntStFG Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 20.12.2001, BGBl I 2001, 3858
UntStRefG Unternehmenssteuerreformgesetz
UR Umsatzsteuer-Rundschau (Zeitschrift)
USt Umsatzsteuer
UStÄndG Umsatzsteueränderungsgesetz
UStB Der Umsatz-Steuer-Berater
UStDV Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG Umsatzsteuergesetz
USt-IdNr. Umsatzsteueridentifikationsnummer
USt-VA Umsatzsteuervoranmeldung
u. U. unter Umständen
UV Umlaufvermögen
VA Voranmeldung; Verwaltungsakt
v. A. w. von Amts wegen
VAZ Voranmeldungszeitraum
vE verdeckte Einlage, vorweggenommene Erbfolge
vEK verwendbares Eigenkapital
VermBG Vermögensbildungsgesetz
VerwGrS Verwaltungsgrundsätze
Vfg. Verfügung
vGA verdeckte Gewinnausschüttung
vgl. vergleiche
VollStrA Vollstreckungsanweisung
vs. versus
VSt Vorsteuer
VStG Vermögensteuergesetz
V+V Vermietung und Verpachtung
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VwZG Verwaltungszustellungsgesetz
VZ Veranlagungszeitraum
WachstBeschlG Wachstumsbeschleunigungsgesetz
WE Wirtschaftseinheit
WertV Wertermittlungsverordnung
WG Wirtschaftsgut/-güter
wistra Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer, Strafrecht
Wj. Wirtschaftsjahr/-e
WK Werbungskosten
WoP Wohnungsbauprämie
WP Wirtschaftsprüfer
WPg Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift)
WPHG Wertpapierhandelsgesetz
WÜRF Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23.05.1969
ZASt Zinsabschlagsteuer
z. B. zum Beispiel
ZEV Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZFH Zweifamilienhaus/-häuser
ZG Zollgesetz
Ziff. Ziffer
ZPO Zivilprozessordnung
z. T. zum Teil
z. v. E. zu versteuerndes Einkommen
ZVG Zwangsversteigerungsgesetz
zzgl. zuzüglich
zzt. zurzeit
A Einkommensteuer I – Kernbereiche
I Grund- und Strukturfragen bei der Einkommensteuer
1 Einleitung
»Die Einkommensteuer geht alle an.« Sie ist die Steuer mit der größten Breitenwirkung, da von ihr alle natürlichen Personen mit ihren Aktivitäten im In- und Ausland betroffen sind. Sie ist auch die Steuer mit der größten Tiefenwirkung, da sie in persönliche Bereiche (SA und agB) eindringt, die den Verkehrs-, Objekt- und Realsteuern verschlossen sind. In ihrer speziellen Erhebungsform als Quellensteuer (Abzugsteuer) begegnet sie in der Grundform jedem AN (Lohnsteuer) und jedem Kapitalanleger (Kapitalertragsteuer). Bezieht man die Körperschaftsteuer als die – von ihr abgeleitete – ESt der KapG mit ein, bildet sie gem. § 8 Abs. 1 KStG auch die Basis für die Unternehmensbesteuerung.1 Sie ist nicht die aufkommensstärkste Steuer, hat aber für die Entwicklung des Steuerrechts die bei weitem größte Bedeutung. An ihr haben alle Steuertheorien ihren Ausgangspunkt genommen und die Erkenntnisse an ihr verprobt. Die wichtigsten – und vor allem »publikumswirksamen« – Entscheidungen des BVerfG zum Steuerrecht ergingen zum ESt-Recht. Die ESt hat allerdings einen gravierenden Geburtsmangel: Sie verdankt ihr heutiges Erscheinungsbild keinem »Wurf des Gesetzgebers«. Das ESt-Recht ist nicht (geschlossen) kodifiziert. Am EStG in der heutigen Fassung wurde seit 1925 »herumgebastelt«, ohne dass ein Parlament die Kraft zur durchgängigen Normierung einer der Hauptsäulen der Rechtsordnung gefunden hat. Dies liegt nicht nur an den zahlreichen Rechtsquellen mit unterschiedlicher Normenqualität (EStG, EStDV und EStR), aus denen sie sich zusammensetzt. Als weitaus gravierender wird das Zusammenprallen unterschiedlicher (z. T. konkurrierender) Besteuerungskonzepte in einem Corpus, dem EStG, empfunden.
Als Grundsätze verfassungskonformer Besteuerung, die auch bei der praktischen Auseinandersetzung mit dem ESt-Recht (z. B. bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens in der Steuererklärung oder in einer Klausur) unabdingbar sind, werden gleichberechtigt nebeneinander zitiert:
das Leistungsfähigkeitsprinzip,
der Grundsatz der Individualbesteuerung und
das Markteinkommensprinzip.
Diese sog. PrinzipienErtragsteuerrecht, Grundprinzipien des~ beantworten unterschiedliche Grundfragen des ESt-Rechts, ergänzen sich dabei weitgehend, ohne in allen Details zu gleichen Ergebnissen zu gelangen. Sie haben vor allem bei Regelungslücken eine große Bedeutung, da diese sonst für die Rechtsanwender (Gerichte/FinVerw/StB) nicht prinzipiengerecht und manchmal auch nicht sinnvoll zu schließen sind.2 Sie sind zugleich die Richtschnur für den (aktuellen) Gesetzgeber bei der Klärung anstehender Regelungsbereiche. Auch die betroffenen Steuerzahler werden sich als die Normadressaten des EStG bei Streitigkeiten mit dem FA hierauf sowie auf ihre verfassungsmäßigen Rechte berufen.
Unter dem LeistungsfähigkeitsprinzipLeistungsfähigkeitsprinzip (gemeinhin auch als die Besteuerung nach der persönlichen Leistungsfähigkeit – the ability to pay – bezeichnet) werden drei Subprinzipien erwähnt:
die gleiche Besteuerung für Bürger eines (nahezu) identischen Einkommens,
die sog. »Ist-Besteuerung« und
die Geltung des objektiven und subjektiven Nettoprinzips.
Dabei schließt die Ist-Besteuerung aus, dass hypothetische Sachverhalte der Besteuerung unterworfen werden; es gibt danach keine »Soll-Besteuerung«.
Das objektive NettoprinzipNettoprinzip, objektives~ gebietet bei der Ermittlung der Einkünfte (§ 2 Abs. 1 und 2 EStG) den uneingeschränkten Abzug der (aller) Erwerbsaufwendungen, die kausal mit einer Einkunftsquelle zusammenhängen. Die Soll-Bruchstelle mit diesem Prinzip stellen die typisierenden Abzugsbestimmungen dar (Hauptfall: Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG). Die Einzelfallgerechtigkeit wird hier zugunsten einer Vereinfachungs- und Pauschalierungsregelung für alle betroffenen Steuerbürger durchbrochen.
Das subjektive NettoprinzipNettoprinzip, subjektives~ garantiert den Abzug der existenzsichernden Aufwendungen, wie sie in der Sprache des Gesetzgebers mit Sonderausgaben (SA) und außergewöhnlichen Belastungen (agB) umschrieben sind.
Mit der Forderung der gleichen Besteuerung der StPfl. mit wesentlich gleichem Einkommen (sog. horizontale SteuergerechtigkeitSteuergerechtigkeit3) wird Verzerrungen innerhalb der einzelnen sieben Einkunftsarten vorgebeugt.4 Der Testfall für die Verifizierung dieses Prinzips sind die verschiedenen Steuervergünstigungen, die zurzeit sehr unterschiedlich auf die einzelnen Einkunftsarten verteilt sind.
Von einigen wird der Grundsatz der IndividualbesteuerungIndividualbesteuerung, Grundsatz der~als Unterfall des Postulats von der Leistungsfähigkeit behandelt. In einer (sehr wichtigen) Fallgruppe hat das Prinzip jedoch eine eigenständige Bedeutung. Als wichtigster Anwendungsbereich gilt für Ehegatten der Grundsatz der Einzeleinkunftsermittlung. Verwirklichen Ehegatten gleichzeitig und sogar miteinander einen Einkunftstatbestand (z. B. als G’fter einer PersG), so erfolgt für jeden von ihnen eine getrennte und eigenständige Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen.5 Noch allgemeiner bedeutet der Grundsatz der Individualbesteuerung, dass die Besteuerung (und damit die Erfassung aller Besteuerungsgrundlagen wie insb. der AfA) nur bei demjenigen erfolgt, der i. S. v. § 2 Abs. 1 EStG die »[…] Einkünfte erzielt«.
Mit dem MarkteinkommensprinzipMarkteinkommensprinzip umschreibt die heute h. M.6 die gemeinsame Klammer der sieben Einkunftsarten in dem Sinne, dass nur marktoffenbare Einnahmen zu einem steuerbaren Tatbestand führen. Ergebnisse der sog. Privatsphäre und Erträge ohne Markt (Schenkung, Erbschaft) sind nicht einkommensteuerbar. Es handelt sich dabei um ein praktisches Erklärungsmodell für die zulässige Umsetzung von Lebenssachverhalten in einkommensteuerliche Dimensionen.
1 Für PersG ist dies wegen § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG ohnehin der Fall.
2 Im Zusammenhang mit den anerkannten juristischen Auslegungsmethoden (grammatikalische, systematische, teleologische und historische Auslegung).
3 Demgegenüber betrifft die »vertikale Steuergerechtigkeit« diese sog. Tarifgerechtigkeit, die weitgehend in das Ermessen des Gesetzgebers gestellt ist.
4 Eines der weiteren Stichworte hierfür lautet: Prinzip des »synthetischen Einkommens« bzw. der »synthetischen« Einkunftsarten. Mit der Einführung der Abgeltungsteuer ab dem VZ 2009 wird dieses Prinzip für die Einkünfte aus Kapitalvermögen durch den besonderen Steuersatz von 25 % (§ 32d EStG) durchbrochen.
5 Erst danach, d. h. ab dem Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG), werden die zusammenveranlagten Ehegatten als ein StPfl. behandelt.
6 Grundlegende Ausführungen stammen von P. Kirchhof in Kirchhof/Söhn, § 2 A 365 ff.
2 Übersicht Einkommensteuerrecht – Einkommensermittlung nach § 2 EStG
Nach der steuerrechtswissenschaftlichen Einführung definiert § 2 EStG exakt (und technokratisch) die jeweiligen Schritte, die bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens zu durchlaufen sind (§ 2 Abs. 1 – 5 EStG), bevor hierauf der Steuerbetrag festgesetzt wird (§ 2 Abs. 6 EStG). Die »großen« Abschnitte, so wie sie auch in § 2 EStG verwendet werden, heißen in dieser Reihenfolge:
Einkünfte (§ 2 Abs. 1 EStG),
Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 2 EStG),
Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG),
Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG),
zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG).
Für die schematische Ermittlung der Zielgröße »zu versteuerndes Einkommen« sowie für die Klausurenpraxis ist das Ermittlungsschema in R 2 Abs. 1 EStR zusammengefasst, wobei die hier kursiv gedruckten Zeilen die Standardfälle repräsentieren.
Für Klausurenzwecke ist anzumerken, dass nur die einschlägigen Rechtsprüfungen und Rechenoperationen vorzunehmen sind. Das »schematische« Prüfen aller Einzelschritte ist in der vorgegebenen Zeit nicht zu leisten. Des Weiteren bestände die Gefahr der Annahme unzulässiger Sachverhaltsunterstellungen.7
BerechnungsschemaBerechnungsschema, ESt für das Zu versteuerndes Einkommen, Berechnungsschemazu versteuernde Einkommen
Das zu versteuernde Einkommen ist wie folgt8 zu ermitteln:
1
Summen der Einkünfte aus den Einkunftsarten
2
Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 2 EStG)
3
./.
Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG)
4
./.
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG)
5
./.
Freibetrag für Land- und Forstwirte (§ 13 Abs. 3 EStG)
6
+
Hinzurechnungsbetrag (§ 52 Abs. 3 S. 3 EStG sowie § 8 Abs. 5 S. 2 ALG)
7
Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)
8
./.
Verlustabzug nach § 10d EStG
9
./.
Sonderausgaben (§ 10, § 10a, § 10b, § 10c EStG)
10
./.
außergewöhnliche Belastungen (§§ 33 – 33b EStG)
11
./.
Sonder-AfA (erhöhte Absetzungen) gem. §§ 10e – 10i, § 52 Abs. 21 S. 6 EStG, § 7 Förder GG
12
+
Erstattungsüberhänge (bei Sonderausgaben gem. § 10 Abs. 4b S. 3 EStG)
13
+
zuzurechnendes Einkommen gem. § 15 Abs. 1 AStG
14
Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG)
15
./.
Freibeträge für Kinder (§§ 31, 32 Abs. 6 EStG)
16
./.
Härteausgleich nach § 46 Abs. 3 EStG, § 70 EStDV
17
zu versteuerndes Einkommen (z. v. E., § 2 Abs. 5 EStG)
Die aufgeführten Schritte zur Ermittlung des z. v. E. sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der bei weitem arbeitsintensivste Schritt auf der ersten Ebene, nämlich der Ermittlung der einzelnen Einkünfte und ggf. horizontalem bzw. vertikalen Verlustausgleich bis hin zur Summe der Einkünfte (Stufe 2) befindet. Die auf das z. v. E. festzusetzende ESt berechnet sich nach R 2 Abs. 2 EStR wie folgt, wobei hier nur die wichtigsten Komponenten wiedergegeben werden:
1
Steuerbetrag
a) lt. Grundtabelle/Splittingtabelle (§ 32a Abs. 1, 5, § 50 Abs. 3 EStG) oder
b) gem. Steuersatz lt. Progressionsvorbehalt (§ 32b EStG) bzw. sich nach der Steuersatzabgrenzung ergebende Steuersatz
2
+
Steuer aufgrund Berechnung nach §§ 34, 34b EStG
3
+
Steuer aufgrund der Berechnung nach § 34a Abs. 1 und 4 – 6 EStG
4
tarifliche Einkommensteuer (§ 32a Abs. 1, 5 EStG)
5
./.
Minderungsbetrag lt. Pkt. 11 zu Art. 23 DBA Belgien9
6
./.
ausländische Steuer nach § 34c Abs. 1 und 6 EStG, § 12 AStG
7
./.
Steuerermäßigung nach § 35 EStG
8
./.
Steuerermäßigung gem. § 34f Abs. 1 und 2 EStG
9
./.
Steuerermäßigung bei Mitgliedsbeiträgen/Spenden, § 34 g EStG
10
./.
Steuerermäßigung nach § 34f Abs. 3 EStG
11
./.
Steuerermäßigung nach § 35a EStG
12
./.
Ermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer (§ 35b EStG)
13
+
Steuer aufgrund Berechnung nach § 32d Abs. 3 und 4 EStG
14
+
Steuer nach § 34c Abs. 5 EStG
…
17
+
Anspruch auf Zulage für Altersvorsorge nach § 10a Abs. 2 EStG10
18
+
Kindergeld, falls Berücksichtigung qua Kinderfreibetrag
19
festzusetzende Einkommensteuer (§ 2 Abs. 6 EStG)
Hieraus ergibt sich unschwer ein AufbauschemaAufbauschema ESt-Klausur für eine ESt-Klausur, das sich an die Rechenschritte der Verwaltung anlehnt, zusätzlich aber die arbeitsintensiven und problembehafteten Überlegungen zur Ermittlung der Summe der positiven Einkünfte beinhaltet:
Steuersubjekt (natürliche Person als Steuer-In-/Ausländer?, bei Ehegatten getrennt) unter Einbeziehung von Alter, zu berücksichtigenden Kindern, Veranlagung (Tarif).
Steuerinländer (Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt gem. §§ 8, 9 AO) mit Welteinkünftenoder Steuerausländer mit Inlandseinkünften (§ 1 Abs. 4 i. V. m. § 49 EStG)?
Prüfung der Einkünfte je Einkunftsart (ggf. horizontaler Verlustausgleich11)
Vorliegen einer (Markt-)Einkunftsquelle (= sog. Zustandstatbestand)
Vorliegen des »Erzielens von Einkünften« (= sog. Handlungstatbestand12)
Nach Prüfung ggf. aller sieben Einkunftsarten und dem vertikalen Verlustausgleich13: Summe der Einkünfte, ggf. unter Einbeziehung der Einkünfte des Ehegatten bei Zusammenveranlagung.
Von der Summe der Einkünfte zum Gesamtbetrag der Einkünfte § 2 Abs. 3 EStG (Abzug gem. §§ 24a, 24b, 13 Abs. 3 EStG).
Berücksichtigung von § 10d EStG (Verlustabzug) sowie Abzug der SA und außergewöhnlichen Belastungen zur Ermittlung des Einkommens.
Der Abzug von persönlichen Freibeträgen führt zum zu versteuernden Einkommen (z. v. E.).
Berechnung der Steuer unter Abzug der Entlastungsbeträge, der Steuerermäßigungen (§§ 34 ff. EStG) und der Anrechnungsbeträge (Vorauszahlungen (§§ 36 Abs. 1 Nr. 1 EStG) und Quellensteuern (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EStG sowie mit Besonderheiten für die Anrechnung von KapESt § 36a EStG14).15
2.1 Einzelveranlagung
Die Grundform der Veranlagungsarten befindet sich in § 25 Abs. 3 S. 1 EStG. Demnach hat die stpfl. Person für den Veranlagungszeitraum (Kj. nach § 25 Abs. 1 EStG) eine eigenhändig unterschriebene ESt-Erklärung abzugeben. Die Veranlagung zur ESt setzt dabei als formalisiertes Verfahren eine Steuererklärung (§ 25 Abs. 1 EStG i. V. m. § 56 EStDV) voraus.
Die Einzelveranlagung kommt zur Anwendung bei Einzelpersonen und Ehegatten / eingetragenen Lebenspartnern, die die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung nicht erfüllen.
Von der Einzelveranlagung wird nur Abstand genommen (d. h. keine Steuererklärungspflicht und damit keine Veranlagung, vgl. § 56 EStDV), wenn
der Gesamtbetrag der – nicht lohnstpfl. – Einkünfte unter dem Grundfreibetrag von 11.784 € (im VZ 2024) liegt (§ 32a Abs. 1 EStG),
keine Amtsveranlagung bei lohnstpfl. Einkünften nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 – 7 EStG in Betracht kommt und
kein Verlustvortrag (§ 10d EStG) festgestellt worden ist.
Beispiel 1: Der einfältige Chirurg mit den vielfältigen Aktivitäten
Der verwitwete, in Leipzig lebende und arbeitende Chirurg Hacklberg (H), geb. am 31.12.1959, gibt beim zuständigen FA für das letzte Jahr seiner aktiven Berufstätigkeit (2024) die ESt-Erklärung ab. Dieser ist zu entnehmen:
(in €)
a) Gewinn aus der Waldnutzung in Mecklenburg-Vorpommern (M/V)
+
5.000
b) Verlust aus einer in Neuseeland betriebenen Lachszucht
./.
150.000
c) Beteiligungsverlust aus der H & Co.-OHG (der 30-jährige einzige Sohn ist Mit-G’fter) nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG
./.
6.500
d) Beteiligungsgewinn als Kommanditist an der X-KG
+
8.000
e) Gewinn als frei praktizierender Chirurg i. H. v. 250 T€ (in den erklärten BE von 450.000 € ist auch der Jahrespreis der deutschen Sterbehilfe für besonders couragierte journalistische Beiträge i. H. v. 5.000 € enthalten); Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG). H gibt des Weiteren an, bei seinen Fähigkeiten das Doppelte verdienen zu können.
+
250.000
f) Arbeitslohn als angestellter Arzt (1. Jahreshälfte 2023)
– vom Krankenhaus abgeführte Lohnsteuer: 25.000 € –
+
80.230
g) Zinsen aus Sparguthaben:
(Bankgebühren für die Verwaltung des Sparbuchs: 250 €)
+
6.180
h) Einnahmen aus der Vermietung eines Häuserblocks
– Ausgaben hierzu 40.000 € –
+
60.000
i) (Vollabzugsfähige) Krankheitskosten (§ 33 EStG)
./.
2.500
j) (Vollabzugsfähige) Sonderausgaben
./.
3.500
Aus diesen Angaben soll die ESt des H für 2024 errechnet werden. Auf die KiSt und den SolZ soll nicht eingegangen werden.
Lösung:
1. und 2. Ausführungen zur persönlichen Steuerpflicht
H als natürliche Person ist ESt-Subjekt und als Steuerinländer (Wohnsitz gem. § 8 AO) mit seinen Welteinkünften (§ 1 Abs. 1 EStG) unbeschränkt stpfl.; insb. hat er als OHG- und KG-G’fter die Beteiligungsergebnisse der ESt zu unterwerfen.
H hat am 30.12.2024 das 64. Lebensjahr vollendet (§ 187 Abs. 2 Alt. 2 BGB, § 188 Abs. 2 S. 2 BGB, § 108 Abs. 1 AO).
30-jährige Kinder sind grds. nicht zu berücksichtigen (§ 32 Abs. 4 EStG).
Für H kommt nur die Einzelveranlagung in Betracht (§ 32a Abs. 1 EStG).
3. Ermittlung der Einkünfte in den verschiedenen Einkunftsarten16
a) L+F-Einkünfte für Waldnutzung in M/V
(in €)
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1, § 2 Abs. 2 Nr. 1, § 13 EStG)
+
5.000
b) Der Verlust aus der Lachszucht in Neuseeland kann nicht berücksichtigt werden, da nach § 2a Abs. 1 Nr. 1 EStG dieser Verlust nur mit künftigen neuseeländischen L+F-Gewinnen verrechenbar ist
0
Gewinn aus L+F (§ 13 EStG)
+
5.000
(Alternative (hier horizontaler Verlustausgleich))
(./.145.000)
c) Gewerbliche Einkünfte; hier KG-Beteiligungsergebnis
(§ 2 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1, § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG)
+
8.000
d) Horizontaler Verlustausgleich mit OHG-Beteiligungsverlusten
nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, § 2 Abs. 3 EStG17
./.
6.500
Gewerbliche Einkünfte (§ 15 EStG)
+
1.500
e) Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 2 Abs. 2 Nr. 1, § 4 Abs. 3 EStG):
Der Preis der Gesellschaft für Sterbehilfe hat keinen Bezug zur Tätigkeit als Arzt (Katalogberuf i. S. d. § 18 Abs. 1 S. 1 EStG:
»Zustandstatbestand«) und ist daher – wegen fehlender Kausalitätsdichte der Einnahmen zur Tätigkeit – aus den BE zu streichen (»Handlungstatbestand«);
+
250.000
außerdem sind Jahrespreise keine Gegenleistung für marktoffenbare Tätigkeiten.
./.
5.000
Die Mitteilung zum potenziellen Mehrverdienst ist wegen der Besteuerung des Ist-Einkommens irrelevant.
Gewinn aus »selbständiger Arbeit« (§ 18 EStG)
+
245.000
f) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m.
§ 2 Abs. 2 Nr. 2, §§ 8 ff., § 19 EStG)
Als Einnahme (§ 8 EStG) gilt der Bruttoarbeitslohn18:
+
80.230
Als Erwerbsaufwand (»objektives Nettoprinzip«) ist mangels konkreten Nachweises der Pauschbetrag gem. § 9a S. 1 Nr. 1 Buchst. a EStG abzuziehen
./.
1.230
Überschuss aus »nichtselbständiger Arbeit« (§ 19 EStG)
+
79.000
g) Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 2, §§ 8 ff., § 20 EStG) unterfallen nach § 32d EStG einem besonderen Steuertarif (Abgeltungsteuer)19 und sind deshalb bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte hier nicht zu berücksichtigen
h) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, § 2 Abs. 2 Nr. 2, § 21 EStG)
Einnahmen (§ 8 EStG) gem. § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG
+
60.000
WK (§ 9 EStG) i. H. v.
./.
40.000
Überschuss bei »V+V« (§ 21 EStG):
20.000
4. Summe der Einkünfte (hier: kein vertikaler Verlustausgleich)
350.500,00
5. Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte:
• Altersentlastungsbetrag (§ 24a S. 5 EStG), da H im Jahr 2024
• das 64. Lebensjahr vollendet hat, 12,8 % der Einkünfte, max.
./.
608,00
• L+F-Freibetrag gem. § 13 Abs. 3 EStG (900 €) kommt nicht
• zum Tragen, da die Summe der Einkünfte den Betrag
• von 30.700 € übersteigt (§ 13 Abs. 3 S. 2 EStG)
./.
0,00
Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)
349.892,00
6. Ermittlung des Einkommens (§ 2 Abs. 4 EStG)
a) Sonderausgaben (§§ 10 ff. EStG)
./.
3.500,00
b) außergewöhnliche Belastungen (§§ 33 ff. EStG20)
./.
2.500,00
Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG)
343.892,00
7. Ermittlung des zu versteuernden Einkommens (§ 2 Abs. 5 EStG)
Ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG ist nicht ersichtlich, sodass das z. v. E. dem Einkommen entspricht:
343.892,00
8. Die ESt-Schuld ist gem. § 32a Abs. 1 Nr. 5 EStG21 wie folgt zu berechnen:
154.751,40 €
./.
18.936,88 €
135.814,52 €
135.814,00
./. einbehaltene Steuerabzugsbeträge
(ggf. ./. Vorauszahlungen)
./. Lohnsteuer (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG)
./.
25.000,00
ESt-Schuld
110.814,00
9. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen unterfallen nach § 32d EStG einem besonderen Steuertarif i. H. v. 25 % (Abgeltungsteuer).
Brutto-Einnahmen (inkl. Kapitalertragsteuer22) gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG (»Zustandstatbestand«)
+
6.180,00
Die WK (250 €) können wegen § 20 Abs. 9 S. 1 EStG nicht abgezogen werden23
./.
0,00
abzüglich des Sparer-Pauschbetrages (§ 20 Abs. 9 EStG)24
./.
1.000,00
Überschuss bei »Kapitalvermögen« (§ 20 EStG)
5.180,00
Die ESt für die Einkünfte aus Kapitalvermögen beträgt gem. § 32d Abs. 1 EStG 25 % der Einkünfte25
1.295,00
./. einbehaltene Kapitalertragsteuer (§ 36 Abs. 2 Nr. 2, § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 Buchst. b EStG)
./.
1.295,00
ESt-Schuld für die Einkünfte aus Kapitalvermögen
0,00
Ergebnis:
Die endgültige ESt-Schuld für H im VZ 24 beträgt:
110.814,00 €
2.2 Zusammenveranlagung
Ehegatten bzw. eingetragene Lebenspartner26 haben nach § 26 Abs. 1 und 2 EStG ein Veranlagungswahlrecht zwischen Einzelveranlagung (§ 26a EStG) und Zusammenveranlagung (§ 26b EStG). Die Voraussetzungen hierfür sind, dass
beide unbeschränkt einkommenstpfl. nach § 1 Abs. 1 oder 2 oder § 1a EStG sind,27
sie nicht dauernd getrennt lebend sind und
die Voraussetzungen (kumulativ!) zu Beginn des VZ vorgelegen haben oder im Laufe des VZ eingetreten sind.
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Einzelfall und für jeden VZ erneut zu prüfen. Ehegatten leben dauernd getrennt, wenn die zum Wesen der Ehe gehörende Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft nach dem Gesamtbild der Verhältnisse nicht mehr besteht. Die bloße Ankündigung, sich trennen zu wollen, ist nicht ausreichend. Die eheliche Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft endet erst mit dem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung (vgl. BFH vom 28.04.2010, Az.: III R 71/07). Daraus schlussfolgernd muss das »Zusammenleben« tatsächlich beendet werden.
Die Ausübung des Wahlrechts für den jeweiligen VZ wird durch Angabe in der Steuererklärung getroffen. Einzelveranlagung erfolgt, sobald einer der Ehegatten dies wählt. Zusammenveranlagung erfolgt, wenn beide Ehegatten dies wählen.28
Sobald der Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist, ist eine Änderung der Veranlagungsart nur noch unter den Voraussetzungen des § 26 Abs. 2 S. 3 EStG möglich.
Bei Nichtausübung oder nicht wirksamer Ausübung des Wahlrechts ist eine Zusammenveranlagung durchzuführen (§ 26 Abs. 3 EStG).
Die Folgen einer Zusammenveranlagung sind, dass beide Ehegatten eine gemeinsam unterschriebene Steuererklärung abzugeben haben und einen einheitlichen Steuerbescheid erhalten. Sie haften nach § 44 Abs. 1 AO gemeinsam für die festgesetzte Steuer (Hinweis: Antrag auf Aufteilung der Gesamtschuld nach § 268 AO möglich). Die Einkünfte der Ehegatten werden jeweils getrennt ermittelt und dann zusammengerechnet. Die Ehegatten werden bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens und der ESt wie ein einziger StPfl. behandelt.
Die Zusammenrechnung der Einkünfte ermöglicht einen Verlustausgleich (vgl. B IV 2.2) im Rahmen der Einkünfte der Ehegatten untereinander.
Entscheiden sich die Ehegatten für die Durchführung einer Einzelveranlagung, gilt (vgl. auch OFD Frankfurt vom 20.08.2012, Az.: S 2262 A – 10 – St 216):





























