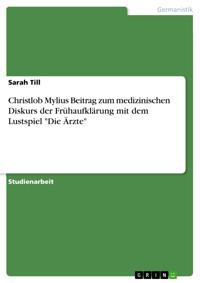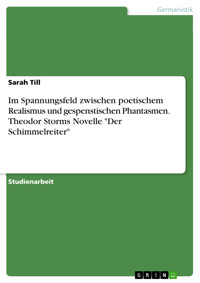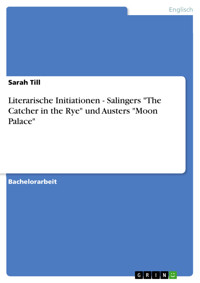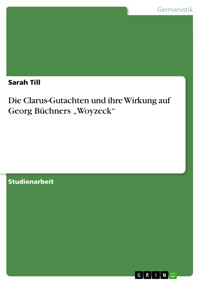Erzählen gegen das Vergessen - Über die erzählende Reflexion von Geschichte in Uwe Johnsons „Jahrestage“ und Einar Schleefs „Gertrud“ E-Book
Sarah Till
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note: 1,0, Ruhr-Universität Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Vorwort des Sammelbands „Literatur als Erinnerung“1 weist der Herausgeber Bodo Plachta auf ein hochaktuelles Phänomen hin, wenn er von einem „'Höhepunkt' unserer gegenwärtigen Erinnerungskultur“2 spricht. Tatsächlich ist gerade in Deutschland der Erinnerung insbesondere an die Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts mit fortschreitender Zeit ein immer bedeutenderer kultureller Stellenwert zuteil geworden. Ob durch die Neuerrichtung und Pflege von Gedenkstätten, Museen und Archiven oder durch die vermehrten Forderungen nach Symposien bzw. historischen Forschungsprojekten – die Erinnerung an Geschichte konstituierende Ereignisse ist zweifelsohne mittlerweile ein wichtiger Parameter des modernen Selbstverständnisses. Im Folgenden soll nun erörtert werden, inwiefern literarische Werke einen Teil zu diesem großräumig angelegten Erinnerungsdiskurs beitragen und ihn gegebenenfalls komplettieren können. Diese Arbeit fragt danach, wie die Geschichte – im Sinne von Historie – in den Roman gelangt, sie fragt nach Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen Geschichtsschreibung und literarischer Fiktion und sie fragt nach dem Beitrag, den Literatur hinsichtlich der Aufarbeitung von jüngster Geschichte im Zeichen einer generationsübergreifenden Erhaltung von Erinnerung zu leisten vermag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 2
(Psalm 78,6 - Text auf dem Jüdischen Mahnmal der Gedenkstätte Buchenwald)
Page 3
1. Einleitung
Im Vorwort des Sammelbands „Literatur als Erinnerung“1weist der Herausgeber Bodo Plachta auf ein hochaktuelles Phänomen hin, wenn er von einem „'Höhepunkt' unserer gegenwärtigen Erinnerungskultur“2spricht. Tatsächlich ist gerade in Deutschland der Erinnerung insbesondere an die Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts mit fortschreitender Zeit ein immer bedeutenderer kultureller Stellenwert zuteil geworden. Ob durch die Neuerrichtung und Pflege von Gedenkstätten, Museen und Archiven oder durch die vermehrten Forderungen nach Symposien bzw. historischen Forschungsprojekten - die Erinnerung an Geschichte konstituierende Ereignisse ist zweifelsohne mittlerweile ein wichtiger Parameter des modernen Selbstverständnisses. Im Folgenden soll nun erörtert werden, inwiefern literarische Werke einen Teil zu diesem großräumig angelegten Erinnerungsdiskurs beitragen und ihn gegebenenfalls komplettieren können. Diese Arbeit fragt danach, wie die Geschichte - im Sinne von Historie - in den Roman gelangt, sie fragt nach Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen Geschichtsschreibung und literarischer Fiktion und sie fragt nach dem Beitrag, den Literatur hinsichtlich der Aufarbeitung von jüngster Geschichte im Zeichen einer generationsübergreifenden Erhaltung von Erinnerung zu leisten vermag. Die hier vorgenommene Beschäftigung mit Literatur, Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur orientiert sich einerseits an der interdisziplinären Ausrichtung der Komparatistik, indem Berührungspunkte zwischen Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft und Kulturwissenschaft beleuchtet werden. Der erste Teil der Arbeit widmet sich daher den theoretischen Gegebenheiten, die bei der Untersuchung dieser Einflussbereiche wirksam werden. Andererseits soll hier auch das vergleichende Moment der Komparatistik zur Anwendung kommen, weswegen die theoretischen Überlegungen zum Thema Literatur, Geschichte und Erinnerung im zweiten Teil anhand eines Vergleichs von Uwe Johnsons vierbändigem RomaneposJahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl3(ersch. 1970-1983) und Einar Schleefs zweibändigem4MonumentalmonologGertrud5(ersch. 1980-1984) veranschaulicht werden sollen.
Die Kritik hat in der Vergangenheit schon mehrfach auf einen Vergleich zwischenJahrestageundGertrudangespielt6, doch bis dato ist keine differenzierte Analyse bezüglich Gemeinsamkeiten
1 Plachta, Bodo (Hg.): Literatur als Erinnerung. Winfried Woesler zum 65. Geburtstag. Tübingen: Niemeyer 2004, S. IX-XII.
2 Ebd. S. X-XI.
3 Johnson, Uwe: Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000. Verweise auf Johnsons Roman werden im Folgenden abgekürzt mit (JT, Band, Seite).
4 Ein dritter Teil ist wohl existent, jedoch nie veröffentlicht worden. Vgl. Wolfgang Behrens: Einar Schleef. Werk und Person. Berlin: Theater der Zeit 2003, S. 84.
5 Schleef, Einar: Gertrud. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983 und Einar Schleef: Gertrud. Zweiter Band. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003. Verweise auf Schleefs Roman werden im Folgendem abgekürzt mit (GT, Band, Seite).
6 Vgl. etwa: Kn., C.: Gertrud. In: Jens, Walter u.a (Hg.): Kindlers Neues Literaturlexikon Bd. 14. München: Kindler 1991, S. 960-961, hier S. 961.
Page 4
und Unterschieden erschienen. Dies mag damit zusammenhängen, dassGertrudinsgesamt von der Forschung bisher nur wenig Beachtung geschenkt worden ist. Einschlägige Schriften zu Schleefs Werk sind an einer Hand abzählbar. Dabei ist Einar Schleef (1944-2001) bei weitem kein unbeschriebenes Blatt. Er machte sich nicht nur als Autor verdient, sondern war auch - gleichsam als eine Art Universalkünstler - auf den Gebieten Theater7, bildende Kunst und Photographie äußerst produktiv.
Über Uwe Johnson (1934-1984) dagegen ist schon viel geschrieben worden; seine Popularität verdankt er in erster Linie seinem finalen RomanprojektJahrestage.Dies ist auch der Grund dafür, warum die Jahrestage in dieser Arbeit die Rolle des Referenztextes übernehmen. So wie sich die Lebensläufe beider Autoren ähneln, finden sich auch in ihren Veröffentlichungen einschlägige Gemeinsamkeiten. Ohne die Lebensumstände für die Bedeutung beider Werke zu sehr hervorheben zu wollen, muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass sowohl Schleef als auch Johnson als Bürger der DDR die künstlerische freie Entfaltung aufgrund der kompromisslosen ideologieverhafteten Kulturpolitik des Regimes versagt geblieben ist - ein Umstand, der beide in letzter Konsequenz zur Flucht trieb.
Es spiegeln sich jedoch nicht nur Teile der schmerzlich empfundenen DDR-Lebenswirklichkeit im Schaffen der beiden Schriftsteller wieder, sondern es werden immer auch Rückgriffe vollzogen, in denen deutsche Vergangenheit bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus zum Gegenstand der Reflexion gemacht wird. Aus der unmittelbaren Erfahrung der SED-Diktatur nach Hitlers Regime entsteht so die Notwendigkeit, den Katastrophenzusammenhang Geschichte in bewusster Abgrenzung zur Historiographie literarisch-kritisch aufzuarbeiten.
2. Poetisierte Geschichtsschreibung und historiographischer Roman
2.1 Geschichte(n): Literatur und Geschichtsschreibung
Vor über 2000 Jahren wurde die eindeutige erkenntnistheoretische Unterscheidung zwischen dichterischem und literarischem Diskurs nicht hinterfragt. Aristoteles weist in seinerPoetikauf einen basalen Unterschied hin, wenn er erklärt, dass
„der Geschichtsschreiber und der Dichter [...] sich nicht dadurch voneinander [unterscheiden], daß sich der eine in Versen und der andere in Prosa mitteilt - man könnte ja auch das Werk Herodots in Verse kleiden, und es wäre [...] um nichts weniger ein Geschichtswerk [...]; sie unterscheiden sich vielmehr dadurch, daß der eine das wirklich Geschehene mitteilt, der andere, was geschehen könnte“.8
7 AuchGertrudist von Schleef unter dem TitelGertrud. Ein Totenfestfür das Theater aufbereitet worden.
8 Aristoteles: Poetik. Stuttgart: Reclam 2003, S. 29.
Page 5
Mit Aufkommen der Moderne relativierte sich diese strenge Grenzziehung zwischen historiographischer Realität und literarischer Fiktion in zunehmendem Maße und es begannen sich gegenseitige Überlappungen und Beeinflussungen abzuzeichnen. So nennt denn auch Eberhard Lämmert in Bezug auf die letzten 200 Jahre das „Verhältnis von Geschichtsschreibung und Roman [...] ein[en] Wechsel von Annäherung und Abstoßung“.9War der Roman zuvor gern aufgrund seines Hangs zum Fabulieren hinter die Historiographie zurückgestellt worden, so verschafft sich mittlerweile schon vereinzelt die Ansicht Akzeptanz, dass allein der Roman imstande sei, aus überlieferten Nachrichten ein vollständiges und vor allem plastisches Panoramabild vergangener Zustände entstehen zu lassen.
Derart revolutionäre Ideen wurzeln in einem neuen methodischen Denkansatz der Geschichtsbetrachtung. Anders als bei der im Zeitalter der Aufklärung vorherrschenden generalisierenden Geschichtsbetrachtung, betonte man seit der Französischen Revolution verstärkt die Prozesshaftigkeit von Geschichte. Es wurde Wert darauf gelegt, sich von einem gegenwärtigen Standpunkt aus mit der Vergangenheit zu befassen, um sie unter sich immer anders bietenden Blickwinkeln „neu [...] sehen, [...] ordnen und [...] interpretieren“10zu können. Der Vergangenheit kommt mit ihrer Neubetrachtung als Einflusssphäre der Gegenwart damit eine vorher ungekannte Aktualität zu, denn das aufgekommene „Entwicklungsdenken erlaubt, die Wirkungen der Vergangenheit auf die Gegenwart und die der Gegenwart auf die Zukunft zu projizieren“.11
Die Neuartigkeit des Verlaufs und die Folgen der Französischen Revolution hatten schlicht nach einer innovativen Auseinandersetzung mit Geschichte verlangt. Mit dem Sprengen der engen Grenzen des generalisierend-teleologisch ausgerichteten aufklärerischen Ansatzes begann der his-torische Diskurs auch auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche Einfluss zu nehmen. So ist schon über die Zeit des 19. Jahrhunderts nachzuweisen,
„daß sich zahlreiche Bewegungen zwischen den Formen ergeben, die die Grenzen zwischen fiktionaler Literatur und Historiographie durchlässig machen, ja sie geradezu zugunsten eines Prozesses des (historischen) Erkennens [...] aufzulösen scheinen und damit ein Denken und Schreiben vorweg nehmen, wie es die (Post)Moderne kennzeichnet“.12
Es kann nun nicht behauptet werden, dass es gar keine Grenzlinien zwischen Historie und Fiktion mehr gäbe, denn - darauf macht Lützeler aufmerksam - es existiert ein unschlagbares Kriterium, das den fundamentalen Hiatus benennt: „Romanaussagen als von vornherein fiktionale sind nicht
9 Lämmert, Eberhard: „Geschichte ist ein Entwurf“: Die neue Glaubwürdigkeit des Erzählens in der Geschichtsschreibung und im Roman. In: The German Quarterly 63 (1990), S. 5-18, hier S. 5.
10 Sieweke, Gabriele: Der Romancier als Historiker. Untersuchungen zum Verhältnis von Literatur und Geschichte in der englischen Historiographie des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Lang 1994, S. 3.
11 Ebd. S. 3.
12 Ebd. S. 3.
Page 6
falsifizierbar“.13Dennoch ist die Tatsache nicht zu unterschätzen, dass sich die oben zitierten Bewegungen zu regelrechten Amalgamierungen zwischen der modernen Geschichtswissenschaft und der gleichzeitigen Romanliteratur ausgeweitet und einer Fülle von hybriden Formen zur Existenz verholfen haben.
Allein schon die Mehrdeutigkeit des Wortes Geschichte weist auf das unlösliche Ineinandergreifen der Einzelfaktoren der EreignisketteGeschehnis - erzählerische Repräsentation des Geschehnisseshin: „Geschichte bezeichnet demnach [...] sowohl dieres gestaeals auch diehistoria rerum gestarum“.14
2.2 Das Romaneske an der Geschichtsschreibung
Die Idee15, die Geschichtsschreibung auf die ihr immanenten Romancharakteristika zu untersuchen, d.h. die Überzeugung von der
„'objektive[n]' Rekonstruierbarkeit der 'Fakten' in Frage zu stellen, die narrative Ebene der Historiographie (als ein Text, der die Wirklichkeit nach seinen eigenen Gesetzen strukturiert, filtert und modifiziert) in den Vordergrund zu rücken und damit eine erkenntnistheoretische sowie gestalterische Nähe zwischen Historiker und Romancier [zu] implizieren“,16
ist schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nachweisbar. In Jean-Jacques Rousseaus pädagogischem HauptwerkÉmile, ou de l'éducation(ersch. 1762) beispielsweise heißt es über die Fakten, mit denen sich der Geschichtsschreiber auseinander zu setzen hat:
„[l]ls changent de forme dans la tête de l'historien, ils se moulent sur ses intérêts, ils prennent la teinte de ses préjugés. Qui est-ce qui sait mettre exactement le lecteur au lieu de la scène pour voir un événement tel qu'il s'est passé?“17
Die Nähe zwischen Historiker und Romancier resultiert aus ihren wichtigsten Berührungspunkten: Beide unterliegen beim Abfassen von Texten einer gewissen subjektiven Komponente, beide geben ihrem Stoff beim Niederschreiben eine Form und beide sind in der Regel bemüht um die Herstellung eines Erzählzusammenhangs. Diese Feststellung bedeutet für die Arbeit des Historikers, dass auch seine Fakten einer (unbewussten) Auswahl, Anordnung und dadurch zwangsläufig einer
13 Lützeler, Paul Michael: Fiktion in der Geschichte - Geschichte in der Fiktion. In: Borchmeyer, Dieter (Hg.): Poetik und Geschichte. Tübingen: Niemeyer 1989, S. 11-21, hier S. 16.
14 Straub, Jürgen: Geschichte erzählen, Geschichte bilden. Grundzüge einer narrativen Psychologie historischer Sinnbildung. In: Ders. (Hg.): Erzählung, Identität und historisches Bewusstsein. Die psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998, 81-169, hier S. 88.
15 Vgl. etwa Macaulay, Thomas: „History“ (1828). In: Lady Trevelyan (Ed.): The works of Lord Macaulay. Complete in eight Volumes, Vol. 5. London: Longmans, Green and Co. 1879. S. 122-161, hier S. 158.
16 Sieweke, 1994, S. 4.
17 Rousseau, Jean-Jaques: Émile, ou de l'éducation. In: Ders.: Œuvres complètes, Bd. 1. Hrsg. v. Musset-Pathay, V.D. Paris: Dupont: 1823. S. 439.
Page 7
impliziten Bewertung unterliegen. Fakt ist, dass beide unterschiedliche Mittel beim Erzählen instrumentalisieren, doch es gilt ebenso,dassbeide erzählen.
Der amerikanische Literatur- und Geschichtswissenschaftler Hayden White (geb. 1928) hat mit seinen Überlegungen zur Metaebene der Geschichtsschreibung bedeutend dazu beigetragen, das „klassische Oppositionspaar derres fictaeund derres factae“18einander anzunähern:
„Novelists might be dealing only with imaginary events whereas historians are dealing with real ones, but the process of fusing events, whether imaginary or real, into a comprehensive totality capable of serving as theobjectof representation, is a poetic process. Here the historians must utilize precisely the same tropological strategies, the same modalities of representing relationships in words, that the poet or novelist uses. [...] These fragments have to be put together to make a whole of a particular, not general, kind. And they are put together in the same ways that novelists use to put together figments of their imaginations“.19
Whites bahnbrechender Neuansatz besteht in der Behauptung, dass jede Geschichtsschreibung poetologischen Darstellungsweisen unterliegt. Er zeigt, dass eine systematische Engführung von Literatur und Historiographie da möglich wird, wo Untersuchungsmethoden der Literaturtheorie und Sprachwissenschaft auf ein historiographisches Werk angewendet werden können. Der Historiker bediene sich bei seinen Erklärungsstrategien, zu denen White auch das „emplotment“, also „the encodation of the facts [...] as components of specifickindsof plot structures“20, gerechnet haben will, verschiedener fiktionaler Darstellungsweisen, nämlich dem Romantischen, dem Komischen, dem Tragischen und dem Satirischen.21
White fordert darüber hinaus „senitivity to alternative linguistic protoclos, cast in the modes of metaphor, metonymy, synecdoche, and irony“22, da diese rhetorischen Figuren jeder gelungenen Geschichtsdarstellung zugrunde lägen.
Legt White seinen Schwerpunkt auf den formal-ästhetischen Aspekt der Rhetorizität von Geschichtsschreibung, so ist an anderer Stelle verstärkt auf ein genuin fiktionales Moment von historiographischen Texten hingewiesen worden. Jauss bringt es auf den Punkt, wenn er der modernen Historiographie abverlangt, den ihr inhärenten Fiktionalisierungsprozess anzuerkennen. Dieser sei „immer schon am Werk, weil das ereignishafteWaseines historischen Geschehens immer schon
18 Jauss, Hans Robert: Der Gebrauch der Fiktion in Formen der Anschauung und der Darstellung von Geschichte. In: Koselleck, Reinhart u.a. (Hg.): Formen der Geschichtsschreibung. München: dtv 1982, S. 415-451, hier S. 415.
19 White, Hayden: Tropics Of Discourse. Essays in cultural criticism. Baltimore u.a.: Johns Hopkins University Press21982, S. 125.
20 Ebd. S. 83.
21 Ebd. S. 70.
22 Ebd. S.129.