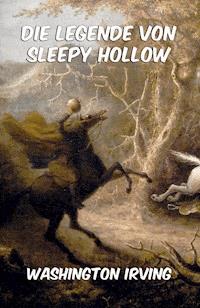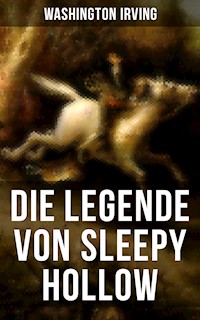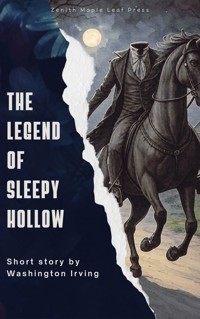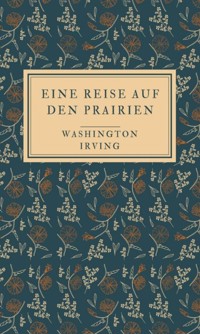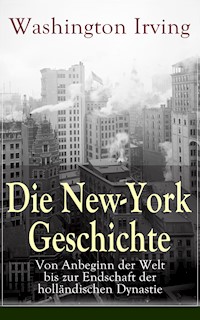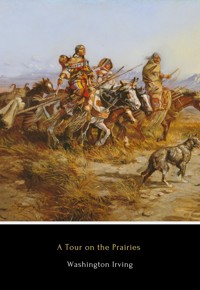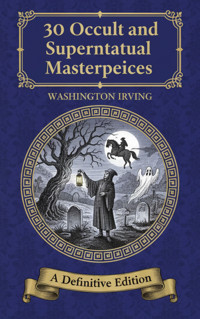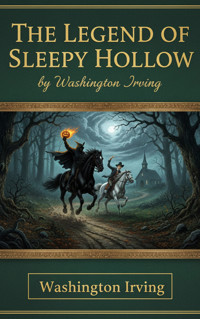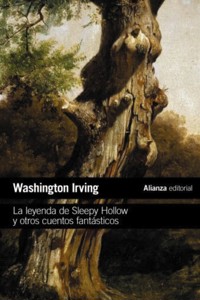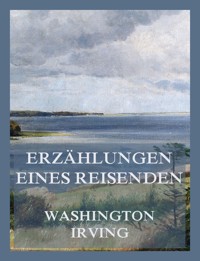
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Reisender öffnet seine Truhe voller Erinnerungen – und entführt uns in eine Welt, wo sich hinter jeder Ecke das Unheimliche verbirgt. Von verfluchten Schätzen in der italienischen Campagna über zwielichtige Gestalten im deutschen Räuberwald bis zu den dunklen Geheimnissen New Yorker Kaufleute: Washington Irving verwebt Abenteuer, Schauerromantik und satirische Gesellschaftsbeobachtung zu einem faszinierenden Mosaik. Ist der Geist im verfallenen Palazzo real oder Einbildung? Führt die Schatzsuche zu Reichtum oder Verderben? Und was geschah wirklich in jener Nacht, als das Schicksal des jungen Malers besiegelt wurde? Mit der ihm eigenen Mischung aus Humor, Melancholie und Gothic Horror lädt Irving seine Leser ein, die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen zu lassen – ganz im Geiste der Romantik, die Europa und Amerika gleichermaßen erfasst hatte. Eine Sammlung, die zeigt: Die besten Geschichten sind jene, bei denen man nie ganz sicher ist, ob man ihnen glauben darf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Erzählungen eines Reisenden
WASHINGTON IRVING
Erzählungen eines Reisenden, W. Irving
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783988682864
Quelle: archive.org
www.jazzybee-verlag.de
INHALT
Vorrede des Übersetzers.1
Vorrede des Verfassers.2
Erster Band. 5
Erste Abteilung.5
Der große Unbekannte.5
Die Jagdmahlzeit.6
Meines Oheims Abenteuer.10
Das Abenteuer meiner Base.21
Der kecke Dragoner, oder das Abenteuer meines Großvaters.25
Das Abenteuer des deutschen Studenten.33
Das Abenteuer mit dem geheimnisvollen Bild.39
Das Abenteuer mit dem geheimnisvollen Fremden.46
Geschichte des jungen Italieners.53
Zweite Abteilung. Bucktorne und seine Freunde.79
Gelehrtenleben.79
Ein gelehrtes Mittagsessen.81
Der Club der närrischen Leute.84
Der arme Teufel von Schriftsteller.89
Der praktische Philosoph.110
Bucktorne, oder der junge Mann von großen Aussichten.112
Zweiter Band. 162
Zweite Abteilung. Bucktorne und seine Freunde. (Fortsetzung.)162
Ernste Bemerkungen eines Getäuschten.162
Der alberne Squire.167
Der wandernde Schauspieldirektor.171
Dritte Abteilung. Die Italienischen Banditen.186
Das Gasthaus von Terracina.186
Das Abenteuer des kleinen Altertumsforschers.197
Die verspäteten Reisenden.205
Das Abenteuer der Familie Popkins.219
Das Abenteuer des Malers.224
Die Geschichte des Banditen-Häuptlings.231
Die Geschichte des jungen Räubers.241
Das Abenteuer des Engländers.252
Vierte Abteilung. Die Schatzgräber.257
Das Höllentor.257
Kidd, der Pirat.260
Der Teufel und Tom Walker.265
Wolfert Webber, oder die goldenen Träume.278
Das Abenteuer des schwarzen Fischers.298
Vorrede des Übersetzers.
Dem Publikum ein neues Werk Washington Irvings zu übergeben, kann ihm nur einen neuen Genuss versprechen heißen. Wenn wir aber in diesem Werk den Verfasser in der ganzen Reinheit seiner Gedanken, seiner Bilder und Feiner Sprache wiederfinden, mit der er uns in Feinen früheren Schriften erschienen ist, so heißt dies wohl zugleich auf die angenehmste Weise an das erinnern, was wir ihm bereits zu danken haben. Wer den Verfasser aus manchen Abschnitten in Bracebridge-Hall verehren gelernt, und die ungemeine Zartheit bewundert hat, mit der er jedes Lebensverhältnis in Anklang bringt, wird mit Freuden ihn in den Abschnitten wiederbegrüßen, wo er auf eine so unnachahmliche Weise einem der schönsten Gefühle der menschlichen Brust, der Liebe des Kindes zu seiner Mutter, ein unvergängliches Denkmal errichtet, und die Erzählung von Bucktornes Schicksalen gewiss dem Geistreichsten und Wahrsten an die Seite setzen, das je aus der Feder des ausgezeichneten Amerikaners geflossen ist. — Die Mannigfaltigkeit des Talents, welche wir schon an ihm zu bewundern gewöhnt sind, lässt uns bald in England, bald in Italien, bald in Amerika verteilen, und Witz und Laune beleben ohne Ausnahme die Schilderungen, zu denen nur ein geistreicher Beobachter so feine Farben wählen kann.
Dem Übersetzer konnte bei seiner neuen Arbeit keine größere Ermutigung zu Teil werden, als die freundliche, ja, wenn er sagen darf, schmeichelhafte Art, mit welcher der Verfasser seine Übersetzung von Bracebridge-Hall bewillkommnete. Er hofft, bei diesem neuen Versuche seinem Urbilde, so viel dies möglich ist, ebenso nahe geblieben zu sein, als früher, und wird sich freuen, wenn das deutsche Publikum eine Arbeit mit Wohlwollen aufnimmt, die er mit Liebe und nicht ohne Sorgfalt unternommen und vollendet hat.
Vorrede des Verfassers.
An den Leser!
Werter und teurer Leser!
Bist Du je, mitten auf einer angenehmen Reise von einer verräterischen Krankheit hinterrücks überfallen, zu Boden geworfen worden und genötigt gewesen, die lästigen Minuten, wie sie vorüber gingen, in der Einsamkeit einer Wirtshausstube zu zählen? — Ist das bei Dir der Fall gewesen, so wirst Du Dich geneigt fühlen, Mitleid mit mir zu empfinden. Denke Dir mich, wie ich in meiner Reise an den Ufern des schönen Rheins hinauf unterbrochen worden, und Unpässlichkeit halber in der alten Grenzstadt Mainz liegen bleiben muss! Jede Quelle der Unterhaltung ist erschöpft; ich kenne den Ton einer jeden Uhr, die in diesem Orte schlägt, jeder Glocke die geläutet wird; ich weiß, auf die Sekunde, wann ich den ersten Schlag der Preußischen Trommel hören werde, welcher die Garnison zur Parade ruft, oder in welcher Stunde die entfernten Töne der Oesterreichischen Regimentsmusik erschallen werden. Alles dieses bin ich überdrüssig geworden, und selbst der wohlbekannte Tritt meines Arztes, wenn er langsam den Gang herauf kommt und schon das Knarren seiner Schuhe die Heilung verkündet, gewährt mir keine angenehme Unterbrechung mehr für die Einförmigkeit meines Stubenlebens.
Eine Zeitlang suchte ich den Kauf der trägen Stunden dadurch zu beflügeln, dass ich bei der artigen kleinen Tochter meines Wirts, Katharina, Deutsch lernte; allein ich fand bald, dass selbst das Deutsche nicht die Kraft besaß, einem abgestumpften Ohre zu schmeicheln, und dass das Konjugieren von „ich liebe“ keine Gewalt mehr hatte, wie rosig auch die Lippen waren, von denen es kam.
Ich versuchte zu lesen, aber mein Geist konnte sich nicht sammeln; ich blätterte Band auf Band durch, warf aber alle mit Missvergnügen weg. Nun gut, sagte ich am Ende voll Verzweiflung, wenn ich kein Buch lesen kann, so will ich eines schreiben. Es konnte keinen glücklicheren Gedanken geben: er verschaffte mir zu gleicher Zeit Beschäftigung und Unterhaltung.
In alten Zeiten hielt man das Schreiben eines Buches für ein sehr mühsames und schweres Unternehmen, so dass man die allerunbedeutendste literarische Untersuchung ein „Werk“ nannte, und die Welt mit Scheu und Ehrfurcht von den Arbeiten der Gelehrten sprach. Alles dies versteht man ist viel besser. Dank sei es den Verbesserungen, die man bei allen Arten von Manufaktur eingeführt hat, die Kunst des Büchermachens ist auch dem allergewöhnlichsten Verstande zugänglich gemacht worden. Jedermann schriftstellert. Das Zusammenschreiben eines Quartbandes ist ein bloßer Zeitvertreib für Müßiggänger; ein junger Mann von Erziehung bringt seine zwei Klein-Oktavbände während der Jagdzeit zusammen, und die junge Dame schreibt ihre Reihe von Bändchen mit eben der Leichtigkeit, wie ihre Urgroßmutter ein halbes Dutzend Stuhlsitze wirkte.
Da ich also einmal den Gedanken gefasst hatte, ein Buch zu schreiben, so kann der Leser wohl denken, dass die Ausführung mir nicht schwer ward. Ich durchsuchte meine Mappe, rief mir in Gedanken die fliegenden Materialien zurück, die Jemand natürlich auf Reisen sammelt, und habe sie hier in diesem kleinen Werk zusammengestellt.
Da ich weiß, dass wir in einem Erzählung-schreibenden und Erzählung-lesenden Zeitalter leben, und dass die Welt sich gern durch Fabeln belehren lässt, so habe ich das, was ich Andern beizubringen wünschte, in eine gewisse Anzahl von Erzählungen eingekleidet. Sie besitzen vielleicht nicht das Unterhaltende, was den Erzählungen Mancher von meinen Zeitgenossen eigen ist; allein ich tue mir etwas auf die gesunde Moral zugute, welche jede von ihnen enthält. Diese mag Anfangs nicht so deutlich hervortreten, aber der Leser wird sie gewiss am Ende herausfinden. Ich bin dafür, die Welt durch gelinde Arzneimittel, nicht durch heftig wirkende, zu heilen; ja, der Patient sollte es eigentlich nie wissen, dass er ein starkes Mittel genommen hat. Ich habe darüber viel aus Erfahrung unter den Händen meines würdigen Äskulap in Mainz gelernt.
Ich bin demnach nicht für die unverschleierten Erzählungen, welche ihre Moral auf der Oberfläche tragen, so dass sie Einem in die Augen schlägt; sie sind ganz dazu gemacht, die Leser abzuschrecken. Im Gegenteil habe ich oft die Moral meiner Erzählungen zu verstecken, und so viel als möglich durch Süßigkeiten und Gewürze zu verbergen gesucht, so dass, während der einfältige Leser mit offenem Munde einer Geister- oder Liebesgeschichte zuhört, ihm eine Pille voll gesunder Moral den Schlund hinunterfliegt, und er am Ende den Betrug gar nicht merkt.
Da das Publikum immer gern etwas Näheres über die Quellen erfahren mag, aus denen ein Schriftsteller seine Erzählungen schöpft, ohne Zweifel, um zu wissen, wie weit es sich darauf verlassen kann: so will ich hier nur bemerken, dass das Abenteuer vom Deutschen Studenten, oder vielmehr der letztere Teil desselben auf eine Anekdote gegründet ist, welche mir, als irgendwo im Französischen gedruckt, erzählt worden ist; auch habe ich seit der Zeit gehört, dass ein Englischer Schriftsteller eine sehr geistreiche Erzählung darauf gegründet hat. Ich habe indessen weder die erste noch die zweite je gedruckt erhalten können. Einige von den Umständen in dem Abenteuer mit dem geheimnisvollen Bilde und in der Geschichte des jungen Italieners, sind schwache Erinnerungen von Anekdoten, die ich schon vor einigen Jahren gehört habe; aus welcher Quelle sie aber kommen mögen, weiß ich in der Tat nicht. Das Abenteuer des jungen Malers unter den Banditen ist beinah gänzlich aus einer glaubwürdigen, handschriftlichen Erzählung entlehnt.
Was die übrigen in diesem Werk enthaltenen Erzählungen, und in der Tat alle meinigen überhaupt betrifft, so will ich nur das bemerken — dass ich ein alter Reisender bin. Ich habe etwas gelesen, mehr noch gesehen und gehört, und namentlich sehr viel geträumt. Mein Kopf ist daher voll von allen möglichen närrischen Geschichten. Auf Reisen werden diese verschiedenartigen Stoffe untereinander gerüttelt, wie die Sachen in einem schlecht: gepackten Reisekoffer, so dass, wenn ich einen Gegenstand herausnehme, ich nicht gleich bestimmen kann, ob ich davon gelesen, gehört, oder geträumt habe; und so weiß ich gewöhnlich selbst nicht, was ich von meinen Erzählungen glauben soll.
Nachdem ich nun dies Alles vorausgeschickt, so greife, werter Leser, mit gutem Appetit, und vor allen Dingen, mit guter Laune nach dem, was Dir hier vorgesetzt wird. Wenn auch die Erzählungen, die ich geliefert habe, nicht viel Nutz sind, so wird man sie wenigstens nicht zu lang finden, so dass Niemand sich an demselben Gegenstande langweilen wird. „Die Mannigfaltigkeit ist ergötzlich“ sagt der Dichter. Die Abwechselung hat immer etwas Angenehmes, selbst wenn der Übergang vom Schlimmen zum Schlimmsten stattfinden sollte, wie ich es wohl in einer Landkutsche gefunden habe, wo es oft höchst behaglich ist, seine Lage zu verändern und sich wieder an einem neuen Fleck zerstoßen zu lassen.
Hôtel de Darmstadt, früher Hôtel de Paris in Mainz, sonst Maïence genannt.
Stets der Deinige
Washington Irving.
Erster Band
Erste Abteilung.
Seltsame Geschichten von einem nervenschwachen Herrn.
Noch mehr: man fing einmal' nen Fisch
'Nen wunderbaren Fisch, der hatt' ein Schwert, ein langes,
ne Pik' am Hals, 'ne Flint' am Maul, 'ne große,
Und Kaperbrief' vom Herzog von Florenz im Rachen.
Kleanthes. Das ist 'ne niederträchtige Lüge.
Tony. Allerdings:Denkt Ihr, ich werde Euch die Wahrheit sagen?
Fletchers Frau auf einen Monat.
Der große Unbekannte.
Die folgenden Begebenheiten hörte ich von dem: selben nervenschwachen Herrn, der mir die romantische Geschichte von dem dicken Herrn erzählte, welche in Bracebridge-Hall vorkommt. Es ist sehr sonderbar, dass, ob ich gleich dort ausdrücklich gesagt, dass mir die Geschichte erzählt worden ist, und sogar den Mann beschrieben habe, der sie mir erzählt hat, man doch durchaus hat haben wollen, dass dieser Vorfall mir begegnet sei. Nun kann ich aber beteuern, dass sich nie irgendeine Begebenheit der Art mit mir zugetragen hat. Ich würde daraus weiter nichts machen, hätte nicht der Verfasser von Waverley in der Einleitung zu seinem Roman "Peveril vom Pik", zu verstehen gegeben, dass ich selbst der dicke Herr wäre.
Seit der Zeit bin ich nun mit Fragen und Briefen von Herren, und namentlich von Damen ohne Zahl, bestürmt worden, um zu erfahren, was ich von dem großen Unbekannten wüsste.
Alles dies ist nun sehr peinlich. Es ist, als ob man Jemanden zum großen Lose Glück wünschte, der eine Niete gezogen hat: denn ich bin eben so begierig, wie jeder andere, hinter das Geheimnis zu kommen, wer dieser sonderbare Mann ist, dessen Stimme die ganze Welt erfüllt, ohne dass Jemand sagen könnte, von wannen sie komme.
Auch mein Freund, der nervenschwache Herr, der ungemein scheu und zurückgezogen ist, beklagt sich darüber, dass man ihn sehr beunruhigt habe, weil es in seiner Gegend ruchbar geworden, dass er dieser Glückliche sei. Dies ist so weit gegangen, dass er in zwei oder drei Landstädten einen bedeutenden Ruf erlangt, und dass man ihn häufig aufgefordert hat, sich in gelehrten Zirkeln sehen zu lassen, und zwar nur deswegen „weil er der Herr sei, der den Verfasser von Waverley erblickt habe.“
Der arme Mann ist nun noch zehnmal nervenschwacher geworden, als vorher, seitdem er, aus so guter Quelle, erfahren hat, wer eigentlich der dicke Herr ist, und kann es sich gar nicht vergeben, dass er keinen rascheren Schritt getan habe, um ihn ordentlich zu sehen. Er hat sich die größte Mühe gegeben, sich alles das in das Gedächtnis zurückzurufen, was er von diesem stattlichen Manne gesehen hat, und deswegen seit der Zeit immer ein wachsames Auge auf alte Herren von mehr als gewöhnlichem Umfange gehabt, die er in Landkutschen hat einsteigen sehen. Alles vergebens! Das, was er von ihm erblickt hat, scheint dem ganzen Geschlecht der dicken Herren eigentümlich zu sein, und der große Unbekannte bleibt ebenso unbekannt, als er es bisher war.
Nachdem ich dies alles vorausgeschickt habe, will ich den nervenschwachen Herrn seine Geschichten beginnen lassen.
Die Jagdmahlzeit.
Ich war einst bei einer Jagdmahlzeit, die ein würdiger alter Fuchsjäger, ein Baronet, gab, der in seinem alten, mit Raben bevölkerten Familiensitze, in einer der mittleren Grafschaften, ein lustiges Junggesellenleben führte. Er war, in seinen jungen Tagen, ein eifriger Bewunderer des schönen Geschlechts gewesen; nachdem er aber viel gereist war, das Geschlecht in mehreren Ländern mit ausgezeichnetem Erfolge studiert hatte, und, wie er glaubte, in der Art und Weise der Frauen gründlich erfahren und als Meister in der Kunst zu gefallen, zurückgekehrt war, hatte er die Kränkung gehabt, von einem jungen, so eben aus der Pension gekommenen Mädchen, welches kaum die Anfangsgründe der Liebe kannte, hinter das Licht geführt zu werden.
Der Baronet war durch diese unglaubliche Niederlage ganz zernichtet, zog sich aus Verdruss von der Welt zurück, begab sich unter das Regiment seiner Haushälterin, und beschäftigte sich, von nun an, wie ein wahrer Nimrod, nur mit der Fuchsjagd. Was auch die Dichter dagegen sagen mögen, die Liebe vergeht mit dem Alter, und eine Koppel Jagdhunde kann selbst das Andenken an eine Göttin aus der Pension aus dem Herzen eines Mannes verdrängen. Der Baronet war, als ich ihn sah, ein so lustiger, behaglicher alter Junggeselle; als nur je einer den Kunden nachgeritten ist, und die Liebe, die er einst für ein Frauenzimmer empfunden, hatte sich itzo über das ganze Geschlecht verbreitet, so dass es kein hübsches Gesicht in der ganzen Gegend umher gab, das nicht seinen Anteil daran gehabt hätte.
Die Mahlzeit dauerte bis spät abends, denn da der Wirt keine Dame im Hause hatte, die uns in das Teezimmer rufen lassen konnte, so behauptete die Flasche, ohne den Einspruch ihres mächtigen Feindes, des Teekessels, ihre Junggesellen-Herrschaft. Der alte Saal, in welchem wir speisten, halte von den Ausbrüchen der kräftigen Fuchsjäger-Laune wieder, dass die alten Hirschgeweihe an den Mauern bebten. Nach und nach fing jedoch der Wein und das Wohlleben an, auf die durch die Jagd schon etwas abgespannten Körper zu wirken. Die lebendigen Geister, welche zu Anfang des Mahles aufgeflammt hatten, flimmerten noch eine Zeit lang, und gingen dann, einer nach dem andern, aus, oder gaben nur dann und wann noch einen schwachen Schein von sich. Einige der rüstigsten Sprecher, welche bei dem ersten Anlauf so wacker die Zunge gerührt, schliefen fest ein, und es hielten nur einige von den langatmigen Rednern aus, die wie kurzbeinige Jagdhunde, ohne bemerkt zu werden, im Gespräche mitlaufen und immer mit dabei sind, wenn das Wild verendet. Aber selbst diese wurden am Ende still, und man hörte beinahe nichts weiter als die Nasentöne zweier oder dreier alter Esser, die, da sie, während ihres Wachens, still gewesen waren, ist bei ihrem Schlafe die Gesellschaft dafür entschädigten.
Endlich erweckte die Nachricht, dass der Tee und Kaffee in dem Zedernzimmer aufgetragen sei, Alles aus dieser einstweiligen Betäubung. Jeder erhob sich, wunderbar gestärkt, und begann nun, während er den erfrischenden Trank aus des Baronets altmodischem, väterlichem Porzellan schlürfte, daran zu denken, sich auf den Heimweg zu machen. Hier trat aber plötzlich ein Hindernis entgegen. Während wir bei unserm Mahl gesessen, hatte ein gewaltiges Winterunwetter sich erhoben, von Schnee, Regen und Schlacken begleitet, wozu ein so schneidender. Wind kam, dass es einen bis auf die Knochen zu durchschauern drohte.
„Es ist gar nicht daran zu denken,“ sagte unser gastfreundliche Wirt, „in solchem Wetter sich hinauszumachen. Die Herren werden also, wenigstens für diese Nacht, meine Gäste bleiben, und ich werde Anstalt zu ihrem Unterkommen treffen lassen.“
Das ungestüme Wetter, welches immer stürmischer wurde, machte das gastfreundschaftliche Anerbieten unablehnbar. Die einzige Frage war, ob nicht eine so unerwartete Vermehrung der Gesellschaft in einem schon überfüllten Hause die Haushälterin in Verlegenheit setzen würde, [Put her to her trumps, wörtlich: sie auf ihre Trümpfe zurückbringen.] wie sie Alle unterbringen wolle.
„Bah!“ sagte der Wirt: „wisst Ihr nicht, dass eines Junggesellen Haus elastisch ist, und zweimal so viel Leute beherbergen kann, als eigentlich hinein gehen?“ Aus gutmütigem Eigensinn wurde also die Haushälterin zu einer Beratung vor uns alle vorgeladen. Die alte Dame erschien in ihrem Staatskleide von verschossenem Brokat, das von lauter Erregung und Bewegung rauschte, denn, unsers Wirtes Prahlerei ungeachtet, war sie doch ein wenig in Verlegenheit. Solche Sachen machen sich indessen in eines Junggesellen Hause und mit Gästen, die Junggesellen sind, sehr leicht. Die Frau vom Hause kann, ohne große Bedenklichkeiten dabei zu haben, Männer in abgelegenen Winkeln und Kammern unterbringen und die Blößen des Hauses sichtbar werden lassen. Die Haushälterin eines Junggesellen ist überdies schon an Aushilfen und unvorhergesehene Fälle gewöhnt, und so kam dann, nach vielem Hin- und Herlaufen und manchen Beratschlagungen über das rote Zimmer, und das blaue Zimmer, und das Damastzimmer, und das kleine Zimmer mit dem Erkerfenster, die Sache endlich in Ordnung.
Als alles dies geschehen war, wurden wir abermals zu der Hauptvergnügung auf dem Lande, zum Essen, entboten. Der Zwischenraum nach Tische, der unter dem Schlummern und der Erfrischung und Beratung im Zedernzimmer vergangen war, schien, nach der Ansicht des hochgeröteten Haushofmeisters, hinlänglich, um eine angemessene Esslust zum Abendessen zu erwecken. Es war daher ein leichtes Mahl aus den Überbleibseln der Mittagsmahlzeit zusammengebracht worden, welches aus einem kalten Rinderbraten, gehacktem Wildbret, einer gerösteten Truthahnkeule, oder dergleichen, und einigen wenigen andern leichten Dingen bestand, welche die Herren vom Lande zu sich zu nehmen pflegen, um fest zu schlafen und recht ordentlich zu schnarchen.
Das Schläfchen nach Tische hatte den Witz der ganzen Gesellschaft wieder belebt, und eine Menge trefflicher Einfälle über die Verlegenheit des Wirts und seiner Haushälterin wurden von einigen verheirateten Herren aus der Gesellschaft zu Tage gebracht, welche ein Recht zu haben glaubten, sich über die Haushaltung eines Junggesellen lustig zu machen. Von da aus wandte sich der Scherz auf das Unterkommen, das ein Jeder finden würde, da er so plötzlich in einem so alten Hause einquartiert werden sollte.
„Bei meiner Seele“, sagte ein irischer Dragonerhauptmann, einer von den lustigsten und lärmendsten aus der Gesellschaft: „bei meiner Seele, ich würde mich gar nicht wundern, wenn einige von den stattlich aussehenden Herrschaften, die da an den Wänden umher hangen, in dieser stürmischen Nacht umherzuwandern anfingen, oder wenn der Geist einer dieser Damen mit den langen Taillen, statt in ihr Grab auf dem Kirchhofe, in mein Bett einkehrte.“
„Glauben Sie denn an Geister?“ sagte ein magerer, zerrissen aussehender Herr, mit hervorragenden Augen, wie ein Hummer.
Schon bei Tische war mir dieser Mann aufgefallen, weil er einer jener unaufhörlichen Frager war, die einen verzehrenden, ungesunden Appetit bei der Unterhaltung verraten. Er schien nie mit einer Geschichte zufrieden, lachte nie, wenn Andere lachten, sondern bekrittelte immer noch den Scherz. Er konnte nie sich am Kern einer Nuss freuen, sondern quälte sich immer ab, um noch mehr aus der Schale herauszubringen. „Sie glauben also an Geister?" sagte der fragelustige Herr.
„Das will ich meinen,“ erwiderte der lustige Irländer. „Ich bin in der Furcht und dem Glauben daran aufgewachsen. Wir hatten einen Banshee in unserer eigenen Familie, Liebster.“ [Honey (Honig), wie im Original steht, ein allgemeines Schmeichelwort der Irländer. Übers.]
„Einen Banshee, was ist das?" — rief der Frager aus.
„Nun, der Geist einer alten Dame, welche alle unsere echten milesischen Familien umschwebt, und an ihren Fenstern erscheint, sobald jemand daraus sterben soll.“ [Milesische Familien nennen sich in Irland die, welche von den Milesiern abzustammen behaupten, die mit den alten Phöniziern lange Zeit vor C. G. nach Irland eingewandert sein sollen. Sie haben meistens ein O' oder Mac vor ihren Namen. Übers.]
„Eine angenehme Nachricht!" rief ein ältlicher Herr mit einem schlauen Blick und einer beweglichen Nase, der er eine sehr launige Krümmung geben konnte, wenn er schalkhaft sein wollte.
„Bei meiner Seele, Sie müssen wissen, dass es eine Art von Auszeichnung ist, wenn Einem ein Banshee erscheint. Das ist ein Beweis, dass man echtes Blut in seinen Adern hat. Aber wahrhaftig, da wir gerade von Geistern reden, ich glaube nicht, dass es ein Haus, oder eine Nacht gibt, die sich besser dazu passte, ein Geisterabenteuer zu erleben. Gibt es kein Zimmer bei Ihnen, Sir John, worin es spukt, und das ein Gast bekommen könnte?“
„Vielleicht", sagte der Baronet lächelnd, „kann ich Ihnen auch damit aufwarten."
„Oh, das möchte ich vor allen Dingen haben, lieber Schatz. So ein finsteres, mit Eichenholz ausgetäfeltes Zimmer, mit hässlichen, jämmerlich aussehenden Bildern, die einen grauenvoll anstarren, und von denen die Haushälterin eine Menge herrlicher Geschichten von Liebe und Mord zu erzählen weiß. Und dann eine düster brennende Lampe, einen Tisch mit einem rostigen Schwerte darauf und ein weißes Gespenst, das um Mitternacht einem die Bettvorhänge aus einander reißt. —“
„Wahrhaftig," sagte ein alter Herr an einem Ende des Tisches: Sie erinnern mich da an eine Anekdote —
„Oh! eine Geistergeschichte! eine Geistergeschichte!", scholl es rings um den Tisch; und Jeder rückte seinen Stuhl etwas näher.
Die Aufmerksamkeit der ganzen Gesellschaft war itzo auf den Sprecher gerichtet. Es war ein alter Herr, mit einem Gesichte, das zwei ganz ungleiche Hälften hatte. Auf der einen hing das Augenlied herab, wie eine ausgehängte Fensterlade. Überhaupt war diese ganze Seite seines Kopfes in einem verfallenen Zustande und gleich dem Flügel eines Hauses, der verschlossen ist und worin es umgeht. Ich bin überzeugt, die Seite war voll von Geistergeschichten.
Man verlangte allgemein die Erzählung.
„Aber,“ sagte der alte Herr: „es ist eine bloße Anekdote, und noch dazu eine sehr gewöhnliche: Sie sollen sie indessen hören, wie sie ist. Ich habe sie meinen Oheim einmal als etwas erzählen hören, das ihm selbst begegnet sei. Er war ein Mann, der manche sonderbare Abenteuer gehabt hatte. Ich habe ihn wohl noch seltsamere erzählen hören.“
„Was für eine Art von Mann war Ihr Oheim?" sagte der fragende Herr.
„Er war ein trockener, schlauer Mensch, der sehr viel gereist war und gern von seinen Abenteuern erzählte.“
„Wie alt mochte er wohl sein, als sich dies zutrug?"
„Als was sich zutrug?" rief der Herr mit der beweglichen Nase ungeduldig aus.
„Ach, Sie haben noch keiner Sache Zeit gelassen, sich zuzutragen. Lassen wir des Oheims Alter in Ruhe und hören wir sein Abenteuer."
Der fragende Herr war hiermit auf einen Augenblick zum Schweigen gebracht, und der alte Herr mit dem Gespensterkopf begann nun folgendermaßen.
Meines Oheims Abenteuer.
Vor vielen Jahren und einige Zeit vor der französischen Revolution hatte mein Oheim mehrere Monate in Paris zugebracht. Die Engländer und Franzosen lebten damals auf besserem Fuße als itzo, und sahen sich häufig in Gesellschaft. Die Engländer reisten noch, um Geld zu verzehren, und die Franzosen waren ihnen dazu immer gern behilflich; itzo aber reisen sie, um Geld zu sparen und behelfen sich ohne die Franzosen. Vielleicht gab es damals weniger und ausgesuchtere Englische Reisende, als itzo, wo das ganze Volk aufgebrochen ist und das Festland überschwemmt hat. Auf jeden Fall aber bewegten sie sich mehr und leichter in fremder Gesellschaft, und mein Oheim machte, während seines Aufenthaltes in Paris, manche sehr vertraute Bekanntschaft unter dem Französischen Adel.
Einige Zeit darauf machte er, im Winter, eine Reise in dem Teile der Normandie, welcher das Pays de Caux genannt wird. Der Abend brach so eben ein, als er die Türme eines alten Schlosses über die Bäume des, mit einer Mauer umgebenen, Parks hervorragen sah, und jeder Turm, mit seinem hohen kegelförmigen Dache, hatte das Ansehen eines Lichts mit seinem Dämpfer darauf.
Wem gehört dies Schloss, mein Freund? sagte mein Oheim zu einem magern, aber feurigen Postillion, der mit furchtbaren Kurierstiefeln und dreieckigem Hut vor ihm her trabte.
Dem Herrn Marquis von — sagte der Postillion, und fasste dabei an seinen Hut, teils aus Ehrerbietung gegen meinen Oheim, teils aus Achtung gegen den edlen Namen, den er aussprach.
Mein Oheim erinnerte sich, den Marquis in Paris ganz besonders gut gekannt zu haben, und dass dieser oft den Wunsch geäußert hatte, ihn einmal auf seinem väterlichen Schloss zu sehen. Mein Oheim war ein alter Reisender und wusste Dinge sehr gut zu benutzen. Er bedachte einige Augenblicke lang, wie angenehm es seinem Freunde, dem Marquis, sein dürfte, wenn er auf eine so freundliche Weise durch einen unvermuteten Besuch überrascht würde, und wie es ihm selbst ungleich angenehmer sein würde, in einem Schloss ein gutes Unterkommen zu finden, des Marquis wohlbekannte Küche zu genießen und von seinem trefflichen Champagner und Burgunder zu kosten, als in dem Gasthofe einer Landstadt schlecht zu wohnen und schlecht zu essen. Nach einigen Minuten knallte daher der magere Postillion mit seiner Peitsche, wie der Teufel, oder wie ein wahrer Franzose, die lange Allee hinunter, welche zum Schloss führte.
Wahrscheinlich haben Sie Alle Französische Schlösser gesehen, da itzo Jedermann in Frankreich reiset. Dies war eines der ältesten; es stand frei und allein in einer Wüste von Kiesgängen und kalten steinernen Terrassen, hatte einen kalt aussehenden förmlichen Garten, dessen Beete in Winkel und Rauten geschnitten waren, einen kalten, blätterlosen Park, der geometrisch mit geraden Alleen durchschnitten war, zwei oder drei kalt aussehende nasenlose Bildsäulen, und Springbrunnen, aus denen so viel kaltes Wasser strömte, dass Einem die Zähne hätten klappern mögen. Dies war wenigstens das Gefühl, welches mein Oheim bei seinem Besuch an einem Wintertage dabei empfand. Bei warmem Sommerwetter mochte es hier so heiß sein, dass Einem die Augen hätten ausglühen mögen.
Das Knallen der Peitsche des Postillions, das immer lauter wurde, je näher die Reisenden kamen, machte, dass ein Schwarm Tauben aus dem Taubenschlage und die Raben aus dem Dache flogen, und endlich ein Schwarm von Dienern, den Marquis an ihrer Spitze, aus dem Schloss stürzte. Er war entzückt, meinen Oheim zu sehen, denn sein Schloss hatte, wie das Haus unseres würdigen Wirts, gerade so viel Gäste, als es fassen konnte, und so küsste er meinen Oheim auf beide Backen, nach französischer Weise, und führte ihn in das Schloss.
Der Marquis machte, mit der seinem Vaterlande eigentümlichen Feinheit, den Wirt. In der Tat war er auf sein altes Familienschloss stolz, wovon ein Teil wirklich sehr alt war. Ein Turm und eine Kapelle darin waren beinahe vor Menschengedenken erbaut, das Übrige war etwas neuerer Bauart, da das Schloss während der Kriege der Ligue beinahe ganz zerstört worden war. Der Marquis verweilte bei dieser Begebenheit mit großer Selbstgenügsamkeit, und schien gewissermaßen ein Gefühl der Dankbarkeit gegen Heinrich den Vierten zu nähren, dass er seinen väterlichen Sitz der Ehre für wertgehalten habe, in den Grund geschossen zu werden. Er wusste von der Tapferkeit seiner Vorfahren gar Manches zu erzählen, und zeigte mehrere Blechkappen, Helme, Armbrüste und allerhand gewaltige Stiefeln und Wämser von Büffelleder vor, welche die Ligisten getragen hatten. Vor allen aber zeichnete sich ein doppelhändiges Schwert aus, welches er kaum aufheben konnte, das er aber vorwies, als einen Beweis, dass es Riesen in seiner Familie gegeben habe.
In der Tat war er nur ein sehr winziger Nachkomme so großer Krieger. Wenn man ihre gewaltigen Gesichter und ihre starken Glieder betrachtete, wie sie auf ihren Bildern abgemalt waren und dann den kleinen Marquis, mit seinen Spindelbeinen und seinem gelben Laternengesichte, ansah, mit einem Paar gepuderten Ohrenlocken, oder Taubenflügeln, daran, welche mit jenen davon fliegen zu wollen schienen, so konnte man sich kaum davon überzeugen, dass er von demselben Stamme sei. Sah man aber seine Augen an, die zu beiden Seiten seiner gebogenen Nase wie die eines Schröters hervorblitzten, so bemerkte man sogleich, dass er ganz den Feuergeist seiner Vorfahren geerbt hatte.
In der Tat verraucht sich der Geist eines Franzosen nie, wie auch sein Körper zusammenschrumpfen mag. Er verdichtet sich eher und wird entzündlicher, je nachdem die irdischen Teile verschwinden, und ich habe oft in einem kleinen mutigen französischen Zwerg so viel Herzhaftigkeit gefunden, dass man einen leidlichen Riesen damit hätte versehen können.
Wenn der Marquis, wie er zu tun pflegte, einen der alten Helme aufsetzte, welche in seinem Rittersaale hingen, so blitzten, obgleich sein Kopf ihn eben so wenig ausfüllte, als eine trockne Erbse ihre Schote, seine Augen aus dem Grunde der eisernen Höhle wie Karfunkel hervor, und wenn er das gewichtige zweihändige Schwert seiner Vorfahren in der Hand wog, so hätte man glauben sollen, man sähe den tapferen kleinen David vor sich, wie er Goliaths Schwert schwingt, welches wie ein Weberbaum für ihn war.
Ich bemerke indes, meine Herren, dass ich zu lange bei der Schilderung des Marquis und seines Schlosses verweile; Sie müssen mich jedoch entschuldigen; er war ein alter Freund meines Oheims, und so oft mein Oheim die Geschichte erzählte, sprach er auch gern sehr viel von seinem Wirt. — Der arme kleine Marquis! er gehörte zu dem Häuflein tapferer Hofleute, welche die Sache ihres Herrschers, mit so großer aber erfolgloser Hingebung, in dem Schloss der Tuilerien gegen den einbrechenden Pöbel an dem unglücklichen zehnten August verteidigten. Er hielt sich tapfer bis zuletzt, wie ein wackerer französischer Ritter, schwang seinen kleinen Galanteriedegen mit einem ça-ça gegen eine ganze Legion von Sansculotten, wurde aber von einer Poissarde mit einer Pike wie ein Schmetterling an die Wand gespießt, und seine heldenmütige Seele erhob sich auf seinen Taubenflügeln zum Himmel.
Alles dies hat indes nichts mit meiner Geschichte zu tun. Also zur Sache. Als die Stunde heranrückte, wo man sich zur Ruhe begeben sollte, ward mein Oheim in sein Zimmer geführt, welches in einem alten Turme befindlich war. Dies war der älteste Teil des Schlosses und in alten Zeiten das donjon oder Verließ gewesen; natürlich war also das Zimmer keines von den besten. Der Marquis hatte es ihm indessen anweisen lassen, teils, weil er wusste, dass er ein Reisender von Geschmack war und die Altertümer liebte, teils, weil die besseren Zimmer bereits besetzt waren. Auch wusste er meinen Oheim bald vollkommen mit seiner Wohnung auszusöhnen, indem er ihm die großen Leute nannte, welche sie einst inne gehabt, und welche sämmtlich, auf eine oder die andere Weise, in Verbindung mit der Familie gestanden hatten. Seiner Aussage nach war Johann Baliol, oder, wie er ihn nannte, Jean de Baileul, in diesem selben Zimmer vor Kummer gestorben, als er die Nachricht von dem Siege seines Nebenbuhlers, Robert Bruce, in der Schlacht von Bannockburn; erhalten.
[Sowohl Baliol als Bruce waren aus vornehmen schottischen Familien, und machten nach dem Tode der Margarethe, Tochter Alexander III. Königs von Schottland, Anspruch auf die schottische Krone (1291). Eduard I. König von England, der zum Schiedsrichter in dieser Angelegenheit aufgerufen wurde, erklärte sich für Baliol, nahm aber späterhin Schottland selbst in Besitz, ließ Baliol einkerkern und gab ihm erst nach einer zweijährigen Gefangenschaft seine Freiheit wieder, worauf dieser sich nach Frankreich zurück zog und dort starb. — Der Sieger bei Bannockburn über Eduard II. (25. Jun. 1314) war der jüngere Bruce, Sohn des Nebenbuhlers Baliols. Übers. ]
Und als er hinzufügte, dass der Herzog von Guise darin geschlafen habe, so hätte sich mein Oheim beinahe Glück gewünscht, dass ihm die Ehre widerführe, eine so vornehme Wohnung zu erhalten.
Die Nacht war scharf und windig, und das Zimmer nichts weniger als warm. Ein alter Bedienter mit langem Leib und langem Gesicht in steifer auffallender Livree, welcher meinen Oheim bediente, warf einen Armvoll Holz neben den Kamin hin, einen sonderbaren Blick im Zimmer umher, und wünschte ihm dann angenehme Ruhe, mit einem Gesicht und einem Achselzucken, das bei jedem Anderen, als bei einem alten französischen Bedienten, höchst verdächtig ausgesehen haben würde.
Das Zimmer hatte allerdings ein wildes, verfallenes Ansehen, das Jeden, der Romane gelesen hatte, mit Furcht und Ahnung erfüllen musste. Die Fenster waren hoch und schmal, und waren einst Schießscharten gewesen; man hatte sie indes, so viel es die ungeheure Dicke der Dauern hatte erlauben wollen, ganz roh erweitert, und die schlecht passenden Fensterflügel klapperten bei jedem Windstoß. In einer windigen Nacht würde man geglaubt haben, einen der alten Ligisten in seinen gewaltigen Stiefeln und klirrenden Sporn im Zimmer umherstampfen und rasseln zu hören. Eine Tür, welche nicht schloss, und, wie eine wahre französische Tür, aller Vernunft und allen Anstrengungen zum Trotze, nicht schließen wollte, ging auf einen langen dunkeln Gang hinaus, der Gott weiß wohin führte, und eben dazu gemacht zu sein schien, dass Geister, wenn sie um Mitternacht aus ihren Gräbern kämen, sich darin eine Bewegung machen könnten. Der Wind pflegte in diesem Gange ein dumpfes Gesause und die Tür hin und her knarren zu machen, als bedenke sich irgendein Geist, ob er hereintreten solle oder nicht. Mit einem Worte, das Zimmer war gerade von der unheimlichen Art, dass ein Geist, wenn es deren im Schloss gab, es sich zu seinem Lieblings-Erholungsplatz wählen musste.
Mein Oheim, ein Mann, der sonst wohl an sonderbare Abenteuer gewohnt war, ahnte damals keines. Er machte mehrere Versuche, die Tür zuzudrücken, aber vergebens. Nicht, dass er irgendetwas gefürchtet hätte, denn er war ein zu alter Reisender, als dass ihm ein schauerlich aussehendes Zimmer hätte einen Schrecken einjagen sollen, aber die Nacht war, wie ich gesagt habe, kalt und windig, der Sturm heulte um den alten Turm beinahe ebenso, wie in diesem Augenblicke um dies alte Haus, und der Zug aus dem langen, finstern Gange blies so feucht und kalt herein, als ob er aus einem Gefängnis käme. Da mein Oheim also die Tür nicht zumachen konnte, so warf er eine Menge Holz in den Kamin, dass bald eine große Flamme aufloderte, die das ganze Zimmer erhellte und den Schatten der Feuerzange auf der Wand gegenüber wie einen langbeinigen Riesen erscheinen ließ. Mein Oheim erklomm nun den Gipfel eines halben Dutzends von Matratzen, die gewöhnlich ein französisches Bett bilden, und welche in einer tiefen Nische aufgetürmt waren, wickelte sich fest ein, begrub sich bis an das Kinn in die Betttücher, und lag nun so da, sah nach dem Feuer, dachte daran, wie er von seinem Freunde, dem Marquis, so listig ein Nachtquartier erhalten — und schlief endlich ein.
Er mochte noch nicht die Hälfte seines ersten Schlafes genossen haben, als er durch die Schlossuhr erweckt wurde, die in dem Turme über seinem Zimmer befindlich war, und zwölf schlug. Dies war gerade so eine alte Uhr, wie sie Geister gernhaben. Sie hatte einen tiefen, schauerlichen Ton und schlug so langsam und langweilig, dass mein Oheim glaubte, sie würde nie aufhören. Er zählte und zählte, bis er überzeugt war, er habe Dreizehn gezählt; dann hielt sie inne.
Das Feuer war herabgebrannt und das Holz beinahe ausgeglimmt; es gab nur noch eine schwache blaue Flamme von sich, die zuweilen in kleine weiße Spitzen aufloderte. Mein Oheim lag mit halbgeschlossenen Augen da, die Nachtmütze beinahe bis auf die Nase gezogen. Seine Einbildungskraft war bereits auf Abwegen, und begann den gegenwärtigen Schauplatz mit dem Krater des Vesuv, der Französischen Oper, dem Coliseum in Rom, Dollys Garküche in London [S. Quentin Durward, Th. I. S. 8. d. Einl. Übers.] und all' dem Gewirr von bekannten Orten, womit der Kopf eines Reisenden angefüllt ist, zu vermischen; — kurz, er war im Begriff, einzuschlafen.
Plötzlich ward er durch den Schall von Fußtritten erweckt, welche langsam auf dem Gange herzukommen schienen. Mein Oheim war, wie ich ihn oft habe von sich sagen hören, kein Mann, der sich so leicht schrecken ließ. Er lag also still, und glaubte, es sei irgendein anderer Gast oder ein Bedienter, der zu Bett ginge. Die Fußtritte kamen indes näher, die Tür öffnete sich langsam, ob von selbst, oder ob von außen geöffnet, konnte mein Oheim nicht unterscheiden; und eine weiße weibliche Gestalt schwebte herein. Sie ging nach dem Kamin hin, ohne meinen Oheim anzusehen, der seine Nachtmütze mit der einen Hand in die Höhe rückte, und sie starr anblickte. Sie blieb eine Zeitlang vor dem Feuer stehen, das von Zeit zu Zeit aufloderte und blaue und weiße Flammen von sich gab, so dass mein Oheim die Gestalt ganz genau sehen konnte.
Ihr Gesicht war geisterbleich, und wurde es vielleicht noch mehr durch das bläuliche Licht des Feuers. Es war schön, aber die Schönheit trug das Gepräge der Sorge und Bekümmernis. Es war der Blick Jemandes, der an Unglück gewohnt ist, den aber das Unglück nicht niederzuschlagen oder zu überwältigen vermag: denn es lag noch das Gebietende stolzer, unbesiegbarer Entschlossenheit darin. Dies war wenigstens die Meinung meines Oheims, und er hielt sich für einen großen Physiognomen.
Die Gestalt blieb, wie ich gesagt habe, eine Zeitlang vor dem Feuer stehen, streckte dann eine Hand, sodann die andere aus, dann auch die Füße nacheinander, als ob sie sich wärme: denn Gespenster, — und dieses war doch wohl wirklich eines — frieren gewöhnlich. Mein Oheim bemerkte weiter, dass sie Schuhe mit hohen Absätzen, nach alter Mode, nebst Schnallen mit unechten oder echten Steinen trug, die blitzten, als ob sie wirklich vorhanden wären. Endlich wandte sich die Gestalt langsam, warf einen hohlen Blick in das Zimmer, der, als er über meinen Oheim wegstreifte, alles Blut in seinen Adern stocken und das Mark in seinen Gebeinen erstarren machte. Hierauf streckte sie die Arme zum Himmel empor, faltete die Hände, rang sie auf eine flehende Weise und glitt dann langsam zum Zimmer hinaus.
Mein Oheim blieb eine Zeitlang in Betrachtungen über diesen Besuch liegen, denn obgleich er (wie er bemerkte, als er mir die Geschichte erzählte) ein Mann von sehr festem Charakter war, so liebte er doch auch über eine solche Sache nachzudenken und verwarf sie nicht sogleich, weil sie außerhalb der gewöhnlichen Sphäre der Ereignisse lag. Da er indessen, wie ich vorher erwähnt habe, ein erfahrener Reisender und an seltsame Begebenheiten gewöhnt war, so rückte er seine Nachtmütze ruhig über die Augen, legte sich mit dem Rücken nach der Tür, zog sich die Betttücher bis über die Schultern, und schlief wieder ein.
Wie lange er geschlafen haben mochte, konnte er nicht sagen, als er durch die Stimme Jemandes, der neben seinem Bette stand, geweckt wurde. Er drehte sich um, und sah den alten französischen Bedienten, mit seinen Ohrlocken in festen Wickeln zu beiden Seiten seines langen Laternengesichts, auf welchem die Gewohnheit ein ewiges Lächeln hervorgebracht hatte. Er schnitt tausend Gesichter, bat tausendmal Monsieur um Verzeihung, dass er ihn gestört habe, sagte aber, es sei schon ziemlich hoch am Morgen. Während mein Oheim sich ankleidete, rief er sich den Besuch der vergangenen Nacht oberflächlich in das Gedächtnis zurück. Er fragte den alten Bedienten, was für eine Dame in diesem Teil des Schlosses des Nachts umherzuwandeln pflege. Der alte Diener zuckte die Schultern bis an den Kopf, legte eine Hand auf die Brust, spreizte die andere aus, machte ein höchst komisches Gesicht, was ein Kompliment andeuten sollte, und sagte:
„Es gehöre sich nicht für ihn, etwas von den bonnes fortunes von Monsieur wissen zu wollen.“
Mein Oheim sah wohl, dass hier nichts Genügendes zu erfahren war. — Nach dem Frühstück ging er mit dem Marquis in den modernen Zimmern des Schlosses spazieren und glitt über die wohlgebohnerten Fußboden der mit Seide tapezierten Säle hin, zwischen reich vergoldeten und mit Brokat bezogenen Möbeln hindurch, bis sie an eine lange Bildergalerie kamen, welche mehrere Bildnisse, teils in Ölfarben, teils in Kreide ausgeführt, enthielt.
Hier eröffnete sich ein weites Feld für die Beredsamkeit seines Wirts, der ganz den Stolz eines Edelmanns vom ancien régime hatte. Es gab keinen großen Namen in der Normandie, ja kaum in Frankreich, der sich nicht, auf irgendeine Weise, mit seinem Hause in Beziehung befand. Mein Oheim stand da und hörte mit innerer Ungeduld zu, ruhte bald auf einem Beine, bald auf dem andern, während der kleine Marquis, mit seinem gewöhnlichen Feuer und vieler Lebendigkeit, sich über die Taten seiner Vorfahren verbreitete, deren Bildnisse an den Wänden hingen, — von den Kriegstaten der ernsten, stahlgepanzerten Krieger, bis auf die Galanterien und Intrigen der blauäugigen Herren herab, mit niedlichen lächelnden Gesichtern, gepudertem Haar, Spitzenmanschetten und roten und blauen seidenen Röcken und Beinkleidern; wobei er die Eroberungen der lieblichen Schäferinnen nicht vergaß, die, mit Reifröcken, und mit Taillen die nicht stärker als eine Sanduhr waren, ihre Schafe und ihre Anbeter mit ihren zierlichen, mit fliegenden Bändern geschmückten Schäferstäben zu weiden schienen.
Mitten in dem Gespräch seines Freundes ward meines Oheims Aufmerksamkeit durch ein Bildnis in ganzer Figur erregt, welches ihm das wahre Konterfei seines Besuches von voriger Nacht zu sein schien.
„Mich dünkt,“ sagte er, indem er darauf zeigte, „ich habe das Original dieses Bildnisses gesehen.“
„Pardonnez-moi", erwiderte der Marquis höflich, „das ist wohl kaum möglich, da diese Dame schon seit mehr als hundert Jahren tot ist. Es war die schöne Herzogin von Longueville, welche während der Minderjährigkeit Ludwigs des Vierzehnten eine Rolle spielte." [Anna Genovefa von Bourbon, Herzogin von Longueville, und ältere Schwester des Prinzen von Condé. Genauere Nachrichten über sie finden sich in (Maily) Esprit de la Fronde, Vol. II. p. 71. Übers.]
„Und haben ihre Schicksale irgendetwas Merkwürdiges?“
Es konnte nicht leicht eine unglücklichere Frage geben. Der kleine Marquis nahm sogleich die Stellung eines Mannes an, der im Begriff ist, eine lange Geschichte zu erzählen. Mein Oheim hatte sich nämlich die ganze Beschreibung des bürgerlichen Krieges der Fronde auf den Hals gezogen, worin die schöne Herzogin eine so ausgezeichnete Rolle gespielt hatte. Turenne, Coligny und Mazarin mussten aus ihren Gräbern hervorkommen, um seiner Erzählung Schmuck zu verleihen, und selbst die Händel der Barrikaden und die Heldentaten der Torwege wurden nicht übergangen. [Der Sperrketten, welche die Bewohner von Paris damals in den Straßen zogen, um sich der Königin Anna von Oesterreich, der Vormünderin Ludwigs XIV. und ihren Anhängern zu widersetzen. Übers.]
Mein Oheim fing an, sich tausend Meilen von dem kleinen Marquis mit seinem unbarmherzigen Gedächtnis wegzuwünschen, als plötzlich die Erinnerungen des kleinen Mannes eine anziehendere Wendung nahmen. Er erzählte nämlich die Gefangenhaltung des Herzogs von Longueville, nebst den Prinzen von Condé und Conti im Schloss von Vincennes, und von den vergeblichen Versuchen der Herzogin, die wackeren Nordmänner zu ihrer Befreiung aufzuregen. Er war itzo an den Teil der Geschichte gekommen, wo die Herzogin von den königlichen Truppen in das Schloss von Dieppe eingeschlossen wurde.
„Der Mut der Herzogin,“ sagte der Marquis, „wuchs mit ihrem Unglück. Es war bewunderungswürdig, ein so zartes und schönes Wesen so entschlossen mit dem Missgeschick kämpfen zu sehen. Sie beschloss, alles anzuwenden, um ihre Flucht zu bewerkstelligen. Wahrscheinlich haben Sie das Schloss gesehen, worin sie eingesperrt war: es ist ein altes verfallenes Gebäude, das auf der Spitze eines Hügels oberhalb der rostigen kleinen Stadt Dieppe liegt. [Im Originalesteht an old ragged wart of an edifice, wahrscheinlich, weil es sich auf dem Hügel wie ein Auswuchs oder eine Warze ausnahm. Übers.]
In einer finsteren stürmischen Nacht schlich sie heimlich aus einem kleinen Pförtchen des Kastels, welches der Feind zu besetzen vergessen hatte. Dies Pförtchen ist noch heutigen Tages zu sehen und geht auf eine schmale Brücke hinaus, welche über einen tiefen Graben führt, der zwischen dem Schloss und dem Abhange des Hügels durchgeht. Ihre Dienerinnen, einige wenige männliche Bediente und einige tapfere Ritter, welche ihrer Sache treu geblieben waren, folgten ihr. Ihre Absicht war, den etwa zwei Meilen entfernten Hafen zu erreichen, wohin sie insgeheim ein Schiff hatte kommen lassen, um, im Notfall, darauf entfliehen zu können.
„Die kleine Schar der Flüchtlinge war genötigt, den Weg zu Fuß zurückzulegen. Als sie im Hafen anlangte, war der Wind heftig und stürmisch, die Flut ungünstig, das Schiff lag weit entfernt auf der Höhe der Reede, und es gab kein anderes Mittel, um an Bord zu kommen, als sich eines Fischerbootes zu bedienen, das wie eine Muschelschale von der Brandung hin und her geworfen wurde. Die Herzogin entschloss sich, das Wagestück zu bestehen. Die Seeleute suchten sie von ihrem Vorhaben abzubringen, allein das Dringende der Gefahr am Ufer und ihre Geistesgröße machten, dass sie auf die Vorstellungen derselben nicht achtete. Ein Seemann musste sie in seinen Armen in das Boot tragen. Die Gewalt des Windes und der Wogen war indes so groß, dass er schwankte, das Gleichgewicht verlor und seine kostbare Bürde in das Meer fallen ließ. [Esprit de la Fronde, Vol. III. pag. 360. 361. Übers.]
„Die Herzogin wäre beinahe ertrunken, allein ihre eigenen Anstrengungen und die Bemühungen der Seeleute machten, dass sie glücklich wieder an das Land kam. Sobald sie sich etwas erholt hatte, bestand sie darauf, den Versuch zu wiederholen. Der Sturm war jedoch unterdessen so heftig geworden, dass er allen Bemühungen Trotz bot. Länger zu zögern, musste unausbleiblich Entdeckung und Gefangenschaft nach sich ziehen. Es blieb weiter nichts übrig, als Pferde zu nehmen. Sie setzte sich, mit ihren Begleiterinnen, hinter den tapferen Rittern, die sie geleiteten, auf, und ritt nun landeinwärts, um einen einstweiligen Zufluchtsort zu suchen.
„Während die Herzogin,“ fuhr der Marquis fort, indem er den Zeigefinger auf meines Oheims Brust legte, um dessen abnehmende Aufmerksamkeit wieder zu beleben, — „während die arme Herzogin so im Sturm umherirrte, langte sie bei diesem Schloss an. Ihre Ankunft verursachte einige Unruhe, denn das Getrappel eines Trupps von Pferden mitten in der Nacht, der Gang zu einem einsamen Schloss hinauf, war, in diesen bewegten Zeiten und in einem so unruhigen Teil des Landes, hinlänglich, Besorgnisse zu erregen.
„Ein großer breitschulteriger Jäger, bis zu den Zähnen bewaffnet, sprengte voraus und meldete die Besucherin an. Alle Besorgnis war itzo verschwunden. Das Hausgesinde kam heraus, mit Fackeln, sie zu empfangen, und nie beleuchteten diese einen mehr vom Wetter und der Reise mitgenommenen Haufen als den, der itzo auf den Hof trabte. Die arme Herzogin und ihre Begleiterinnen, jede hinter ihrem Ritter, erschienen mit bleichen, abgehärmten Gesichtern und beschmutzten Kleidern: und die halb durchnässten, halb schläfrigen Pagen und Diener schienen jeden Augenblick vor Schlaf und Ermattung von ihren Pferden sinken zu wollen.
„Mein Ahnherr empfing die Herzogin mit großer Herzlichkeit. Sie ward in den großen Saal des Schlosses geführt, und bald prasselte und glühte das Feuer, sie und ihr Gefolge zu erwärmen, und jeder Bratspieß und jede Pfanne ward in Bewegung gesetzt, um Erquickungen für die Wanderer zu bereiten.
„Sie hatte ein Recht auf unsere Gastfreundschaft,“ fuhr der Marquis fort, indem er sich etwas mehr in die Höhe richtete, „denn sie war mit unserer Familie verwandt. Ich will Ihnen erzählen, wie das zusammenhing. Ihr Vater, Heinrich von Bourbon, Prinz von Condé —“
Brachte denn die Herzogin die Nacht in dem Schloss zu? — fragte mein Oheim querfeldein, da der Gedanke ihn erschreckte, in eine der genealogischen Erörterungen des Marquis hineinzugeraten.
„Oh, die Herzogin — die bekam gerade das Zimmer, das Sie vergangene Nacht innegehabt haben, und das damals eine Art von Staatsgemach war. Ihren Begleitern wurden die Zimmer zugeteilt, welche auf den anstoßenden Gang hinausgehen, und ihr Lieblingspage schlief in einem anstoßenden Cabinet. Der große Jäger, welcher ihre Ankunft angekündigt hatte, und der die Stelle einer Art von Schildwacht oder Leibwache vertrat, ging in dem Gange auf und nieder. Er war ein schwärzlicher, ernster Mensch von gewaltigem Ansehen, und wenn das Licht der Lampe im Gange auf die scharfen Züge seines Gesichts und seinen muskelhaften Bau fiel, so glaubte man Jemanden vor sich zu sehen, der das Schloss durch die alleinige Kraft seines Armes verteidigen könne.
„Es war eine raue, ungestüme Nacht, ungefähr um diese Zeit des Jahres — Apropos! da ich eben daran denke, vergangene Nacht war der Jahrestag des Besuchs der Herzogin. Ich kann das Datum nicht aus dem Gedächtnis verlieren, denn das war eine Nacht, deren unser Haus nicht so leicht vergessen kann. Es geht eine sonderbare Sage darüber in unserer Familie.“ Hier hielt der Marquis inne, und eine Wolke schien seine buschigen Augenbraunen zu überschatten. „Es geht eine Sage — dass sich ein sonderbarer Vorfall in jener Nacht zugetragen habe, — ein sonderbarer, geheimnisvoller, unerklärlicher Vorfall.“ —Hier besann er sich auf einmal und hielt inne.
Stand er mit jener Dame in Beziehung? fragte mein Oheim begierig.
„Mitternacht war vorbei“, fing der Marquis wieder an, — „als das ganze Schloss —“ hier hielt er abermals inne. Mein Oheim machte eine Bewegung, die seine gespannte Neugier verriet.
„Entschuldigen Sie,“ sagte der Marquis, indem eine leichte Röthe über sein bleiches Gesicht flog. „Es gibt einige Umstände, welche mit der Geschichte unserer Familie in Verbindung stehen und die ich nicht gern erzähle. Es war damals eine rohe Zeit. Es war eine Zeit, wo große Verbrechen unter großen Leuten begangen wurden, denn Sie wissen, dass vornehmes Blut, wenn es einmal nicht den rechten Weg nimmt, nicht wie das Blut der Canaille, ruhig dahin fließt — die arme Dame! — Doch, ich habe etwas Familienstolz, der — Sie entschuldigen mich, — wir wollen lieber von etwas anderem sprechen, wenn Ihnen gefällig ist.“
Meines Oheims ganze Neugier war itzo erregt. Die pomphafte und prachtvolle Einleitung hatte ihn verleitet, etwas Wunderbares in der Geschichte zu erwarten, wozu jene als eine Art von Eingang diente. Er hatte durchaus keinen Begriff davon, dass er ihrer, durch eine plötzliche Anwandlung törichter Bedenklichkeit, ganz verlustig gehen sollte. Außerdem hielt er es, als ein Reisender, der sich gern unterrichten wollte, für seine Pflicht, sich nach Allem zu erkundigen.
Der Marquis wich indessen allen Fragen aus. „Nun,“ sagte mein Oheim etwas unwillig: „Sie mögen davon denken, was Sie wollen — ich habe die Dame vergangene Nacht gesehen.“
Der Marquis trat zurück, und sah ihn mit Erstaunen an.
„Sie hat mich in meinem Schlafzimmer besucht.“
Der Marquis nahm mit einem Achselzucken und einem Lächeln seine Schnupftabaksdose zur Hand, und hielt dies wahrscheinlich für einen sehr plumpen englischen Spaß, den er, höflichkeitshalber, sehr angenehm finden musste.
Mein Oheim fuhr indessen sehr ernsthaft fort und erzählte den ganzen Vorfall. Der Marquis hörte ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zu, und hielt dabei seine Schnupftabaksdose ungeöffnet in der Hand. Als die Geschichte zu Ende war, schlug er bedächtig auf den Deckel seiner Dose, nahm eine lange, tönende Prise Tabak —
„Bah!“ sagte der Marquis, und ging nach dem andern Ende der Galerie.
Hier hielt der Erzähler inne. Die Gesellschaft wartete eine Zeitlang, dass er die Erzählung wieder anfangen würde, aber er schwieg.
Nun, sagte der fragende Herr: was sagte Ihr Oheim darauf?
„Nichts,“ erwiderte der andere.
Und was sagte der Marquis ferner?
„Nichts.“
Und ist das alles?
„Das ist alles,“ sagte der Erzähler, indem er sich ein Glas Wein einschenkte.
Ich vermute, sagte der schlaue alte Herr mit der neckischen Nase: ich vermute, der Geist ist niemand anders, als die alte Haushälterin gewesen, die im Hause die Runde machte, um zu sehen, ob Alles in Ordnung sei.
„Bah!“ sagte der Erzähler: „mein Oheim war viel zu sehr an sonderbare Erscheinungen gewöhnt, um nicht einen Geist — von einer Haushälterin unterscheiden zu können!“
Rund um den Tisch lief ist ein Gemurmel, teils aus Scherz, teils aus Unwillen über die getäuschte Erwartung. Ich konnte nicht umhin, zu glauben, dass der alte Herr noch einen zweiten Teil der Geschichte im Rückhalte habe, aber — er schlürfte seinen Wein und sagte nichts weiter, und es lag ein sonderbarer Ausdruck in seinem verfallenen Gesicht, der mich zweifelhaft ließ, ob das Ganze Scherz oder Ernst gewesen sei.
„Hm! sagte der schlaue Herr mit der beweglichen Nase: „die Geschichte von Ihrem Oheim erinnert mich an eine ähnliche, welche eine meiner Basen, von mütterlicher Seite, zu erzählen pflegte, wiewohl ich nicht weiß, ob sie die Vergleichung aushalten wird, da der guten Dame nicht so leicht sonderbare Sachen begegneten. Auf jeden Fall will ich sie aber erzählen.“
Das Abenteuer meiner Base.
Meine Base war eine Frau von starkem Körperbau, kräftigem Geist und großer Entschlossenheit; sie war, was man eine sehr männliche Frau nennen würde. Mein Oheim war ein magerer, schwächlicher, kleiner Mann, sehr sanft und nachgiebig, und keineswegs meiner Base gewachsen.
Man sah, dass er vom Tage seiner Verheiratung an allmählig zu vergehen anfing. Seiner Frau gewaltiger Geist war zu mächtig für ihn: er verzehrte ihn. Meine Base trug indessen alle mögliche Sorgfalt für ihn, die Ärzte aus der halben Stadt mussten ihm verordnen, sie ließ ihn alle ihre Rezepte einnehmen, und gab ihm so viele Arznei ein, dass ein halbes Spital damit hätte geheilt werden können. Alles war indes vergebens. Mein Oheim wurde immer kränker, je mehr ihm eingegeben und je mehr er gepflegt wurde, bis er am Ende die lange Reihe der ehelichen Opfer vermehrte, welche aus lauter Liebe umgekommen sind.
„Und sein Geist erschien ihr?“ fragte der neu: gierige Herr, der den vorigen Erzähler so ausgefragt hatte.
Das werden Sie gleich hören, antwortete der Erzähler. Meine Base nahm sich den Tod ihres guten, armen Mannes sehr zu Herzen. Vielleicht fühlte sie einige Gewissensbisse, ihm so viele Arznei gegeben und ihn so lange gepflegt zu haben, bis er daran starb. Genug, sie tat alles, was eine Witwe nur tun kann, sein Andenken zu ehren. Sie sparte keine Kosten, sowohl in Hinsicht der Beschaffenheit, als der Menge ihrer Trauergewänder; sie trug ein Miniaturbild von ihm, so groß wie eine kleine Sonnenuhr, und sein Bild in ganzer Figur hing in ihrem Schlafzimmer. Jedermann erhob ihr Benehmen bis in den Himmel, und man kam darin überein, dass eine Frau, die das Andenken ihres ersten Gatten so ehre, wert sei, bald einen zweiten zu bekommen.
Nicht lange darauf entschloss sie sich, ihren Wohnsitz auf einem alten Landhause in Derbyshire aufzuschlagen, das seit langer Zeit nur unter der Aufsicht eines Haushofmeisters und einer Haushälterin gestanden hatte. Sie nahm den größeren Teil ihrer Dienerschaft mit sich, da sie beschlossen hatte, den Ort zu ihrem Hauptwohnsitz zu machen. Das Haus lag in einem einsamen, wilden Teil des Landes, zwischen den grauen Hügeln von Derbyshire und hatte eine Aussicht auf einen hingerichteten Mörder, der auf einer wüsten Anhöhe in Ketten hing.
Die Dienerschaft aus der Stadt war vor Schrecken außer sich, bei dem Gedanken, an so einem fürchterlichen, heidnischen Orte wohnen zu müssen, besonders, als sie am Abend in der Bedientenstube zusammenkamen, und nun die Gespenstergeschichten erzählt wurden, die ein Jeder des Tages über gehört hatte. Sie fürchteten sich, allein durch die finstern, schwarzaussehenden Zimmer zu gehen. Die Kammerjungfer, die an den Nerven litt, erklärte, dass sie nie in einem „grässlichen, umgehenden alten Gebäude“ allein schlafen könne, und der Bediente, ein gutherziger junger Mensch, bot alles Mögliche auf, sie zu erheitern.
Meine Base selbst schien von dem einsamen Ansehen des Hauses überrascht zu sein. Ehe sie zu Bett ging, untersuchte sie demnach alle Türen und Fenster, ob sie auch fest verschlossen wären, schloss das Silber mit eignen Händen ein, und trug die Schlüssel, so wie ein kleines Kästchen mit Gelde und Juwelen, in ihr eignes Zimmer: denn sie war eine achtsame Frau, und liebte nach allen Dingen selbst zu sehen. Nachdem sie die Schlüssel unter ihr Kopfkissen gelegt und ihre Kammerjungfer entlassen hatte, regte sie sich noch an ihre Toilette und ordnete ihr Haar, denn da sie, ungeachtet ihres Grams um meinen Oheim, noch eine stattliche Witwe war, so war sie etwas eigen in ihrem Äußern. — So saß sie einige Zeit und betrachtete sich im Spiegel, erst von der einen Seite, dann von der andern, wie Frauen zu tun pflegen, wenn sie sehen wollen, ob sie sich gut ausgenommen haben: denn ein stattlicher Squire aus der Nachbarschaft, der ihr den Hof gemacht hatte, als sie noch Mädchen war, hatte ihr heute die Aufwartung gemacht, um sie auf dem Lande willkommen zu heißen.
Plötzlich glaubte sie, etwas hinter ihr sich bewegen zu hören. Sie sah sich schnell um, erblickte aber nichts. Nichts war zu sehen, als das Bild ihres lieben seligen Mannes in Lebensgröße, das an der Wand hing.
Sie weihte seinem Andenken einen tiefen Seufzer, wie sie immer zu tun gewohnt war, wenn sie in Gesellschaft von ihm sprach, und fuhr dann fort, ihre Nachtkleider in Ordnung zu bringen und an den Squire zu denken. Ihr Seufzer wurde durch einen andern, oder durch einen tiefen Atemzug beantwortet. Sie blickte sich abermals um, und Niemand war zu sehen. Sie meinte, dass es der Wind sei, der durch die Mäuselöcher des alten Hauses pfeife, und fuhr gemächlich fort, ihr Haar in Papilloten zu wickeln, als sie auf einmal eines der Augen des Bildes sich bewegen zu sehen glaubte.
„Während sie ihm den Rücken zukehrte?“ sagte der Erzähler mit dem verfallenen Kopfe. „Gut!“
Ja, mein Herr! erwiderte der Redner trocken; ihr Rücken war allerdings dem Bilde zugewendet, allein sie sah es im Spiegel. Wie ich also gesagt, so bemerkte sie, dass das Bild ein Auge bewege. Eine so sonderbare Erscheinung musste, wie Sie wohl denken können, sie nicht wenig erschrecken. Um sich jedoch zu überzeugen, ob sie recht gesehen habe, legte sie die eine Hand an die Stirn, als ob sie sie reiben wollte, sah durch die Finger und bewegte dabei das Licht mit der anderen Hand. Das Licht der Kerze fiel auf das Auge und spiegelte sich darin. Allerdings bewegte sich dieses. Ja, was noch mehr war, es schien ihr zuzuwinken, so wie ihr Gatte es zuweilen bei seinem Leben getan hatte. Einen Augenblick überlief sie ein Schauer, denn sie war allein und fühlte sich in einer furchtbaren Lage.
Der Schauer war indessen nur vorübergehend. Meine Base, die beinahe so entschlossen war, als Ihr Oheim, mein Herr (hier wandte er sich zu dem alten Herrn, der die Geschichte erzählt hatte), ward sogleich wieder ruhig und besonnen. Sie fuhr fort, ihre Kleider in Ordnung zu bringen. Sie brummte sogar ein Lied und sang keine einzige falsche Note. Sie warf zufällig einen Toilettenkasten um, nahm ein Licht und las das Herausgefallene nacheinander auf, verfolgte ein Nadelkissen, das unter das Bett rollte, öffnete dann die Tür, sah einen Augenblick auf den Gang hinaus, als sei sie zweifelhaft, ob sie gehen sollte, und ging dann ruhig hinaus.
Sie eilte die Treppe hinunter, befahl den Bedienten, sich mit dem zu bewaffnen, was ihnen zuerst in die Bände fiele, stellte sich an ihre Spitze und kehrte beinahe augenblicklich wieder zurück.
Ihr schnell aufgebotenes Heer stellte eine furchtbare Macht auf. Der Haushofmeister hatte eine verrostete Donnerbüchse, der Kutscher eine gezogene Peitsche, [Ich gestehe, dass ich mir den Zusatz loaded (geladen) bei einer Peitsche nicht anders, als durch einen Scherz erklären kann, und habe ihn deswegen. so wiederzugeben gesucht. Übers.] der Bediente ein Paar Kavalleriepistolen, der Koch ein gewaltiges Hackmesser, und der Kellermeister eine Flasche in jeder Hand. Meine Base bildete, mit einem rotglühenden Schüreisen, den Vortrab, und war, nach meiner Meinung, die furchtbarste von Allen. Die Kammerjungfer, welche sich fürchtete, allein in der Bedientenstube zu bleiben, bildete den Nachtrab, roch an einer zerbrochenen Flasche mit flüchtigem Salz, und äußerte die größte Furcht vor den Gespenstern.
„Gespenster!“ sagte meine Base entschlossen. „Ich will ihnen den Bart schon versengen.“
Man trat in das Zimmer. Alles war still und ruhig, wie in dem Augenblick, wo sie es verlassen hatte. Man näherte sich dem Bilde meines Oheims.
„Nehmt das Bild herab!“ rief meine Base. Ein tiefer Seufzer, und ein Ton, wie Zähneknirschen, ließ sich aus dem Bilde hören. Die Bedienten fuhren zurück: das Kammermädchen stieß einen schwachen Schrei aus und hielt sich an dem Bedienten fest.
„Den Augenblick!“ fügte meine Base hinzu und stampfte mit dem Fuße.
Man nahm das Bild herab, und aus einer Nische dahinter, in welcher früher eine Uhr gestanden hatte, zog man einen breitschultrigen, schwarzbärtigen Kerl, mit einem armlangen Messer hervor, der aber wie ein Espenlaub zitterte.
„Nun, und wer war das? doch wohl kein Geist?“ sagte der fraglustige Herr.
Ein Strauchdieb, welchen das Vermögen der reichen Witwe angezogen hatte, oder vielmehr ein marodierender Tarquinius, der sich in ihr Zimmer geschlichen hatte, um ihrer Börse Gewalt anzutun und ihre Schatulle zu plündern, wenn Alles im Hause schlafen würde. Geradezu gesagt, fuhr er fort, war der Landstreicher ein liederlicher Müßiggänger aus der Nachbarschaft, der einst in dem Hause gedient, und den man gebraucht hatte, um zu helfen, als man es zum Empfange der Besitzerin in Stand setzte. Er bekannte, dass er dieses Versteck zu seinem schändlichen Plane sich ausersehen, und ein Auge des Bildnisses als einen Beobachtungspunkt gebraucht hatte.
„Und was tat man mit ihm? wurde er gehängt?“ fing der Frager wieder an.
Gehängt! wie wäre das möglich gewesen? rief ein Advokat mit buschigen Augenbraunen und einer Falkennase. Es war ja kein todeswürdiges Verbrechen. Er hatte keinen Raub begangen, Niemanden angefallen oder Einbruch verübt.
Meine Base, sagte der Erzähler, war eine entschlossene Frau, die das Gesetz gern selbst handzuhaben pflegte. So hatte sie auch ihre eigenen Ansichten vor Reinlichkeit. Sie befahl, dass der Kerl in die Pferdeschwemme geschleppt werden solle, um alle Übeltat abzuwaschen, und dass man ihn nachher mit einem eichenen Handtuche wieder trocken mache.
„Und was wurde nachher aus ihm?“ sagte der fragelustige Herr.
Das kann ich wirklich nicht genau sagen. Ich glaube, er wurde auf eine Bildungsreise nach Botany-Bay geschickt.
„Und ihre Base,“ sagte der fragelustige Herr, „die ließ gewiss nachher ihre Kammerjungfer mit in ihrem Zimmer schlafen. Nein, mein Herr, sie tat etwas Klügeres; sie gab kurz nachher ihre Hand dem stattlichen Squire, denn sie pflegte zu sagen, es sei doch eine unangenehme Sache für eine Frau, auf dem Lande so allein zu schlafen.
„Da hatte sie Recht,“ bemerkte der fragelustige Herr, indem er sehr weise dazu mit dem Kopfe nickte: „mir tut es nur leid, dass der Kerl nicht gehängt wurde.“
Alle waren darüber einig, dass der letzte Erzähler seine Geschichte am genügendsten geendet habe, wobei jedoch ein anwesender Landgutsbesitzer bemerkte, es sei Schade, dass der Oheim und die Base, welche in den beiden Geschichten die Hauptrollen gespielt, einander nicht geheiratet hätten: das würde gewiss ein schönes Paar gegeben haben.
„Aber bei dem allen,“ sagte der fragelustige Herr, ,,ist in der letzten Geschichte doch kein Geist vorgekommen.“
Oh! wenn Ihnen an Geistern liegt, Liebster, rief der irische Dragonerhauptmann: — wenn Ihnen an Geistern liegt, so sollen Sie ein ganzes Regiment haben. Und da diese Herren hier uns die Begebenheiten ihrer Oheime und Basen erzählt haben, so will ich Ihnen auch ein Kapitel aus meiner eignen Familiengeschichte zum Besten geben.
Der kecke Dragoner, oder das Abenteuer meines Großvaters.
Mein Großvater war ein kecker Dragoner, denn Sie müssen wissen, dass dies ein Handwerk ist, das schon lange in der Familie einheimisch gewesen. Alle meine Vorfahren waren Dragoner, und sind auf dem Felde der Ehre gestorben, mich ausgenommen, und ich hoffe, meine Nachkommen werden dasselbe von sich sagen können: indessen will ich damit nicht prahlen. — Genug, mein Großvater war, wie ich eben gesagt habe, ein kecker Dragoner, und hatte in den Niederlanden gedient. Er gehörte zu demselben Heer, das, nach der Aussage des Oheims Tobias, [In Sternes Tristram Shandy. Übers.] so fürchterlich in Flandern fluchte. Er selbst konnte recht ordentlich fluchen, und war überdies ebenderselbe Mann, der die Lehre einführte, deren Corporal Trim [Ebendaselbst. Übers.] erwähnt, nämlich von der Grundhitze und Grundfeuchtigkeit, oder mit anderen Worten, wie man sich gegen die feuchten Dünste des Grabenwassers durch Branntwein verwahren könne. Dem sei nun, wie ihm wolle; so gehört das nicht zu meiner Geschichte. Ich sage das auch nur, um Ihnen zu beweisen, dass mein Großvater kein Mann war, den man so leicht hinter das Licht führen konnte. Er hatte sich etwas versucht, oder, nach seinem eignen Ausdrucke, den Teufel kennen gelernt — und das will etwas sagen.
Nun, meine Herren, mein Großvater war auf dem Heimwege nach England, wohin er sich in Ostende einzuschiffen gedachte –– über das alles Mögliche Unglück kommen möge, denn das war der Ort, wo ich drei lange Tage durch Sturm und widrige Winde zurückgehalten wurde, und keinen Teufel von einem lustigen Kameraden oder einem niedlichen Gesichte hatte, die mich hätten aufheitern können. Nun, wie ich sage, — mein Großvater war auf dem Wege nach England, oder vielmehr nach Ostende — gleichviel, das kommt auf eins hinaus. So ritt er denn einen Abend, gegen Eintritt der Nacht, ganz lustig nach Brügge hinein. Wahrscheinlich kennen Sie Alle, meine Herren, Brügge: eine närrische, altfränkische flamländische Stadt, die, wie man behauptet, einst ein großer Handelsplatz war, und wo viel Geld verdient wurde, als die Mynheers noch in ihrem Glanze waren, heutzutage aber beinahe so groß und so leer als die Tasche eines Irländers ist Es war die Zeit des alljährlichen Marktes. Ganz Brügge war voll Menschen: die Kanäle wimmelten von holländischen Booten, und die Straßen von holländischen Kaufleuten, und vor Gütern, Waaren und Ballen, Bauern in weiten Hosen, und Frauen mit einem halben Dutzend Röcken konnte man sich kaum bewegen.
Mein Großvater ritt fröhlich dahin auf seine unbefangene, schlendrige Weise, denn er war ein sorgenloser, in den Tag hinein lebender Mensch — sah umher auf die bunte Menge und die alten Häuser mit den Giebeln nach der Straße und den Storchnestern auf den Schornsteinen, nickte den Juffrouws, die sich an den Fenstern sehen ließen, und scherzte rechts und links mit den Frauen auf der Straße, die alle darüber lachten und die Sache sehr gut aufnahmen, denn obgleich er nicht ein Wort von der Sprache wusste, so hatte er doch immer eine gewisse Art und Weise, sich den Frauen verständlich zu machen.