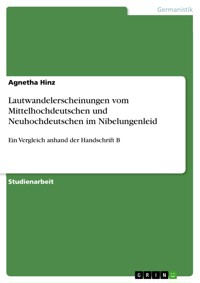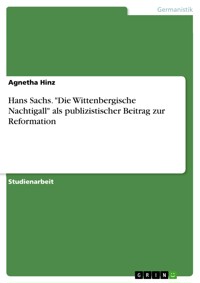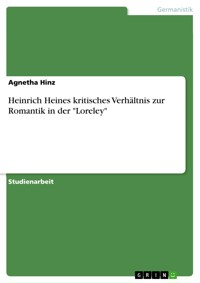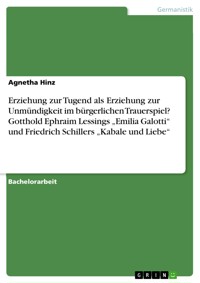
Erziehung zur Tugend als Erziehung zur Unmündigkeit im bürgerlichen Trauerspiel? Gotthold Ephraim Lessings „Emilia Galotti“ und Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“ E-Book
Agnetha Hinz
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note: 1,3, Freie Universität Berlin (Deutsche und Niederländische Philologie), Sprache: Deutsch, Abstract: Da sich das an strenge Verhaltensrichtlinien geknüpfte, patriarchalisch strukturierte Erziehungskonzept des Bürgertums und der Zustand der Mündigkeit aufgrund deren Definitionen gegenseitig auszuschließen scheinen, wird die Frage beleuchtet, ob und wenn ja, inwiefern die Erziehung zur Tugend einer Erziehung zur Unmündigkeit gleichzusetzen ist. Hierzu wird auf literarischer Ebene, genauer, innerhalb der Gattung des bürgerlichen Trauerspiels geforscht, da sich diese aufgrund ihrer zielgerichteten Problematik des Familienkonflikts für die Beantwortung des zu erörternden Themas anbietet. Als Beispielwerke werden hauptsächlich Lessings „Emilia Galotti“ und Schillers „Kabale und Liebe“ herangezogen. Beide Werke eignen sich deshalb besonders gut, da sie in das Zeitalter der Aufklärung, beziehungsweise in das der aufklärerischen Strömung des Sturm und Drangs fallen, dessen Fokus auf die Emanzipation des Bürgers gerichtet war und das sich darüber hinaus verstärkt mit der Frage nach mündigem und unmündigem Handeln beschäftigte. Im Zeitalter der Aufklärung entwickelte sich in Deutschland aufgrund wirtschaftlicher Faktoren ein erstarkendes Bürgertum. Dieses fand sich angesichts der dominierenden feudalen Ordnung jedoch in einer öffentlichen, politischen Ohnmacht wieder, wandte sich daraufhin dem Privaten zu und grenzte sich damit sowohl politisch als auch räumlich vom Adel ab. Innerhalb dieser kulturellen Emanzipation folgte auch die Entwicklung neuartiger Ideale und bestimmter bürgerlicher Werte und Tugenden. Neben diesen Entwicklungen machten ebenfalls die Struktur und die Rollenverteilung der bürgerlichen Familie ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wesentliche Veränderungen durch. Die familiäre Struktur wandelte sich in die auch heute noch typische Form der Kleinfamilie. Das vorherrschende bürgerliche Familienideal zeichnete sich nun durch das intensivierte und intimisierte Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern und der Abschottung vor der Öffentlichkeit aus. Innerhalb der familiären sozialen Rollenverteilung sorgte der Vater nun mehr außerhalb des Hauses für die „ökonomische Absicherung der Familie [und] stellte den Kontakt zur Gesellschaft her, deren Gesetz und Ordnung er innerhalb des Familienraums“ vertrat; der Mutter oblag die Kindererziehung. Allerdings blieb der Vater das uneingeschränkte und autoritäre Oberhaupt der Familie, wodurch sich die Struktur der bürgerlichen Familie demnach weiterhin als patriarchalisch bestimmt beschreiben lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Gegenstand der Arbeit und Zielstellung
2. Das bürgerliche Trauerspiel
3. Erziehung zur Tugend als Erziehung zur Unmündigkeit?
3.1. Lessings „Emilia Galotti“
3.2. Schillers „Kabale und Liebe“
3.3. Der Einfluss bürgerlicher Tugenderziehung auf die Mündigkeit am Beispiel zweier weiterer bürgerlicher Trauerspiele
4. Fazit
5. Bibliographie
1. Gegenstand der Arbeit und Zielstellung
Im Zeitalter der Aufklärung entwickelte sich in Deutschland aufgrund wirtschaftlicher Faktoren ein erstarkendes Bürgertum. Dieses fand sich angesichts der dominierenden feudalen Ordnung jedoch in einer öffentlichen, politischen Ohnmacht wieder, wandte sich daraufhin dem Privaten zu[1] und grenzte sich damit sowohl politisch als auch räumlich vom Adel ab.[2] Innerhalb dieser kulturellen Emanzipation folgte auch die Entwicklung neuartiger Ideale und bestimmter bürgerlicher Werte und Tugenden. Neben diesen Entwicklungen machten ebenfalls die Struktur und die Rollenverteilung der bürgerlichen Familie ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wesentliche Veränderungen durch. Die familiäre Struktur wandelte sich in die auch heute noch typische Form der Kleinfamilie.[3] Das vorherrschende bürgerliche Familienideal zeichnete sich nun durch das intensivierte und intimisierte Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern und der Abschottung vor der Öffentlichkeit aus.[4] Innerhalb der familiären sozialen Rollenverteilung sorgte der Vater nun mehr außerhalb des Hauses für die „ökonomische Absicherung der Familie [und] stellte den Kontakt zur Gesellschaft her, deren Gesetz und Ordnung er innerhalb des Familienraums“[5] vertrat; der Mutter oblag die Kindererziehung. Allerdings blieb der Vater das uneingeschränkte und autoritäre Oberhaupt der Familie, wodurch sich die Struktur der bürgerlichen Familie demnach weiterhin als patriarchalisch bestimmt beschreiben lässt.[6]
Die Kindererziehung hatte das Ziel, die neu entwickelten Ideale weiterzugeben. Tugenden, also erwünschte Eigenschaften, wie Aufrichtigkeit, Frömmigkeit, Ordentlichkeit, Treue, Fleiß und Gehorsam gegenüber den Eltern wurden dem Heranwachsenden im geschützten Kreis der Familie anerzogen, galten primär „als implizite Kritik an der als unmoralisch empfundenen politisch-öffentlichen Sphäre des Hofes“[7] und sollten dieser als Vorbild dienen. Letztlich formte dies jedoch ein „Modell [...] private[r] Erziehungsutopie“.[8] Darüber hinaus bestand insbesondere gegenüber Töchtern eine enorme Erwartungshaltung bezüglich ihrer Verhaltensweisen. So ist die ideale, tugendhafte Tochter
sittsam, gehorsam, heiter [...] [und] hegt keinerlei über ihr häusliches Betätigungsfeld hinausweisende Ambitionen [...]. Kurz: sie will und kann in keiner Weise in Konkurrenz zum Ehemann oder Vater, zum Patriarchen, treten, sondern funktioniert im Familiengefüge als dessen ergänzendes Gegenteil.[9]
Ein Verstoß gegen diese Verhaltensrichtlinien und somit ein Heraustreten aus der auferlegten Rollenerwartung gilt als unmoralisch, jegliches erwünschtes Verhalten gemäß dieser Erwartungshaltung, selbst wenn es sich gegen die eigenen, subjektiven Bedürfnisse richtet, gilt als tugendhaft.[10] Hinzu kommt eine starke Verflechtung der Begriffe Tugend und Enthaltsamkeit. Dieser Zusammenhang erklärt sich dadurch, dass „patriarchalische Gesellschaftsordnungen notwendigerweise auf weibliche Unschuld und Enthaltsamkeit Wert legen müssen, um eine patriarchale Erbfolge gewährleisten zu können.“[11] Als Schlussfolgerung dieser Erkenntnisse wird klar, dass die Gebundenheit an eine patriarchalisch strukturierte Familie wie auch an deren strenge Erwartungshaltung bezüglich festgeschriebener Verhaltensweisen das Agieren des Kindes stark beeinflusst, wodurch im Umkehrschluss eine Einschränkung der individuellen Freiheit zu erwarten ist.