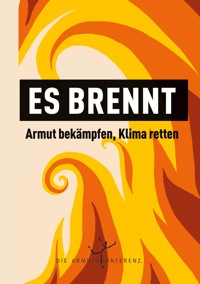
Es brennt E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Wetterprognose lautet heiß und stürmisch. Das Tief der sozialen Krise bedroht viele Menschen im Land. Das Hoch der Klimaerhitzung nagt an unseren globalen Lebensgrundlagen. Die Zeit (b)rennt. Armutsbetroffene sind vom Klimawandel weitaus stärker betroffen als einkommensstärkere Gruppen. Während Erstere weniger zur Klimakrise beitragen, bekommen sie die Auswirkungen der Umweltbelastungen wie die Verknappung der natürlichen Ressourcen, Luftverschmutzung, Hitze, Überschwemmungen oder Dürre deutlicher zu spüren. Klimaschutz kann nur dann erfolgreich sein und Akzeptanz finden, wenn er nicht sozial blind ist. Klimaschutz selbst muss Armut bekämpfen. Die Autor*innen dieses Bandes behandeln große sozial-ökologische Problemfelder des Klimawandels, diskutieren Dimensionen der sozial-ökologischen Transformation und thematisieren Lösungsansätze in den Bereichen Ernährung, Mobilität oder Wohnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
FLÄCHENBRAND: Die großen sozial-ökologischen Problemfelder
Ulrich Brand
Ökologie ist keine Luxusfrage
Klimakrise und soziale Ungleichheit gehen uns alle an
Stephan Lessenich
Klima – Klasse – Konsum
Ungleichheitsdynamiken in der ökologischen Krise
Karin Fischer
Klima-Kolonialismus
Die Klimakrise als globale Verteilungs- und Gerechtigkeitskrise
Judith Kohlenberger
Migration bekämpfen, Klima retten?
Chancen einer sozial-ökologischen Transformation der Asyl- und Integrationspolitik
GLUTNESTER: Dimensionen der sozial-ökologischen Transformation
Beate Littig
Die sozial-ökologischen Zukünfte der Arbeitsgesellschaft
Eine geschlechterpolitische Bestandsaufnahme
Ilja Steffelbauer
Mangel- und Fehlernährung als historische und aktuelle Herausforderung
Ernährungssouveränität als Lösung
Elisa Klein Díaz und Michaela Moser
Ernährungssouveränität weiterentwickeln
Bestehende Initiativen und notwendige Schritte
Christine Sallinger
Armutsbetroffene sind Klimaschutzweltmeister*innen
Ein Kommentar
Hanna Braun, Iris Frey, Martin Schenk, Felix Steinhardt
Energiegrundsicherung
Warum wir ein Recht auf saubere Energie haben und der Markt es nicht richten wird
Johannes Seidl
Menschenrecht Wohnen
Ein Kommentar
Alexander Brenner-Skazedonig, Lina Mosshammer
Die klimasoziale Mobilitätswende
Raus aus dem teuren Autozeitalter
Hedy Spanner im Gespräch mit Alban Knecht
Transformative Bildung und soziale Ungleichheit
Ein Interview
BRANDSCHUTZ: Sozial- und klimapolitische Feuerlöscher
Susanne Elsen
Soziale und solidarische Ökonomie
Armut verhindern und ökosoziale Transformation verwirklichen
Gabriele Winker
Revolutionäre Realpolitik für Care und Klima
Eine konkrete Utopie für eine solidarische Gesellschaft
Marie Chahrour
Nachhaltige Arbeit
Ein Weg zu einem guten Leben für alle
Clara Moder und Jana Schultheiß
Klimasoziale Politik
Entwicklungsmöglichkeiten des Sozialstaats in der Klimakrise
Rafael Wildauer
Armutsbekämpfung durch Vermögenssteuern finanzieren
Das Beispiel Österreich
Wolfgang wodt Schmidt
Wer brennt’s? – Wer zahlt’s? Die öko-soziale Steuerreform konsequent denken
Ein Kommentar
Michaela Haunold
Den öffentlichen Raum klimafit für alle gestalten
Eine Ideensammlung
Anja Eberharter
Kein sozial ohne ökologisch!
Klimaschutz im Sozialen Sektor braucht adäquate Rahmenbedingungen
Yannick Liedholz
Klimagerechte Soziale Arbeit
Drei Schritte auf dem Weg dorthin
Robert Blum
Who cares?
Die Sozialarbeitspraxis in der Klimakrise
Verena Fabris, Martin Schenk
;
Es brennt! Armut bekämpfen, Klima retten
Ergebnisse der 13. Österreichischen Armutskonferenz
DIE ARMUTSKONFERENZ
Einleitung
Die Wetterprognose für die kommenden Jahre lautet heiß und stürmisch. Während die Hitze die globalen Lebensgrundlagen bedroht, wird die soziale Kälte der Gesellschaft mit jeder neuen Krise spürbarer. Dabei sind Armutsbetroffene vom Klimawandel weitaus stärker betroffen als einkommensstärkere Gruppen. Während Armutsbetroffene weniger zur Klimakrise beitragen, bekommen sie die Auswirkungen der Umweltbelastungen – wie die Verknappung der natürlichen Ressourcen, Hitze, Dürre, Überschwemmungen, aber auch Luftverschmutzung und Lärm – deutlicher zu spüren. Auch die bisherigen Maßnahmen gegen den Klimawandel stellen keinen sozialen Ausgleich her. Regelungen wie die CO2-Steuer haben weitaus größere Auswirkungen auf einkommensschwache Gruppen als auf einkommensstarke, wenn kein finanzieller Ausgleich erfolgt.
„Klimaschutz kann nur dann erfolgreich sein und Akzeptanz finden, wenn er nicht sozial blind ist. Klimaschutz selbst muss Armut bekämpfen.“ Das war ein wesentliches Resümee der 13. Armutskonferenz, die unter dem Titel „Es brennt!“ von 23. bis 25. Mai 2022 mit über 300 Teilnehmer*innen aus Wissenschaft, Selbsthilfe-Initiativen, sozialen Organisationen und Bildungseinrichtungen sowie mit Armutsbetroffenen in Salzburg stattfand. Auf der Konferenz wurden Maßnahmen und Strategien vorgestellt und diskutiert, welche die Klimakrise und die Krise des sozialen Klimas zusammendenken. Theoretische Beiträge wurden mit Einsichten aus der Praxis und der Sichtweise Armutsbetroffener verbunden. Dabei haben sich Umwelt- und Klimagerechtigkeit als die brennendsten Fragen herausgestellt. Im Rahmen der Konferenz wurden Themen wie Demokratie, solidarische Care-Arbeit, Wohnen und Energie, Verteilungspolitik und Steuern, Konsum, Gesundheit, Arbeit, Bildung, Öko-Bewegungen sowie globale Perspektiven behandelt – in diesem Tagungsband werden sie weiter vertieft.
Überblick
Der Tagungsband ist in drei Teile gegliedert. Die Artikel im Abschnitt Flächenbrand behandeln große sozial-ökologische Problemfelder des Klimawandels. Im Abschnitt Glutnester werden Dimensionen der sozial-ökologischen Transformation diskutiert. Der dritte Teil thematisiert unter dem Titel Brandschutz, mit welchen Lösungsansätzen die sozial- und klimapolitischen Brandherde in Bereichen wie Ernährung, Mobilität oder Wohnen gelöscht werden können.
Im ersten Abschnitt Flächenbrand weist zuerst Ulrich Brand darauf hin, dass die Klimakrise keine Luxusfrage ist, sondern eine existentielle Frage, die uns alle angeht. Luxus ist allerdings dann ein Thema, wenn man sich fragt, wer auf wessen Kosten lebt. Stephan Lessenich ergänzt diese Sichtweise durch eine soziologische Ungleichheitsanalyse, die sich um die Frage dreht „Wer ist an dieser Krise schuld und wer hat sie auszubaden?“ Diese beiden Globalanalysen werden vertieft durch den Beitrag von Karin Fischer, der aufzeigt, wie globale Ungleichheit durch die internationalen Verflechtungen und ungleichen Weltwirtschaftsbeziehungen die Erderwärmung weiter anheizt. Eine Folge der Erderwärmung sind schon heute weltumspannende Flüchtlingsströme, die stets neue moralische Fragen aufwerfen und gesellschaftspolitische Spannungen auslösen, wie Judith Kohlenberg in ihrem Beitrag darlegt.
Der zweite Abschnitt dieses Bandes diskutiert unter dem Titel Glutnester Ernährung, Konsum, Energie, Wohnen, Mobilität, Gesundheit und Bildung als Dimensionen der sozial-ökologischen Transformation. Zuerst zeigt Beate Littig eine moderne Form der sozial-ökologischen und geschlechtergerechten Tätigkeitsgesellschaft auf, die das Wachstumsparadigma und den Konsumismus hinter sich lässt und als Alternative zu fragwürdigen Ansätzen der Green Economy dienen kann. Ilja Steffelbauer zeichnet mit seinem Blick in die Geschichte die weltweite Entwicklung von Mangelkrankheiten hin zu einer gegenwärtigen Adipositas-Diabetes-Epidemie nach und leitet daraus die Bedeutung von Ernährungssouveränität im Sinne einer kollektiven Kontrolle der Konsument*innen und Produzent*innen über selbst produzierte Nahrungsmittel ab. Elisa Klein Díaz und Michaela Moser sehen drei Aspekte als Basis für eine konzeptionelle Weiterentwicklung von Ernährungssouveränität, die sich insbesondere auch auf zivilgesellschaftliche Initiativen stützen sollte: ein weltweiter Zugang zu gesunden, naturnah produzierten und regionalen Nahrungsmitteln, weltweit faire Arbeitsbedingungen sowie der Erhalt unserer ökologischen Ressourcen. Christine Sallinger schreibt in ihrem Kommentar allgemeiner über Konsum: Sie zeigt auf, welche Einschränkungen armutsbetroffene Menschen beim Konsum in Kauf nehmen müssen. Aufgrund mangelnder finanzieller Möglichkeiten entpuppen sie sich als „Klimaschutzweltmeister*innen mit gutem Gewissen“. Dass Energie kein gewöhnliches Konsumgut ist, weil es ein Grundbedürfnis deckt, betonen Hanna Braun, Iris Frey, Martin Schenk und Felix Steinhardt. Ähnlich wie im Beitrag von Ilja Stellebauer für die (weltweite) Ernährung festgestellt, so existieren auch beim Energieverbrauch Überkonsum und Knappheit nebeneinander. Die Autor*innen fordern, dass der Grundbedarf für jeden Menschen gedeckt werden muss. Das Thema von Johannes Seidl ist Wohnen. Er fordert in seinem Kommentar eine konsequente Umsetzung des Menschenrechts auf Wohnen – die abgeschwächte Forderung nach „leistbarem Wohnen“ findet er scheinheilig. Mit Mobilität beschäftigten sich Alexander Brenner-Skazedonig und Lina Mosshammer. Sie zeigen auf, dass der motorisierte Individualverkehr das Erreichen der Klimaziele erschwert. Um klimaverträgliche und sozial gerechte Mobilität für alle umsetzen zu können, braucht es zuallererst politische Visionen, die Gehen, Radfahren und den öffentlichen Verkehr in den Mittelpunkt stellen. Im Gespräch mit Alban Knecht diskutiert Hedy Spanner aus der Perspektive einer Armutsbetroffenen die Bedeutung von transformativer Bildung im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit als Teil einer umfassenden Klimapolitik. Sie weißt unter anderem auf die Potenziale hin, die in sozial benachteiligten Menschen schlummern und die in einer solidarischen Gesellschaft besser genutzt werden können und sollten als bisher.
Im dritten Abschnitt des Buches werden unter dem Titel Brandschutz Lös(ch)ungsansätze bezüglich klima- und sozialpolitischer Herausforderungen diskutiert. Susanne Elsen weist in ihrem Artikel auf das große soziale und ökologische Potential der Solidarökonomie hin und zeigt ihren möglichen Beitrag zur Armutsbekämpfung und Integration benachteiligter Menschen auf. Anhand von praktischen Beispielen erläutert sie das Potenzial zur Entwicklung einer sozial gerechteren, ökologisch nachhaltigeren Wirtschafts- und Lebensweise. Gabriele Winker stellt familiäre und ehrenamtliche Sorgearbeit in den Kontext von Klimapolitik. Sie zeigt die systemischen Gemeinsamkeiten zwischen der Überlastung von Sorgearbeitenden und der Überlastung ökologischer Kreisläufe auf und erläutert, wie eine radikale Care-Bewegung auch einen Beitrag zur Stärkung der Klimagerechtigkeitsbewegung leisten kann. Der Beitrag von Marie Chahrour diskutiert nachhaltige Arbeit als umfassenden Begriff, der neben Erwerbsarbeit auch Sorge-, Gemeinschafts- und Eigenarbeit umfasst. Eine angemessene Bewertung all dieser Tätigkeitsbereiche ist eine Voraussetzung für ökologische Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit. In ihrem Artikel zu klimasozialer Politik fordern Clara Moder und Jana Schultheiß, dass der Sozialstaat eine starke Rolle bei der Abfederung sozialer Risiken des Klimawandels spielen müsse. Zentrale Hebel sind dabei die Bekämpfung von Ungleichheit, die Gestaltung der Sozialleistungen und die Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur. Rafael Wildauer fragt in seinem Beitrag, ob sich Österreich Armutsbekämpfung in Zeiten (klima-bedingter) belasteter Haushalte leisten kann. Er zeigt die im internationalen Vergleich hohe Einkommens- und Vermögensungleichheit Österreichs auf und weist auf die Ergiebigkeit und Notwendigkeit von Vermögenssteuern hin. Wolfgang Wodt Schmidt ergänzt diesen Beitrag und betont, dass eine Umverteilung von oben nach unten nicht nur für die Finanzierung des Staates, sondern auch als ökologischer Lenkungsmechanismus wichtig ist. Den öffentlichen Raum thematisiert Michaela Haunold in ihrem Beitrag: Sie stellt dar, mit welchen Maßnahmen dieser Raum klimafit wird und so für alle nutzbar bleibt. Anja Eberharter diskutiert die Rolle des sozialen Sektors in der Klimapolitik. Weil soziale Organisationen als Akteure vergessen werden, fordert sie einen Transformationsfonds für diesen Bereich. Zwei Beiträge des Bandes widmen sich dezidiert der Sozialen Arbeit: Yannick Liedholz diskutiert vor dem Hintergrund des Begriffes Klimagerechtigkeit mögliche Wege der Transformation zu einer klimagerechten Sozialen Arbeit. In Ergänzung fragt Robert Blum nach der Bedeutung der natürlichen Umwelt für Sozialarbeiter*innen und ihrem Verständnis der Klimakrise. Ein Einblick in die Ergebnisse der Konferenz beendet das Buch.
Es brennt! Diese zwei Worte sind Beobachtung, Statement, Aufruf und Warnung zugleich. Aufzuzeigen, wie wir soziale Kälte abwenden und globale Hitze verhindern können, das ist das Anliegen dieses Buches.
Margit Appel, Alexander Brenner-Skazedonig, Verena Fabris, Gunter Graf, Alban Knecht, Sandra Matzinger, Robert Rybaczek, Martin Schenk
Mai 2023
FLÄCHENBRAND
Die großen sozial-ökologischen Problemfelder
Ulrich Brand
Ökologie ist keine Luxusfrage
Stephan Lessenich
Klima – Klasse – Konsum
Karin Fischer
Klima-Kolonialismus
Judith Kohlenberger
Migration bekämpfen, Klima retten?
Ulrich Brand
Ökologie ist keine Luxusfrage
Klimakrise und soziale Ungleichheit gehen uns alle an
Mit diesem Vortrag eröffnete Ulrich Brand die 13. Armutskonferenz am 24. Mai 2022. Er zeigt, dass ökologische Themen keine Luxusfragen sind, setzt sie in Zusammenhang mit imperialen Lebens- und Produktionsweisen und weist auf die Grenzen von ökologischen Reformen im Rahmen des Kapitalismus hin. Die solidarische Lebensweise und die sozial-ökologische Transformation werden als Chance für positive gesellschaftliche Entwicklungen beschrieben.
Armut bekämpfen, Klima retten – und die Wetterprognose ist heiß und stürmisch. Gleichzeitig ist das soziale Klima eher kalt und geprägt von hoher Unsicherheit. Die Politik ist geschäftig, sie tut so, als ob sie klimapolitisch vorankommen würde. Sie will Hoffnung verbreiten, sie will das grüne Projekt einer Ökologisierung des Kapitalismus vorantreiben, was auch in der breiten Öffentlichkeit auf Zustimmung stößt – denken wir beispielsweise an den ganzen Hype um die E-Autos, an dem öffentlich kaum Kritik geäußert wird. Elon Musk, der jetzt bei Berlin eine Tesla-Fabrik hat bauen lassen, wird als eine Art Heilsbringer gefeiert. Es wirkt, als lösten grünes Wachstum und grüne Jobs samt Elektromobilität alle Emissionsprobleme. Ich bin wie Beate Littig aber eher skeptisch, was die Möglichkeiten dieser „Green Jobs“ angeht. Und „grünes Wachstum“ ist ein falsches Versprechen.
Ich beginne auf diese Weise, weil ich denke, dass es gerade in Zeiten von großer Veränderung, von großer Unsicherheit und Frustration – denken wir an den Krieg oder die negativen sozialen Effekte der Corona-Pandemie – Räume braucht, in denen man sich über wesentliche Fragen und Themen verständigen kann: Wo stehen wir? Wie kann Handlungsfähigkeit in bestimmten politischen Feldern erreicht und vergrößert werden? Wie können tatsächlich lebenswerte, gerechte und ökologisch nachhaltige Verhältnisse geschaffen werden?
Dazu möchte ich vier Überlegungen anstellen. Zunächst möchte ich auf die Frage „Warum ist Ökologie keine Luxusfrage?“ eingehen. Die zweite Überlegung behandelt die imperiale Lebens- und Produktionsweise. Warum ist sie so tief verankert und warum ist sie trotz der Zerstörung, die sie anrichtet, so attraktiv? Wichtig ist mir dabei: Die imperiale Lebensweise bedeutet nicht, dass alle gleich leben, sondern sie basiert auf Ungleichheit und sie verlängert Ungleichheit. Bei der dritten Überlegung möchte ich unter der Überschrift „Umkämpfte Zukunft“ argumentieren, dass durchaus auch das Establishment, die Machteliten sowie die herrschende Politik versuchen, mit der Klimakrise umzugehen. Unter dem Begriff „Ökologisierung des Kapitalismus“ habe ich bereits angedeutet, dass diese Versuche der Herrschenden und Mächtigen, die Klimakrise zu bearbeiten, unzureichend sind. Trotzdem sollten wir sie ernst nehmen, da sie eine wichtige Bedingung für weitergehende emanzipatorische und gerechte Lösungs- oder Bearbeitungswege darstellen. Das bringt mich zu meiner vierten und letzten Überlegung, nämlich zu Gedanken zu einer solidarischen Lebensweise und zu einer sozialökologischen Transformation.
Warum ist Ökologie keine Luxusfrage?
Wir erleben aktuell die sozial-ökologische Zerstörung der Welt. Dazu zählt nicht nur die Klimakrise, sondern auch der Krieg ist eine sozial-ökologische Zerstörung, weil die Debatten um den Ausstieg aus der Energieabhängigkeit von Russland ja sehr eng geführt werden. Wo bekommen wir jetzt das Gas her, wo die Kohle? Müssen wir die Atomkraftwerke in Europa länger laufen lassen?
Ich bleibe zunächst bei der Klimakrise im engeren Sinn. Diese wird heftig werden, das wird auch in Ländern des Globalen Nordens wie in Österreich zunehmend deutlich: Starkregen und Hitzeperioden traten vor fünf oder zehn Jahren noch viel seltener auf. Da hat man gesagt: „Ja, ja die Klimakrise, aber die betrifft eher den Globalen Süden.“ Jetzt wird sie auch hier erlebbar. In der Folge gibt es Debatten um die Klimafolgenanpassung: Wie wird damit umgegangen, wenn es in Wien oder Salzburg viele Tage mit über 40 Grad gibt oder viele Nächte, in denen die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad fällt?
Wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass Ressourcenverbrauch und Energie-Inputs in wohlhabenden Ländern drastisch reduziert werden müssen. Manche sagen, in den nächsten zwei Jahrzehnten auf 20 Prozent. Also nicht um 20 Prozent, sondern auf 20 Prozent. Und da ist die vorherrschende Antwort natürlich Technologie, die soll es dann richten. Da braucht es eine kritische Entgegnung: Nein, es muss ein komplexerer Umbauprozess von Wirtschaft und Gesellschaft stattfinden, der gerecht und nachhaltig sein soll.
Es wird ungemütlich und deshalb ist es nicht mehr angebracht – und es war noch nie angebracht – zu sagen, dass Ökologie eine Luxusfrage ist, auch wenn sie in den herrschenden Diskursen als solche deklariert wurde. Aus einer kritischen Perspektive ist die ökologische Frage immer eine soziale Frage, denn die Verursachung der ökologischen Krise ist hochgradig ungleich. Die reichsten 10 Prozent der Welt sind für 50 Prozent der Klimaemissionen verantwortlich. Und auch die Folgen sind höchst ungleich verteilt: Wer lebt in den Stadtteilen mit weniger Grünflächen, an den Straßen, wo Abgase ausgestoßen werden? Das dominante Verständnis der Klimakrise entkoppelt Ökologie und soziale Fragen. Das dominante Verständnis lautet: Die Menschheit übernutzt den Planeten. Im Grunde genommen wollen alle immer mehr. Dabei wird kaum unterschieden zwischen den Reichen als den Hauptverursachern der imperialen Lebensweise, und dem Wachstumszwang unserer Gesellschaft einerseits und den ärmeren Bevölkerungsteilen andererseits, die zwar weniger zur Klimakrise beitragen, aber oft viel stärker von ihr betroffen sind – sei es bei uns und vor allem in den Ländern des Globalen Südens.
Die Verantwortung, die Krise zu bearbeiten, liegt bei der Regierung, beim Staat. Dieser soll Regeln aufstellen, die angemessene Rahmenbedingungen schaffen für grüne Investitionen, grünen Konsum, grüne Jobs und grünes Wachstum. Aber aus dieser Perspektive wird Gesellschaft nicht verstanden als Zusammenhang, wo es Machtverhältnisse und starke Interessen gibt, wo es Leute gibt, die Interesse haben an Ungleichheit, nämlich die Wohlhabenden, die gut Verdienenden, die obere Mittelschicht. Und deshalb geht es bei der Klimakrise um diese doppelte Ungerechtigkeit bei der Verursachung und bei den Folgen.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, dass die ökologische Krise selbst anders begriffen werden muss. Die ökologische Krise ist nicht die Übernutzung des Planeten im Sinne einer Übernutzung der Ressourcen und zu hoher CO2-Emissionen. Das Problem der Klimakrise ist die Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert ist, wie wir Mobilität, Ernährung, Wohnen, industrielle Landwirtschaft, Automobilität oder den Flugverkehr organisieren. Da wird schon wieder deutlich, wie ungleich das ist: Wer fliegt? Wer hat ein fettes Auto, die große Wohnung? Die ökologische Krise ist nicht „da draußen“, sondern sie ist im Kern eine Krise der kapitalistischen, auf Expansion angelegten Produktions- und Lebensweise. Das ist eine Blickverschiebung. Dann geht es nicht nur darum, die CO2-Emissionen zu reduzieren und von fossilen auf erneuerbare Energien umzustellen. Alle Studien zeigen, dass die erneuerbaren Energien die fossilen nicht ersetzen, sondern nur ergänzen, weil es weiterhin einen Wachstumszwang gibt. Die Annahme, dass die erneuerbaren Energien die fossilen Energien ersetzen würden, ist daher bisher falsch. Doch wir müssen weitergehen und darüber nachdenken, wie der Energieverbrauch tatsächlich reduziert werden kann. Vor allem muss es darum gehen, Versorgungsfelder wie Mobilität, Ernährung oder Wohnen zu verändern. Wir müssen bei der ökologischen Krise über Kapitalismus, über Ungleichheit sprechen. Und wir sollten sie nicht auf die Gier der Menschen, die immer nur mehr wollen, zurückführen. Das ist meine erste Überlegung.
Die Attraktivität der imperialen Lebensweise
Die zweite Überlegung ist folgende: Die kapitalistische Produktions- und Lebensweise ist gerade in einem Land wie Österreich, im Globalen Norden, für viele Menschen attraktiv. Weil sie auf dem Land ein Auto brauchen, weil es doch cool ist, wenn die Flüge so billig sind und man für € 19,90 von Wien aus zum Fußballspiel von Real Madrid fliegen kann. Es sind also nicht nur die Reichen, die die Klimakrise verursachen, sondern auch viele andere. Trotzdem sollten zuerst die Mächtigen und Reichen kritisiert werden. Ich sage das hier mal öffentlich: Elon Musk muss scheitern. Es ist ja nicht so, dass er die Welt rettet. Sein Geschäftsmodell zielt auf fette Autos ab. Das ist ja nicht das Drei-Liter-Äquivalent zum Auto, sondern er will einfach Profit machen. Und er betreibt SpaceX. Es ist zynisch zu sagen, wir verpulvern die ganzen Ressourcen, damit ein paar Reiche mal eine halbe Stunde auf die Erde gucken können oder wir auf dem Mars landen, und gleichzeitig tue ich so, als ob ich der ökologischste Unternehmer der Welt wäre. Manche haben das vielleicht mitbekommen: Er wurde wütend, als er kürzlich aus dem Nachhaltigkeitsindex geflogen ist.
Aber die imperiale Produktions- und Lebensweise ist eben auch im Alltag der Vielen vorherrschend: Wenn wir Handys konsumieren, wenn wir in der Automobilfabrik arbeiten, wenn die unter ausbeuterischen Bedingungen gefertigten Vorprodukte wie Aluminium importiert werden, wenn Billigfleisch mit Futtermitteln aus dem Globalen Süden produziert und konsumiert wird, dann schafft das hier Alltag, und der ist von vielen auch gewollt. Das meine ich nicht moralisch oder moralisierend, sondern es geht darum, zunächst einmal zu begreifen, wie sich hier in Österreich, in Europa, vor allem Westeuropa, das Leben reproduziert. Wie hier gelebt wird, basiert auch (wenngleich nicht nur) darauf, dass woanders unter teilweise katastrophalen ökologischen und sozialen Bedingungen Güter produziert werden, die hier in den Produktionsprozess übergehen oder in den Konsum. Dabei kann „woanders“ im Globalen Süden sein, aber auch im Marchfeld bei der Ernte oder in der Fleischfabrik von Tönnies. Der Kapitalismus und die imperiale Lebensweise kümmern sich nicht um die Voraussetzungen ihres Konsums, sondern begründen diese teilweise noch mit den „faulen Leuten“ im Globalen Süden – die sollen sich mal entwickeln und fleißig sein. Das ist strukturelle Sorglosigkeit! Mir geht es zunächst einmal um ein Verständnis der tiefen Verankerung einer bestimmten Produktions- und Lebensweise, die dauernd ihr Äußeres braucht, ihr Äußeres hier in Österreich und Europa, in Osteuropa und im Globalen Süden. Stephan Lessenich hat das als „Externalisierungsgesellschaft“ bezeichnet, also als eine Gesellschaft, die permanent ihre negativen Voraussetzungen und Folgen unsichtbar machen muss.
Gerade in Zusammenhang mit politischen Strategien ist der wichtige Punkt, dass in weiten Teilen der Gesellschaft das gute Leben nicht als ein auskömmliches, sinnerfülltes Leben verstanden wird, das versucht, nicht zu zerstören. Ganz im Gegenteil ist das „gute Leben“, das uns Musk oder Amazon und viele andere verkaufen wollen, das ressourcenintensive und verschwenderische Leben. Dabei gilt es auch zu berücksichtigen: Die herrschende Wissenschaft sagt zwar immer, am Ende sind es die Konsument*innen, die entscheiden, was produziert wird, und nicht Musk – wenn die grün wollen, ist es grün. Aber der Kapitalismus hat mit Macht zu tun hat, mit Strategien von Unternehmen. Die Produktionsnormen des jetzt schon übernächsten Handys, die werden ja in den Entwicklungsabteilungen der Handyunternehmen festgelegt. Trotz Fairphone gibt es da kaum Handlungsspielraum für Konsument*innen.
Es geht also um Macht. Außerdem geht es um machtvolle staatliche Strategien, etwa Freihandelsstrategien, die tendenziell die mächtigen Länder und Unternehmen bevorteilen – die EU spricht beschönigend von „Ressourcendiplomatie“. Vielmehr handelt es sich dabei jedoch um Ressourcenimperialismus: Es geht um die Sicherung der Rohstoffe für die europäische Industrie. Denken wir doch nur an Lithium, das jetzt in die Batterien fließen soll und das im Lithium-Dreieck Chile-Argentinien-Bolivien zu unmöglichen Bedingungen gefördert wird.
Um diese zweite Bemerkung abzuschließen, möchte ich eine Kritik zurückweisen, die beispielsweise Klaus Dörre, der auch schon hier auf der Armutskonferenz war, am Konzept der imperialen Lebensweise, das von meinem Co-Autor Markus Wissen und mir stammt, jüngst formuliert hat. Dörre behauptet, wir würden mit der imperialen Lebensweise den Gesellschaften bzw. den Menschen im Globalen Norden unterstellen, sie würden eine Art Beutegemeinschaft bilden, um den Globalen Süden und die globale Natur auszubeuten. Es wundert uns, dass eine solche Kritik von Klaus Dörre kommt, den wir gut kennen und der sich intensiv mit der imperialen Lebensweise auseinandergesetzt hat. Denn: Unser Argument ist gerade nicht, dass alle Katzen grau sind und alle auf die gleiche imperiale Weise leben. Wir argumentieren vielmehr, dass es enorme Ungleichheiten gibt. Die imperiale Lebensweise weitet sich entlang des „Geldbörserls“ aus, sie erweitert bestimmte Handlungsmöglichkeiten, sie schafft durchaus materiellen Wohlstand und sie ist die Grundlage für eine Teilhabe am Alltagsleben – aber sie beutet auch Menschen und Natur aus.
Daher gehen wir weiter und sagen: Die imperiale Lebensweise braucht die soziale Ungleichheit, sie braucht die Ausbeutung, die Hierarchisierung in Österreich, die Bullshit-Jobs, die schlecht bezahlte Pflegearbeit, die Abstiegsangst. Armut heißt Ausgrenzung. Diese Seite ist uns wichtig, denn sie hält die imperiale Lebensweise am Laufen: „Ich will es besser haben, ich will besser sein als die Armen, die Ausgegrenzten.“ Konsum ist somit auch immer Statuskonsum. Um es zusammenzufassen: Die imperiale Lebensweise verschafft vielen Menschen materiellen Wohlstand, aber der ist ungleich verteilt, und er basiert auch hier in Österreich auf Ausbeutung.
Hinzu kommt, dass die imperiale Lebensweise ein Zwang ist. Sie wird zwar nicht so empfunden, aber es ist verdammt schwer, aus ihr auszusteigen. (Ich werde später auf Alternativen wie eine solidarische Lebensweise zu sprechen kommen.) Die imperiale Lebensweise ist keine Frage der individuellen Entscheidung. Natürlich haben wir Handlungsspielräume und können durchaus teilweise entscheiden, welche Nahrungsmittel wir kaufen oder wie wir uns fortbewegen. Aber gesamtgesellschaftlich gesehen sind beispielsweise die Infrastruktur für Auto- und Luftverkehr oder die industrielle Landwirtschaft so tief in unserer Gesellschaft verankert, dass wir ihnen kaum entkommen können. Also können wir einen Umbauprozess nicht nur auf dem Rücken der Konsument*innen stattfinden lassen, ganz nach dem Motto „Wenn alle nur grün konsumieren, wird es gut“. Gerade die jungen Leute können ja vor moralischer Last kaum gehen, weil sie nicht mehr wissen, was sie konsumieren sollen. Aber das ist gefährlich, denn dabei handelt es sich um eine Individualisierung von Verantwortung. Die Verantwortung bleibt dann bei den Individuen – und die starken Unternehmen, die Vermögenden, diejenigen, die die Profite machen, bleiben schön draußen. Das ist nicht die Diagnose der imperialen Lebensweise, auch nicht die der solidarischen Lebensweise.
Umkämpfte Zukunft
Meine dritte Überlegung ist relativ kurz. Ich will auf eine Ausdifferenzierung hinweisen, wie mit der Klimakrise umgegangen wird, die politisch-strategisch wichtig ist. Natürlich gibt es die Trumps, die Bolsonaros, die Leugner – ich benutze bewusst die männliche Form –, die Leugner der Klimakrise. Diese wollen eine autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise: „America first“, Zaun, Mauer an der Grenze zu Mexiko, bloß niemand ’rankommen lassen an unsere Lebensweise. Diese Perspektive gibt es und die ist auch ernst zu nehmen.
Es gibt aber auch noch Vertreter*innen eines anderen Zugangs: Diese wollen den Kapitalismus zwar ökologisch modernisieren, aber nicht aus der Wachstumslogik aussteigen. Ich möchte diesen Zugang nicht denunzieren, er muss aber in seinen Grenzen verstanden werden. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht Leonore Gewessler anklagen, aber ich habe der Klimaministerin bereits zweimal gesagt: „Frau Ministerin, Ihre Initiativen sind total wichtig, aber Sie können doch nicht behaupten, es reicht, wenn wir auf E-Autos umsteigen.“ Natürlich wird das öffentliche Verkehrssystem jetzt umgebaut, es gibt ein Klimaticket usw. Aber es gibt keine Infragestellung dieser enormen Dynamik des Umstiegs auf E-Autos – „Der Energieverbrauch wächst halt“, heißt es dann. Aber: Wofür wächst er denn? Was steckt dahinter? Wir haben gar kein Wissen darüber, wofür Energie genutzt wird. Wir wissen nur, dass es halt irgendwie immer mehr wird. Digitalisierung – das große Versprechen der 90er Jahre – macht alles „sauber“. Das wurde damals als ökologische Lösung angepriesen. Heute wissen wir: Die Digitalisierung ist ein riesiges, dreckiges Problem, was die Produktion dieser Geräte wie auch ihren Stromverbrauch betrifft.
Solidarische Lebensweise und die sozial-ökologische Transformation
Deshalb, und so komme ich zu meiner vierten Überlegung, brauchen wir einen weitergehenden sozial-ökologischen Umbau, ein anderes Wohlstandsmodell. Ich bin keiner, der für Verzicht argumentiert, schon gar nicht auf einer Armutskonferenz. Das würde ich vielleicht bei der Industriellenvereinigung machen, denn die Reichen müssen sicher verzichten. Aber es geht aus meiner Sicht vor allem darum, die subjektiven Voraussetzungen und die gesellschaftlichen Bedingungen für eine hohe Lebensqualität zu schaffen. Eine hohe Lebensqualität ist nicht der achte Billigflug im Jahr oder das noch fettere Auto oder das E-Auto als Drittwagen. Sondern es geht darum, Mindeststandards von guten, auskömmlichen Lebensbedingungen zu schaffen, die nicht als Verzicht wahrzunehmen sind. Die Essenz des Postwachstums- oder Degrowth-Begriffs ist ein anderes Wohlstandsmodell, das bei den Bevölkerungsmehrheiten nicht als Verzicht wahrgenommen wird.
Wir brauchen in 20 Jahren oder in 15 Jahren, vielleicht auch schon in 10 Jahren – die Zeit läuft – ein völlig anderes Mobilitätssystem. Wenn das gelingen soll, muss es um mehr gehen als nur um E-Auto-Mobilität – es müssen massive Investitionen in den öffentlichen Verkehr stattfinden und es muss ein massiver Umbau der Raumstruktur erfolgen. Die Wege werden ja immer länger. Mein Kollege Heinz Högelsberger von der Arbeiterkammer Wien hat gezeigt, dass sich die Leute seit Jahrzehnten im Durchschnitt drei Stunden am Tag bewegen – zur Arbeit, zum Einkaufen, in der Freizeit usw. Sie werden dabei immer schneller, aber die Distanzen werden immer größer, weil die Funktionsorte unseres Lebens immer weiter auseinandergehen.
Ein anderes Feld ist die Ernährungsweise. Studien der FAO (Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) belegen seit vielen Jahren, dass wir raus müssen aus der industriellen Landwirtschaft, auch wenn das im Land des „Menschenrechts auf das tägliche Schnitzel“ ein riesiges Thema ist. Da sind wir wieder bei der Produktionsweise. Es geht ja nicht darum, den Schnitzelkonsum moralisch zu bewerten, sondern die Fleischfabriken müssen geschlossen werden – aus ethischen, aus sozialen und aus ökologischen Gründen, genauso, wie wir ja auch keine Kinderarbeit akzeptieren, genauso, wie wir sagen, SUVs sind okay, aber mit dem richtigen Panzer kann man halt doch nicht durch Salzburg fahren. Dafür gibt es Regeln. Und aus dem gleichen Grund muss es Regeln geben für Fleischfabriken.
Weiters geht es aus meiner Sicht um attraktive Narrative. Wie sieht denn ein autobefreites Salzburg oder Wien in 15 Jahren aus? Welche politischen Entscheidungen müssen heute getroffen werden? Das Aus für den Lobau-Tunnel ist deshalb so wichtig, weil es den Einstieg in den Umstieg schafft. Damit ist ja am Ende noch nicht so viel gewonnen, aber wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte über andere Verkehrs- und Mobilitätssysteme.
Ein weiterer Aspekt eines sozial-ökologischen und gerechten Wohlstandsmodells ist aus meiner Sicht das, was in der Forschung – Andreas Novy ist hier für Österreich besonders wichtig – als „sozial-ökologische Infrastruktur“ bezeichnet wird. Wir brauchen eine Infrastruktur, die ein gutes Leben ermöglicht und ein Stück weit unabhängig vom Geldbörserl ist. Wir haben ja in Österreich zum Glück noch eine sehr gute Gesundheitsversorgung. In Ländern, wo diese privatisiert ist, hängt es an meiner Kreditkarte, ob ich im Notfall eine Gesundheitsdienstleistung bekomme. Im Bildungssystem ist es genauso.
Trotz aller Kritik an einzelnen Aspekten (wie etwa an den Arbeitsverhältnissen) haben wir in Österreich für viele Menschen eine gute soziale Infrastruktur. Aber diese muss ausgebaut werden für jene Menschen, die in schwierigen Lebenslagen sind, die beispielsweise von Armut betroffen sind, damit auch sie die gesellschaftlichen Bedingungen haben, um auskömmlich leben zu können. Das ist die Idee der sozialen Infrastruktur neben der materiellen Infrastruktur. Aber dieses auskömmliche Leben muss sich auch der ökologischen Frage stellen. Traditionell heißt gesellschaftliche Teilhabe für die, ich sage mal jetzt bewusst, „Betonsozialdemokratie“: Auto, Öffis und auch noch ein billiger Flug ab Schwechat. Aber das geht nicht. Soziale und materielle Infrastruktur im Verkehrssektor sichert das Recht auf Mobilität – auf gute, günstige, sichere Mobilität und eine gute Anbindung, auf dem Land z. B. mit Sammeltaxis. Es muss ja nicht überall das Gleis hingelegt werden oder der Bus hinfahren. Es gibt viele Ideen, eine solche Mobilität ernst zu nehmen und politisch umzusetzen.
Eine sozial-ökologische Infrastruktur muss also sowohl sozialen als auch ökologischen Kriterien entsprechen. Dazu zählen ein gutes öffentliches Verkehrsnetz oder die Möglichkeit, sich auf individueller Ebene oder in der Mensa gut zu ernähren, mit sozial und regional produzierten Lebensmitteln. Außerdem sollte eine Stadtentwicklung, die sozialen Wohnungsbau fördert und für gemischte Stadtstrukturen sorgt, ausgeweitet werden.
Solidarische Produktions- und Lebensweise
Eine solidarische Produktions- und Lebensweise braucht nicht nur die Ermöglichung des guten Lebens für alle im Sinne von Mindeststandards. Sie benötigt auch Obergrenzen. Wir müssen uns gesellschaftlich darüber verständigen, dass bestimmte Dinge in dieser Gesellschaft nicht gehen. Es ist nicht zu akzeptieren, was die interessierte Gegenseite sagt, dass es „Verbotspolitik“ sei, was progressive Grüne oder eine progressive Sozialdemokratie machen. Das Freiheitsverständnis des Kapitalismus und der imperialen Lebensweise ist folgendes: „Ich lasse die Sau ’raus, weil ich es mir leisten kann, das ist Freiheit. Und misch dich da bitte nicht ein.“ Umgekehrt aber ist es richtig: Eine Freiheit, die die Gesellschaft und die Mitmenschen ernst nimmt, ist eine Freiheit, die nicht auf Kosten anderer und der Natur geht. Sie basiert nicht permanent auf Ausbeutung und einer imperialen Produktions- und Lebensweise.
Unterlassen heißt Genügsamkeit. Das Unterlassen im Sinne der Freiheitsschreier hingegen meint: Der Staat soll sich bloß nicht einmischen. Das ist eine negative Freiheit, eine Freiheit im Sinne von „Lass mich in Ruhe! Wenn ich den SUV als Zweitwagen will, ist das doch meine Sache, wenn ich das Geld habe. Das Geld habe ich doch verdient.“ Das ist also ein völliges Weggehen von den gesellschaftlichen Bedingungen.
Eine solidarische Produktions- und Lebensweise muss damit einhergehen, dass in vielen Bereichen die Profitdominanz zurückgedrängt wird. Zum Beispiel sollten die Städte umsichtiger entwickelt werden. Natürlich sollte es Privatinvestitionen in Städten geben. Aber die Logik, dass Städte jetzt weiterentwickelt werden, weil vor allem privat und in entsprechende Größen von Wohnungen investiert wird, was auch nicht sehr ökologisch ist, das muss zurückgedrängt werden.
Das alles bündelt sich im Prinzip der Sorge. Nicht mehr die Profitökonomie steht im Zentrum, sondern die Sorgeökonomie, die Care-Ökonomie – die Sorge für uns selbst, für andere, für die Gesellschaft und für die Natur.
Ein radikaler, also ein an die Wurzeln gehender, ein an die Profitwurzeln, die Expansionswurzeln, die Machtwurzeln gehender Umbau der Produktions- und Lebensweise geht auch mit einem Verlernen einher. Die dominante Debatte dreht sich weiterhin um technologische und soziale Innovation, doch dabei kommt man schnell an Grenzen. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Diskussion mit dem bekannten deutschen Ökonomen und früheren Vorsitzenden des Rats der „Wirtschaftsweisen“ Lars Feld zu Wachstum und Wachstumskritik. Er hatte auf alle Probleme und Krisen eine Antwort – die Antwort sei Innovation und technologischer Fortschritt, ganz einfach. Aber die Tatsache, dass wir als Gesellschaft in einer tiefen Krise sind, dass wir auch ganz andere Ansätze brauchen, jenseits der Logik von Wachstum und technischer sowie sozialer Innovation, wird zu wenig berücksichtigt. Es geht auch um folgende Frage: Wie können wir als Gesellschaft manche Gewohnheiten hinter uns lassen?
Harald Welzer, der Sozialpsychologe, oder auch Niko Paech sprechen von Ruinen des Fortschritts. Wie können wir Ruinen des Fortschritts als Ruinen deklarieren? Das heißt nicht, dass wir gar keine Autos mehr haben werden.





























