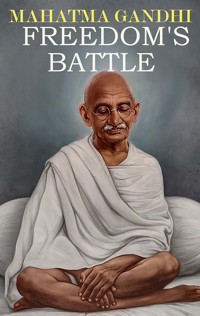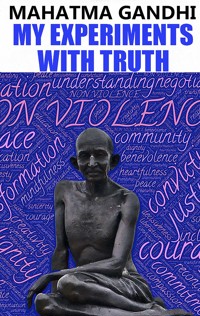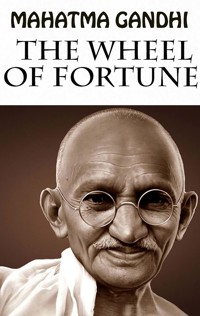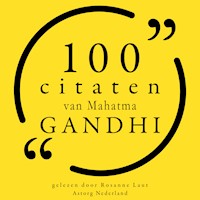12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Sei du selbst die Veränderung.« - Dieses Buch enthält alle wichtigen Texte des großen Menschenrechtlers.
Mahatma Gandhi setzte sich mit seinen Reden für ein unabhängiges Indien ein. Dies tat er mit einfachen und persönlichen Worten, die bis in die heutige Zeit ihre Gültigkeit haben. Die Texte und Gedanken Gandhis sind nicht abgehoben, sie führen nicht aus der Gesellschaft hinaus, sondern mitten in sie hinein und zeigen, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Gleichwohl geben sie uns Orientierung in diesen schwierigen Zeiten.
Zahlreiche Menschen wurden durch seine Worte inspiriert. Darunter u.a. Martin Luther King und Nelson Mandela.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mahatma Gandhi setzte sich mit seinen Reden für ein unabhängiges Indien ein. Dies tat er mit einfachen und persönlichen Worten, die bis in die heutige Zeit ihre Gültigkeit haben. Die Texte und Gedanken Gandhis sind nicht abgehoben, sie führen nicht aus der Gesellschaft hinaus, sondern mitten in sie hinein und zeigen, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Gleichwohl geben sie uns Orientierung in diesen schwierigen Zeiten.
Zahlreiche Menschen wurden durch seine Worte inspiriert. Darunter u. a. Martin Luther King und Nelson Mandela.
MOHANDASKARAMCHANDGANDHI
Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg
Herausgegeben von Franziska Roosen
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.Copyright © 2019 Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenDie Texte diese Buches sind aus folgenden Ausgaben entnommen: Mahatma Gandhi, Ausgewählte Werke, Hg. von Shriman Narayan, bearbeitet von Wolfgang Sternstein. Mit einem Nachwort von Gita Dharampal-Frick. Aus dem Englischen von Brigitte Luchesi und Wolfgang Sternstein, © Wallstein Verlag, Göttingen 2011. Umschlag: Weiss Werkstatt, MünchenSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-24574-0V001www.koesel.de
Inhalt
Einleitung
Familien- und Zeitzeugnisse
Menschenrechte
(Welt)frieden und Freiheit
Satyagraha (Festhalten an der Wahrheit)
Ahimsa (Gewaltlosigkeit)
Religion und Glauben
Ernährung und Gesundheit
Ansichten und Beobachtungen
Aphorismen
Einleitung
Mohandas Karamchand Gandhi wurde vor 150 Jahren in einer kleinen indischen Hafenstadt geboren, in einer Zeit, als Indien noch zum englischen Kolonialreich gehörte, Zylinder Mode waren – Gandhi kaufte als Student in London einen – und eilige Nachrichten per Telegramm verschickt wurden. Und trotzdem ist Gandhi in vielen seiner Gedanken und Ansichten so aktuell, als sei er ein Zeitgenosse. In die Weltgeschichte eingegangen ist Gandhi wegen seines politischen Engagements als Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung und Verfechter des gewaltfreien Widerstands, was ihm den Ehrentitel »Mahatma« einbrachte und fast den Friedensnobelpreis. (Fast, da diese Auszeichnung nicht posthum verliehen wird, weswegen das Komitee in Gandhis Todesjahr 1948 ganz darauf verzichtete, den Preis zu vergeben.)
Tatsächlich aber war Gandhi noch viel mehr als der Weltverbesserer und Freiheitskämpfer, als den wir ihn kennen. So tat er sich unter anderem hervor als Rechtsanwalt, Sanitäter, Vegetarier, Selbstversorger, Frauenrechtler, Lehrer, Weltreisender und Schriftsteller. Dieser letzten Tätigkeit verdanken wir die Möglichkeit, uns einen umfassenden und authentischen Eindruck von seinem Leben, Denken und Fühlen zu verschaffen.
Der vorliegende Band versammelt eine Auswahl von Texten, die Gandhi im Laufe der Jahre verfasst hat und die von der Aktualität und Vielseitigkeit seiner Persönlichkeit zeugen.
Familien- und Zeitzeugnisse
Vorbereitung und Feierlichkeiten anlässlich der Kinderhochzeit
Wir waren, wie gesagt, drei Brüder. Der erste war bereits verheiratet. Die Familienältesten beschlossen, meinen zweiten Bruder, der zwei oder drei Jahre älter als ich war, einen etwa ein Jahr älteren Cousin und mich gleichzeitig zu verheiraten. An unser Wohlergehen, ganz zu schweigen von unseren Wünschen, wurde dabei nicht gedacht. Was allein zählte, waren die praktischen und wirtschaftlichen Erwägungen der Ältesten.
Eine Eheschließung ist bei Hindus keine einfache Angelegenheit. Häufig ruinieren sich die Eltern von Braut und Bräutigam dabei. Sie verschwenden ihr Vermögen, sie verschwenden ihre Zeit. Monate vergehen über den Vorbereitungen – für die Herstellung von Kleidern und Schmuck und die Planung der Mahlzeiten. Jeder versucht, den anderen hinsichtlich der Anzahl und Vielseitigkeit der angebotenen Speisen zu übertreffen. Die Frauen singen sich – unabhängig davon, ob sie eine Stimme haben oder nicht – heiser, ja sogar krank und stören die Ruhe der Nachbarn. Diese wiederum nehmen den ganzen Tumult und Lärm und all den Schmutz und Dreck, den die Festessen hinterlassen, widerspruchslos hin, weil sie wissen, dass die Zeit kommen wird, da sie das Gleiche tun werden.
Die Ältesten meiner Familie hielten es für das Beste, diese ganzen Scherereien alle auf einmal hinter sich zu bringen. Weniger Kosten und mehr Aufsehen. Denn man konnte freigebig mit dem Geld umgehen, wenn es nur einmal und nicht dreimal ausgegeben werden musste. Mein Vater und mein Onkel waren beide alt, und wir waren die letzten Kinder, die sie zu verheiraten hatten. Vermutlich wollten sie noch ein letztes Mal in ihrem Leben ein großes Fest miterleben. Angesichts all dieser Erwägungen entschied man sich für eine dreifache Hochzeit, für deren Vorbereitung wie gesagt Monate benötigt wurden.
Es waren nur diese Vorbereitungen, die uns einen Hinweis auf das kommende Ereignis gaben. Ich glaube nicht, dass es für mich mehr bedeutete als die Aussicht auf neue Kleider, Trommelklang, Hochzeitszüge, reichhaltige Mahlzeiten und ein fremdes Mädchen, mit dem man spielen konnte. Die sinnliche Begierde kam später. […]
Damals hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass ich meinen Vater einmal dafür heftig kritisieren würde, dass er mich als Kind verheiratet hat. Alles schien an jenem Tag richtig, gut und angenehm. Es gab auch von meiner Seite aus den dringenden Wunsch, verheiratet zu werden. Und da alles, was mein Vater tat, mir damals über jeden Tadel erhaben schien, sind mir diese Dinge frisch im Gedächtnis. Ich kann mir sogar heute noch vor Augen führen, wie wir auf unserem Hochzeitspodest saßen, wie wir die saptapadi (ein indisches Hochzeitsritual) vollführten, wie wir, die Neuverheirateten, einander süßen kansar in den Mund steckten und wie wir zusammenzuleben begannen. Und, ach, jene erste Nacht! Zwei unschuldige Kinder stürzten sich völlig unwissend in das Meer des Lebens. Die Frau meines Bruders hatte mich sorgfältig darauf vorbereitet, was ich in der ersten Nacht zu tun hatte. Ich weiß nicht, wer meine Frau vorbereitet hat. Ich habe sie nie danach gefragt und werde das auch jetzt nicht tun. Der Leser kann davon ausgehen, dass wir zu nervös waren, um einander ins Gesicht zu sehen. Auf jeden Fall waren wir zu befangen. Wie sollte ich mit ihr reden und was sollte ich sagen? Die Vorbereitung konnte mir da nicht weiterhelfen. Tatsächlich ist in Fällen wie diesem eine Vorbereitung nicht wirklich nötig. Die Eindrücke aus dem vorigen Leben sind so stark, dass jede Vorbereitung überflüssig wird. Wir lernten einander kennen und frei miteinander zu sprechen. Wir waren gleichaltrig. Aber sehr bald schon beanspruchte ich die Rechte eines Ehemannes. (I, 23 ff.)
Von Jugendsünden und Selbstmordplänen
Ein Verwandter und ich hatten mit dem Rauchen begonnen. Nicht dass wir uns eine positive Wirkung davon versprachen oder den Zigarettengeruch besonders angenehm fanden. Wir glaubten einfach nur, dass es Spaß machen würde, Rauchwolken aus dem Mund auszustoßen. Mein Onkel rauchte, und als wir das sahen, meinten wir, ihm nacheifern zu müssen. Aber wir hatten kein Geld. Deshalb begannen wir, die vom Onkel fortgeworfenen Zigarettenkippen aufzusammeln.
Doch oft gab es keine Kippen, ohnehin ließ sich mit ihnen nur wenig Rauch herstellen.
So entwendeten wir Kleingeld aus der Barschaft des Dieners, um indische Zigaretten kaufen zu können. Allerdings wussten wir nicht, wo wir sie aufbewahren sollten. Wir konnten natürlich nicht in Gegenwart der älteren Familienmitglieder rauchen. Mit dem gestohlenen Geld vermochten wir uns ein paar Wochen lang irgendwie zu versorgen. In dieser Zeit hörten wir, dass die Stängel einer bestimmten Pflanze porös waren und wie Zigaretten geraucht werden konnten. Wir verschafften sie uns und rauchten nun auf diese Weise.
Diese Aktivitäten stellten uns aber keineswegs zufrieden. Wir litten immer mehr unter dem Verlangen nach Unabhängigkeit. Uns war es unerträglich, nichts ohne die Erlaubnis der Älteren unternehmen zu können. Schließlich beschlossen wir, aus schierer Empörung Selbstmord zu begehen.
Wie aber sollten wir das anstellen? Woher konnten wir Gift bekommen? Wir hatten gehört, dass Daturasamen ein wirksames Gift seien. So machten wir uns auf, sie im Dschungel zu suchen, und fanden sie auch. Der Abend galt als die glücksträchtige Zeit. Wir gingen zum Kedarji Mandir, füllten die Tempellampe mit Ghi, vollzogen darshan und suchten uns einen abgelegenen Winkel. Doch da verließ uns der Mut. Angenommen wir starben nicht auf der Stelle? Und was nützte es uns eigentlich, wenn wir uns umbrachten? Warum sich nicht doch lieber mit der Abhängigkeit abfinden? Trotzdem schluckten wir zwei, drei Samen. Mehr wagten wir nicht. Wir überlebten beide und entschieden, zum Ramji Mandir zu gehen, um uns zu beruhigen und den Gedanken an Selbstmord aufzugeben.
Ich begriff, dass es sehr viel schwerer ist, einen Selbstmord tatsächlich zu begehen, als ihn nur zu planen. Seitdem hat es kaum oder gar keinen Eindruck auf mich gemacht, wenn jemand mit Selbstmord drohte.
Der Einfall, Selbstmord zu begehen, führte am Ende dazu, dass wir beide aufhörten, Kippen zu rauchen und dem Diener Kleingeld für Zigaretten zu stehlen. (I, 41 f.)
Der missglückte Versuch, ein englischer Gentleman zu werden
Ich wollte mich um geschliffene Manieren bemühen und meinen Vegetarismus dadurch wettmachen, dass ich andere Fertigkeiten erlernte, die einen Mann für die gehobene Gesellschaft qualifizieren. Und deshalb unternahm ich den völlig unmöglichen Versuch, ein englischer Gentleman zu werden.
Meine Anzüge im Stil der Bombay-Mode eigneten sich meiner Ansicht nach nicht für die englische Gesellschaft, weshalb ich mir neue in den Army- und Navy-Stores besorgte. Ich schaffte mir auch einen Zylinder an; er kostete neunzehn Shilling, ein damals extrem hoher Preis. Damit nicht genug, verschwendete ich zehn Pfund für einen Abendanzug aus der Bond Street, dem Londoner Modezentrum. Meinen guten, großzügigen Bruder veranlasste ich, mir eine doppelte Uhrkette aus Gold zu schicken. Da es nicht korrekt war, eine fertig gebundene Krawatte zu tragen, erlernte ich die Kunst, sie mir zu binden. Zu Hause in Indien war ein Spiegel ein Luxus gewesen, den ich nur an den Tagen gebrauchen durfte, an denen ich vom Familienbarbier rasiert wurde. Hier vergeudete ich täglich zehn Minuten vor einem großen Spiegel, um meine Krawatte zu binden und mir einen korrekten Scheitel zu ziehen. Mein Haar war ziemlich widerspenstig, und es erforderte täglich einen regelrechten Kampf mit der Bürste, um es in Form zu bringen. Bei jedem Auf- und Absetzen des Hutes fuhr meine Hand automatisch zum Kopf, um die Haare glatt zu streichen, ganz zu schweigen von der anderen zivilisierten Handbewegung, die man zum gleichen Zweck ausführte, wenn man sich in feiner Gesellschaft befand.
Als ob dies nicht genügt hätte, mich perfekt aussehen zu lassen, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf weitere Details, die angeblich unverzichtbar waren, um ein englischer Gentleman zu werden. Man sagte mir, ich müsse Unterricht in Tanz, Französisch und Vortragskunst nehmen. Französisch war nicht nur die Sprache des benachbarten Frankreich, sondern auch die lingua franca des Kontinents, den ich gerne bereisen wollte. Ich beschloss, Tanzstunden zu nehmen, und zahlte drei Pfund für einen Kurs. Es waren ungefähr sechs Stunden, verteilt über drei Wochen, die ich absolvierte, aber ich war einfach außerstande, irgendeine rhythmische Bewegung hinzubekommen. Ich konnte dem Klavier nicht folgen und deshalb auch den Takt nicht halten. Was sollte ich also tun? Der Einsiedler in der Fabel schafft sich eine Katze an, um die Mäuse fernzuhalten, dann eine Kuh, um Milch für die Katze zu haben, und schließlich einen Mann, um die Kuh zu hüten, und so weiter. Ähnlich der Entourage des Einsiedlers erweiterte sich auch mein ehrgeiziges Vorhaben. Ich meinte, Geigespielen lernen zu müssen, um mein Verständnis für westliche Musik zu entwickeln. So investierte ich drei Pfund in den Kauf einer Geige und noch etwas mehr in Unterrichtsstunden. Ich suchte mir einen dritten Lehrer, der mir Vortragskunst beibringen sollte, und zahlte ihm eine Guinea als Vorschuss. Als Lehrbuch empfahl er mir Bells Standard Elocutionist, das ich mir auch anschaffte. Ich begann mit einer Rede von Pitt.
Doch bei Mr. Bell hörte ich plötzlich alle Glocken läuten und erwachte.
Ich würde nicht ein ganzes Leben in England verbringen, hielt ich mir vor. Was brachten mir Kenntnisse in Vortragskunst ein? Und wie sollten Tanzkünste aus mir einen Gentleman machen? Geigespielen konnte ich auch in Indien lernen. Ich war ein Student und musste mein Studium fortsetzen. Ich sollte die Zulassung zu den Inns of Court, den Innungen der Barrister in London, betreiben. Wenn mein Charakter aus mir einen Gentleman machte, umso besser. Wenn nicht, dann musste ich eben auf dieses ehrgeizige Ziel verzichten. (I, 69)
Gandhi als Wäscher und Barbier
Ich hatte zunächst ein Leben voller Bequemlichkeiten und Komfort geführt [als Barrister in Südafrika], doch dieses Experiment dauerte nicht lange. Obwohl ich das Haus mit Sorgfalt eingerichtet hatte, hing mein Herz nicht daran. Kaum hatte ich mich auf dieses Leben eingelassen, fing ich auch schon an, die Ausgaben zu verringern. Die Rechnung des Wäschers war hoch, und da er außerdem nicht pünktlich war, reichten mir meine zwei oder drei Dutzend Hemden und Kragen nicht aus. Der Kragen musste täglich und das Hemd, wenn nicht täglich, so doch mindestens jeden zweiten Tag gewechselt werden. Das bedeutete eine doppelte Ausgabe, die mir unnötig schien. Um sie einzusparen, legte ich mir eine Waschausrüstung zu. Ich kaufte ein Buch über das Waschen, studierte diese Kunst und brachte sie auch meiner Frau bei. Das bedeutete natürlich Mehrarbeit, doch da sie etwas Neues war, machte sie Spaß.
Ich werde nie den ersten Kragen vergessen, den ich selbst wusch. Ich hatte mehr Stärke als nötig verwendet, das Bügeleisen war nicht heiß genug und ich hatte es aus Angst, den Kragen zu versengen, zu wenig aufgedrückt. Das Ergebnis war, dass der Kragen zwar recht steif war, die überflüssige Stärke jedoch ständig abbröckelte. Mit diesem Kragen um den Hals ging ich zum Gericht und machte mich so zum Gespött meiner Barrister-Kollegen. Doch schon damals konnte ich unempfindlich gegen Spöttelei sein.
»Nun«, sagte ich, »das ist mein erster Versuch im Kragenwaschen, deshalb das Zuviel an Stärke. Die stört mich aber nicht. Außerdem ist es doch erfreulich, dass es Ihnen so viel Heiterkeit verschafft hat.«
[…]
Wie ich mich aus der sklavischen Abhängigkeit vom Wäscher befreite, so entledigte ich mich auch der Abhängigkeit vom Barbier. Jeder, der nach England geht, lernt dort mindestens, wie man sich rasiert, nicht aber – soweit ich weiß – wie man sich die Haare schneidet. Ich musste auch das lernen. Ich ging einmal in Pretoria zu einem englischen Friseur. Er lehnte es voller Verachtung ab, mir die Haare zu schneiden. Natürlich war ich beleidigt, kaufte aber sofort eine Schere und schnitt mir vor dem Spiegel die Haare. Vorne gelang mir das ganz gut, aber hinten verdarb ich alles. Die Freunde im Gericht schüttelten sich vor Lachen.
»Was ist denn mit Ihren Haaren los, Gandhi? Waren da die Ratten dran?«
»Nein. Der weiße Friseur wollte sich nicht dazu herablassen, meine schwarzen Haare zu berühren«, erwiderte ich. »Deshalb habe ich sie mir lieber selbst geschnitten, wie schlecht auch immer.« (I, 237 f.)
Erfahrungen als Reisender der dritten Klasse
Als Dritte-Klasse-Reisender zog ich meistens die gewöhnlichen Züge den Postzügen vor, da ich wusste, dass letztere voller und teurer waren.
Die Abteile der dritten Klasse sind heute praktisch ebenso schmutzig und die sanitären Einrichtungen ebenso schlecht wie damals. Vielleicht gibt es jetzt hie und da einige Verbesserungen, doch die Unterschiede in der Ausstattung der ersten und dritten Klasse stehen in keinem Verhältnis zum Preisunterschied zwischen den beiden Klassen. Dritte-Klasse-Reisende werden wie Schafe behandelt, und der ihnen gebotene Komfort entspricht dem für Schafe. In Europa reiste ich dritter Klasse – und nur einmal erster, bloß um sie kennenzulernen – , aber ich bemerkte dort keinen derartigen Unterschied zwischen der ersten und der dritten Klasse. In Südafrika sind die Reisenden dritter Klasse meist Schwarze, die Einrichtungen in dieser Klasse sind dort jedoch besser als hier [in Indien]. In Südafrika sind in manchen Landesteilen die Dritte-Klasse-Abteile mit Schlafmöglichkeiten und gepolsterten Sitzen ausgestattet. Es wird auch geregelt, wie viele Reisende darin Platz finden können, um eine Überfüllung zu vermeiden, während ich hier feststellte, dass die festgesetzte Höchstzahl gewöhnlich überschritten wird.
Die Gleichgültigkeit der Eisenbahnbehörden gegenüber der Bequemlichkeit von Dritte-Klasse-Reisenden, zusammen mit den unsauberen und gedankenlosen Gewohnheiten der Reisenden selbst machen die Fahrt in der dritten Klasse für einen Menschen, der auf Reinlichkeit hält, zur Qual. Zu den unerfreulichen Gewohnheiten gehören normalerweise: die Entsorgung des Abfalls gleich auf den Abteilboden, das Rauchen zu allen Zeiten und an allen Orten, das Betel- und Tabakkauen, was den ganzen Wagen zu einem Spucknapf macht, Rufen und Schreien, schmutzige Reden, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse oder die Bequemlichkeit der Mitreisenden. (I, 266 f.)
Zeuge des Zulu-»Aufstandes«
Auch als ich glaubte, ich hätte mich nun dauerhaft in Johannesburg niedergelassen, gab es für mich kein beständiges Leben. Gerade als ich meinte, in Ruhe leben zu können, trat ein unerwartetes Ereignis ein. Die Zeitungen brachten die Nachricht vom Ausbruch eines »Aufstandes« der Zulus in Natal. Ich hegte keinerlei Groll gegen die Zulus, sie hatten den Indern nichts getan. Was den »Aufstand« betraf, hatte ich Zweifel. Aber ich glaubte damals noch, dass das britische Empire zum Wohl der Welt bestehe. Ein aufrichtiges Loyalitätsgefühl hinderte mich sogar daran, dem Empire Schlechtes zu wünschen. […]
Da ich enge Verbindungen zu Natal hatte, betrachtete ich mich als Bürger von Natal. So schrieb ich an den Gouverneur und erklärte meine Bereitschaft, wenn nötig ein indisches Ambulanzkorps aufzustellen. In seiner Antwort, die umgehend eintraf, nahm er das Anerbieten an.
[…] Unser Korps leistete etwa sechs Wochen lang aktiven Dienst. Als wir den Schauplatz des »Aufstandes« erreichten, stellte ich fest, dass es dort nichts gab, was die Bezeichnung »Aufstand« gerechtfertigt hätte. Es gab keinen sichtbaren Widerstand. Eine gewisse Unruhe war als Aufstand ausgegeben worden, weil ein Zulu-Häuptling dazu aufgefordert hatte, eine neue, seinem Volk aufgedrückte Steuer nicht zu zahlen, und einen Feldwebel, der die Steuer eintreiben sollte, mit einem Speer getötet hatte. Mein Herz war jedenfalls auf der Seite der Zulus, und ich war froh, als ich bei der Ankunft im Hauptquartier erfuhr, dass wir in erster Linie die verwundeten Zulus versorgen sollten. Der diensthabende Stabsarzt hieß uns willkommen. Er sagte, die Weißen seien nicht bereit, die verwundeten Zulus, deren Wunden eiterten, zu pflegen, und er wisse nicht mehr, was er tun solle. Er begrüßte unsere Ankunft als Gottesgeschenk für diese unschuldigen Menschen, stattete uns mit Verbandszeug, Desinfektionsmittel usw. aus und brachte uns zum improvisierten Lazarett. Die Zulus waren über unser Kommen hocherfreut. Die weißen Soldaten sammelten sich immer wieder am Zaun, der uns von ihnen trennte, und versuchten, uns davon abzubringen, die Wunden zu versorgen. Da wir nicht auf sie achteten, gerieten sie in Wut und beschimpften die Zulus in unsagbarer Weise.
[…] Die unserer Obhut unterstellten Verwundeten waren nicht im Kampf verwundet worden. Ein Teil von ihnen war als Verdächtige gefangen genommen worden. Der General hatte sie zur Auspeitschung verurteilt. Davon hatten sie schwere Wunden davongetragen, und da diese nicht behandelt worden waren, eiterten sie nun. Die anderen waren verbündete Zulus. Obwohl man ihnen Abzeichen gegeben hatte, um sie vom »Feind« unterscheiden zu können, waren sie von den Soldaten irrtümlich angeschossen worden. […]
Der Zulu-»Aufstand« bot mir viele neue Erfahrungen und reichlich Stoff zum Nachdenken. Der Burenkrieg hatte mir die Gräuel des Krieges nicht annähernd so drastisch vor Augen geführt wie nun dieser »Aufstand«. Das war kein Krieg, sondern eine Menschenjagd. Diese Auffassung teilten auch viele Engländer, mit denen ich ins Gespräch kam. Es war schwer erträglich, allmorgendlich Berichte darüber zu hören, wie die Soldaten eine Salve nach der anderen auf unschuldige Dörfer abgegeben hatten, und dann mit diesen Schützen zusammenzuleben. Doch ich stand es durch, vor allem auch deshalb, weil die Aufgabe unseres Korps ausschließlich in der Pflege verwundeter Zulus bestand. Ohne uns, das war mir ganz deutlich, wären sie unversorgt geblieben. Unsere Tätigkeit beruhigte daher mein Gewissen. (I, 342 ff.)
Verhältnisse in indischen Dörfern (Champaran in den 1910er-Jahren)