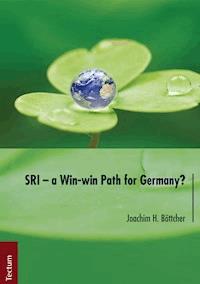Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Herbst 1920. Zürich wird von grausamen Ritualmorden eines satanischen Zirkels erschüttert. Ermordet werden 13jährige Kinder aus ärmlichen Verhältnissen. Die Leichen sind die an sakralen Orten inszenierten Abbilder bestimmter Tarotkarten. Mit dem Fall betraut wird Thomas Schnyder, erfahrener Ermittler der Zürcher Kantonspolizei. Was hat es damit auf sich? Welche Rollen spielen Franziska Renschler von der Waidt, der Rechtsmediziner Prof. Dr. Hansruedi Vögeli, der Fotograf Jakob Büchsenstein, die schöne Schwester Petula oder die äußerst schrullige Madame Aroksé? Und was hat der reiche Grieche Vasilios Dogsinatas mit all dem zu schaffen? Eine spannende Mischung aus alles verachtender Macht, gefühlloser Gewalt, lasterhaften Exzessen und manischen Süchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Freund Volker Pleil. Du bist und bleibst die coolste Socke auf dem Planeten. Baba forever!
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
1
Der Oktobernachmittag war aussergewöhnlich sonnig. Serina spielte ein wenig lustlos mit ihrem Laufreifen auf dem Feldweg am Waldrand.
Normalerweise rannten sie und ihre beste Freundin Regula ihren Reifen solange hinterher, bis sie völlig ausser Puste waren. Immer und immer wieder trieben sie geschickt ihre Reifen mit Stockhieben vor sich her. Schneller und immer schneller.
Normalerweise.
Normalerweise liessen sie sich auch nach Atem ringend zu guter Letzt lachend auf eine Bank unter einem dicken Baum fallen, der majestätisch an einer Weggabelung thronte.
Es war ihre Bank.
Hier spielten sie immer.
Nun schon seit vielen Jahren.
Seit sie sich in der Volksschule kennengelernt hatten. Fast jeden Tag. Hier unter dem Baum war ihr Platz. Im Sommer spendete er ihnen Schatten. Überraschte der Regen sie, war es unter ihm einigermassen trocken. War eine von ihnen traurig, spendete der Baum neben den aufmunternden Worten der Freundin zusätzlichen Trost. Im Sommer lagen sie gerne unter ihm und schauten einfach nur nach oben. Schauten sich das Glitzern der Sonnenstrahlen an, die sich über ihren Köpfen einen Weg durch das Blattwerk der mächtigen Krone bahnten.
Dann war es perfekt.
Normalerweise jedenfalls.
In letzter Zeit war gar nichts mehr perfekt. Ständig musste Regula ihrer Mutter in der Küche helfen. Seit auch sie wie Serina dreizehn geworden war, passierte das immer öfter.
»Doofe Kuh!«, dachte Serina bei sich.
Inzwischen war sie an ihrem Baum angekommen und liess sich ein wenig frustriert auf die Bank unter dem Baum plumpsen.
So richtig langweilig war ihr. Warum musste Regula ausgerechnet heute in der Küche helfen? Es war doch so schön. Serina stützte die Ellenbogen auf die Knie. Nichts. Ihr wollte einfach nichts einfallen, was sie alleine und ohne ihre beste Freundin spielen könnte.
»Du weisst doch, wie sehr meine Mama sich aufregt, wenn ich ihr nicht zur Hand gehe«, hatte Regula flüsternd zu ihr gesagt.
Dann liess sie Serina einfach vor der Tür stehen. Einfach so. Und ob sie das wusste. Das letzte Mal hatte es eine wahre Schimpfkanonade gegeben, als Regula gerade mal eine halbe Stunde zu spät nach Hause gekommen war. Ihre Mutter hatte ihr ordentlich eine gescheuert. Mit roter Wange weinend dastehend hatte sie zu allem Überfluss sogar noch eine Woche lang Stubenarrest bekommen. Ihre Mutter war ziemlich streng. Und das nur, weil ausgerechnet sie und ihr Mann die Beiz im Dorf betrieben. Ständig musste die arme Regula Kartoffeln schälen, aus denen dann für die hungrigen Gäste Rösti zubereitet wurde.
Sollten sie sich doch einfach ein Brot schmieren!
Serinas Mutter war anders. Das einzige, was sie aufregte, war, wenn sie abends zu spät nach Hause kam. Da wurde auch sie böse.
Zumindest ein bisschen.
»Um sechs Uhr gibt es Nachtessen«, hatte sie ihr noch nachgerufen, als sie mit dem Laufreifen davonhopste.
In der Ferne schlug wie auf Bestellung die Kirchturmglocke. Sie zähle mit. Fünf Schläge. Ein bisschen Zeit blieb ihr also noch, ehe sie aufbrechen musste.
Sie griff unter die Bank und holte einen verwitterten Blechkasten hervor, den Regula und sie dort immer versteckten. Hierin bewahrten beide ihre Schätze und Geheimnisse auf.
Viel war es nicht: Eine kleine Miniaturpuppe, die nur noch ein Bein hatte, bunte Haargummis und ein paar Messingknöpfe. Und dann waren da noch ihre kleinen Notizbüchlein, in die beide Mädchen ihre intimsten Gedanken schrieben.
Regula gehörte das blaue.
Gerade wollte Serina ihr rotes Büchlein öffnen, als ihr unbehaglich wurde. Plötzlich überkam sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Ihr wurde es unheimlich. Sie schaute sich um. Nichts. Weit und breit war niemand zu sehen. Sie blieb eine Weile schweigend sitzen und lauschte.
Stille – sie war ganz sicher allein.
Just in dem Moment, als sie das Büchlein aufschlug, zog es sie mit einem Ruck empor.
Sie wollte schreien, doch ihre Stimme versagte. Zu eng war die Schlinge bereits um ihren Hals. Zog sich immer fester zusammen. Raubte ihr den Atem.
Ihre Hände zerrten an der Schlinge um ihren Hals, versuchten sie zu lösen. Sie strampelte mit ihren Beinen, kickte nach unten, suchte nach Halt, spürte jedoch, dass ihr der Boden unter ihren Füssen fehlte. Verzweiflung packte sie. Mit schwindenden Sinnen blickte sie nach oben, blickte in die dunklen Augen ihres Peinigers. Gefühllos schaute er auf sie herab. Kalt und berechnend. Er lag auf einem dicken Ast und zog sie immer weiter empor. Wie eine Gottesanbeterin hatte er seinem Opfer aufgelauert, um dieses im entscheidenden Moment zu packen. Ihre Sicht trübte sich allmählich ein. Der Blick wurde immer verschwommener.
Schliesslich fehlte ihren Händen die Kraft, an der Schlinge zu zerren. Sie folgten den Gesetzen der Schwerkraft und fielen schlaff baumelnd zu ihren Seiten herab. Ein angenehmes Licht tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Es war wie ein sich drehender Tunnel. Sollte sie durch den nun hindurchschreiten? Plötzlich wurde Serina klar, dass sie sich zum Abendbrot definitiv verspäten würde.
Was würde Mama wohl sagen?
Dann wurde sie ohnmächtig.
Und alles war schwarz.
2
Er schnaufte bereits voller Vorfreude, als er das immer gleiche Ritual begann. Mit dem Zeigefinger seiner linken Hand liess er zunächst zittrig die Streichholzschachtel aufgleiten. Ausgemergelt und grüngelblich bleich erschien deren Haut, mit langgliedrigen, leicht gekrümmten Fingern.
Voller Erwartung aufgrund des bevorstehenden, immer gleichen Rituals. Er entnahm ein Zündholz und setzte es an der sandigen Reibefläche an. Bevor er es aufflammen liess, um damit seine Dienerinnen zu rufen, schaute er sich um. Der Raum glich eher einem Verliess denn einem Zimmer. Geradezu lächerlich niedrig. Die Deckenhöhe bestenfalls vergleichbar mit der eines Kriechkellers. Er vermochte einigermassen, darin zu stehen.
In der Mitte stand ein schlichter Gartentisch aus verwittertem Kirschholz, dessen ursprüngliche Anmut und Schönheit bereits vom Regen hinweg gewaschen wie von der Sonne hinfort gesengt waren.
Vor dem Tisch stand ein dreibeiniger hölzerner alter Melkschemel, von dessen runder Sitzfläche seitlich die bis zur letztlichen Unbrauchbarkeit abgenutzte Garnitur zum Umschnallen aus Leder herunterhing.
Auf dem Tisch befand sich ein Kerzenleuchter aus Messing, der jedoch schon seit einigen Wochen nur noch eine Kerze, inzwischen ein Stummel, gesehen hatte. Die anderen hatten sie ihm weggenommen. Ebenso die Bücher, die er so liebte und deren Lektüre ihm eine vorübergehende Flucht aus seinem kümmerlichen Dasein in der Welt dusterer Schatten ermöglichte.
Das letzte Tageslicht der gerade untergehenden Sonne schien durch das winzig kleine, mit verwitterten Stäben vergitterte Fenster auf die teilweise mit schwarzem Schimmel überzogene meterdicke Wand auf der gegenüberliegenden Seite. In Kürze würde die Dunkelheit der bevorstehenden Nacht die Oberhand über den Raum gewinnen.
Die Dunkelheit, vor der er sich so fürchtete und deren Dämonen, die sich mit ihren grässlichen Fratzen in seine Träume frassen, um ihn schliesslich schweissgebadet aus dem Schlaf zu reissen.
Er liess seinen Blick weiter wandern, bis seine Augen in der Ecke auf einem Haufen achtlos hingeworfener Kleider zur Ruhe kamen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie ihm auch diese nehmen würden.
Und den Tisch.
Und den Schemel.
Zu guter Letzt auch den mit trockenem Buchenlaub gefüllten Kartoffelsack, der ihm in der Ecke mit den Kleidern als Schlafstätte diente, seit sie ihm Bett und Matratze fortgenommen hatten. Sie hatten ihn gezwungen zuzusehen, wie sie beides zu seinem Entsetzen vor seinen Augen verbrannten.
Beim Gedanken daran entfuhr ihm ein Laut.
Wie das Gurgeln sich in einen engen Abfluss hinunter schlingernden Wassers.
Eisig.
Kalt und zurückweisend.
Wie die Umwelt, die ihn umgab und zu dem gemacht hatte, was er heute war. Hätte er seinen Blick von den Flammen abgewandt, die seine Schlafstätte frassen, hätte er sicher wieder tagelang auf sein Essen verzichten müssen. Das Ausbleiben von Nahrung setzte ihm weniger zu. Das immer regelmässigere Ausüben seines kleinen Rituals hatte den Hunger in ihm längst auf ein Minimum reduziert. Was ihm jedoch heftig zusetzte, war der Verzicht auf Wasser. Bei ihrer letzten erzieherischen Massnahme hatten sie ihn fast verdursten lassen.
Eine von vielen Erfahrungen, die er höchst ungern zu wiederholen gedachte.
Mit geübtem Streich liess er das Zündholz aufflammen und entzündete die Kerze, die dem Raum sogleich ihr nervös hin und her flackerndes gelbliches Licht schenkte. Nun war es an der Zeit, die braunen Feen zu rufen. Hierzu legte er sich seitlich auf seine Schlafstelle und nahm seine sorgsam gestopfte Bambuspfeife in die rechte Hand.
Hastig schnellte seine Zunge heraus, um das Mundstück der Pfeife anzufeuchten. Schnell wie die Zunge eines bösartig blickenden Lurches, der im Hinterhalt darauf lauerte, seine ahnungslose Beute zu überraschen.
Er setzte die Pfeife an und stocherte nochmals im Tabak herum, bevor er diesen mit geübten Zügen dem Feuer der Kerze aussetzte, um in ihm die Glut zu entfachen, die er und seine kleinen Engel gleich so dringend brauchten.
Mit der anderen Hand spiesste er ein rundes schwarzes Klümpchen auf eine verbogene und ebenso von Russ geschwärzte Nadel. Das Klümpchen setzte er ebenfalls der Hitze der Kerzenflamme aus, bis das Chandoo seine zunächst flüssige Form verändert hatte und zu einem zähen Pech verdickt war.
Er wurde immer nervöser ob des unmittelbar bevorstehenden Ereignisses. Sorgsam blies er die ebenso hektisch tanzende Flamme gegen das aufgespiesste Chandoo. Er war stets darauf bedacht, dass diese am Leben blieb, denn es waren nur noch wenige Streichhölzer in der Schachtel übrig.
Dann war der Moment gekommen. Grün-schwärzlich schimmernd leuchtete ihm das Klümpchen entgegen, als er die Nadel mit der nun leicht zähflüssig gewordenen Masse der gleichmässigen Glut in der engen Öffnung des Meerschaumkopfes seiner Pfeife aussetzte. Routiniert drehte er die nun verheissungsvoll in den Tabak eintauchende Nadel leicht, um einen winzigen Kanal zum Bambusrohr der Pfeife zu bilden und zog diese anschliessend behutsam wieder heraus.
Nun machte er es sich soweit bequem, wie es auf seiner hierfür eigentlich ungeeigneten Schlafstätte eben möglich war, drehte den Pfeifenkopf langsam nach unten und hielt ihn erneut über die Flamme.
Geübt zog er den süsslichen Rauch des Opiums ein und behielt diesen jeweils möglichst lange bei sich. Zunächst gierig, wie ein Ertrinkender, der kurz vor dem Erstickungstod wieder frische Luft zum Atmen erhält. Dann behutsam und immer tiefer atmend.
Der Effekt, jener eigenartige Zustand des wohligen Behagens, liess zu seiner Enttäuschung länger auf sich warten als bei den letzten Malen.
Schon stieg ein Gefühl der Enttäuschung in ihm auf, wenn er in seinem abgestumpften Sein zu so etwas wie Gefühlen überhaupt noch in der Lage war.
Dann setzte der mit Sehnsucht erwartete Zustand ein, und die Droge liess ihn die Welt durch einen Schleier sehen, nahm allen Kummer, jegliches Empfinden von Last und all die dunklen Bilder von ihm.
Und sie kamen wieder.
Engelsgleich geflügelte Jungfrauen von betörender Anmut und Reinheit. Sie nahmen ihn in ihre Arme und schmiegten ihre nackten Körper an ihn. Begannen lasziv und fordernd, ihre festen Brüste an ihm zu reiben. Sämtliche Gedanken an Kummer verliessen ihn jetzt, vermischten sich mit seiner Umgebung und wurden von ihr absorbiert.
Nur dank der Droge fühlte er.
Fühlte überhaupt.
Fühlte sich völlig frei.
Frei von den Zwängen seiner Peiniger. Fiese Peiniger, die ihn einerseits quälten und denen er sogleich so viel verdankte. Flucht in ein Gefühl, nur noch übertroffen vom fast schmerzend anschwellenden Verlangen nach geschlechtlicher Befriedigung. Während er sich berauscht Abhilfe verschaffte, tauchte sein Wesen in sein Innerstes. Wie durch Watte gedämpft nahm er die Funktionen seines Körpers wahr.
Nachdem die Wellen des ansonsten für ihn bedeutungslosen Höhepunktes verebbt waren, spürte er seinen Herzschlag. Sein dumpfer und langsamer werdender Puls klang wie der tiefe Ton einer in weiter Ferne geschlagenen Basstrommel.
Sogleich spürte er den Strom seines Blutes durch die Adern.
Spürte, wie dieses das geheuchelte Gefühl unendlicher Harmonie und vollkommender Bedeutsamkeit durch ihn hindurchfliessen liess. Schon wollte er sich auf den bald verblassenden vielfarbigen Lichtstrahl setzen, der ihn nur deshalb neckend blendete, um ihn in die wohlige Müdigkeit und das bodenlose Vergessen hinab zu reissen.
Die Droge der Entrückung hatte ihre Wirkung voll entfaltet und erwartungsgemäss die Schwere um ihn herum zu angenehmen Vorstellungen aus dem Reich der Sinnlichkeit mutiert. Dann übergab der Wirkstoff des Mohns ihn der Stille und Sanftheit.
Er wusste: Schon bald würde der Rausch beginnen abzuebben, würde sich bleierne Müdigkeit gepaart mit narkotischem Schlaf über ihn senken.
So berauscht griff er die Karten und liess diese, jedes einzelne Bild sorgfältig betrachtend, durch seine Hände gleiten.
Schliesslich blieb sein Blick auf der obersten Karte haften, bevor seine Augen in stoischer Langsamkeit in die andere Ecke des Raumes glitten. Dort sah er die graue Decke, die das Bündel verdeckte, das er nach getaner Arbeit achtlos dort abgelegt hatte. Bevor Morpheus‘ Schwingen ihn vorübergehend tröstend mit einem Gefühl zwischen Ohnmacht und Schlaf umfingen, blickte er noch einmal auf die Karte.
Und dann wusste er: Es musste geschehen.
Mögen die Spiele beginnen.
Heute Nacht.
3
Sein Wecker klingelte um 5:30 Uhr. Und wie eigentlich jeden Morgen war Thomas Schnyder bereits wach. Er aalte sich noch ein wenig in den Federn, streckte sich genüsslich, um dann endlich einen Fuss unter der Bettdecke hervorlugen zu lassen und dem Bett zu entsteigen.
Der Morgen war aussergewöhnlich kalt, und er bereute sofort, die Kälte seines geräumigen Schlafzimmers gegen die Wärme des Bettes eingetauscht zu haben.
Es fröstelte ihn spürbar, als er seine Bartbinde ablegte und nach seinem dunkelblauen Morgenmantel griff, den er sorgsam an einem Haken neben seiner betont schnörkellosen Kommode aus Walnussholz drapiert hatte. Ein wenig in die Jahre war dieser Überzieher gekommen. Und nachdem er kurz überlegte, sich eventuell demnächst einen neuen zuzulegen, streifte er ihn rasch über und spürte sofort die Wärme, die dieser zu schenken vermochte.
Er verwarf den Gedanken an einen neuen Morgenmantel wieder und schritt zur Tür.
Die Stufen zur Haustür hinabschreitend dachte er über die bevorstehenden Ereignisse des Tages nach. Zumindest über die, die sich fest planen liessen.
Oft kam es anders.
Das brachte seine Profession als Ermittler bei der Zürcher Kantonspolizei nun mal mit sich.
Gleich vormittags wollte er nochmals zu den Eltern Herberts gehen, des Knaben, der seit nunmehr acht Wochen spurlos verschwunden war. Sein Vorgesetzter hatte den Fall längst aufgegeben. Das hätte auch er. Doch, im Gegensatz zu seinem Chef, war Thomas derjenige, der in die leergeweinten Augen der Eltern zu blicken hatte, um dort eines zu sehen: Hoffnung. Und wenn es in den letzten Tagen auch nur noch die Hoffnung auf Gewissheit war.
Auf die Gewissheit, dass dem Jungen wohl etwas Fatales zugestossen war.
Ein glückliches Ende hatte auch er längt ad acta gelegt, doch brach ihm der Gedanke, den Eltern den Tod des Knaben mitzuteilen, schier das Herz.
Mehr als zehn Jahre war er nun bei der Kriminalpolizei des Kantons Zürich. Und immer noch fiel es ihm schwer, Überbringer von Todesnachrichten zu sein.
Zu oft hatte er miterlebt, wie die Worte, kaum waren sie gesprochen, den Betroffenen jede Freude vom Antlitz nahmen. Sie versteinerten, um die Wucht der Worte überhaupt ertragen zu können.
Kapselten sich ein.
Hörten alles, wie durch einen Filter, der, einer Glocke gleich, über ihr Bewusstsein gestülpt worden war.
Manchmal hatte er das Gefühl, sein Gegenüber altere, kaum waren die Worte gesprochen. Es ergraute förmlich vor seinen Augen. Und mit jeder überbrachten Todesnachricht war es ihm, als stürbe auch ein Teil von ihm.
Daran hatte er selbst nach so langer Zeit im Dienst immer noch zu knabbern.
Inzwischen war er an der Haustür angekommen und suchte seine Schlappen, da er wenig Lust darauf verspürte, die Strecke bis zum Tor barfuss zurückzulegen. In den sonnigeren Monaten genoss er das sogar. Doch erlebte die Stadt einen strengen Herbst. Der eisige Griff des bevorstehenden Winters hatte auch das kurze Stück Weg bis zum Milchkasten schon in sein kaltes, weisses Kleid aus Raureif gehüllt.
Wo waren nur die verflixten Schlappen?
Er machte sich in Gedanken eine Notiz, dass er sein Dienstmädchen deswegen rügen musste. Gutes Personal war schwierig zu finden dieser Tage. Diese leidvolle Erfahrung hatte er bereits mehrfach hinter sich. Einige der letzten Dienstmädchen luden gar während seiner Abwesenheit einfache Männer der Arbeiterschicht zu sich ins Gemach, um sich mittels Gelegenheitsprostitution ein paar Franken dazuzuverdienen. Und das, obwohl er ihnen allen einen anständigen Lohn zahlte. Die Dienstverhältnisse beendete er natürlich sofort und schenkte der Auswahl seines Personals fortan mehr Aufmerksamkeit.
Luise war Anfang der Vierziger, doch hatte sie bereits das Aussehen einer Frau in den Mittfünfzigern. Die verstrichene Lebenszeit und die schwere körperliche Arbeit bei vermutlich weniger angenehmen Dienstherren hatten deutliche Spuren hinterlassen.
Schwer vorstellbar, dass eine solche Person im horizontalen Gewerbe nennenswerte Erfolge würde feiern können. Er musste verwegen schmunzeln. Sie hatte erst vor knapp vier Monaten bei ihm angefangen. Und doch war seinen Anweisungen weiterhin strikt zu folgen. Und diese Anweisungen sahen nun einmal vor, dass seine Schlappen ordentlich neben der Eingangstüre bereitzustellen waren.
Ganz gleich, wann und wo er diese am Abend zuvor ausgezogen und abgestellt hatte!
Angestrengt versuchte er, sich zu erinnern. Zielstrebig schritt er nach nebenan in den gediegenen und doch schlicht eingerichteten Wohnraum.
Er hasste jede Form aufgesetzten Pomps.
Vor dem offenen Kamin standen sein lederner Lesesessel und davor der Fussschemel. Zu dessen Seiten standen seine Pantoffeln. In ihnen befanden sich achtlos hineingestopfte Socken.
Er erinnerte sich wieder.
Er hatte über einigen Unterlagen seines Falls gebrütet und war schliesslich, wie so oft, mitten in der Nacht ermüdet und barfuss ins Richtung Bett getrottet.
Den Gedanken, Luise zu rügen, löschte er sogleich wieder.
Wer konnte es ihr verübeln, gegen drei Uhr nachts bereits selbst zu schlafen?
Nachdem er sorgsam die Socken in den Taschen seines Morgenmantels verstaut hatte, glitten seine Füsse in die Pantoffeln. Wieder in der Lobby angelangt, drehte er entschlossen zwei Mal den Schlüssel im Schloss, drückte die Klinke nach unten und öffnete die schwere Eichentür.
Die Tür war immer zwei Mal verschlossen.
Eine seiner vielen Marotten, die er sich angeeignet hatte, nachdem eine Versicherung ihm die Leistung nach einem Einbruchdiebstahl mit der Begründung verweigert hatte, die Tür sei nur einfach verschlossen gewesen.
Ein Einbruchdiebstahl.
Ausgerechnet bei ihm.
Einem Vertreter der Kriminalpolizei.
Für seine Kollegen war dies ein gefundenes Fressen. Es hatte Wochen gedauert, bis ihre mit ironischem Witz gewürzten Sticheleien aufgehört hatten.
Durch die geöffnete Tür wehte von der nahen Limmat eiskalte Luft herüber, die ihn die vielleicht zwei, drei Grad über dem Gefrierpunkt noch deutlicher spüren liess, als er in Richtung Tor loslief. Es war immer noch dunkel und die wenigen nervös zuckenden Gaslaternen an der Schipfe schienen ihren Schein der Witterung angepasst zu haben. Sie tauchten den kurzen Weg in ein abweisend bläuliches Licht, nur unterbrochen vom langen und gespenstischen Schatten einer Linde.
Rasch nahm er die Morgenzeitung und die Flasche mit frischer Milch aus dem Milchkasten und eilte wieder hinein ins Warme, wo er sich erstmal die Kälte von seinen Händen hauchen musste.
Vor dem Frühstück ging er jedoch wie jeden Morgen erst einmal ins Bad und duschte sich, bevor er sich seinem täglich aufwendig zelebrierten Ritual einer perfekten Nassrasur zuwandte.
Zur Vorbereitung klappte er sein Rasiermesser auf, strich dessen Klinge gekonnt einige Male über den seitlich bereit hängenden Schleifgurt und legte dessen Klinge in eine Schale heissen Wassers. Dann weichte er die Barthaare seines frisch geduschten Gesichts nochmals einige Minuten mit einem Tuch auf, das er vorher in heisses Wasser getaucht hatte. Anschliessen trug er etwas Rasier-Öl auf, um seine empfindliche Haut schützend geschmeidig zu machen und auf die Rasur vorzubereiten. Es folgte der Griff zu seiner verchromten Schale mit Rasierseife. Er fügte noch etwas Rasiercreme hinzu und begann, beides mit seinem Rasierpinsel aufzuschlagen.
Noch unzufrieden mit dem Ergebnis fügte er ein bisschen warmes Wasser hinzu und rührte die Mischung schön cremig. Endlich zufrieden, schäumte er mit kreisenden Bewegungen sorgfältig sein Gesicht ein.
Die vorgewärmte Klinge des Rasiermessers in seiner Rechten liess er sorgsam mit dem Strich über die Haut gleiten. Immer bedacht, seinen leicht gezwirbelten Schnurrbart stehen zu lassen. Um die Rasur zu vervollkommnen, schäumte er sein Gesicht nochmals mit Rasierschaum ein und wiederholte den Durchgang. Er spülte die Schaumreste auf seinem Gesicht mit reichlich kaltem Wasser ab und tupfte sein Gesicht mit einem sauberen Handtuch ab.
Dann griff er zur Dose mit der Barttinktur der Marke Es ist erreicht neben dem Waschbecken, fuhr entschlossen mit den Zeigefingern durch die Pomade und gab seinem gezwirbelten Bart den letzten Schliff. Der erneute Blick in den Spiegel machte ihn spürbar zufrieden. Zu guter Letzt griff er nach der Flasche mit After Shave auf der Ablage, verteilte ein paar Spritzer davon auf seinen Händen und klatschte es sich leicht auf die frisch rasierte Haut, die sich dafür sofort mit leichtem Brennen bedankte.
Bevor er zurück ins Schlafgemach schritt, hing er seinen Morgenmantel wieder an seinen angestammten Platz.
Er entnahm dem Schrank ein paar schwarze Socken, die er stets zuerst anlegte, bevor er in die schlichten langen Unterhosen stieg und sich ein weisses Unterhemd überstreifte.
Anschliessend zog er ein kragenloses frisch gebügeltes Schlupfhemd aus Baumwolle an, öffnete die mittlere Schublade seiner Kommode und holte einen frisch gesteiften Kragen mit abgerundeten Ecken heraus, den er mit einem eleganten Perlmuttknopf im Nacken befestigte.
Für das Zähmen der Umschläge an den Unterarmen entschied er sich für gelbgoldene Manschettenknöpfe mit eingearbeitetem Karneol, die er behände durchsteckte.
Dann stieg er in die dunkelbraune Feincordhose und legte einen zu den handgearbeiteten Oxfordschuhen, die er später anzuziehen gedachte, passenden Ledergürtel mit schlichter goldener Dornschliesse an. Geschickt schlug er den Hemdkragen hoch und band seine einfarbige dunkelgraue Krawatte zu einem einfachen leicht asymmetrischen Four-in-hand Krawattenknoten, wie ihn die Kutscher der Stadt trugen, und der seinen lässigen Kleidungsstil zusätzlich unterstrich.
Anschliessend streifte er eine hohe Dreiknopfweste aus dunkelbraun eingefärbtem Glacéleder über und schlüpfte in ein braungraues Harris Tweed Jackett mit Fischgrätmuster, dessen dunkle Lederknöpfe perfekt mit der Farbe der Weste harmonierten.
Die sonst eher üblichen Anzüge trug er nur selten.
Zu oft hatte er berufsbedingt mit Menschen aus einfacheren Schichten zu tun, die meist höchstens eine abgetragene Variante dieses Kleidungsstücks besassen, um in ihm beim sonntäglichen Kirchgang der gesamten Gemeinde demütige Gottesehrfurcht zu heucheln.
Sein Dienstmädchen hatte ihm weisungsgemäss ein Birchermüsli zuzubereiten, das er wie gewohnt allein am runden Tisch im Erker seines Wohnhauses aus einer einfachen Schale einzunehmen pflegte.
Ebenso wie die Einfachheit der Schale schätzte er eben jene bei diesem Gericht. Haferflocken, Nüsse, ein geriebener Apfel, Zitronensaft und ein wenig leicht gezuckerte Kondensmilch. Das war neben einer frisch aufgebrühten Tasse Kaffee schon alles Nötige, um ihn morgens glücklich zu machen. Ein Arzt aus der Region hatte das Gericht vor kurzem in seinem Sanatorium am Zürichberg entwickelt und populär gemacht. Während viele sich ihr Birchermüsli als leicht bekömmliches Abendessen reichen liessen, schwor er darauf, dass sich zumindest bei ihm die von ihrem Erfinder gepriesene Wirkung noch besser am Morgen entfaltete.
Schliesslich sollte in den roh geriebenen Äpfeln die Kraft der Sonne gespeichert sein.
Wann machte es am meisten Sinn, seinem Körper gebündelte Lebenskraft zuzuführen, wenn nicht morgens?
Perfekt ergänzt wurde dieser Muntermacher durch die erste frisch aufgebrühte Tasse Kaffee des Tages, die er besonders genoss und deren Zubereitung in den letzten Jahren nur wenigen seiner Dienstmädchen verzehrfähig gelungen war.
Luise war eines davon.
Er lächelte voll freudiger Erwartung, als er emsiges Klappern in der Küche vernahm und der verheissungsvolle Duft frischen Kaffees durch die einen kleinen Spalt offenstehende Tür in seine Nase stieg. Behutsam stiess Luise die Tür mit einem Servierwagen auf.
»Guten Morgen, Herr Schnyder«, sagte sie mit leiser Stimme und zwang sich dazu, zumindest ein kleines bisschen erholt und munter zu klingen.
Er wusste, dass Luise alles andere als ein Morgenmensch war.
»Guten Morgen, Luise«, antwortete er. »Danke für das Frühstück und den Kaffee. Stellen sie doch einfach alles ab, bitte. Ich denke, ich komme ganz gut alleine zurecht«, fügte er im Wissen hinzu, dass sie nur darauf wartete, diesen für sie anstrengenden Dialog und ihren frühen Morgeneinsatz möglichst rasch zu beenden.
»Wir sehen uns dann heute Abend. Gegen halb sieben.«
Schweigend schritt sie an den Tisch. Tastend und unsicher, fast ein wenig zittrig, obwohl jeder ihrer Handgriffe so sicher von statten ging, wie es einem Lernenden nur nach abertausenden stets gleichen Wiederholungen gelingt. Vermutlich hatte sie das Ritual des Eindeckens bereits ebenso oft ausgeführt.
Woher kam diese Nervosität?
Zunächst stellte sie die Schale mit Müsli auf den Platzteller und legte rechts davon eine Serviette mit hineingefaltetem Speiselöffel zurecht. Dann deckte sie die Kaffeetasse ein, um ihm kurz darauf aus der silbernen Kanne vom Servierwagen einzugiessen.
Nachdem sie die Zuckerdose auf den Tisch gestellt hatte, fragte sie: »Brauchen sie sonst noch etwas, Herr Schnyder?«
Wie so oft staunte er darüber, wie wenig von seinen Anweisungen früh morgens zu ihr durchdrang.
»Danke Luise. Nein. Bis heute Abend. Sie dürfen sich zurückziehen.«
Kaum war Luise aus dem Raum, ignorierte er wie üblich die Zuckerdose und weisste seinen Kaffee lediglich mit etwas Milch, um danach geniesserisch einen ersten Schluck zu sich zu nehmen.
Kurz liess er das heisse Getränk die Geschmacksnerven seiner Zunge umspülen, bevor er es hinunterschluckte. Sogleich glaube er zu merkten, wie ihn das Koffein noch wacher machte, als er ohnehin bereits war. So eingestellt begann er mit der Morgenlektüre in der bereitliegenden Tageszeitung. Der Aufmacher war erneut dem immer stärker aufkeimenden Klassenkampf zwischen kommunistischen Bolschewisten und Vertretern der kapitalistischen Oberschicht gewidmet. Der Beitrag feierte, für seinen Geschmack zu einseitig berichtend, geradezu einen gelungenen Sabotageakt an einer Produktionsstrasse in einer grossen Tuchfabrik.
Auf Seite drei fand er, wonach er suchte. Einen Bericht über die immer noch im Dunkeln tappenden Ermittler der Zürcher Polizei.
Anklagend rechnete der Journalist mit ihnen ab, warf der Polizei Untätigkeit und Planlosigkeit vor. Anfangs hatte er sich über diese Art von Berichterstattung noch aufgeregt. Inzwischen liess es ihn kalt. Er konzentrierte sich lieber darauf, seinen Job anständig zu machen. Jedoch wusste er, dass viele seiner Kollegen deutlich betroffener als er reagierten. Einige nahmen sich die abwertenden Kommentare in den Medien richtig zu Herzen. Immerhin liess sich das Wandern von der Titelseite auf Seite drei als Teilerfolg verbuchen. Er beschloss, sich diese Tatsache als Argument für das sicher gleich am Morgen stattfindende und eher unangenehme Gespräch mit seinem Chef zu merken.
Er seufzte.
Als er auf die nächste Seite umblätterte, fiel aus der Zeitung seitlich etwas heraus. Sein Blick blieb auf einer abgegriffenen Karte mit abgerundeten Ecken haften. Sofort vermutete er, dass es sich um eine Spielkarte handeln müsse, da sie mit einem gleichmässigen engen Muster aus roten Rauten bedruckt war.
Als er die Karte umdrehte, war er überrascht. Es bot sich ihm ein völlig anderes Bild, als das von ihm erwartete einer Spielkarte. Was er sah, war keine der Farben Rosen, Schellen, Eichel und Schilten, mit dem Bürger aller Schichten dem Jassen frönten.
Auf der Karte schritt vielmehr ein betont junger Mann in mittelalterlichen bunten Gewändern sorglos auf einen gierig klaffenden Abgrund zu. An den Seiten des Abgrunds züngelten in rebellischer Weise Wellen aufschäumender Gischt himmelwärts. Wie die gebleckten Reisszähne eines Raubtiers, das bereit war, sein Opfer zu packen. Stets bereit, todbringend zuzuschnappen. An der Seite des Jünglings lief aufgeregt kläffend ein kleiner weisser Hund.
Wollte dieser den naiv nach oben schauenden Mann vor dem Abgrund warnen?
Schon drohte der offensichtlich dem Tode Geweihte, in den Schlund des Abgrunds zu stürzen. Dieser würde ihn dann unwiderruflich verschlingen. Aller Gefahr zum Trotz hatte die Karte dennoch auch etwas Vergnügliches an sich.
Die Sonne strahlte am wolkenlosen Himmel und verlieh der Szenerie eine leichte Heiterkeit. Am Fuss der Karte stand in schwarzen Lettern geschrieben »The Fool«.
Weder wusste er, was das bedeuten sollte, noch konnte er sich einen Reim darauf machen, was diese eigentümliche Karte in seiner Morgenzeitung zu suchen hatte.
Schliesslich beschloss er, diese für eine zumindest bei ihm definitiv erfolglose Spielerei werblicher Art einfallsreicher Kaufleute der Stadt zu halten, die damit den Absatz ihrer Waren zu fördern gedachten. Kopfschüttelnd platzierte er die Karte wieder auf der nun ausgelesenen Zeitung, legte diese halbwegs ordentlich glattstreichend zusammen und ging nachdenklichen Schrittes zum grünen Kachelofen in der Ecke des Raumes.
Hier deponierte er die Zeitung auf einem Stapel, der Luise als Anzündmaterial für das Buchenholz diente, das gut durchgetrocknet in einer Nische unter dem Ofen aufgeschichtet war.
Das Schlagen der grossen Standuhr in der Ecke des Raumes liess ihn aufzucken. Sieben Uhr. Er hatte bei der Lektüre der Zeitung die Zeit vergessen.
Kurz dachte er nach, ob gleich in der Frühe wichtige Termine anstanden. Es wolle ihm jedoch keiner einfallen. Entschlossen ging er in den Flur. Hier angekommen griff er nach seinen Schuhen, entnahm die Schuhspanner aus Zedernholz, schlüpfte mittels eines Schuhlöffels hinein und verschnürte sie.
Dann legte er sich einen Schal um, stieg in einen halblangen schwarzen Wollmantel, setzte die ebenso schwarze Melone auf und ging vergnügt zur Arbeit.
4
Schwester Petula durchschritt den Kreuzgang auf dem Weg zu den Laudes Matutinae, dem liturgischen Morgenlob ihres Ordens. Wie ihre Schwestern war sie angehalten, die Laudes als eine der vornehmsten Gebetsstunden anzusehen und gebührend zu feiern. Ihre Gemeinschaft sah die Laudes als Ausdruck der Heiligung der Morgenstunde. Es durfte erst dann etwas unternommen werden, wenn eine Schwester jeden ihrer Gedanken Gott geweiht hatte.
Warum nur müssen diese vermaledeiten Laudes stets im Licht des anbrechenden Tages beginnen?
Sorgsam ermahnte sie sich, jetzt und künftig besser auf ihre Gedanken zu achten. Versuchte zu kontrollieren, dass sie nicht versehentlich losfluchte. In letzter Zeit passierte ihr dies öfter. Immer wieder ertappte sie sich dabei. Fragte sich, ob es richtig sei, Nonne zu sein, ohne je so etwas wie dem Ruf gefolgt zu sein.
Sie war spät dran und so stimmte sie auf der Schwelle zum Kirchenportal den dafür vorgesehenen Versikel an: »Oh, Gott, komm mir zu Hilfe.«
Müde, fast ein wenig mechanisch kamen ihr die ersten Worte dieser Danklitanei über die Lippen.
Erst als sie diese Zeilen gesprochen hatte, spürte sie, wie ungemein zutreffend diese Worte gerade in ihrer Situation waren.
Als junges Mädchen, hatte ihr Vater, ein reicher Textilindustrieller aus Winterthur, sie in eine klösterliche Gemeinschaft wegsperren lassen. Dies tat er, um eine nach Meinung der Familie nicht standesgemässe Liaison mit einem – ebenfalls ausschliesslich Ansicht der Familie – Taugenichts zu unterbinden.
Die erste Vorsteherin, die sich selbst Äbtissin Ursula nannte, eigentlich eine Priorin, und die sie als gerade einmal 16jährige Novizin unter ihre Fittiche nahm, zeigte ein grosses Herz. Sie war wahrlich berufen. Durch sie wurde die Vorstellung, ein Leben als von der eigenen Familie unter den Schleier gezwungene Nonne zu führen, zumindest einigermassen erträglich.
Doch die Gemeinschaft steckte voller Überraschungen. Es war voll triebhafter Schwestern wie Bernadette, die Fette in der Küche, die sich immer wieder neue Favoritinnen unter den Schwestern aussuchte.
Insbesondere die Novizinnen hatten es ihr angetan.
Auch Petula schien sie mit den Augen bereits auszuziehen, warf ihr glühende, eindeutige Blicke zu. Ohne körperliche Zuwendungen fielen die Essensrationen der Novizinnen äusserst spärlich aus. Während Petula beobachtete, wie einige Novizinnen von Tag zu Tag spürbar zulegten, zog sie es vor, weiterhin schlank zu bleiben.
Noch schwiegen die beiden Glocken im Turm der Kirche. Schon bald riefen sie zur Morgenandacht. Sie musste sich beeilen. Durch die wie immer nur angelehnte Eingangstür auf der Westseite der Kirche trat sie ein. Diese bildhaft offenstehende Tür sollte alle in eine bessere Zukunft einladen. Es verhält sich damit wie mit der durch den Tod am Kreuz geöffneten Tür zum Paradies. Der Blick auf die göttliche Dreifaltigkeit ist endlich wieder frei gegeben.
Oder war der Gekreuzigt selbst die Tür? Sie hatte glatt vergessen, was die Äbtissin hierüber erzählt hatte.
Jedenfalls sollte die Tür Besuchern der Klosterkirche stets offenstehen. Diese sollten Gott kennen lernen, als jemanden, der allen Menschen seine Tür öffnen will. Vorausgesetzt, sie brachten ihm die nötige Demut entgegen.
Dann vermochte diese Tür förmlich, von Angst und Schuld zu befreien, vermittelte Mut und Sicherheit. Sie konnte Hoffnung wecken und ermutigte zu neuen Taten. Sie spendete Trost, verwandelte sogar tiefe Trauer in Freude. Und sie führte aus dem Dunkel, symbolisiert durch das am Tabernakel im Altarraum endlos vor sich hin flackernde ewige Licht. Immerhin hatte die Äbtissin darauf verzichtet, den Türrahmen – wie einst im biblischen Ägypten – mit dem Blut geschlachteter Ziegen zu tränken.
Bislang zumindest.
Tief in Gedanken versunken, glitten die Fingerspitzen ihrer rechten Hand müde und oberflächlich in das Weihwasserbecken, um sich damit zu bekreuzigen. Flugs schritt sie unter der Empore mit der Orgel hindurch an den Beichtstühlen vorbei in Richtung Sakristei. Dabei passierte sie einen kleinen von zahlreichen Andachtskerzen eingerahmten Marienaltar in einer der beiden Seitennischen. Wie von der Priorin angemahnt, ging sie auf beide Knie und betete stoisch ein Avemaria auf Latein herunter.
Dann spürte sie es.
Irgendetwas war anders als sonst.
Warum war es heller als gestern?
Was roch da so seltsam?
War das etwa Weihrauch?
Die Kerzen auf dem Altar waren angezündet. Schon erschrak sie bei dem Gedanken, sie könnte versäumt haben, diese am Vorabend zu löschen.
Was war da hinter dem Abendmahlskelch und dem grossen Evangelienbuch auf dem Altar?
An den Kniebänken vorbeihuschend näherte sie sich dem Altar. Spätestens als sie sah, dass der Weihrauch aus der Hostienschale aufzusteigen schien, realisierte sie, dass definitiv etwas anders war als am Vorabend.
Erschreckend anders.
Vor dem Betreten des Altarraums beugte sie ihr rechtes Knie und bekreuzigte sich erneut, bevor sie die drei Stufen zum Altar emporstieg.
Dann sah sie es.
5
Der Kater kam direkt nach dem Erwachen. Mit ihm keimte bereits der fast unüberwindliche Wunsch nach der nächsten Pfeife auf. Das Verlangen nach seinem Chandoo wuchs. Es wuchs rasch, wurde schnell zu einem Ungetüm von kolossaler Grösse, jenseits der Vorstellungskraft.
Ein Leviathan.
Gott hatte, ihn verspottend, sein Spielzeug gesandt.
Es suchte ihm heim.
Gigantisch wie ein alles verschlingender Wal.
Es wand sich um ihn wie eine würgende Schlange und schnappte gierig nach ihm, wie ein aus dem Wasser schnellendes Krokodil.
Ein Eisdrachen, der mit frostigem Atem in seinen Nacken schnaubte.
Er fror.
Der Leidensdruck und das Verlangen standen über allen Gefühlen, die er in der Vergangenheit zu fühlen einmal in der Lage gewesen war. Über Freude und Traurigkeit.
Freundschaft und Hass.
Sogar über der Liebe.
Sein Körper gab ihm von Moment zu Moment immer deutlicher zu verstehen, dass er sich an den Konsum und an den Rausch der Droge gewöhnt hatte.
Kein Wimpernschlag verstrich, ohne dass das Verlangen nach der üblichen Dosierung in ihm wuchs.
Übliche Dosierung?
Die gab es nicht mehr.
Ihn verlangte nach mehr.
Viel mehr.
Sein Körper begann allmählich zu rebellieren. Seine Glieder schmerzten höllisch. Kalter Schweiss stand auf seiner Stirn. Er konnte sich nicht rühren, war wie gelähmt. Plötzlich überkam ihn Übelkeit, und er liess dem aufsteigenden Mageninhalt freien Lauf, verteilte das Bisschen, das er zu sich genommen hatte, fast vollständig auf dem Tisch, an dem er sass und sich vor Schmerz festgekrallt hatte.
Zittern und Schmerzen gerieten ausser Kontrolle.
Dann glitt er vom Schemel und sank sich zusammenkrampfend zu Boden. Hier nahm er am Rande der Ohnmacht in Seitenlage die Haltung eines Embryos ein.
Er lag da wie ein niedergestrecktes Tier.
Wie ein frierendes, kraftlos zitterndes Häufchen Elend.
Sie hatten ihm auch den letzte Rest Würde genommen.
Erst das lautstarke Scheppern der Katzenklappe in der Tür zu seinem Raum, der ihm längst zum Verlies geworden war, verhiess Aussicht auf Erlösung.
6
Er war gerade in seinem Büro im neuen Polizeihauptquartier angekommen und hatte hier und jetzt mit seinen Kollegen eine weitere Tasse Kaffee zu sich nehmen wollen, als sein Chef die Türe aufstiess. Mit deutlichen Worten fasste er das Wenige zusammen, das ein Bote der Polizei vor kurzem mitgeteilt hatte.
»Schnyder, schnappen sie sich ihre Leute und setzen sie sich in Bewegung! Das ist jetzt ihr Fall! Bis zum Mittag möchte ich einen ersten Bericht!«, schloss er knurrend und liess kurz darauf die Tür krachend wieder ins Schloss fliegen.
Thomas Schnyder war der erste, der die Fassung nach dem ungewohnt heftigen Morgenauftritt ihres gemeinsamen Vorgesetzten wiedererlangte.
»Na, dann wollen wir mal …«, seufzte er den anderen zu und griff nach seinem Mantel, den er erst vor wenigen Minuten abgestreift hatte. Allen war klar: An Aufschub für den frisch gebrühten Kaffee war nicht mehr zu denken.
Nachdem sie den Trubel der Stadt hinter sich gelassen hatten und eine Weile an der Limmat entlanggefahren waren, sahen sie schliesslich die geschweifte Haube des Turms und die Mauern des Klosters Fahr. Kaum hatten sie das Kutschtaxi an der Mauer bezahlt, die den ganzen Komplex einfasste, eilten Thomas Schnyder und seine Kollegen durch das grosse gusseiserne Portal des Klosters.
Hastig huschten sie hindurch in Richtung Eingang des Hauptgebäudes. Thomas Schnyder wollte gerade an der Tür klopfen, als sich diese bereits öffnete und eine ältere Nonne sie regelrecht abfing.
»Guten Morgen, Schwester«, sagte er und versuchte, dabei zumindest einigermassen höflich zu klingen.
»Ich weiss zwar nicht, was an so einem Morgen gut sein soll. Dennoch. Auch ihnen einen guten Morgen«, sagte diese forsch.
Ernst, fast ein wenig bedrohlich, blickte sie ihn aus ihren stechenden Augen dabei an.
»Ich bin Schwester Ursula. Und ich leite als Priorin das Kloster, in dem die junge Nonne heute Morgen den schaurigen Leichenfund gemacht hat.«
Sie blickte einige Sekunden lang in die Augen seiner Begleiter. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass ihr ausschliesslich Herren gegenüberstanden, fügte sie hinzu: »Meine Herren, was sie nun sehen werden, hat es in der fast neunhundertjährigen Geschichte unseres Klosters noch nie gegeben. Nichts, ich betone, absolut nichts davon darf an die Öffentlichkeit dringen! Ich muss sie daher um äusserste Diskretion bitten.«
Schnyder hielt ihrem Blick stand, der immer noch um ausdruckslose Kälte bemüht war. Doch nun spürte er so etwas wie Angst in ihren Augen.
Er blickte prüfend in die Augen seiner Kollegen.
Dann nickte er und sagte: »Okay. Verstehe, ich denke, das lässt sich einrichten.«
»Bitte verstehen sie mich nicht falsch, meine Herren. Das ist mir leider nicht genug. Sie müssen mir bei dem, was ihnen lieb und teuer ist, schwören, dass sie das, was sie sehen werden, für sich behalten.«
Die Augen, die eben noch kalt und zurückweisend gefunkelt hatten, wirkten plötzlich hilfesuchend und ängstlich.
»Oder was?«, fragte plötzlich mürrisch Jakob Büchsenstein, den alle nur Köbi nannten, aus dem Hintergrund. Köbi war ein hervorragender, freier Mitarbeiter der Kriminalpolizei, wenn auch kein Polizist. Offiziell zumindest nicht.
Hervorragend schon deshalb, weil er der einzige war, der, ohne sich dabei zu blamieren, mit dem neuen Fotoapparat umzugehen vermochte, mit dem sie seit kurzer Zeit Tatorte dokumentierten. Da er zudem noch mit geradezu bärenhaft hünenartiger Gestalt und ebensolcher Kraft gesegnet war, durfte er die höllisch schwere Ausrüstung auch gleich schleppen.
Leider neigte er jedoch dazu, in Situationen wie dieser mitunter ein wenig aufbrausend zu reagieren.
»Was wollen sie dann tun? Wollen sie uns sonst nicht reinlassen? Die Polizei zu rufen, brauchen sie jedenfalls nicht. Denn die ist schon hier!«, spöttelte er.
»He, Köbi! Du redest mit einer Dame. Ach, was sage ich: Mit einer Nonne. Jetzt krieg dich bitte wieder ein, Mensch!«, fauchte Schnyder ihn an.
Ihm fielen zwei Dinge ein.
Einerseits, dass er jetzt viel lieber bei seiner Tasse Kaffee wäre, die er erkaltend zurückgelassen hatte.
Andererseits hatte er von seinem Chef nach dessen fragwürdigem Auftritt am Morgen neben der spärlichen Information über den Toten noch einen Hinweis erhalten.
Das Kloster fiele, strenggenommen, in die Zuständigkeit eines anderen Kantons. Der Status als vollständig vom Kanton Zürich umschlossene Exklave des Kantons Aargau brachte einige, religionspolitisch bedingte, Kuriositäten mit sich.
Vor mehr als hundert Jahren war die an der Limmat gelegene Klosteranlage auf einmal vom Kanton Zürich umschlossen. Die Kantonsgrenze fiel an verschiedenen Stellen mit den Mauern des Komplexes zusammen. Während die Klostergebäude auf Aargauer Kantonsgebiet standen, lagen die landwirtschaftlich Fläche, Weinberge, Äcker und Wald vollständig auf Zürcher Boden. Das Klostergelände gehörte somit polizeilich eigentlich zum Kanton Aargau.
Jedoch fehlte es in der offiziell zuständigen Gemeinde an einer Polizeistation. Lediglich verwaltungsrechtlich hatte man sich die Mühe gemacht, das Kloster dieser Gemeinde zuzuweisen.
Doch immer wieder gab es Streit. Es war unklar, welcher der beiden Kantone nun für die Polizeiarbeit zuständig war.
»Okay. Du bist der Boss …«, murmelte Köbi vor sich hin und wandte sich immer noch ein wenig schmollend ab. Nach einer kurzen Denkpause, in der er Köbi kopfschüttelnd hinterherschaute, wandte er sich wieder der Nonne zu.
»Hören sie! Ich weiss nicht mal, ob wir für ihr Kloster überhaupt zuständig sind. Noch weniger weiss ich, was uns da drinnen erwartet. Ich weiss auch nicht, ob wir so etwas wie Schwüre leisten dürfen, geschweige denn, ob es irgendjemandem aus meiner Mannschaft etwas ausmachen würde, einen solchen Schwur dann doch zu brechen. Was ich aber weiss, ist, dass meine Leute und ich Informationen im Normalfall immer vertraulich behandeln. Wir werden sicher alles versuchen, den Ruf ihres Klosters zu schützen. Und jetzt wäre es wirklich nett, wenn sie uns unsere Arbeit machen liessen.«
Die Vorsteherin zögerte kurz, wich ein Stück zurück und erwiderte: »Also gut. Ganz wie sie wollen, meine Herren. Folgen sie mir!«
Schwester Ursula machte auf dem Absatz kehrt und schritt durch die karg eingerichtete und ein wenig beklemmend wirkende Empfangshalle des Klosters.
»Wir gehen durch den Klostergarten, das ist der kürzeste Weg zur Klosterkirche«, sagte sie und öffnete auch schon die Tür nach draussen.
»Im Sommer summt und blüht hier alles«, fügte sie hinzu und Schnyder meinte tatsächlich einen Anflug von einem Lächeln bei ihr auszumachen.
»Wissen sie, nebenan hat es eine Schule für Landwirtschaft, an der wir Schwestern für die Allgemeinbildung, die botanische Ausbildung und einen gewissenhaften Umgang mit Gottes Schöpfung bei angehenden Bäuerinnen und Bauern sorgen.«
Der grosse Klostergarten war streng geometrisch angelegt und unterstrich bildlich die Vorstellung, nach der tadelloser Wandel im klösterlichen Leben ewiges Seelenheil ermöglichte. Im Sommer ernteten hier sicher die emsigen Hände der Nonnen kostbar duftende Kräuter und seltene Heilpflanzen. Aus diesen wurden dann köstliches Kräutersalz, aromatische Tees und begehrte Arzneimittel hergestellt.
Die gut gepolsterte Finanzlage des Klosters aufgrund des Verkaufs dieser Produkte war jedenfalls weit über die Grenzen der Klostermauern hinaus bekannt. Bekannt war auch, dass sämtliche Einkünfte des Klosters von der Steuer befreit waren. Da machte es sicher Spass, seine Finanzen aufzubessern, dachte er schmunzelnd bei sich.
In diese obgleich flüchtigen Gedanken versunken, kam er mit den anderen schliesslich am Portal der Klosterkirche an. Diese erhob sich mächtig und ein wenig trutzig am Ende des Gartens.
Schwester Ursula steckte den Schlüssel in das Loch und drehte ihn knirschend zweimal nach rechts. Sie drückte die gusseiserne Klinke nach unten und öffnete knarzend die schwere alte Eichenholztür, deren Scharniere sich offenkundig seiner Erwartung widersetzten, indem sie partout nicht quietschen wollten.
Bis sich seine Augen an das enorm schummrige Licht im Inneren der barocken Kirche gewöhnt hatten, nahm er auf dem Weg ins Presbyterium die Eindrücke des barocken Komplexes mit seinen anderen Sinnen auf. Es roch leicht muffig, irgendwie nach Frömmigkeit. In der Luft lagen die typisch sakralen Düfte vom Russ frisch abgebrannter Kerzen.
Und der Duft von Weihrauch.
»Eine Novizin hat das Kind heute Morgen beim Vorbereiten der Laudes gefunden«, flüsterte Schwester Ursula.
»Wir haben nichts verändert.
Es ist alles noch genau so, wie wir es vorgefunden haben.
Gott sei seiner Seele gnädig.«
Sie ging andächtig auf die Knie, senkte das Haupt und bekreuzigte sich. So verharrend strahlte sie dabei eine solche Demut aus, dass sie ihn für einen kurzen Moment staunen liess.
Die Fünfergruppe war im Presbyterium angekommen.
Thomas Schnyder hiess seine Kollegen, vor den drei Stufen zum Altar auf ihn zu warten, während er selbst behutsam nach oben schritt.
Inzwischen hatten seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt und ihm fiel die Altarszene auf. Auf dem Bild war ein leerer Thron zu sehen. Daneben posaunten Engel und Menschen entstiegen ihren Gräbern.
Das Jüngste Gericht.
Sollte er sich angesichts des Bildes vorsichtshalber lieber ebenfalls bekreuzigen?
Oder gar das Knie beugen, um später nicht in die falsche Kategorie eingeteilt zu werden?
Schliesslich war dies für manche ein heiliger Ort.
Er beschloss, dass es seinem Seelenheil sicherlich zuträglich wäre, machte eine unbeholfene Kniebeuge, an die er sich flüchtig erinnerte, und bekreuzigte sich dabei.
Die skurrile Szene, die sich ihm offenbarte, liess ihn hörbar schlucken. Auf dem Marmor des Altars lag friedlich ein Kind.
Ein Junge.
Seine Augen starrten wie im Bann an die Kirchendecke. Als wollte es die üppige barocke Deckenmalerei und die meisterhaften Arbeiten der Stuckateure bewundern. Es hatte ein weisses Leinenhemdchen an und war in einen gleissend hellroten, seidenen Umhang gehüllt.
Er versuchte, auf kleinste Details zu achten, da er wusste, dass sich hier unter Umständen bereits erste Anhaltspunkte über die Todesursache gewinnen liessen. Ausserdem drohte der bald unvermeidlich einsetzende Verwesungsprozess des jungen Körpers, den Zustand der Kinderleiche von Minute zu Minute zum Schlechteren zu verändern.
»Einen Arzt haben wir gar nicht mehr gerufen. Das hielten wir nicht mehr für notwendig«, flüsterte Schwester Ursula.
»Einige von uns sind in Krankenhäusern im Einsatz.
Er war eindeutig tot.
Requiem aeternam dona ei, Domine.
Et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace.
Amen.«
Er nickte und beugte sich leicht vornüber, um im Schein der andächtig flackernden Kerzen besser sehen zu können. Der Junge war selbst für einen Toten ungewöhnlich blass. Als hätte das Wissen um den bevorstehenden Tod alle Farbe aus seiner Haut weichen lassen.
Auf der Stirn des Knaben waren behutsam und sauber zwei Kreise eingeritzt worden.
Oder was es eine umgestürzte Acht?
Warum war da kein Blut?
Auf den ersten Blick konnte er im schummrigen Licht der Kerzen keine weiteren Veränderungen erkennen.
Er scheute sich zu prüfen, ob die Totenstarre noch anhielt.
Das überliess er getrost Hansruedi.
Der sollte später gefälligst selbst danach suchen, wenn er den Leichnam obduzierte.
Ihn fröstelte plötzlich, da er nun verinnerlichte, was er da vor sich hatte: Einen toten Knaben. Der Grösse nach vielleicht zwölf, dreizehn, höchstens vierzehn Jahre alt. Herausgeputzt und theatralisch zur Schau gestellt auf dem nackten Stein des Altars einer Klosterkirche.
Was ging hier nur vor?
Das Rot des Umhangs war fast das gleiche wie das der roten Rosen, die mit einem kunstvoll verzierten Stab und Josephslilien zu den nackten Füssen des Opfers lagen. Der rechte Arm des Kindes ragte in die Höhe. Die kleinen Finger waren zu einer Faust geformt, die etwas weisses Längliches umklammerten.
War das eine Kerze?
Neben der Leiche stand ein silberner Kelch und lagen ein Brot und ein Schwert. In dem Kelch stand eine dunkelrote Flüssigkeit, die an den Seiten begann, eine Kruste zu bilden.
Vermutlich war es Blut.
Was hatte ein Schwert in einer Kirche zu suchen?
In den Brotlaib war ein seltsames Symbol eingebacken, das er nicht zuordnen könnte.
Es sah aus wie ein Stern.
»Der Kelch ist nicht von hier«, sagte Schwester Ursula, als könnte sie seine Gedanken lesen.
Lautlos hatte sie ihr andächtiges Knien unterbrochen und sich zu ihm gesellt.
»Schwester Ursula, was geht hier vor?«, fragte er sie.
»Ich habe keine Ahnung«, sagte sie.
»Aber bei dem, was ich sehen kann, scheinen hier böse Mächte am Werk zu sein.«
»Wie kommen sie darauf?«
»Das ist ja wohl schwer zu übersehen. Schauen sie nur auf das Brot. Auf dem Brot ist ein Pentagramm. Ein Drudenfuss. Früher war das ein Zeichen, das zum Schutz an Haustüren angebracht wurde. Doch so ausgerichtet, auf dem Kopf stehend, ist es das Zeichen des gefallenen Engels, des Satans.
Die Zacken stehen jeweils für die Hörner, die Ohren und den Bart einer Ziege«, fuhr sie fort und deutete mit den Fingern gestikulierend auf die nach oben zeigenden Zacken des Symbols auf dem Brot.
»Und es ist ganz sicher nicht ihr Messkelch?«
»Nein, wer auch immer das hier getan hat, hat alles mitgebracht.
Auch den Pilgerstab.
Sehen sie?
Hier oben ist eine Jakobsmuschel hineingeschnitzt.
Das ist ein wichtiges Erkennungszeichen für Pilger auf dem Jakobsweg, von dem eine mögliche Route hier ganz in der Nähe entlangführt. Fast jeder Pilger hat eine solche Muschel bei sich. Damit erkennt man sie als solche und ihnen wird auf ihrem Weg zum Beispiel Hilfe oder Obdach angeboten. Für einen Pilger ist er jedoch viel zu jung. Und wie sie sich denken können, haben wir in unserem Kloster höchst selten Bedarf an einem Richtschwert.«
»Sie scheinen sich ihrer Sache ja sehr sicher zu sein. Wie kommen sie darauf, dass es ein Richtschwert sein könnte?«
»Ich habe es mir eben angeschaut. Das Schwert hat eine abgerundete Spitze. Als normales Schwert ist es somit meines Erachtens völlig unbrauchbar.«
Er staunte über ihre Schlussfolgerungen und kritzelte mit seinem Bleistift einen Vermerk hierzu in sein Notizbüchlein, das er inzwischen gezückt hatte.
»Wer hat die Leiche gefunden?«, wollte er wissen.
»Schwester Petula. Eine junge Novizin. Sie ist sicher drüben im Klausurbereich«, sagte sie und als sie den fragenden Ausdruck in seinen Augen bemerkte, füge sie hinzu: »Sie ist in ihrer Zelle. Ich habe ihr erlaubt, sich zurückzuziehen, um sich von dem Schreck ein wenig zu erholen. Das verstehen sie doch sicher, oder?«
»Sicher. Sie ist doch hoffentlich nicht allein? Glauben sie, es ist machbar, dass ich mit ihnen rübergehe und ihr ein paar Fragen stelle?«, wollte er wissen.
»Hören sie. In einem Kloster sind sie immer Teil einer Gemeinschaft und nie wirklich allein. Ganz sicher ist eine der Mitschwestern bei ihr. Und was ihre Frage nach einer Vernehmung von Schwester Petula angeht. Ja, das wird sich sicher einrichten lassen.«
»Die Herren, ich bin nun mit Schwester Ursula drüben im Konvent, um Schwester Petula zu vernehmen«, sagte er.
»Ihr kümmert euch bitte um den Abtransport der Leiche.
Und versaut es nicht wieder!
Sagt dem Bestatter, er soll den Jungen in die Gerichtsmedizin zu Hansruedi bringen. Und denkt bitte daran, ihm zu sagen, dass er ihn vorher auf keinen Fall waschen soll!«
Er erinnerte sich mit Grauen daran, dass sie beim letzten Mal auf ein anderes Bestattungsinstitut hatten ausweichen müssen.
Der Bestatter hatte die Leiche vollständig gewaschen und dabei so gut wie alle Indizien den Abfluss hinuntergespült.
»Und Köbi …«
»Ja. Thomas?«
»Ich brauche diesmal absolut erstklassige Aufnahmen vom Fundort der Leiche.«
7
Während seine Kollegen am Fundort der Kinderleiche damit beschäftigt waren, alles fein säuberlich zu dokumentieren und Spuren zu sichern, eilte er mit Schwester Ursula durch die kleine Verbindungstür und den Kreuzgang Richtung Dormitorium der Nonnen.
Die Gänge waren schlicht und kalt, wirkten duster und zurückweisend. Das hallende Klacken ihrer Füsse auf den tönernen Kacheln und das spärliche Licht des bevorstehenden Winters taten ein Übriges, um ein mulmiges Gefühl zu erzeugen. Erst vor kurzem, so erklärte die Priorin ihm, sei jeder Novizin und Nonne eine individuelle Zelle zugeteilt worden. Bis vor einigen Jahren noch hätten die Nonnen die Nächte auf schlichten Pritschen in einem gemeinsamen Schlafraum verbracht.
Nur die Priorin verfüge seit jeher über den vermeintlichen Luxus eines separaten Schlafgemachs.
Die mit vielleicht vierzehn Quadratmetern eher beengte Zelle der Novizin war geradezu abweisend kalt und ebenso eingerichtet. Der ganze Raum schrie den Besucher förmlich an, draussen zu bleiben, da es im Inneren rein gar nichts gab. Jedenfalls rein gar nichts, das ein Verweilen lohnenswert erscheinen liess.
Bis auf dessen Bewohnerin.
Sofort fielen ihm das schöne Gesicht und der frauliche Körper der vielleicht Zwanzigjährigen auf. Das Kloster hatte sich mittels Haube und Tracht alle Mühe gegeben, die Reize dieser jungen Frau zu verbergen.
Vergeblich.
Beinahe vergass er, warum er eigentlich hier war. Entgegen der Vermutung der Priorin war Schwester Petula allein. Ihre smaragdgrünen Augen starrten ausdruckslos an die ihrer Schlafstätte, die er sich weigerte, Bett zu nennen, gegenüberliegende Wand.
Die Wand war bis auf ein mit zwei vertrockneten Buchsbaumzweigen verziertes, aus Lindenholz geschnitztes Kruzifix völlig schmucklos. Schwester Ursula bat darum, sich zurückziehen zu dürfen, um sich ihren Pflichten als Priorin widmen zu können.
Schweigend setzte er sich zu Schwester Petula und starrte mit ihr minutenlang das Kruzifix an.
»Warum lässt er so etwas zu?«, fragte sie ihn plötzlich.
Hatte sie wirklich ihn gefragt?
Hatte dieses engelsgleiche Wesen überhaupt bemerkt, dass er sich neben sie gesetzt hatte?
Da auch er die Antwort nicht wusste, zog er es vor zu schweigen. Dann dreht sie sich zu ihm um. Schliesslich blickte auch er sie an. Blickte mitten in ihr Gesicht. Tränen kullerten über ihre Wangen. Ihr Gesicht war so schön, dass er diese am liebsten sofort mit seinen Fingern getrocknet hätte. Nur um sie berühren zu können.
»Sie ist eine Nonne!«, ermahnte er sich innerlich, da er spürte, dass heisses Blut begann, seinen Körper empor- und in bestimmte Regionen hinabzusteigen. Er räusperte sich und hatte sich schliesslich wieder im Griff.
»Ich weiss es auch nicht«, hatte er schliesslich gesagt.
Und da sie ihre Frage bereits wieder vergessen zu haben schien, blickte sie ihn aus ihren sanften grünen Augen fragend an.
Die vollen Lippen ihres Mundes strahlten eine kindliche Unschuld aus, bevor dieser leise fragte: »Was?«
»Ich weiss auch nicht, warum Gott solche Dinge geschehen lässt«, antwortete er.
»Aber ich weiss, dass wir den Täter mit ihrer Hilfe schnappen können.«
Wieder schwiegen sie eine Weile. Inzwischen hatte sie aufgehört zu weinen und sich an seine Schulter gelehnt. Eine Geste, die er nur allzu gerne zuliess. Er legte seinen Kopf auf ihren. Unter der Haube konnte er den Duft ihres Haares erahnen, das dem Ansatz zufolge rotblond sein musste, der entgegen der Anweisungen ihres Ordens unter dem Schleier hervorlugte.
Ihr Atem ging nun ruhiger.
Und er konnte sehen, wie sich ihre Brüste unter der Tracht behutsam hoben und senkten.
Tröstend legte er seinen Arm um sie.
Ihr Körper schien, seine Hand durch ihre Nonnentracht hindurch versengen zu wollen.
Nach einigen Minuten, die ihm wie eine Ewigkeit vorkamen, sprudelte es förmlich aus ihr heraus: »Der tote Junge heisst Valentin. Seine Familie lebt ganz in der Nähe. Vor kurzem erst hat er mit seiner älteren Schwester bei der Weinlese mitgeholfen. Seine Schwester geht bei uns in die Schule, wissen sie?«
Natürlich wusste er das nicht.
Woher hätte er dies auch wissen sollen?
Er zog es vor, seine Gedanken bei sich zu behalten und zu schweigen, damit sie weitererzählen konnte. Sie erzählte ihm alles, was sie über Valentin, dessen Schwester und Familie wusste. Er schien ein aufgeweckter und wissbegieriger Junge gewesen zu sein. Sie berichtete ihm auch davon, wie sie den toten Knaben vor Sonnenaufgang in der Kirche gefunden hatte. Dabei begann ihre Stimme zu brechen, bis sie schliesslich ins Stocken geriet.
Ihr Atem beschleunigte sich, und sie schluchzte. Erneut rollten Tränen ihre Wangen hinab. Diesmal konnte er nicht widerstehen und strich mit der Hand über ihr Gesicht, um die Tränen sanft wegzuwischen.
Sie wich nicht zurück, sondern griff nach seiner Hand, um die Wärme an ihre Wange zu drücken. In ihm keimte das Verlangen, ihre Wange und vielleicht mehr zu streicheln. Er besann sich jedoch erneut eines Besseren und zog seine Hand behutsam zurück.
Dann küsste er sie auf die Stirn und sagte, dass er allmählich wieder zu den anderen zurückgehen müsse. Immerhin hatte er einen Ruf zu verlieren. Sie lächelte und blickte ihn mit ihren verführerischen Augen an.
»Dieses Grün!«, dachte er bei sich. Schliesslich nickte sie, geleitete ihn zur Tür und wies ihm den Weg zurück zur Klosterkirche.
Erleichtert atmete er einige Male tief durch, bevor er sich auf den Weg machte. Wie warmer Nebel zog sein Atem vor ihm her, um schon kurz darauf ebenso rasch wieder zu verschwinden.
Genauso erging es der Lust, die ihn in der Zelle der Novizin im Wortsinne beinahe übermannt hatte.
Mit jedem tiefen Atemzug ebbte sie mehr und mehr ab.
Und ein Gefühl nüchterner Sachlichkeit hielt wieder in ihm Einzug. Allmählich verschaffte sie ihm wieder den klaren Kopf, den er für seine Arbeit als Ermittler in einem Mordfall an einem Kind so dringend brauchte.
8
Auf dem Weg zurück aufs Revier zogen die immer noch reifbedeckten Bäume an ihnen vorbei. Inzwischen hatte die Sonne sich ihren Weg durch den Nebel gekämpft und tauchte die Landschaft in das glitzernde Kleid eines schönen Spätherbsttages.
Das Funkeln der Eiskristalle auf den schwer herabhängenden Ästen der Bäume täuschte ein wenig über ihre trübe Stimmung hinweg. Wie blitzende silbrige Seide tauchte der Raureif die Landschaft in seinen ganz speziellen Glanz. Die Traurigkeit in ihnen schien überstrahlt zu werden vom Funkeln der Millionen Sterne, die am lichten Tag auf den Ästen der Bäume sassen. Das ganze Spektrum des Sonnenscheins einte seine Farben zu einer Art goldenem Schimmer.
Als stünde die Pforte des Himmels eine Weile offen, da die Engel des Himmels gerade hinabstiegen, um die Seele des kleinen Valentin vor seinen Schöpfer zu geleiten.
Alle vier gingen ihren ganz eigenen tröstenden Gedanken nach, während das Trotten der Pferde und das Ruckeln der Kutsche sie gleichsam sachte wie beruhigend durchrüttelte. Seine Kollegen waren ebenfalls verstummt, da sie die grausigen Ereignisse des Morgens so aufgewühlt hatten.
Als er wieder in der Klosterkirche angekommen war, war Köbi just damit beschäftig, seine Fotoausrüstung wieder zusammen zu packen. Vom Geräusch der abrupt und knarzend geöffneten Tür aufgeschreckt, wirbelte er herum und fegte mit den Beinen seines Stativs den goldenen Messkelch vom Altar. Scheppernd schlug dieser auf dem Boden auf und verteilte seinen kostbaren Inhalt auf dem hellen Ocker des Kirchbodens. Zäh und langsam tropfte die rote Flüssigkeit die drei Stufen vor dem Altar hinab.
»Schon gut. Ich bin’s nur«, knurrte Thomas und hob dabei beschwichtigend seine Hände.
Es dauerte einige Sekunden, bis der Schreck aus den Gliedern seiner Kollegen gewichen war.
Köbi erlangte als erster Fassung und Sprache wieder.
»Mensch, hast du mich erschreckt. Musst du eigentlich immer so herumschleichen?«, polterte er los und schickte sich sofort an, den Messkelch wieder aufzuheben. Als er ihn jedoch in die Hand nahm, hielt er zögernd inne.
»Seht mal. Was haben wir denn hier?«, murmelte er.
Irgendetwas im Inneren des Kelches erforderte plötzlich seine ganze Aufmerksamkeit. Geschickt griff er mit seiner Rechten in die Seitentasche seines Jacketts, das er unter seinem Mantel trug, und förderte eine Pinzette zu Tage. Behutsam stocherte er damit in der Öffnung des Kelches herum und hielt einen Augenblick später mit der Pinzette etwas in die Höhe.
Thomas Schnyder traf fast der Schlag.
Er war sprachlos und alles fühlte sich danach an wie in einem schlechten Traum.
Erst vor wenigen Stunden hatte er etwas ganz Ähnliches gesehen und für einen Werbegag gehalten. Beim Aufschlagen der Morgenzeitung war sie ihm entgegengefallen.
Die Spielkarte.
Diese lag nun beim Papier zum Anfeuern, während er vor einem Altar in der Kirche hoffte, dass sie Luises eifrigem Drang, im Winter stets ein gemütlich wärmendes Feuer am Lodern zu haben, nicht bereits zum Opfer gefallen war.
»Was ist denn jetzt los? Alles in Ordnung, Thomas?«, wollte Köbi wissen.
Stille.
Statt zu antworten, nahm Thomas Schnyder vorsichtig die Pinzette mit der Karte aus Köbis Hand. Ganz langsam wischte er sie mit einem Taschentuch ab. Gerade soweit, um das Motiv erkennen zu können.
Beim Anblick erschrak er so heftig, dass er zusammenzuckte. Die Karte war ein Abbild dessen, was sie im fahlen Licht der Kerzen auf dem Alter sahen.
Der blonde Jüngling.
Sein Haarschnitt.
Die in die Stirn geritzte Lemniskate, die umgestürzte Acht, das Symbol der für das menschliche Gehirn kaum vorstellbaren Unendlichkeit.
Der Kelch, der runde Laib Brot mit dem Pentagramm. Auch die Figur auf der Karte reckte in ihrer Faust eine Schriftrolle empor.
Der Pilgerstab und das Schwert.
Selbst die Blumen zu den Füssen des Opfers entsprachen dem Bild auf der Karte. Sie trug den Titel »The Magician«. Angestrengt begann er nachzudenken, was auf der Karte vom Morgen gestanden und wie diese ausgesehen hatte.
Doch so richtig zu schaffen machte Schnyder der Anblick der römischen Eins auf der Karte. Sofort ahnte er, dass dies erst der Anfang sein könnte.
Er schwieg nun auf dem Rest des Rückwegs, da er an das anziehende Wesen in der Nonnentracht denken musste. Das Bild hatte sich wie in seine Netzhaut gefressen. Fürs erste hatte er sicher das Richtige getan. Er hatte ihren betörenden Reizen widerstanden. Zumindest glaubte er, sich dem Zauber der Circe entzogen zu haben.
Vorerst zumindest.