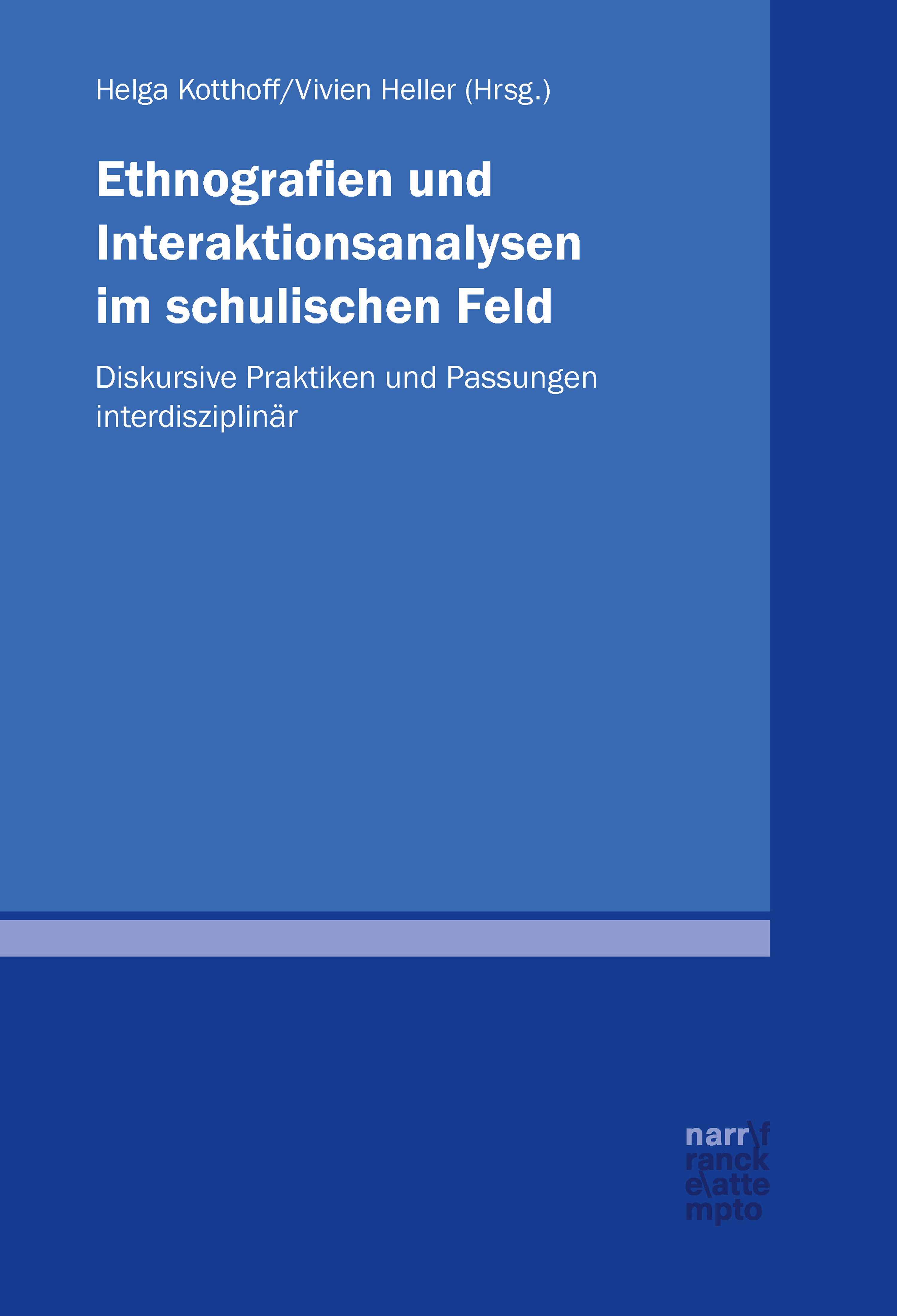
Ethnografien und Interaktionsanalysen im schulischen Feld E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band mit Beiträgen aus der Interaktionslinguistik und der qualitativ und ethnografisch ausgerichteten Soziologie und Pädagogik lotet aus, wie Ethnografien und Interaktionsanalysen zur Rekonstruktion der Herstellung sozialer Ordnung in Unterricht und Schule und – weiter gefasst – zur Erzeugung von Bildungsungleichheiten beitragen können. Die im Band vereinten Studien zeigen, dass mikroanalytische Ansätze musterhafte Prozesse innerhalb des schulischen Feldes erhellen, die sich eher außerhalb des Radars der öffentlich stark beachteten quantitativen Zugänge vom Typ der PISA-Erhebungen befinden. Sie können aufzeigen, dass und inwiefern angestrebte Prozesse der Schul- und Unterrichtsentwicklung den Eigensinn sozialer Interaktionen sowie Perspektiven und Handlungslogiken der Beteiligten berücksichtigen müssen. Eine Stärke der im Buch präsentierten Studien liegt darin, dass sie die Praktiken der in den unterschiedlichen institutionellen Rollen Beteiligten – Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung usw. – in vielfältigen Interaktionskontexten innerhalb des schulischen Felds in den Blick nehmen und zeigen, inwiefern Bildungsungleichheit nicht nur strukturell bedingt ist, sondern auch interaktiv hergestellt und perpetuiert wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helga Kotthoff / Vivien Heller
Ethnografien und Interaktionsanalysen im schulischen Feld
Diskursive Praktiken und Passungen interdisziplinär
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8369-7 (Print)
ISBN 978-3-8233-0215-5 (ePub)
Inhalt
Ethnografien und Interaktionsanalysen im schulischen Feld
Zur Einführung in diesen Band
Vorwort1
Der vorliegende Band2 lotet aus, welche Beiträge Ethnografien und Interaktionsanalysen zu Fragen der Herstellung sozialer Ordnung in Unterricht und Schule und – weiter gefasst – zur Erzeugung von Bildungsungleichheit zu leisten vermögen. Das einleitende Kapitel unternimmt den Versuch herauszuarbeiten, inwiefern mikroanalytische Ansätze gerade solche musterhaften Prozesse innerhalb des schulischen Feldes erhellen, die sich eher außerhalb des Radars quantitativer Zugänge befinden. Im Zusammenspiel mit quantitativen Zugängen können sie so Erklärungsansätze für die Reproduktion von Bildungsungleichheit liefern und aufzeigen, dass und inwiefern angestrebte Prozesse der Schul- und Unterrichtsentwicklung den Eigensinn sozialer Interaktionen sowie Perspektiven und Handlungslogiken der Beteiligten berücksichtigen müssen.
Die quantitative Bildungsforschung hat wiederholt belegt, dass sich trotz der beträchtlichen Bildungsexpansion an der Herkunftsspezifik von Bildungschancen in den letzten Jahrzehnten wenig geändert hat – dies dokumentieren sowohl Schulleistungsstudien als auch längsschnittlich angelegte soziologische Forschungen (u.a. Blossfeld et al. 2019). Die Kluft zwischen Kompetenzen von Schüler/innen aus Familien mit hohem und niedrigem Bildungs- und Wohlstandsniveau hat sich sogar noch vergrößert, wie die jüngste PISA-Studie in Bezug auf den Kompetenzbereich Lesen zeigt (Reiss et al. 2019). Auf Kinder aus zugewanderten Familien trifft dies in besonderem Maße zu (vgl. zusammenfassend Stanat und Edele 2015); stärker als in anderen Staaten ist in Deutschland Zuwanderung also mit dem sozialen Status verknüpft. Mit diesen Befunden wird die Frage virulent, wie genau und an welchen ‚Stellen‘ im Bildungsverlauf Disparitäten entstehen. Die quantitative Bildungsforschung begegnet dieser Frage, indem sie u.a. primäre, sekundäre und tertiäre Effekte – also herkunftsspezifische schulrelevante Fähigkeiten, familiale Bildungsentscheidungen und lehrerseitige Übergangsempfehlungen – untersucht, wobei der Fokus insbesondere auf Schulübergängen als den ‚Gelenkstellen‘ von Bildungsverläufen liegt. Während sie nachweisen kann, dass alle drei der genannten Effekte bedeutsam sind, wird eine Herausforderung darin gesehen, das Zustandekommen und Zusammenwirken der einzelnen Effekte genauer zu erklären (Ditton und Maaz 2015).
Dazu können neben quantitativ-längsschnittlichen vor allem auch mikroanalytische Zugänge wie die Ethnografie und Interaktionsanalyse beitragen, indem sie Passungen (Bourdieu und Passeron 1977) zwischen herkunftsspezifischen familialen Habitusausprägungen und schulischen Erwartungen rekonstruieren. Eine Stärke mikroanalytischer Ansätze liegt dabei darin, dass sie die Praktiken der in den unterschiedlichen institutionellen Rollen Beteiligten – Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung usw. – in vielfältigen Interaktionskontexten innerhalb des schulischen Felds in den Blick nehmen und zeigen, inwiefern Bildungsungleichheit nicht nur strukturell bedingt ist, sondern auch interaktiv hergestellt und perpetuiert wird.
Mit Blick auf den oben grob umrissenen Komplex von Fragen scheinen uns Ethnografie und Interaktionsanalyse aber noch in einer weiteren Hinsicht relevant. Die Befunde zur Kopplung des Bildungserfolgs an die soziale Herkunft resultierten hierzulande in einer Wende hin zu einer empirisch orientierten Bildungspolitik, deren Notwendigkeit insgesamt unbestritten sein dürfte. Sie mündete aber z.T. in praktische Umsetzungen, bspw. in Form datengetriebener Schul- und Unterrichtsentwicklung, die kritisch zu beleuchten sind. Auf der Ebene von Schulentwicklungsprozessen sollen bspw. Vergleichsarbeiten Lehrkräften Informationen für die (in Eigenregie zu bewerkstelligende) Optimierung ihres Unterrichts liefern. Fraglich ist nicht nur, ob die mittels Vergleichsarbeiten erhobenen Daten überhaupt Auskunft über Ursachen unterschiedlicher Schulleistungen oder gar Ansatzpunkte für die Unterrichtsentwicklung liefern können (Bellmann 2017). Aus ethnomethodologischer und wissenssoziologischer Sicht stellt sich vor allem auch die Frage, was eigentlich geschieht, wenn Forderungen nachVeränderungen unterrichtlichen Handelns auf im Verlauf der beruflichen Sozialisation überlieferte und relativ verfestigte unterrichtliche Praktiken und Deutungsmuster von Lehrkräften treffen. So verwundert es nicht, dass Lehrkräfte auf den fortwährenden Abgleich von Sein und Sollen und den Vergleich mit anderen Klassen und Schulen größtenteils mit einem „anreizkonformen Anpassungsverhalten“ (u.a. Reallokation von Unterrichtszeit zugunsten getesteter Aspekte des Curriculums, Assimilation des Unterrichts an testrelevante Kompetenzentwicklung, s. Bellmann 2018: 62) reagieren, das weder mit Kompetenzzuwächsen auf Seiten der Schüler/innen noch mit dem Abbau von Bildungsungleichheit einhergeht. Mit ihrem Fokus auf die Orientierungen und Praktiken der jeweiligen Beteiligten können ethnografische und interaktionsanalytische Studien auch Beiträge zu einer reflektierten Konstellierung von praxeologischer (Unterrichts-)Forschung und Fachdidaktik liefern, die Unterrichtsentwicklungs- und Professionalisierungsprozesse ausgehend von den Orientierungen und Praktiken der Beteiligten zu verändern versucht.
Im Folgenden stellen wir Überlegungen dazu an, was es heißt, Bildungsungleichheit als praktische Herstellungsleistung zu betrachten (Abschnitt 1). Aufbauend auf einen Überblick über ausgewählte ethnografische und interaktionsanalytische Befunde zum Konzept der Passung (Abschnitt 2) werden Potenziale und methodische Herausforderungen ethnografischer und interaktionsanalytischer Zugänge herausgearbeitet (Abschnitt 3). Abschnitt 4 gibt schließlich einen Überblick über die einzelnen Beiträge zu diesem Band.
1‚Bildung‘ und ‚Bildungsungleichheit‘ als Herstellungsleistung
Aus sozial-konstruktivistischer und praxeologischer Perspektive dokumentiert sich soziale Ungleichheit nicht nur in der (im Rahmen quantitativer Sozialforschung feststellbaren) Verteilung von Ressourcen und sozialen Positionen, sondern auch in dem aufeinander bezogenen Handeln von Menschen. Behrmann et al. (2019:2) bringen dies in Anlehnung an Sacks (1984) mit der Bezeichnung „doing inequality“1 auf den Punkt. Bezogen auf den speziellen Fall von Bildungsungleichheit heißt dies: Bildungsungleichheit wird ‚hergestellt‘; sie ist das Produkt praktischer, interaktiver, jedoch nicht zwangsläufig bewusster oder intentionaler Handlungsvollzüge. Eine solche dynamisch-prozessuale und generative Betrachtung von Bildungsungleichheit rückt folglich situierte Praktiken – z.B. das Kategorisieren von Personen nach bestimmten relevant gesetzten Merkmalen, das Bewerten von Leistungen und dasWeitergeben i.S. der sozialisatorischen Transmission kultureller und bildungsrelevanter Fähigkeiten (Behrmann et al. 2019) – ins Zentrum, über deren Zusammenspiel eine bestimmte bildungsbezogene Teilhabeordnung konstituiert wird.
Der Begriff der Praxis verweist dabei allerdings auf verschiedene Theorieansätze (z.B. Garfinkel 1967; Bourdieu 1976; Schatzki 1996; Reckwitz 2003; dazu auch Knoblauch und Tuma 2016), aus deren Perspektive das Herstellen und Darstellen von sozialer Ordnung konzeptionell auf jeweils unterschiedliche Weise gefasst wird. Eine gemeinsame Grundlage bildet aber die Erkenntnis von Berger und Luckmann (1969/2009: 49ff.), dass gesellschaftliche Wirklichkeit wesentlich über Prozesse der Institutionalisierung konstituiert wird, d.h. wenn sich im Laufe einer gemeinsamen Geschichte reziproke Typisierungen von Handlungen wie von Handelnden herausbilden und verfestigen. Dies gilt auch für sämtliche im schulischen Feld Agierenden. Sie konzeptualisieren so eine schulische ‚Realität‘, die essentiell eine soziale Konstruktion ist. Diese Vorstellung ist eng verwandt mit der ethnomethodologischen Auffassung, dass gesellschaftliche Tatbestände ihren Wirklichkeitscharakter erst durch die in sozialen Interaktionen vollzogenen Sinnzuschreibungen und Interpretationsleistungen erhalten (Garfinkel 1967). Auf diese Weise werden auch ‚schulische Fakten‘ in Interaktionen konstituiert:
„… Because educational facts are constituted in interaction, we need to study interaction in educational contexts, both in and out of school, in order to understand the nature of schooling.“ Mehan (1979:5f.)
Ausgehend von diesen Prämissen können Ethnografien schulischer Kommunikation und Interaktionsforschung zur Erhellung der komplexen institutionellen und kommunikativen Verhältnisse des schulischen Raums etwas Anderes beitragen als quantitative Schulleistungsstudien oder auf standardisierte Befragungen zu Sichtweisen der Akteure fußende Forschungen. Sie gehen nicht davon aus, dass die Beteiligten ihr in Praktiken eingelagertes Wissen und Können ohne Weiteres explizieren können; stattdessen machen sie die sinngebenden Alltagspraktiken und somit das Wie des als selbstverständlich und unproblematisch angenommenen Generierungsprozesses sozialer Ordnung zum Gegenstand. Deshalb stehen in den Beiträgen dieses Bandes Praktiken bzw. Aktivitätstypen bspw. des Positionierens (Kotthoff und Röhrs; Kordts; Heller und Quasthoff), des Auswählens und Reflektierens (Kern) und des Beurteilens bzw. Bewertens (Mundwiler; Kalthoff und Dittrich; bei Breidenstein und Tyagunova: Selbst-Korrigieren) im Zentrum, die mehr oder weniger gekonnt und mehr oder weniger konsonant im Zusammenspiel der Beteiligten ausgeführt werden. Diese Praktiken werden in ihren natürlichen Kontexten – in schulischen Sprechstunden, im individualisierten Unterricht, in familialen Hausaufgabeninteraktionen – aufgezeichnet und rekonstruiert. Das Ziel ist dabei nicht,
„statistisch repräsentative Auskünfte darüber machen zu können, was die im Hinblick auf Lernergebnisse geeignetsten Unterrichts-Verfahren sind. Es ist für sie [die qualitative Schulforschung, H.K. und V.H.] kein Problem, nicht in die Köpfe der Schüler/innen oder der Lehrer/innen schauen zu können, weil sie sowohl pädagogische Interaktionen wie auch Lernen selbst jeweils als ein soziales Geschehen versteht und beobachtet. Sie kann – sehr konkret am einzelnen Fall – zeigen, was im Unterricht und in welcher Weise etwas im Unterricht geschieht und funktioniert; sie kann in der Folge und im Vergleich Formen und Muster dieses sozialen Geschehens herausarbeiten“ (Reh 2012:151).
Ethnografien schulischer Kommunikation erhellen beispielsweise den „Schüler-Job“ (Breidenstein 2006), der u.a. das komplexe Management von gleichzeitigem Mitmachen-am-Unterricht und Banknachbarn-Unterhalten beinhaltet, die komplexe Anforderung also, seine Aufmerksamkeit und sein Handeln gleichzeitig auf mehreren Ebenen zu organisieren (Kotthoff 2011). Daneben wurden bspw. Benotungspraktiken unter die soziologisch-ethnografische Lupe genommen (Kalthoff 1996 und in diesem Band) oder auch Elitebildungsprozesse in Internatsschulen, die von vornherein nicht allen offenstehen (Kalthoff 1997). Auf diese Weise können Ethnografien und Interaktionsanalysen Praktiken innerhalb des schulischen Felds in ihren (in)formellen Logiken und ihrer auch materiellen Ressourcenanbindung erhellen.
Neben diesen Potenzialen sind allerdings auch Herausforderungen zu nennen, vor denen insbesondere Interaktionsanalysen ethnomethodologischer und konversationsanalytischer Provenienz stehen, wenn sie versuchen, Praktiken mit Blick auf ihre Milieu- oder Herkunftsspezifik zu untersuchen: Um sicherzustellen, dass bei der Datenerhebung Interaktionen von Angehörigen unterschiedlicher Milieus oder Gruppen erfasst werden, müssen die Forschenden auf extern gesetzte, präanalytische Kategorien wie bspw. den sozio-ökonomischen Status oder die Schulform zurückgreifen. Damit begeben sie sich in ein Dilemma. Aus dem naturalistischen Datenverständnis (Deppermann 2000) der ethnomethodologischen Konversationsanalyse folgt, dass Daten nicht theoriebasiert arrangiert werden und sich die rekonstruktive Analyse auf die beobachtbaren Relevanzen der Beteiligten beschränkt. Erfolgen Datenerhebungen aber in Absehung möglicher sozialer Unterschiede, drohen sie einen Bias zu produzieren und bspw. für bildungsaffine Milieus typische Praktiken als ‚Normalform‘ zu postulieren. Werden hingegen externe Kategorien bei der Datenerhebung berücksichtigt, besteht die Gefahr, diese als Ressource für eigene Analysebemühungen zu nutzen (Garfinkel 1967), und zu übersehen, ob und inwiefern sie auch von den Beteiligten relevant gemacht werden. Eben darin dürfte wohl einer der wesentlichen Gründe liegen, warum die ethnomethodologische Konversationsanalyse der Untersuchung sozialer Ungleichheit bislang weitestgehend aus dem Weg gegangen ist – auch wenn dies durchaus als relevant erachtet wird: „Investigation into how interaction is embedded in the reproduction of race, class, and gender inequalities, though overdue, is a clear prospect for contemporary CA research“ (Heritage 2009: 313).
Zeitgenössische Studien haben unterschiedliche Lösungen für dieses methodische Problem entwickelt. Eine Lösung besteht darin, mögliche ungleichheitsgenerierende Praktiken wie das Kategorisieren, Positionieren und Bewerten (s.o.) selbst zum Gegenstand der Untersuchung zu machen (vgl. auch Hirschauer 2014: 180). Andere Ansätze verbinden interaktionsanalytische Zugänge mit dem Bourdieuschen Habituskonzept, um einer etwaigen Milieuspezifik von Praktiken und ihre unterschiedliche Passung zu schulischen Erwartungen auf die Spur zu kommen. Dabei werden zum einen kulturelle Ressourcen und Praktiken verglichen; zum anderen wird der von Bourdieu und Passeron (1977) geprägte Begriff der Passung konstitutionsanalytisch als diskursives, interaktiv hergestelltes „achievement“gefasst. Wie dies in bisherigen ethnografischen und interaktionsanalytischen Untersuchungen zum Tragen kam, ist Gegenstand des folgenden Abschnittes.
2Ethnografische und interaktionsanalytische Zugänge zu Passungen
Angestoßen durch die Befunde international vergleichender Schulleistungsstudien zur Kopplung des Bildungserfolgs an die soziale Herkunft wurde das von Bourdieu und Passeron (1977) formulierte Konzept der kulturellen Passung erneut aufgegriffen und in einer Reihe ethnografischer und interaktionsanalytischer Studien weiterentwickelt. Vorreiter waren dabei groß angelegte Ethnografien zur Kommunikation in Elternhäusern und Schulen in den USA, wie etwa die von Heath (1983) und Lareau (2003). Auf der Grundlage längerfristig angelegter teilnehmender Beobachtungen in zwei Grundschulen und zwölf Familien aus unterschiedlichen sozio-ökonomischen Milieus (sowie Interviews mit 88 Eltern) untersuchen Lareau und ihr Team, wie Elternschaft und Kindheit je nach sozialer Klasse kulturell anders praktiziert werden. Was sie u.a. bei Fußball- und Nachbarschaftsspielen, Auto- und Busfahrten durch die Stadt, Hausaufgaben- und Morgenroutinen, Arzt- und Zahnarztterminen sowie Gesprächen zwischen Eltern und Lehrpersonen beobachten, zeigt auffallende Unterschiede in der Organisation des täglichen Lebens der Kinder, ihrer Kommunikationsentwicklung sowie ihren Fähigkeiten, in sozialen Institutionen zu interagieren. Die Studie entdeckt in alltäglichen Abläufen, wie sich das kulturelle Repertoire, das den Kindern vermittelt wird, je nach sozialer Schicht so gestaltet, dass schon im frühen Alter schulische Vor- und Nachteile auftreten. In der Welt der Mittelschicht wird die Kindererziehung als „konzertierte Kultivierung“ praktiziert, die eine hohe Passung zu schulischen Erwartungen aufweist und in der Schule ihre optimale Ergänzung findet. Mittelschichteltern fördern und bewerten die Talente ihrer Kinder, indem sie sie in organisierte Aktivitäten einbeziehen, mit ihnen argumentieren, sie auffordern, Fragen an Ärzte zu formulieren und insgesamt so aufzutreten, dass sie von sozialen Einrichtungen Maßnahmen verlangen können. Besonders deutlich zeigt sich dies im schulischen Kontext: Im Unterschied zu Kindern aus ärmeren Milieus formulieren Mittelschichtskinder gegenüber Lehrpersonen Erwartungen; darüber hinaus intervenieren aber auch die Eltern in ihrem Namen bei Lehrerpersonen und Coaches. Die Logik der Kindererziehung in Familien der Arbeiterklasse, die Lareau als „natural growth“ bezeichnet, bildet dazu einen erheblichen Kontrast. Diese Eltern konzentrieren sich auf die Grundversorgung der Kinder und setzen auf eine natürliche Talententwicklung. Das Leben der Kinder findet vor allem in der Nähe des Hauses statt, mit weniger strukturierten Aktivitäten, mehr Interaktion mit Geschwistern und klareren Grenzen zwischen Erwachsenen und Kindern. So wird von Kindern i.d.R. erwartet, in Gegenwart von Erwachsenen gehorsam zu sein; parallel dazu leben ihnen die Eltern Unbehagen und Zurückhaltung in ihren Interaktionen mit Schulbeamt/innen und medizinischen Fachkräften vor. Die schichtspezifischen Unterschiede kulminieren darin, dass Mittelstandskinder lernen, das zu fordern, was sie wollen, während Kinder aus Arbeiterhaushalten und armen Familien lernen, das zu akzeptieren, was angeboten wird. Für Kinder, die eine „konzertierte Kultivierung“ ihrer Fähigkeiten erfahren, ergänzen sich Schule, Freizeitaktivitäten und Elternhaus konsonant, was sich auch am jeweiligen Zuschnitt kommunikativer Erwartungen der Lehrpersonen zeigt (Fragen nach Erfolgen bei musikalischen Auftritten werden gestellt, Fragen zum Fernsehkonsum hingegen nicht). Nicht alles lässt sich aus diesen Ethnografien milieuspezifischer familialer Praktiken auf den deutschsprachigen Raum übertragen. Unterschiedliche Passungen von kommunikativen Praktiken, Handlungslogiken und Deutungsmustern in Elternhaus und Schule wurden aber auch hier sichtbar. Jünger (2008) nähert sich diesen Logiken über Interviews und Gruppendiskussionen mit Viert- und Fünftklässler/innen aus wohlhabenden und unterprivilegierten Wohngebieten der Stadt Zürich. Sie stellt die Belastungen heraus, unter denen Kinder aus ressourcenschwachen Elternhäusern aufgrund ihrer Erfolglosigkeit leiden. Zum anderen untersucht sie (schul-)pädagogische Möglichkeiten zur Unterstützung dieser Kinder.
Auch aus Perspektive der interaktionalen Soziolinguistik werden unterschiedliche Passungsverhältnisse untersucht, wobei insbesondere familiale und schulische Interaktionsformen fokussiert werden. Die Frage nach diskursiven Passungen eröffnet neue soziolinguistische, post-bernsteinianische Diskussionen (Cook-Gumperz 2009; Duff 2010; Quasthoff und Heller (Hrsg.), 2014). So beschreibt Heller (2012) die „kommunikativen Erfahrungen“ von elf Grundschulkindern mit deutscher, türkischer und vietnamesischer Erstsprache anhand von audiografierten familialen Tischgesprächen und videografiertem Anfangsunterricht in vier Schulen. Mikroanalytisch werden zunächst familiale Gattungsrepertoires und Praktiken des Argumentierens in ihren jeweiligen Passungsverhältnissen zur alltäglichen kommunikativen Praxis der Schule beschrieben. Ausgehend von einem Verständnis von Passung als interaktiv hergestellt wird darüber hinaus rekonstruiert, wie sich Passungen und Divergenzen in der Lehrer-Schüler-Interaktion manifestieren und im Verlauf von Interaktionsgeschichten schon zu Beginn des Bildungsverlaufs musterhaft verfestigen. Es zeigen sich zum einen familienspezifische Gattungsrepertoires und Praktiken des Argumentierens, die unterschiedlich gut zu unterrichtlichen Anforderungen und Erwartungen passen (dazu auch Spiegel und Deschner 2010). Je unterrichtsähnlicher eine Schülerin argumentiert, desto eher beteiligen sich Lehrpersonen an dem Diskurs, desto stärker gelingt die Bezugnahme aufeinander. Die Schulklassen werden für die untersuchten elf Kinder in ganz unterschiedlichem Maße zu einer Diskursgemeinschaft, in der ihnen Anerkennung als vollwertiges Mitglied und Partizipationschancen gewährt werden.
Quasthoff und Morek (2015) untersuchen Passungen und Divergenzen zwischen schulisch erwartetem Sprachverhalten und außerschulischen Diskurspraktiken von Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Milieus, indem sie über Familie und Unterricht hinaus auch Peergruppen als relevante Sozialisationskontexte in den Blick nehmen. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, welche diskursiven Praktiken in welchen der drei Kontexte prominent vorkommen. Gerade in Bezug auf die im schulischen Unterricht relevanten Praktiken des Erklärens und Argumentierens zeigt sich, dass diese nicht durchgängig auch in Cliquen- und Familieninteraktionen vorkommen oder sogar als dispräferiert behandelt werden. Im Vergleich des kommunikativen Agierens derselben Jugendlichen in den drei Kontexten werden unterschiedliche Partizipationsprofile (z.B. kontextübergreifend Erfolgreiche und ausschließlich außerschulisch Erfolgreiche) herauspräpariert.
Schließlich dokumentieren die unlängst entstandenen Arbeiten zu schulischen Sprechstundengesprächen, dass und wie im Zusammenspiel von Eltern und Lehrkräften (und mitunter auch Kindern) unterschiedliche Passungen konstituiert werden. Verschiedene Studien (z.B. Pillet-Shore 2012 und einige Arbeiten in Hauser und Mundwiler 2015) arbeiten heraus, wie Eltern sich in dem institutionellen Setting als Unterstützungsinstanz für das Kind darstellen. Eltern erzählen beispielsweise detailliert, wie sie ihr Kind zum Lernen anhalten und gemeinsame Lernkontexte gestalten (Kotthoff 2015). Dass Lehrpersonen diese Seite einer professionell kompetenten Person von sich zeigen, erwartet man gemeinhin sowieso. Sowohl in Erzählfragmenten als auch beim Argumentieren oder in Beratungszusammenhängen holen nun aber auch viele Eltern zur Kommunikation von „doing being a competent parent“ im ethnomethodologischen Sinne aus (dazu auch Adelswärd und Nilholm 2000). Dies betreiben Eltern sogar mittels kritischer Beschreibungen des Verhaltens oder der Leistung ihres Kindes. Wenngleich dies sicher nicht als bewusst gewählte Strategie einer optimalen Präsentation des Zuhauses gesehen werden kann, fällt diese Praxis aber doch auf, vor allem in Distinktion zu Eltern, die sie nicht betreiben (können).
Der kurze Überblick zeigt, dass Passungsverhältnisse auf vielfältige Weise gefasst werden können und sollen. Dementsprechend nehmen die Beiträge des Bandes unterschiedlichste Prozesse in den Blick, die die Vielschichtigkeit schulischer und schulbezogener Gestaltungsverhältnisse beleuchten. In Bezug auf den Kontext Schule liegen seit 40 Jahren Studien zu Unterrichtsinteraktionen vor (siehe dazu beispielsweise Beiträge in Krelle und Spiegel 2009; Spreckels 2009; Heller und Morek 2015), die in den letzten Jahren besonders unter multimodaler Perspektive (Schmitt 2009, 2011) beleuchtet werden. Wir knüpfen an diese Forschung an und erweitern diese, indem wir vermehrt auch schulische Aktivitätsfelder an den Peripherien von Unterricht ins Visier nehmen, wobei eine interaktional-soziolinguistische und kommunikationssoziologische Interessensausrichtung leitend ist.
3Die Beiträge in diesem Band
Der vorliegende Band versammelt interaktionsanalytische und ethnografisch geprägte Herangehensweisen an schulische Interaktion. Gemeinsam ist ihnen, dass Schule als ein komplexer Handlungsraum perspektiviert wird, in dem nicht nur Lernen und optimaler Input über den tatsächlichen Bildungserfolg entscheiden, sondern auch Identitätsverhandlungen und Konstruktionen von mehr oder weniger erfolgreichen Schülertypen unterschiedlicher Art und Voraussetzung (Wortham 2006; Budde et al. 2008) von hoher Relevanz sind. Die in diesem Band versammelten Beiträge widmen sich den verschiedenen Nahtstellen, die im schulischen Feld von Bedeutung sind, denen von Elternhaus und Schule, denjenigen von Fachwissen und unterrichtlichen Eigendynamiken oder auch derjenigen von Unterricht und Lehrerhandeln aus Außen- und Innenperspektive.
Dabei setzen wir nicht nur auf die wechselseitige Ergänzung von Ethnografie und Interaktionsanalyse, sondern auch auf Interdisziplinarität: Im Feld unserer praxeologisch orientierten Schulforschung untersuchen Soziolog/innen auf ethnographischem Wege die zeitliche Zurichtung des Unterrichts auf Prüfungen sowie Praktiken des Bewertens (Kalthoff und Dittrich); Erziehungswissenschaftler/innen beschreiben familiale Unterstützungspraktiken und -ressourcen für die Bewerkstelligung von Hausaufgaben (Budde) und rekonstruieren, wie Schülerinnen und Schüler im individualisierten Unterricht mit der eigenständigen Bearbeitung fachlicher Aufgaben umgehen (Breidenstein und Tyagunova). Interaktionslinguist/innen wiederum rekonstruieren Bewertungs- und Positionierungspraktiken von Eltern, Kindern und Lehrpersonen in schulischen Sprechstunden (Kotthoff und Röhrs, Mundwiler) und untersuchen auf Basis von Schüler-Gruppendiskussionen über Unterricht, wie sozial privilegierte und benachteiligte Schüler/innen Lehrpersonen sozial kategorisieren und sich zu ihnen in Beziehung setzen (Heller und Quasthoff). Schließlich wird rekonstruiert, wie Novizen im Rahmen der Nachbereitung von Praxiserfahrungen Reflexionsgegenstände konstituieren und unter Hinzuziehung (mehr oder weniger adäquaten) fachlichen Wissens zu bearbeiten versuchen (Kern).
Sechs Beiträge fokussieren diskursive Praktiken und Passungen. Sie widmen sich der Beschreibung des komplexen Zusammenspiels unterschiedlicher Akteure, die jeweils spezifische Ordnungen herstellen, z.B. durch bestimmte Positionierungen innerhalb von Interaktionen.
Jürgen Budde nähert sich aus praxistheoretischer Perspektive „Fallvignetten“ zu bestimmten Schülern und Schülerinnen in konkreten Kontexten, die sein Team und er in zwei schulvergleichenden Forschungsprojekten kennengelernt haben. Die Projekte verbinden Video- und Audioaufzeichnungen relevanter Situationen im Bereich der Sekundarstufe (z.B. Hausaufgabenkontrolle) sowie ethnografische Hintergrunderhebungen und Befragungen der agierenden Personen. Ausgehend von der Diskussion vorherrschender erziehungswissenschaftlicher Betrachtungsweisen zu unterschiedlichen Feldlogiken von Schule und Elternhaus, die längst auch schichtenspezifische Perspektiven der Eltern auf den Bereich Schule erhellt haben, macht Budde stark, dass Praktiken im Sinne Schatzkis (situative Verbünde von Handeln und Kommunizieren) Subjektkonfigurationen erst hervorbringen würden. Im familiären und schulischen Umgang mit Hausarbeiten wird in den vignettenhaften Szenenbeschreibungen und Gesprächstranskripten deutlich, wie stark schulbezogen eine im Aufsatz vorgestellte Familie agiert, in der die Mutter auch selbst Lehrerin ist. Hier wird zu Hause sehr unterrichtsähnlich und auch in dieser Hinsicht kompetent agiert. Auf der anderen Seite wird sichtbar, dass Lehrpersonen schon bei der Vergabe von Hausarbeiten auf die Notwendigkeit elternseitiger Unterstützung verweisen, und weder registrieren noch reflektieren, dass nicht alle Schüler/innen über diese Ressource verfügen. Stattdessen wird umstandslos von einer Passung schulischer Erwartungen und familialer Ressourcen ausgegangen.
Ina Kordts zeigt auf Basis videografierten Unterrichts an verschiedenen Schulformen, wie unterschiedlich Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler als Kollektiv positionieren. Dazu greift sie neben konversationsanalytischen und ethnografischen Zugängen auch auf das sozialpsychologische Konzept der sozialen Positionierung zurück. Rekonstruiert wird zunächst, wie die Schüler/innen einer Realschule und eines privaten Gymnasiums im Hinblick auf ihr Sozialverhalten und Leistungsvermögen von ihren jeweiligen Lehrkräften interaktiv positioniert werden. Komplementär werden die damit einhergehenden Selbstpositionierungen der Lehrkräfte in den Blick genommen. Im anschließenden schulformbezogenen Vergleich zeigt sich, dass die Schülerschaft der Realschulklasse als verhaltensproblematisch, erziehungsbedürftig und (in Bezug auf Leseerfahrungen und -vermögen) leistungsschwach positioniert wird, während die Schüler/innen der Gymnasialklasse als kritisch-mitdenkende Subjekte, die fachlich zu fordern sind, etabliert werden. Damit einher gehen unterschiedliche Selbstpositionierungen der Lehrkräfte als fürsorglich vs. fordernd. In der Verschränkung mit ethnographischen Daten zeigt sich, dass die gesprächsanalytisch gewonnenen Befunde in einem systematischen Zusammenhang mit unterschiedlichen Arten unterrichtlicher Gesprächsführung und Sichtweisen auf Schüler/innen einhergehen.
Auf der Basis von Gruppendiskussionen sozial privilegierter und benachteiligter Schüler/innen, also Daten zweiter Ordnung, machen Vivien Heller und Uta Quasthoff die Schülersicht auf Lehrerhandeln zum Gegenstand. Mit Hilfe der „Membership Categorization Analysis“ wird freigelegt, welche konstitutiven und nicht-konstitutiven kategoriengebundenen Aktivitäten von Lehrkräften relevant gesetzt werden und welche „stances“ die diskutierenden Schüler/innen dabei einnehmen. Während die sozial benachteiligten Schüler/innen die soziale Kategorie Lehrer mit konstitutiven Aktivitäten koppeln, thematisieren die sozial privilegierten Schüler/innen auch nicht-konstitutive und somit prinzipiell hinterfragbare Aspekte des Lehrerhandelns. Im Rahmen stilisierender Redewiedergaben enttarnen und hinterfragen sie beobachtetes Lehrerhandeln aus quasi-professioneller Sicht als problematisch und entwickeln Alternativen. Dabei wird sichtbar, dass die jeweiligen Schülergruppen das Lehrerhandeln aus sehr unterschiedlichen Positionen heraus bewerten: Die eher privilegierten Schüler/innen bewerten Unterricht „auf Augenhöhe“ aus einer Position der sozialen Passung heraus, während weniger privilegierte Schülerinnen und Schüler sich aus einer sozial inferioren Position heraus als wenig handlungsfähige Objekte der Bildungsinstitution positionieren. Der gewählte methodische Zugriff macht sichtbar, dass sich Passungen und Divergenzen auch in den schülerseitigen Deutungen und Bewertungen von Unterricht zeigen.
Herbert Kalthoff und Tristan Dittrich untersuchen Praktiken des Korrigierens von Lehrkräften am Beispiel einer Unterrichtseinheit zum mündlichen und schriftlichen Argumentieren. Auf Basis ethnographischer Beobachtungen, die über den Unterricht hinaus auch die außerhalb des Unterrichts stattfindende Korrektur umfasst, beschreiben sie zum einen die zeitliche Einbettung der Arbeit in die Unterrichtseinheit und zum anderen den Prozess des Korrigierens und Bewertens. Im kontrastierenden Vergleich der Textbewertungsprozesse zweier Schüler/innen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zeigt sich u.a., dass Lehrkräfte im Beurteilungsprozess einen Erwartungsabgleich vollziehen, bei dem die schülerseitigen Textprodukte auf ihre Entsprechung zu dem im Unterricht Behandelten geprüft werden. Schriftliche Kommentierungen werden dabei sowohl graphisch als auch sprachlich unterschiedlich kontextualisiert und entweder als zurückweisende Identifikation von Fehlern oder ‚aufmunternde‘ Verbesserungsvorschläge gerahmt. In dem jeweiligen Zuschnitt der Kommentare werden auf diese Weise auch unterschiedliche Erwartungen der Lehrkraft bezüglich des Leistungsvermögens der Schüler/innen erkennbar. Kalthoff und Dittrich schließen, dass die kontingente Praxis des Beurteilens eine diskursive (Nicht-)Passung mitorganisiert, deren Bezugspunkte die Sprache des Unterrichts, die schulische Kultur oder die soziale Herkunft sind.
Vera Mundwiler hat in der Nordwestschweiz vierzehn Beurteilungsgespräche in der Primar- und Sekundarstufe erhoben, bei denen auch die Kinder anwesend waren. Die Anwesenheit der Schüler/innen in solchen ursprünglich nur von Eltern und Lehrperson geführten Besprechungen werden in der Schweiz und Deutschland als Demokratiegewinn und Kommunikation auf Augenhöhe ideologisiert. Mundwiler untersucht nun, wie in den Gesprächen an einer zuvor schriftlich eingeforderten Selbstbeurteilung der Schüler/innen konversationell gearbeitet wird. Redeanimationen, in denen beispielsweise die Lehrperson mögliche Gedanken der Schülerin inszeniert, erhalten eine Funktion für ihre schulische Passung, indem sie mögliche Haltungen veranschaulichen und implizit bewerten. Mundwiler zeigt auf detaillierte Weise, dass sich vor allem eine Verantwortungsverschiebung weg von der Schule hin zu den Schülern ereignet. Die geforderte Selbstbeurteilung wird so fast zu einem Test für die Schulkompatibilität der Schüler/innen. Damit fundiert Mundwiler eine kritische Sicht auf die vermeintliche Augenhöhe zwischen Lehrpersonen und Schülern, die sich auch in der Studie von Bonanati (2018) findet.
Auch der Beitrag von Helga Kotthoff und Falko Röhrs betrachtet Gespräche zwischen Lehrpersonen und Eltern. Sie zeichnen besonders die auffälligen Bemühungen der Eltern nach, sich in diesen Gesprächen in Sachen Schule kundig und engagiert zu präsentieren. Sie analysieren Abläufe im kommunikativen Aktivitätstyp des Beratens. Unter Rückgriff auf das in der Interaktionslinguistik schon lange verankerte Konzept des Aktivitätstyps deuten sie darauf hin, dass sich in diesen Konnex zwischen „doings and sayings“ einschreibt, wer auf im Kontext wertvolle Ressourcen zurückgreifen kann. Mit Knoblauch und Tuma (2016) wird der subjektive Faktor in der Analyse der Beratungspraktiken nicht ausgespart und so wird deutlich, dass sich das performative Vorführen als engagierte Eltern graduell unterscheidet. Es gelingt gebildeten und sprachlich kompetenten Eltern eher, Beratungen selbständig auszugestalten und Aktivitäten ins Feld zu führen, die in Bezug auf den Unterricht und in einer Art Weiterführung desselben zu Hause stattfinden. Das Korpus von 77 Elterngesprächen aller Schultypen zeigt, ähnlich wie in den Beiträgen von Heller und Quasthoff sowie Kordts, dass sich soziale Positionierungen – hier der Eltern (meist Mütter) – zu den Lehrpersonen unterscheiden: Beratungen, in denen Eltern(teile) Informationen der Lehrkraft schlicht rezipieren, zeugen unter der Hand auch von einem Kompetenzgefälle. Stark ko-konstruierte Beratungen zeigen dagegen, wie sehr die Eltern sich in der Lage sehen, zu Hause selbsttätig Aktivitäten zu veranlassen, die schulische Bemühungen unterstützten – und dies auch vorzubringen. In diesem Fall sprechen sie von diskursiver Passung. Eltern mit hoher schulischer Kompetenz halten auch Dissens mit der Lehrperson länger durch. Sie bringen mitunter inhaltliche Kritik an didaktischen Vorgehensweisen zum Ausdruck.
Zwei Beiträge des Bandes verbinden Interaktionsforschung, Ethnografie und Fachdidaktik, indem sie nachzeichnen, in welcher Form sich Lern- und Bildungsprozesse einzelner Schüler/innen im individualisierten Unterricht vollziehen und wie Lehramtsstudierende ethnografisch beobachtetes Handeln von Deutschlehrkräften mit Blick auf dessen fachliche und fachdidaktische Begründung reflektieren.
Georg Breidenstein und Tanya Tyagunova untersuchen eine Episode aus dem individualisierten Unterricht, in der Schüler/innen mit Unterrichtsmaterial arbeiten, bei dem sich erst sehr spät herausstellt, dass es fehlerhaft konzipiert ist. Sie zeigen die Mühen eines Schülers, trotzdem sinnvoll mit dem Material umzugehen, aber auch, wie die mangelnde Anleitung durch die Lehrerin einen Raum für fremdkontrollierend auftretende Schüler öffnet. Dass die Schüler/innen die Sachebene verlassen und sich mehr mit passenden Farben des Materials beschäftigen, tritt in der detaillierten Ethnografie deutlich hervor. Die Routinen der Bearbeitung werden von den Schülern durchgehalten, auch wenn dabei Einsichten in den fachlichen Gegenstand ausbleiben. Damit zeigen Breidenstein und Tyagunova, dass sich in die Programmatik des individualisierten Unterrichts Praktiken der Interaktionsorganisation und des peerkulturellen Umgangs mit Material einschreiben, die die Lernpotenziale des Materials außer Acht lassen. In der eingehenden Analyse der schülerseitigen Auseinandersetzung mit dem Material wird sichtbar, dass der individualisierte, auf selbstorganisiertes Lernen setzende Unterricht nicht automatisch (die beabsichtigten) Lernprozesse initiiert und somit nur bedingt als Antwort auf die Heterogenität von Schüler/innen taugt. Auf der Grundlage dieser Beobachtungen werden grundlegende Überlegungen dazu angestellt, wie eine praxeologische und eine fachdidaktisch orientierte Unterrichtsforschung in produktiver Weise aufeinander bezogen werden können. Mit der praxeologischen Reformulierung des didaktischen Dreiecks schälen sich Praktiken der Strukturierung des Lerngegenstands, der Aufgabenbearbeitung und der Interaktionsorganisation als drei sich wechselseitig ergänzende Forschungsgegenstände heraus.
Friederike Kern widmet sich der Passung von Theorie und Praxis am Beispiel von Lehramtstudent/innen, die im Rahmen des Praxissemesters Deutschunterricht ethnografisch beobachten und ihre Beobachtungen nachträglich in Seminarkleingruppen für die Entwicklung der eigenen Professionalität fruchtbar zu machen versuchen. Anhand von Interaktionsanalysen aufgezeichneter Kleingruppengespräche zeigt Kern, wie komplex die Überführung von Beobachtungen in fachliche Reflexionen ist: Sie erfordert zunächst einmal die Konstitution eines ethnografischen Falls, darüber hinaus die Aushandlung thematischer Fokussierungen und vor allem das Hinzuziehen einschlägiger fachlicher Wissensbestände zur Einordnung und Reflexion des Beobachteten. Insbesondere der letzte Aspekt erweist sich insofern als eine wesentliche Herausforderung, als in einigen Gruppen ausschließlich allgemein-didaktische oder erziehungswissenschaftliche Wissensbestände für die Durchdringung des eigentlich fachlichen Problems herangezogen werden. Mit ihrer Untersuchung adressiert Kern die wichtige Nahtstelle der Relationierung von Praxisbeobachtung und Fachwissen, die nicht erst seit der Restrukturierung schulpraktischer Anteile in der Lehramtsausbildung in ihrer Relevanz erkannt wird. Sie zeigt, dass Novizen bei der Entwicklung einer „professional vision“ (Goodwin 1994) nicht zuletzt auf Experten angewiesen sind, die sie auf die Divergenz zwischen ethnografisch beobachtetem und fachdidaktisch begründetem Unterrichtshandeln hinweisen.
Schluss
Der Überblick macht die Bandbreite sichtbar, mit der die hier versammelten mikroanalytischen Beiträge interaktive Musterhaftigkeiten und diskursive Praktiken in den unterschiedlichsten schulischen Aktivitätsfeldern – vom Unterricht über das Korrigieren schriftlicher Arbeiten, familiale Hausaufgabeninteraktionen, schulische Sprechstundengespräche bis hin zu Diskussionen von Schüler/innen und Lehramtsnoviz/innen über Unterricht – beleuchten. Dabei erweist sich zum einen die Verbindung von Ethnografie und Interaktionsanalyse als gewinnbringend: Mikroanalytisch untersuchte Interaktionsepisoden werden in längerfristige zeitliche Ordnungen eingeordnet oder zu übergreifenden Orientierungen (bspw. von Lehrkräften) in Beziehung gesetzt. Zum anderen zeigt sich, dass systematisch angelegte Datenerhebungen und vergleichende mikroanalytische Zugänge das Potenzial haben, Unterschiede in Ressourcen und Praktiken zutage zu fördern, ohne dabei sozialstrukturellen Determinismen das Wort zu reden (Rehbein und Saalmann 2009). So wird deutlich, dass sich Akteure innerhalb der Institution Schule mehr oder weniger günstig positionieren können. Dabei spielt ihr praktisches Wissen über die Institution und ihr Handlungspotenzial durchgängig eine Rolle. Schließlich verspricht die Verbindung von praxeologischer (Unterrichts-)Forschung und Fachdidaktik Grundlagenwissen dafür zu generieren, Unterrichtsentwicklungs- und Professionalisierungsprozesse ausgehend von den Orientierungen und Praktiken der Beteiligten zu konzeptualisieren.
Wuppertal und Freiburg im Breisgau, im März 2020
Literatur
Adelswärd, Viveka/Nilholm, Claes (2000): Who is Cindy? Aspects of identity work in a teacher-parent-pupil talk at a special school. Text 20/4, 545–568.
Behrmann, Laura/Eckert, Falk/Gefken, Andreas (2018): Prozesse sozialer Ungleichheit aus mikrosoziologischer Perspektive – eine Metaanalyse qualitativer Studien. In: Behrmann, L./Eckert, F./Gefken, A./Berger, P.A. (Hrsg.) ‚Doing Inequality‘. Wiesbaden: Springer, 1–34.
Bellmann, Johannes (2018): Selbstregulation im ständigen Abgleich von Sein und Sollen. Ansätze zu einer Theorie von Wirkungen und Nebenwirkungen datengetriebener Steuerung. In: Drossel, K./Eickelmann, B. (Hrsg.): Does „What works“ work? Bildungspolitik, Bildungsadministration und Bildungsforschung im Dialog. Münster: Waxmann, 55–71.
Bellmann, Johannes et al. (2016): Nebenfolgen Neuer Steuerung und die Rekonstruktion ihrer Genese. Zeitschrift für Pädagogik 62:3, 381–402.
Berger, Peter L./Luckmann, Thomas (2009/1969): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. 22. Aufl. Frankfurt a.M.: Fischer.
Bergmann, Jörg R. (2000): Ethnomethodologie. In: Flick, U./von Kardorff, E./Steinke, I. (Hrsg.) Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 118–135.
Blossfeld, Hans P./Blossfeld, Gwendolin J./Blossfeld, Pia N. (2019): Soziale Ungleichheiten und Bildungsentscheidungen im Lebensverlauf: Die Perspektive der Bildungssoziologie. Journal of Educational Research Online11:1, 16–30.
Bonanati, Marina (2018): Lernentwicklungsgespräche und Partizipation. Rekonstruktionen zur Gesprächspraxis zwischen Lehrpersonen, Grundschülern und Eltern. Wiesbaden: Springer VS.
Bourdieu, Pierre (1976): Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Bourdieu, Pierre/Passeron, Jean C. (1977): Reproduction in education, society and culture. London: Sage.
Breidenstein, Georg (2006): Teilnahme am Unterricht. Ethnographische Studien zum Schülerjob. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Budde, Jürgen/Scholand, Barbara/Faulstich-Wieland, Hannelore (2008): Chancen und Blockaden einer geschlechtergerechten Schule. Weinheim/München: Juventa.
Deppermann, Arnulf (2000): Ethnographische Gesprächsanalyse: Zu Nutzen und Notwendigkeit von Ethnographie für die Konversationsanalyse. Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 1, 96–124.
Ditton, Hartmut/Maaz, Kai (2015): Sozioökonomischer Status und soziale Ungleichheit. In: Reinders, H./Ditton, H./Gräsel, C./Gniewosz, B. (Hrsg.) Empirische Bildungsforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 229–244.
Duff, Patricia A. (2010): Language Socialization into Academic Discourse Communities. Annual Review of Applied Linguistics 30, 169–192.
Garfinkel, Harold (1967): Studies in ethnomethodology. Cambridge: Polity Press.
Goodwin, Charles (1994): Professional Vision. American Anthropologist 96:3, 606–633.
Gumperz, John (2009): Bernstein, educational change, and gendered language. Multilingua28:2/3, 291–307.
Hauser, Stefan/Mundwiler, Vera (2015) (Hrsg.): Sprachliche Interaktion in schulischen Elterngesprächen. Bern: hep.
Heath, Shirley B. (1983): Ways with words. Language, life, and work in communities and classrooms. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
Heller, Vivien (2012): Kommunikative Erfahrungen von Kindern in Familie und Unterricht. Tübingen: Stauffenburg.
Heller, Vivien/Morek, Miriam (Hrsg.) (2015): Academic discourse as situated practice. Themenheft in Linguistics& Education 31.
Helsper, Werner/Kramer, Rolf-Thorsten/Thiersch, Sven (Hrsg.) (2013): Schülerhabitus. Theoretische und empirische Analysen zum Bourdieuschen Theorem der kulturellen Passung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Heritage, John (2009): Conversation Analysis as Social Theory. In: Turner, B. S. (Hrsg.) The new Blackwell companion to social theory. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 300–320.
Jünger, Rahel (2008): Bildung für alle? Die schulischen Logiken von ressourcenprivilegierten und -nichtprivilegierten Kindern als Ursache der bestehenden Bildungsungleichheit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kalthoff, Herbert (1996): Das Zensurenpanoptikum. Zeitschrift für Soziologie 25:2, 106–124.
Kalthoff, Herbert (1997): Wohlerzogenheit. Eine Ethnographie deutscher Internatsschulen. Frankfurt a.M.: Campus.
Knoblauch, Hubert/Tuma, René (2016): Praxis, kommunikatives Handeln und Videoanalyse der Videoanalyse. In: Deppermann, A./Linke, A./Feilke, H. (Hrsg.) Sprachliche und kommunikative Praktiken. Berlin/Boston: de Gruyter Mouton, 229–250.
Kotthoff, Helga (2002): Was heißt eigentlich ‚doing gender‘? Wiener Slawistischer Almanach 55, 1–27.
Kotthoff, Helga (2011): Sociolinguistic Potentials of Face-to-Face Interaction. In: Wodak, Ruth/Johnstone, Barbara/Kerswill, Paul: The SAGE Handbook of Sociolinguistics. Washington, 315–329.
Kotthoff, Helga (2015): Narrative constructions of school oriented parenthood during parent-teacher-conferences. Linguistics & Education 31, 289–303.
Lareau, Annette (2003): Unequal childhoods. Class, race, and family life. Berkeley: University of California Press.
Mehan, Hugh (1979): Learning lessons. Socialorganization in theclassroom. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Pillet-Shore, Danielle (2012): The Problem with Praise in Parent-Teacher Interaction. Communication Monographs 79:2, 181–204.
Quasthoff, Uta M./Heller, Vivien (Hrsg.) (2014): Learning in context – Linguistic, social and cultural explanations of inequality. Special Issue of Learning, Culture and Social Interaction 3:2.
Quasthoff, Uta M./Morek, Miriam (2015): Diskursive Praktiken von Kindern in außerschulischen und schulischen Kontexten. Abschlussbericht. Dortmund.
Reckwitz, Andreas (2003): Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Zeitschrift für Soziologie 32:4, 282–301.
Reiss, Kristina/Weis, Mirjam/Klieme, Eckhard/Köller, Olaf (Hrsg.) (2019): PISA 2018. Waxmann Verlag.
Reh, Sabine (2012): Mit der Videokamera beobachten. Möglichkeiten qualitativer Unterrichtsforschung. In: De Boer, H./Reh, S. (Hrsg.) Beobachten in der Schule – Beobachten lernen. New York: Springer, 151–168.
Sacks, Harvey (1984): Notes on methodology. In: Atkinson,J.M./Heritage, J.C. (Hrsg.), Structures of socialaction. Studies in conversationanalysis. Cambridge: Cambridge University Press, 21–27.
Schatzki, Theodore R. (1996): Social practices. A Wittgensteinian approach to human activity and the social. Cambridge: Cambridge University Press.
Spiegel, Carmen/Deschner, Annette (2010): Fair gewinnt? Argumentations- und Urteilskompetenz – Sekundarstufe I. In: Rösch, A. (Hrsg.) Kompetenzorientiert unterrichten. Zeitschrift Ethik und Unterricht1:10, 32–35.
Stanat, Petra/Edele, Aileen (2015): Zuwanderung und soziale Ungleichheit. In: Reinders, H./Ditton, H./Gräsel, C./Gniewosz, B. (Hrsg.) Empirische Bildungsforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 215–228.
Weiglhofer, Hubert (2004): Neue Wege in der Lehramtsausbildung. Das interdisziplinäre Projekt. ZFHD 2 (Dezember), 1–11.
Wortham, Stanton (2006): Learning Identity. The Joint Emergence of Social Identification and Academic Learning. Cambridge University Press.
Diskursive Praktiken und Passungen
Bildungsungleichheiten zwischen Schule und Familien
1Einführung
Erziehungswissenschaftliche Studien verweisen wiederholend auf die Tradierung von Bildungsungleichheit entlang sozialer Differenzkategorien wie Geschlecht, Milieu oder Migrationshintergrund (vgl. Melzer 1997; Deutsches PISA-Konsortium 2003), wobei in diesem Zusammenhang dem Zusammenwirken von Schule und Familie große Bedeutung zukommt. Schule und Familie werden zumeist als getrennte Institutionen mit unterschiedlichen Logiken und Funktionen verstanden. Während Familien durch emotionale Fürsorge und binnenorientierter Zusammengehörigkeit charakterisiert werden (vgl. Tyrell 1983), orientiert sich Schule an der Qualifikation, Allokation und Selektion der Schüler/innen durch Leistung (vgl. Fend 2006). In der Praxis lassen sich jedoch zahlreiche Verschränkungen von Schule und Familie beobachten. Entgegen einer festgelegten Trennung der Institutionen Schule und Familie scheint es plausibel, Ähnlichkeiten und Überschneidungen der Praktiken beider Institutionen anzunehmen und nicht von zwei getrennten Systemen auszugehen. Da weder die Schule noch die Familie die alleinige Reproduktionsinstanz von Bildungsungleichheit ist (vgl. Willis 1979), interessiert sich der Beitrag für jene Praktiken, in denen Bildungsungleichheiten prozessiert werden und fokussiert dafür auf die Schnittmenge von Familie und Schule. Dazu werden zuerst Überlegungen zur institutionellen Schnittmenge angestellt und diese dann mit Blick auf Bildungsungleichheiten theoretisiert. Die anschließende praxistheoretische Fundierung methodologisiert dann den Blick auf die Institutionen. Anhand exemplarischer ethnographischer Untersuchungen werden die theoretischen Überlegungen empirisch untermauert und insbesondere auf die Relationierung von Erziehungs- und Bildungspraktiken zwischen Familien sowie zwischen Schule und Familie fokussiert.
2Die Schnittmenge von Familie und Schule
Familie und Schule gelten zu Recht als zwei bedeutsame Institutionen, an denen Kinder und Jugendliche in institutionalisierte Erziehungs- und Bildungspraktiken eingebunden sind. Strukturfunktionalistisch lassen sich Schule und Familie als die zwei zentralen Funktionssysteme verstehen, denen die Aufgabe der gesellschaftlichen Integration der nachwachsenden Generation durch Erziehung und Bildung zukommt, wobei die Annahme vertreten wird, dass sie sich wie Gegenwelten zueinander verhielten (vgl. Parsons 2012; auch Wernet 2003). Tyrell und Vanderstraeten (2007) identifizieren fünf strukturelle Trennungsmerkmale von Schule und Familie: So unterscheiden sich diese räumlich, zeitlich, systemreferenziell, personell sowie in der Eigendynamik der Kinder voneinander. Diese Bestimmungen weisen beiden Institutionen dabei spezifische, komplementäre Funktionen zu: Schule als öffentlicher Ort formalisierter Bildungsprozesse, Familie als privater Ort von Erziehung und Fürsorge. Solche differenzstabilisierenden Vorstellungen von Familie oder der Schule verdecken allerdings den Blick auf das ‚Innenleben‘ wie auch auf die unscharfen Grenzen von Institutionen. Denn legte man wie die Strukturtheorie zugrunde, dass Schule die Institution der öffentlichen Bildung sei und Familie der Ort der Fürsorge und Reproduktion, dann wird weder die praktische Herstellung sichtbar noch die Schnittmenge der Institutionen. Ginge man in dieser Weise vorab kategorisierend vor, so riskierte man, lediglich scheinbar bekannte Zuordnungen von Praktiken der Erziehung und Bildung vermeintlich zur Familie oder Schule zu bedienen. Auch die aktuelle komplementäre Doppelbewegung der ‚Familialisierung der Schule‘ sowie der ‚Scolarisierung außerschulischer Lebenswelten‘ weist auf die Verschränkung von Erziehungs- und Bildungspraktiken hin. Damit einher geht eine „Transformation der Schule“ (Idel et al. 2013) wie auch eine Transformation der Familie (Honig 2010), sodass die Trennung nicht scharf zu ziehen ist, sondern sich die Institutionen in ständiger Transformation befinden und unscharfe Grenzen haben. Mit neoinstitutionalistischen Theorien (vgl. Meyer und Rowan 1977) oder Ansätzen wie der „institutional ethnography“ (Smith 2006) erscheint es hingegen sinnvoll, eine solche Bestimmung der Institution entlang ihrer Praxis (und nicht ihrer Funktion) anhand von „ruling relations“ (Smith 2006: 32) vorzunehmen.
An diese Überlegungen anschließend ist davon auszugehen, dass auch die in Praktiken hervorgebrachten sozialen Ordnungen nicht als isolierte Feldlogiken von klar voneinander abgrenzbaren Institutionen angenommen werden können, sondern dass alle Institutionen Schnittmengen bilden. Nadai und Koch sprechen in diesem Zusammenhang von „Zwischenräumen“ (Nadai und Koch 2011: 234; auch Heinzel 2003). Diese Zwischenräume lassen sich (auch in einem räumlichen Sinne) als Schnittmengen fassen, die sich unter Bezug auf implizite wie explizite Normvorstellungen und Verhaltenserwartungen beider Institutionen in Erziehungs- und Bildungspraktiken konstituieren. Durch praktische Anlässe vermitteln sich Erziehungs- und Bildungsvorstellungen der Schule an die Familien und anders herum Bildungs- und Erziehungserwartungen der Familien an die Schule und transformieren sich dabei zu je eigenen sozialen Ordnungen der Schnittmenge. Dieses Verhältnis ist nicht linear oder komplementär, vielmehr existiert ein enges Geflecht zwischen beiden Institutionen, welches auch als Koproduktion verstanden werden kann.





























