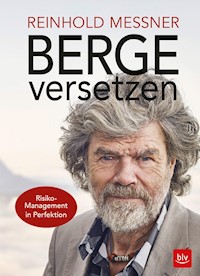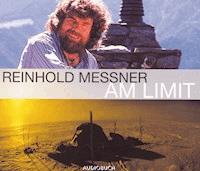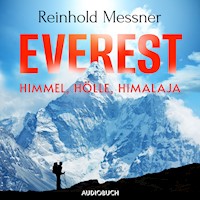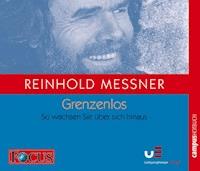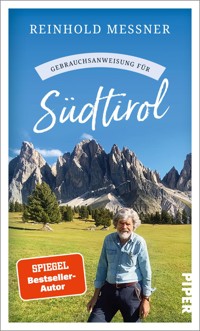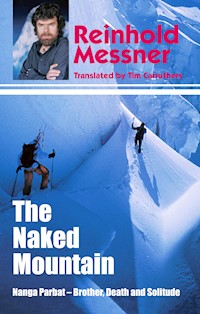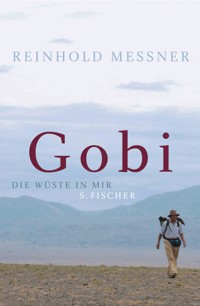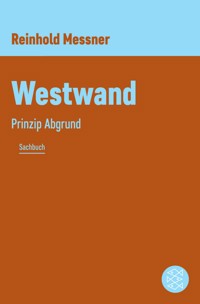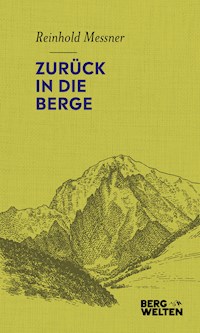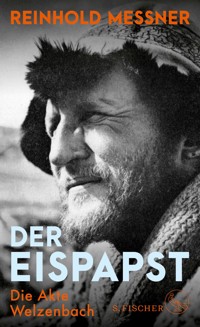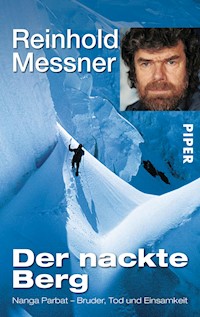9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Reinhold Messner 1979 in Kathmandu erfährt, dass der japanische Bergsteiger Naomi Uemura die Erlaubnis erhalten hat, den Mount Everest im Winter 1980/81 im Alleingang zu besteigen, kennt er nur ein Ziel: Er muss ihm zuvorkommen. Seit seinem Alleingang zum 8125 Meter hohen Nanga Parbat weiß Messner, dass auch die Besteigung des Everest, des mit 8848 Metern höchsten Gipfels der Erde, allein möglich ist. Messner handelt sofort, und es gelingt ihm, eine Expeditionsgenehmigung für die Zeit von Juni bis Ende August 1980 zu bekommen. Schon einmal stand Reinhold Messner auf dem Everest. Das war 1978. Nun wird er ein zweites Mal gehen, wieder ohne künstlichen Sauerstoff, aber diesmal auch ohne Kletterpartner, ohne feste Lagerkette, ohne Träger und über eine neue Route auf der tibetischen Seite. Messners Bericht über die alpinistische Sensation seiner Solobesteigung schildert nicht nur den Kampf ums Überleben angesichts der gewaltigen Herausforderungen der Natur, wie Monsunstürme, Gletscherspalten und die sauerstoffarme Luft in achttausend Meter Höhe, sondern vor allem auch die Abenteuer der Psyche an den Grenzen menschlicher Belastbarkeit und das mystische Erleben der Einsamkeit in eisiger Natur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Reinhold Messner
Everest Solo
»Der gläserne Horizont«
Über dieses Buch
Als Reinhold Messner 1979 in Kathmandu erfährt, dass der japanische Bergsteiger Naomi Uemura die Erlaubnis erhalten hat, den Mount Everest im Winter 1980/81 im Alleingang zu besteigen, kennt er nur ein Ziel: Er muss ihm zuvorkommen. Seit seinem Alleingang zum 8125 Meter hohen Nanga Parbat weiß Messner, dass auch die Besteigung des Everest, des mit 8848 Metern höchsten Gipfels der Erde, allein möglich ist. Messner handelt sofort, und es gelingt ihm, eine Expeditionsgenehmigung für die Zeit von Juni bis Ende August 1980 zu bekommen. Schon einmal stand Reinhold Messner auf dem Everest. Das war 1978. Nun wird er ein zweites Mal gehen, wieder ohne künstlichen Sauerstoff, aber diesmal auch ohne Kletterpartner, ohne feste Lagerkette, ohne Träger und über eine neue Route auf der tibetischen Seite.
Messners Bericht über die alpinistische Sensation seiner Solobesteigung schildert nicht nur den Kampf ums Überleben angesichts der gewaltigen Herausforderungen der Natur, wie Monsunstürme, Gletscherspalten und die sauerstoffarme Luft in achttausend Meter Höhe, sondern vor allem auch die Abenteuer der Psyche an den Grenzen menschlicher Belastbarkeit und das mystische Erleben der Einsamkeit in eisiger Natur.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2000 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490831-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Erster sein
Heimwärts
Zurück in Europa
Aufbruch ins Schneeland
Monsunschnee
Durch Tibet zum Mount Everest
Spuren der Kulturrevolution
Aufstieg für den Abstieg
Sisyphus am Everest
Ein hoher Preis
Everest
Chronik der Besteigungsversuche und der wichtigsten Besteigungen des Mount Everest
Tafelteil
Töricht bist du, der du in der Mitte des Lebens das Kommen des Todes nicht ahnst; denn alles, was du tust und für großartig hältst, ist nichts wert im Augenblick des Todes.
aus Dardò Thödol, Tibetisches Totenbuch
Erster sein
Die jüngste Chronik der Mount-Everest-Besteigungen liest sich wie ein postmoderner Marketing-Text. Als ginge es nicht um den Berg oder die Erfahrungen bei einer Expedition dorthin, sondern um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Die Fluchtpunkte aller Eitelkeiten sind begehrt wie nie! Alle scheinen nur das eine zu wollen: den Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde.
Da lese ich von einem ältesten Gipfelsieger mit einundsechzig und einem jüngsten mit sechzehn Jahren, von der ersten Vater-und-Sohn-Besteigung, dem ersten Ehe- und dem ersten Brüderpaar am Gipfel, dem ersten Beinamputierten und der Tragödie mit den meisten Todesfällen. Wer am schnellsten hinaufsteigt, wird gemessen, und wer am längsten oben bleibt. Aber Vorsicht, der jüngste Nichtnepalese am Gipfel des Mount Everest bisher war siebzehn, und der erste Sohn eines Everest-Besteigers war Peter Hillary, der Sohn des Erstbesteigers.
Nach der »Eroberung« des höchsten Berges der Welt am 29. Mai 1953 war es 25 Jahre lang um neue Aufstiegswege gegangen, dann endlich gelang eine Besteigung ohne Sauerstoffmaske und eine mitten im Winter, der Paraglider-Flug vom Gipfel und zuletzt der schnellste Abstieg, der nur möglich geworden war, weil die beiden leichten Wege zum Gipfel immer besser präpariert und abgesichert werden.
In den vergangenen zehn Jahren sind mehr als doppelt so viele Bergsteiger auf den Everest-Gipfel gestiegen als in den 40 Jahren zuvor, bis zu 40 Menschen an einem Tag.
Daß es der Sherpa Ang Rita zehnmal bis zum Gipfel geschafft hat, immer ohne Flaschensauerstoff, beeindruckt mich, aber nicht die längste Kolonne am Gipfelgrat, der tausendste Tourist in 8850 m Meereshöhe oder das Geburtstagskind mit Rekordallüren. Auch nicht die Anzahl der Zeitungsartikel, die über die eine oder andere »Heldentat vom Everest« erscheinen.
Im Widerstreit zwischen einem Mount Everest, der heute zur Karriere eines jeden erfolgreichen Bergsteigers gehören mag, und dem Anspruch, etwas zu wagen, stürzen immer mehr Bergsteiger verbaliter ab, wenn sie ihre Gruppenreisen als Sensationen ankündigen und via Internet Solo-Bilder aus der Zeltstadt am Bergfuß vertreiben, um Einsamkeit vorzutäuschen.
Bergsteigen hat viel mehr mit Ausgesetztsein zu tun als mit Gipfeln, und die Kunst dabei ist eher das Zurückkommen aus der Einsamkeit als das Weggehen oder das Obensein. Das Oben-gewesen-Sein bringt nicht viel mehr als das Schulterklopfen jener, die auch für die erste Hundebesteigung »standing ovations« bereithalten. Nicht der Kopfstand am Gipfel, die Herausforderung an uns selbst ist es, die uns aus dem Gleichgewicht wirft, wenn sie ins Ungewisse führt, bringt uns der Grenzgang doch an den Rand unseres Seins, auch des Gesundseins und damit unserer Leistungs- und Leidensfähigkeit.
Meine eigene Hinfälligkeit ist es, die mir von meinem Alleingang in Erinnerung geblieben ist, aber keinerlei Euphorie. Nicht der fitteste, fetteste oder pfiffigste Tourist am Mount Everest hat mir etwas zu erzählen, sondern die wenigen Verwegenen, die fern aller Infrastruktur und in Eigenverantwortung dorthin gehen, wo der Mensch nicht hingehört. Jenseits aller Nützlichkeit entsteht mit dem Zurückkommen aus der »Todeszone« jene individuelle Sinnhaftigkeit, die ich 1980 selbst als Wiedergeburt erlebt habe. Als hätte ich mich selbst ins Leben zurückgeholt.
Bergsteigerkolonne am Everest-Gipfelgrat
Heimwärts
Oswald Oelz, Bulle genannt, erwacht, als das erste Licht durch die winzigen Fenster der Sherpa-Hütte fällt. Rings um ihn stehen alle auf, gürten ihre Gewänder. Die Männer ziehen Mäntel an. Im Lehmherd brennt Feuer. Es ist Morgen. Bulle hat, kaum daß er sich am Abend zuvor auf der schmalen Pritsche am Fenster ausgestreckt hatte, zu schnarchen begonnen. Er ist zwar dann und wann kurz aufgewacht, im übrigen aber hat er die ganze Nacht tief geschlafen. Als er jetzt auf seine Uhr schaut, ist es sieben. Wir sehen uns an und setzen uns auf. Als ob ein neues Leben beginnen würde. Eine Stunde später müssen wir in Syangpoche sein. Wir wollen das Flugzeug nicht verpassen, das uns zurück nach Kathmandu bringen soll.
Bulle gähnt mit weit aufgerissenem Mund. Dann holt er seine Hose aus der Fensternische und blickt hinaus in die Landschaft. Es ist ein kalter, klarer Herbsttag. Reif liegt auf den Wiesen und Schnee auf den Bergen im Süden. Yaks werden westwärts hinunter nach Namche Bazar getrieben. Eine Zeitlang noch hören wir das Gebimmel ihrer Glocken.
Bulle spricht kein Wort. Es ist, als murmle er nur in seinem Herzen. In dieser Weise reden wir oft, wenn die gemeinsame Zeit in den Bergen zu Ende geht. Jetzt aber, nachdem wir unsere Ama-Dablam-Expedition abgebrochen haben, scheint Bulle bedrückt. Wenn er an die Heimreise denkt, ist er unzufrieden mit sich selbst. Nicht, weil wir den Gipfel des Ama Dablam nicht erreicht haben; vielleicht, weil er sich nicht voll verausgabt hat. Wann würde sich die nächste Gelegenheit dazu bieten? Bulle freut sich auf seine Arbeit als Arzt im Spital, aber er hat kein neues, greifbares Abenteuer vor Augen. Das weckt in ihm ein Gefühl von Einsamkeit. Zu Hause in Zürich lebt er allein.
Viele sagen, der Ama Dablam sei der schönste Berg der Welt. Riesig erhebt er sich hinter unserem Nachtquartier im Gegenlicht; er sieht aus wie eine Frau mit ausgebreiteten Armen.
Hier in Solo Khumbu sollte man bleiben können, eine Hütte bauen, jahrelang leben. Das Sherpa-Land strahlt Ruhe und Gleichmut aus. Das kleine Flugzeug, das auf der steinigen Landepiste in Syangpoche steht, ist ausgebucht. Es hat einige Touristen gebracht und wartet nun auf andere Gäste des »Everest View«-Hotels, die eiligst in die Hauptstadt zurückgeflogen werden müssen. Da kommen sie hintereinander: mit Koffern beladene Yaks, gefolgt von einer dürren, alten Frau, auf zwei Skistöcke gestützt, mit grünlich gefärbtem Haar. Hinter ihr tragen Sherpas einen Höhenkranken auf einer Bahre.
Einmal den Everest sehen und sterben, denke ich spöttisch. Unter den Neuankömmlingen ist eine üppig beringte andere Grünhaarige, etwa Mitte Sechzig und offenbar damit beschäftigt, mit vollen Händen das Geld auszugeben, das ihr Mann einst zusammengebracht hat. Sie fotografiert ununterbrochen. Ich staune über ihre Ausdauer. Lauthals begeistert sie sich für das Hotel, das Flugzeug und die Sauerstoffausrüstung.
Was, so frage ich mich, tun Leute wie diese Frau in Nepal?
Vor 30 Jahren war dieses Land noch nahezu unerreichbar und für Fremde verschlossen. Die höchsten Berge der Welt, jahrhundertelang natürlicher Schutz der Himalajastaaten gegen Eindringlinge, haben im letzten Jahrzehnt viele hunderttausend Bergsteiger und Trekker angezogen. Das hat zu einem schnellen, ja dramatischen Wandel geführt: Der Tourismus ist heute die wichtigste Einnahmequelle, Nepal soll die »Schweiz Asiens« werden.
»Wir wissen, daß unsere Berge eine Attraktion für die Welt darstellen«, sagt Birendra Bir Bikram Shah, der König, der Nepal mit fast absolutistischer Macht regiert. »Die Welt ist eingeladen, hierherzukommen und sie zu genießen.«
Ein dutzendmal bin ich in Nepal gewesen. Ich habe gelernt, mich in diesem Land so zu verhalten, wie es die Einheimischen tun. Nur den Sechs-, Sieben- und Achttausendern gegenüber bin ich Europäer geblieben: zielstrebig und ehrgeizig.
Am Abend gehen Bulle und ich ins »Everest View« zum Essen. Dieses japanische Hotel auf knapp 4000 Meter Meereshöhe ist seit Jahren ein Mekka für europäische und amerikanische Wohlstandsbürger. »Den Himalaja erleben«, heißt es im Werbeprospekt.
Bei den Gesprächen am offenen Feuer schauen wir immer wieder durch die großen Panoramafenster hinaus zum Lhotse und zum Everest. Es ist schon ein großartiges Gefühl, den höchsten Berg der Welt bestiegen zu haben. Wir haben es 1978 beide geschafft und zwinkern uns zu.
In den Hotelzimmern liegen Sauerstoffmasken, das Haus ist geheizt. Draußen in den Rhododendronwäldern fegt der Wind durch die Blätter. »Der Everest, eine Idylle!«
Als der Hotelmanager seinen Gästen erzählt, daß Bulle und ich den Everest bestiegen haben, werden wir mit Fragen überschüttet. Auf die erste – »Warum wagen Sie ein so gefährliches Abenteuer?« – meint Bulle lakonisch: »Jeder braucht ein bißchen Exklusivität in einer Zeit, in der mit Geld sonst alles zu haben ist.«
»Und wie steht es mit der Angst?« Diese Frage geht an mich.
»Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ganz ohne Angst lebt keiner aktiv. Vor kritischen Augenblicken verdichtet sie sich, etwas ganz Natürliches. Man kann diese Angst, hinunterzufallen oder vom Sturm hinweggefegt zu werden, nicht unterdrücken, auch wenn man sich bewußt ist, daß Sterben zum Leben gehört.«
»Würden Sie auch auf Achttausender steigen, wenn Ihre Leistungen der Öffentlichkeit gleichgültig wären?«
»Mit fünf Jahren habe ich angefangen, auf Berge zu klettern, und habe in den ersten 20 Jahren meiner Bergsteigerei 2000 Berge in Europa bestiegen. Kein Mensch hat davon gesprochen, und doch hat es mir Spaß gemacht.«
»Was aber treibt Sie zu immer neuen Höchstleistungen?«
»Als Bub bin ich in den heimatlichen Bergen herumgestiegen. Mit dem Fahrrad fuhr ich in die Dolomiten, später mit einem Motorroller in die Schweiz zur Eigernordwand und zum Matterhorn. Heute muß ich, um die gleiche Spannung zu erleben, zum Everest oder zum Südpol.«
»Laufen Sie nicht auch einer Illusion hinterher?« forscht einer der Hotelgäste, Psychologe von Beruf, weiter.
»Schon möglich«, sagt Bulle, der aufgestanden ist und zum Aufbruch drängt. »Jede Gesellschaft schminkt sich zum eigenen Untergang mit Illusionen.« Die Leute schütteln den Kopf. »Ein exzentrisches Hobby«, murmelt einer. Bulle grinst. Wir verabschieden uns und gehen hinaus in die Nacht.
Als wir am nächsten Nachmittag in Syangpoche erfahren, daß wir immer noch auf der Warteliste stehen, entschließen wir uns, zu Fuß zum nächsten Flugplatz nach Lukla zu marschieren, für Trekker eine Etappe von zwei Tagen. Wir müssen es in einem schaffen. Das letzte Stück legen wir bei Dunkelheit zurück. Ausgepumpt und mit schmerzenden Gliedern kommen wir in Lukla an. Erschöpft lassen wir uns im Hotel der »Sherpa-Cooperative« nieder. Wir verschlingen ein paar Yak-Steaks und genießen bei einer Flasche Bier die wohlige Wärme.
Früh am nächsten Morgen gelingt es uns, zwei Tickets für die erste Maschine nach Kathmandu zu ergattern. Unser beharrliches Drängen geht dem Mann mit der Warteliste derartig auf die Nerven, daß er alles tut, um uns mit der ersten Maschine loszuwerden. Wir schmunzeln. Das hat geklappt. Bulle und ich sind so unter Zeitdruck, daß wir bereit gewesen wären, eine Passage für den zehnfachen Preis zu ersteigern: Ich muß pünktlich zu einer Vortragstournee in Deutschland sein, Bulle muß zurück zu seiner Arbeit in der Klinik.
Während wir auf der steinigen Terrasse am oberen Rand des Flugfeldes auf die Maschine warten, kommt Bulle mit zwei jungen kanadischen Frauen ins Gespräch. Sie setzen sich während des Fluges zu uns, erzählen von ihrer Wanderung durchs Sherpa-Land. Als unter uns die Landschaft vorbeizieht – frisch gerodete Wälder, kleine Dörfer, mäandernde Bäche mit schmalen Steigen daneben –, verabreden wir uns vage für den Abend, vergessen das Rendezvous aber in dem Augenblick, als wir in Kathmandu Stadtboden betreten.
Wir haben eine Menge zu tun. Unsere Flüge nach Europa müssen gebucht werden, und die noch verbleibende Zeit wollen wir nutzen, uns um Genehmigungen für weitere Expeditionspläne zu kümmern.
In Kathmandu gibt es eine Frau, die auf diesem Gebiet so ziemlich alles weiß: Elizabeth Hawley, eine Journalistin, die seit über 20 Jahren in der Stadt lebt. Ich besuche sie in ihrem Büro bei »Tiger Tops«, und sie erzählt mir sofort, daß Naomi Uemura, der berühmte japanische Bergsteiger, die Erlaubnis erhalten hat, den Mount Everest im Winter 1980/81 im Alleingang zu besteigen. Das darf nicht sein! Diese Idee gehört mir! Seit einem Jahr trage ich sie mit mir herum. Innerhalb von Sekunden reift nun ein konkreter Plan in mir. Ich muß Naomi Uemura schnell handeln.
Naomi Uemura
Schon wenige Wochen nach meiner Rückkehr vom Nanga-Parbat-Alleingang 1978 habe ich gewußt, daß auch eine Besteigung des Mount Everest allein möglich ist. Dann hat sich dieses Wissen zur fixen Idee verdichtet. Überzeugt davon, daß mir niemand zuvorkommen würde, wollte ich den konkreten Versuch bis Mitte der achtziger Jahre aufschieben. Jetzt stehe ich da und frage mich, wie ich von heute auf morgen zu einer Solo-Genehmigung für den Everest kommen soll. Mein ganzer bergsteigerischer Ehrgeiz ist erwacht. Der höchste Berg der Welt ist für einen Bergsteiger allein der absolute Höhepunkt!
Aber wie kann ich dem ausdauernden Uemura, der allein im Hundeschlitten bis zum Nordpol vorgedrungen ist und auf fünf der sieben höchsten Berge aller Kontinente gestanden hat, zuvorkommen? ist nicht nur einer der erfolgreichsten Bergsteiger der Welt, er ist auch ein Abenteurer, ein Draufgänger, und dabei zäh wie ein Sherpa-Träger. In Tokio haben wir uns 1976 ein paar Stunden lang unterhalten. Seitdem weiß ich, daß dieser kleine, untersetzte Mann mit den vom Frost verbrannten Wangen alles kann, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Unsere Einstellungen zum Bergsteigen, ja zum Leben überhaupt, gleichen sich. Diesmal ist Uemura, dieser schlaue Bursche, schneller gewesen! Ich kann nicht umhin, ihn dafür zu bewundern.
Ich muß etwas unternehmen. Um jeden Preis will auch ich dieses Experiment wagen, und zwar als erster.
Das Bild des von Schnee und Eis bedeckten Everest-Westgrats flackert vor meinem inneren Auge auf, während ich mit Liz Hawley spreche. »Gibt es für 1980 eine Hoffnung auf eine Nachmonsun-Genehmigung am Westgrad?« frage ich sie.
»Ich denke schon«, meint sie.
Aber der Westgrat ist unendlich lang, zu sehr den Herbststürmen ausgesetzt. Dort wären meine Chancen gleich Null. »Und sonst?«
»Eine andere Genehmigung steht nicht in Aussicht.«
Und die Nordseite? Sie liegt in Tibet, und die chinesische Regierung hat bisher nur nach mühseligen Verhandlungen über hohe Politiker die Erlaubnis zur Besteigung erteilt. Ich weiß, daß der Nordgrat die einzige Aufstiegsroute ist, die für einen Solokletterer verantwortbar wäre. Der in Nepal gelegene Normalweg – Western Cwm und Südsattel – kommt wegen der zerklüfteten Khumbu-Eisfälle nicht in Frage, und den gefährlichen Eisbruch mit Hilfe von Sherpas zu überwinden steht bei einem Alleingang nicht zur Debatte. Die Ostwand ist noch unzugänglicher. Am tibetischen Nordgrat aber waren Engländer schon in den zwanziger Jahren bis nahe an den Gipfel herangekommen. Dort muß ein Aufstieg auch allein möglich sein. Ich bin aufgeregter als vor einer Prüfung, und diese Nervosität macht mich hellwach. Sie zaubert Bilder vor mein inneres Auge und beflügelt mein Denken. In diesem gesteigerten Wachzustand fallen mir immer wieder einzelne Abschnitte aus alten Everest-Büchern ein, als ob ich sie auswendig gelernt hätte. Auswendig gelernt für diesen Moment der Entscheidung.
Everest, mit Nordflanke, Westgrat und Südwand
»Eine gut akklimatisierte Seilschaft kann in sechs Tagen vom Rongbuk-Lager bis zum Gipfel steigen.« Das sind die frühen Erkenntnisse Mallorys. Jetzt erscheinen sie mir wie eine Vision: »Zwei sind zu wenig, da einer keine Hilfe leisten kann, wenn dem anderen etwas zustößt.«
Das heißt auch: Zwei sind zuviel! Ja, einer allein ist genug, wenn er den Aufstieg bis zum Nordsattel schafft, Zeit zum Abwarten hat und bereit ist, im äußersten Notfall zu sterben.
Bisher hat am Mount Everest niemand die ungünstigen Wetterbedingungen als zusätzliche sportliche Herausforderung gesucht. Erst jetzt, nach der Eroberungsphase, der Durchsteigung der steilsten Wände, dem Verzicht auf Sauerstoffgeräte, stehen die ersten Winterbesteigungen an. Daher die Logik: Everest im Winter und im Alleingang.
Ist aber im östlichen und zentralen Himalaja nicht der Sommer, die Monsunzeit, die ungünstigste Periode für eine Besteigung? Während des Monsuns, von Ende Mai bis Mitte September, schneit es an den hohen Bergen fast ununterbrochen, Lawinen donnern herab, im Nebel wird die Orientierung unmöglich.
Sicher, der Winter ist viel kälter, aber Dezember und Januar, die beiden von der Regierung in Nepal für künftige Winterbesteigungen freigegebenen Monate, bringen neben polarer Kälte und orkanartigen Stürmen meist herrliches Wetter. Das heißt: wenig Schnee, geringe Lawinengefahr, auch mittags keine sengende Hitze. Die Monsunzeit ist am Everest wohl schlimmer.
Von den 20 höchsten Bergen der Welt befinden sich 13 völlig oder teilweise innerhalb der Grenzen Nepals. Um diese Berge besteigen zu können, muß man zunächst eine Genehmigung beantragen und sich dann dem entsprechenden Reglement unterwerfen. Monsun-Expeditionen sieht dieses Reglement nicht vor.
Nepal ist ein unterentwickeltes Land mit nur wenigen Straßenverbindungen. Entfernungen werden in Nepal danach bemessen, wie vieler Tage es bedarf, sie zurückzulegen, und Entfernungen sind das Maß der Löhne. Expeditionen beschäftigen oft viele hundert, ja tausend und mehr Träger. Und der Anmarsch ist lang, er dauert manchmal mehrere Wochen. Gute Gründe also, mein Ansuchen für eine Monsun-Besteigung zu befürworten. Ein großer Teil seiner 14-Millionen-Bevölkerung arbeitet als Lastenträger. Diese brauchen Arbeit, auch im Sommer. Wenn meine Expedition im Monsun am Westgrat Erfolg hätte, kämen in Zukunft häufiger Gruppen. Vor allem im äußersten Nordwesten Nepals würden Sommerbesteigungen folgen.
Ich gehe durch die Stadt, phantasiere vor mich hin und denke nach. Dann handle ich rasch. Ich muß es schaffen, noch vor dem Winter 1980/81 eine Genehmigung für den Everest zu bekommen. In Begleitung von Bobby Chettri, dem Manager von »Mountain Travel«, der führenden Trekking-Organisation in Kathmandu, gehe ich zu Herrn Sharma ins Ministerium für Tourismus. Da »Mountain Travel« auch Expeditionen organisiert, will ich noch vor meiner Abreise nach Europa eine Zu- oder Absage erzwingen, um meinen Freund Bobby mit den wichtigsten Vorbereitungen vor Ort beauftragen zu können.
Eine Genehmigung für die Monsunzeit gibt man mir nicht. Man zeigt sich aber so interessiert an meiner Alleingangsidee, daß ich neue Hoffnung schöpfe. Herr Sharma verspricht mir, wenn auch vage, ein Permit für den Everest-Westgrat im Herbst 1980. Ich unterschreibe Gesuche, hinterlege Daten und Kartenskizzen. Mit der mündlichen Zusicherung, in der Nachmonsunzeit 1980 allein über den Westgrat auf den Everest steigen zu dürfen, komme ich mir vor wie ein Bub, der eine Reise zum Mond gewonnen hat.
Ich weiß natürlich, daß die Aussicht gering ist, über diese lange, schwierige, dem Westwind ausgesetzte Route bis zum Gipfel der Welt zu gelangen. Trotzdem tue ich so, als ob ich es um jeden Preis versuchen müßte. In diesen Tagen, in dem Hin und Her zwischen dem Ministerium für Tourismus, »Mountain Travel«-Office und dem Büro von Liz Hawley ertappe ich mich öfters bei dem »illegalen« Gedanken, über den Lho-La in das Rongbuk-Tal nach Tibet hinüberzuwechseln und von dort aus die alte klassische Engländer-Route am Everest zu versuchen. Liz Hawley scheint Gedanken lesen zu können, denn ich erfahre von ihr sogleich, daß die nepalesische Grenze nach Tibet bei Kodari bald geöffnet werden soll. Das wäre noch besser und sicher der billigste Weg nach China, nach Tibet, zum Everest!
Was aber würde die chinesische Regierung zu meiner Idee eines höchst privaten Alleingangs sagen?
In den frühen 20er Jahren waren es die Engländer, die sich die Eroberung des Everest – wie schon hundert Jahre zuvor die der Alpen – in den Kopf gesetzt hatten. 1921 brach die erste Expedition auf. Über einen großen Umweg durch Sikkim und Tibet reiste die Karawane nach Rongbuk, dem sagenumwobenen Kloster am Nordfuß des Chomolungma, wie die Tibeter den Everest nennen. Unter den Bergsteigern der Gruppe war auch George Leigh Mallory, damals einer der fähigsten britischen Alpinisten.
Aufgabe der Expedition war es, den Berg zu erkunden; sie sollte den leichtesten Aufstieg ausfindig machen.
Nach einem Umweg von einigen hundert Kilometern erreichte die Gruppe über das Kharta-Tal den Fuß des Nordsattels. Schließlich kämpften Mallory und zwei weitere Bergsteiger sich durch orkanartige Stürme bis auf 7000 Meter am Nordgrat durch. Von dort aus sahen sie eine mögliche Route zum Gipfel. Mallory war zufrieden: Den Everest konnte man »packen«.
Sobald die Expedition in London zurück war, begann das »Mount-Everest-Committee« mit neuen Vorbereitungen, und im März 1922 wagte man dann den ersten Vorstoß.
Von Darjeeling aus setzte sich eine kleine Armee in Bewegung. Sie bestand aus 13 Briten, 160 Hochträgern und über 300 Packtieren. Brigadegeneral Charles Bruce führte die Expedition an. Zu ihren Mitgliedern gehörte die Elite der Bergsteiger Englands: Norton, Somervell, Finch und abermals Mallory. Expeditionsleiter Bruce hatte seit 40 Jahren bergsteigerische Erfahrung in den Alpen und im Himalaja gesammelt. Niemand verstand es so gut wie er, mit den Einheimischen umzugehen, denn er hatte 30 Jahre lang in einem Gurkha-Regiment gedient.
Bis in den Monat Mai herrscht im Gebiet des Mount Everest Winter, und schon im Juni dringen die indischen Monsunstürme bis dorthin vor. Die warmen Winde verwandeln Schnee und Eis in tückische Todesfallen. Der Expedition stand also nur wenig Zeit zur Verfügung. Jeder Tag, jede Stunde war kostbar.
Eine Kette von kleinen Hochlagern, ausgerüstet mit Zelten, Proviant und Schlafsäcken, wurde auf dem Weg zum Gipfel errichtet.
Hauptmann Finch hatte einen kühnen Plan mitgebracht: Er wollte dem Berg mit künstlichem Sauerstoff zu Leibe rücken. Sauerstoffgeräte sollten den Bergsteigern in großen Höhen das Atmen erleichtern.
Zu Hause in England hatte er sich in eine Unterdruckkammer einschließen lassen und experimentiert. Der Luftdruck ließ sich von außen regulieren. Finch setzte sich in die Kammer und ließ langsam die Luft herauspumpen, bis der Luftdruck in der Kammer dem auf 8800 Meter Höhe entsprach. Er unternahm zwei Versuche: einmal mit und einmal ohne Sauerstoffzufuhr. Ohne Sauerstoff schlug sein Herz rasend schnell, der Druck in Kopf und Ohren nahm zu, er wurde benommen. Die Zufuhr von Sauerstoff hob dagegen jedes körperliche Unbehagen auf.
Zwei Ärzte hatten Finch während dieser Versuche beobachtet. Die Tests bewiesen eindeutig, daß ein Mensch in einer Höhe von 9000 Meter mit Hilfe eines Sauerstoffapparates überleben konnte. Als der Druckmesser draußen 8000 und 8500 Meter anzeigte, fühlte sich Finch in der Kammer mit dem Gummischlauch im Mund, der ihm den Sauerstoff zuführte, wohl und leistungsfähig.
In leichten Stahlzylindern, die 15 Kilogramm wogen und von einem Mann getragen werden konnten, führten Finch und seine Kameraden nun erstmals am Berg Sauerstoff mit, Sauerstoff, der die fast übermenschlichen Qualen der Anstrengung in der dünnen Luft der Todeszone erleichtern sollte.
Die Expedition brauchte einige Tage, um den Eisfall auf dem Weg zum Nordsattel zu überwinden. Lager IV konnte auf etwa 7000 Meter Höhe errichtet werden. Unmittelbar nach Lager IV kam ein verhältnismäßig leichtes Stück. Dann begannen neue Schwierigkeiten. Es war grimmig kalt, und ab einer Höhe von 7600 Meter wurde das Steigen fast unmöglich, so heftig tobte der Sturm. Morshead litt unter Übelkeit, Mallory, Norton und Somervell holten sich Erfrierungen. Trotzdem gingen alle außer Morshead weiter. Sie erreichten eine Höhe von 8230 Meter, dann zwangen Sauerstoffmangel und die unglaubliche Kälte sie zur Umkehr. Ein paar Tage später kamen Finch und der jüngere der beiden Bruce sogar bis auf 8321 Meter.
George H. Leigh Mallory
»Obwohl uns noch etwa 500 Meter fehlten, konnten wir einzelne Steine eines kleinen Geröllhaufens sehen, der genau am Endpunkt lag. Wir litten Tantalusqualen, als wir, von Hunger geschwächt und durch den Überlebenskampf erschöpft, nicht in der Lage waren weiterzusteigen. Mir war klar, würden wir auch nur 150 Meter weitergehen, wir kämen nicht lebend wieder zurück«, erzählte Finch später.
Das Basislager glich inzwischen einem Feldlazarett. Trotzdem wollten Mallory und Somervell einen letzten Versuch starten. Als sie mit ihren Trägern und Kameraden gerade die steilen Hänge des Eisfalls hinaufkletterten, geschah ein tragisches und folgenschweres Unglück:
»Schlechteren Schnee hatten wir noch nie angetroffen. Rundum war es sonnig und windstill, und da selten jemand sprach, hörte man nur das Keuchen der Lungen. Diese Ruhe wurde plötzlich unterbrochen. Ein unheimliches Geräusch schreckte uns auf. Es war scharf, achtunggebietend, heftig und dennoch weich wie die Zündung ungestampften Pulvers. Niemals noch habe ich in den Bergen einen solchen Laut vernommen. Zweifelsohne fühlten alle, was er zu bedeuten habe, als ob er zu den alltäglichen Erfahrungen gehörte. Nach einem kurzen Augenblicke sah ich die glatte Schneefläche neben mir sich kräuseln und aufbrechen. Ich machte einige verzweifelte Schritte, um an den Rand der Strömung zu kommen. Aber langsam begann ich mich abwärts zu bewegen, von einer Macht dahingeschoben, gegen die jeder Widerstand vergeblich war. Es gelang mir nur, mich so zu wenden, daß ich nicht kopfüber stürzte. Einige Sekunden lang schien mir die Gefahr nicht allzu groß zu sein, da der Schnee mich sanft hinabtrug. Dann spannte sich das Seil um meinen Leib und zog mich zurück. Eine Schneewelle begrub mich, und ich nahm an, daß es nun für immer vorbei war. Erinnerungen an Gelesenes und Gehörtes zogen mir durch den Sinn. Als bestes Rettungsmittel waren Schwimmbewegungen vorgeschlagen. Ich stieß die Arme über den Kopf empor und machte tatsächlich etwas dergleichen. Unter dem Schnee, wo der Vergleich mit umliegenden Gegenständen fehlte, vermochte ich die Schnelligkeit nicht zur beurteilen. Ohne auf sonstiges zu achten, kämpfte ich mit dem sich herabwälzenden Schnee.
Nach einigen weiteren Augenblicken schien eine Stockung einzutreten, und ich bemerkte wachsenden Druck um den Leib. Ich fragte mich gerade, wie fest ich wohl eingeklemmt sein würde, als die Lawine stillstand.
Ich hatte die Arme frei; die Beine lagen nahe der Oberfläche. Nach kurzem Ringen kam ich in die Höhe, überrascht und atemlos auf die ruhende Schneefläche starrend. Das umgegürtete Seil war stramm, woraus ich schloß, daß der auf mich folgende Träger tief im Schnee vergraben liege. Um so mehr erstaunte ich, als er plötzlich unverletzt auftauchte. Somervell und Crawford befreiten sich ebenfalls bald und standen dicht bei mir, obgleich sie um die ganze Seillänge von mir getrennt gewesen waren. Aus ihren Erzählungen ergab sich später, daß es ihnen ähnlich ergangen war wie mir. Wo aber waren die anderen?«
Die schlimmsten Befürchtungen Mallorys bestätigten sich: Sieben Träger waren tot. Ein Weitersteigen kam nicht in Frage.
Niedergeschlagen kehrte die Gruppe nach Darjeeling zurück. Mallory übernahm die Verantwortung und antwortete den Kritikern:
»Der Everest liegt außerhalb der Reichweite eines simplen Vertrages, der mit Geld gemessen wird. Die Träger waren mitgekommen, um an unserem Unternehmen teilzunehmen, und diese Männer starben in Erfüllung freiwilliger Dienste, die sie frei anboten und treu erfüllt haben.«
Mehr denn je wurde jetzt der Zweck eines solchen Unternehmens auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Was, so fragte man sich, sollte die Ersteigung des Mount Everest für einen Sinn haben? Diese Versuche kosteten nicht nur Menschenleben, Entbehrungen und Leid, sondern auch viel Geld. Der Nutzen für die Allgemeinheit aber war gleich Null. Nun versuchten die Bergsteiger klarzumachen, worum es ihnen ging.
»Der innerste Zweck unseres Tuns ist vermehrtes Wissen um unsere Fähigkeiten. Wenn wir uns mit festem Willen an die schwere Aufgabe machen, dann erfahren wir das Höchstmaß unserer Leistungsfähigkeit. Noch vermag niemand zu sagen, ob das Ziel erreichbar ist oder nicht.«
Und »wir leben schließlich nicht, um zu essen und Geld zu verdienen. Viele von uns wissen aus Erfahrung, daß eine Bergbesteigung zu den herrlichsten Quellen der Lust gehört.«
Zwei Jahre später, im März 1924, zog eine neue Expedition von Darjeeling aus durch die tropischen Täler Sikkims in Richtung Everest. Auch der knabenhaft schmale Mallory war wieder dabei, zum dritten Mal. Bruce und Norton leiteten das Unternehmen wie eine militärische Operation. Eine Hochlagerkette wurde angelegt, doch diesmal überraschte sie der sonst als geeignet geltende Expeditionsmonat Mai mit winterlicher Kälte und heftigen Schneefällen. Zweimal mußten die Mannschaften sämtliche Hochlager verlassen und ins Basislager absteigen. Diese Rückzüge kosteten zwei Trägern das Leben. Als in den letzten Maitagen endlich Schönwetter eintrat, war die Expedition bereits geschwächt. Trotzdem wurden alle Lager bis zum 7000 Meter hohen Nordsattel noch einmal besetzt. Der Aufstieg durch den Eiskamin in der Chang-La-Wand war eine Glanzleistung der damaligen Kletterkunst. Es gelang sogar, ein Sturmlager auf 8145 Meter vorzuschieben. Die meisten Höhenphysiologen hatten so etwas bis dahin für unmöglich gehalten.
Felix Norton, kurz bevor er aufgab.
Am 4. Juni brachen Norton und Somervell bei idealem Wetter zum Gipfelsturm auf. Somervell litt stark unter einem quälenden Höhenhusten. Erstickungsanfälle zwangen ihn, aufzugeben und zurückzubleiben. Norton stieg allein weiter und kam ohne Sauerstoffmaske bis auf 8572 Meter, ein Rekord, der neun Jahre nicht überboten werden sollte. Dann gab er auf. Die Expedition war gescheitert.
George Leigh Mallory habe ich schon in den sechziger Jahren bewundert, zu der Zeit, als ich die größten Klettertouren meiner alpinen Laufbahn unternahm. Ich verehrte ihn wie auch den englischen Nanga-Parbat-Pionier Albert Frederick Mummery wegen ihrer leidenschaftlichen Diskussionen um die Verwendung von künstlichem Sauerstoff.
In einer Zeit der Industrialisierung, als die Verwendung technischer Hilfsmittel allgemein als Fortschritt gepriesen wurde, setzten sich die beiden mit dem »by fair means« auseinander. Sie hatten damals schon erkannt, daß wir uns mit dem Einsatz der Technik beim Bergsteigen um etwas Wesentliches betrügen – die Lust und das Glücksgefühl, etwas anscheinend Unmögliches aus eigener Kraft und durch äußersten Einsatz physischer und psychischer Fähigkeiten zu erreichen. Mallory und Mummery waren mir, wie später Paul Preuß, der aus den gleichen Gründen die Verwendung des Mauerhakens beim Felsklettern verurteilte, Vorbilder.
Heute ist unsere Welt weitgehender, als es sich diese klugen Männer ausmalen konnten, von Technik bestimmt. Es gibt auf unserem ramponierten Planeten kaum noch Freiräume, wo wir unsere Industriegesellschaft vergessen und unbehelligt unsere ureigensten Kräfte und Fähigkeiten erproben können.
Und dies ist der eigentliche Grund dafür, daß es für mich keine faszinierendere Herausforderung gibt als die des Menschen vor dem Berg. Ich weigere mich, mir diese Herausforderung durch technische Hilfsmittel verderben zu lassen, worunter ich Sauerstoffgeräte, Bohrhaken, Hubschrauber, kurz, technisches Gerät verstehe, mit dessen Hilfe Unmögliches möglich gemacht werden kann. Um in diesem Zeitalter der Technisierung, der Betonwüsteneien, der Entfremdung durch das Eingespanntsein in eine irrwitzige Fabrikations- und Verwaltungsmaschinerie überleben zu können, brauche ich die Berge als Gegenwelt.
Wer meine Verdrossenheit versteht und meint, meine »by fair means«-Philosophie sei eine persönliche Überspanntheit, sollte eine Reise ins Everest-Basislager von heute am Khumbu-Eisfall unternehmen. Wenn er dort die quadratkilometergroße Müllhalde sieht, die die fortschrittlichen Bergsteiger aus dem Westen mit ihrer Wegwerflogistik hinterlassen haben, wird er mich besser verstehen.
Der nächste Vorstoß zum Everest sollte zur Tragödie werden. Die beiden Gipfelstürmer, Mallory und Irvine, blieben vermißt. Über ihr tragisches Ende ist eine Menge geschrieben worden. Und meist ging es dabei um die Frage, ob die beiden vor ihrem Tod den Gipfel erreicht hatten oder nicht.
Besessen von der Idee, den Mount Everest vielleicht selbst bald von Norden zu sehen, beginne ich, alles, was ich über diese Geschichte weiß, in meinem Kopf zu ordnen. Dabei merke ich, daß ich mir wünsche, Mallory und Irvine wären erst bei ihrem Abstieg und nicht während des Aufstiegs gestürzt oder erfroren. Ich wünsche es mir, obwohl Mallory selbst nach einer seiner Touren einmal geschrieben hat:
»Erfolg, dieses Wort bedeutet hier gar nichts …«
Mallory, ein Mann, der mehr getan hat als jeder andere, um dem Geheimnis Everest auf die Spur zu kommen, und dessen unbeugsamer Wille Antriebskraft für drei Expeditionen gewesen ist, wurde mit seinem Tod zur Legende. Wer war dieser Mann?
»Mallory war ein außergewöhnlicher Mensch. Körperlich erschien er uns als das Vorbild des Bergsteigers. Er sah sehr gut aus. Sein für sein Alter von 37 Jahren merkwürdig knabenhaftes Gesicht deutete auf eine unverwüstliche Gesundheit. Aus der drahtigen Gestalt sprach unermüdlicher Tatendrang; mit seinem schwebenden Gang hielt bergauf niemand so leicht Schritt. Noch gewandter war er im Abstieg, bei dem er große Übung und hohe Kunstfertigkeit bewies.
Aber noch mehr war es seine Seele, die ihn zum großen Bergsteiger stempelte. Er schöpfte aus seiner Willenskraft, so daß man nie sagen konnte, ob er müde war oder nicht, denn er zeigte sich sofort tatbereit, sobald er vor irgendeiner Herausforderung stand. Solange diese Situation anhielt, blieb er der führende Geist des jeweiligen Unternehmens.«
Als die Überlebenden nach England zurückgekehrt waren, begannen endlose Mutmaßungen über die Frage, ob nun der Gipfel des Mount Everest bezwungen war oder nicht. Wer immer sich kompetent fühlte, stellte auf Grund von Tagebuchaufzeichnungen, Odells Augenzeugenbericht, der allgemeinen Informationen über Höhenprobleme und die Schwierigkeiten an der Nordseite des Everest seine Theorie auf. Fast alle diese Theorien widersprachen einander.
Hier, irgendwo unter dem Second Step sah Mallory sein Scheitern ein.
Mich interessiert das Geheimnis um Mallory und Irvine ebenso wie mein geplanter Alleingang. War Mallory allein auf den Gipfel gegangen? Wie kann er den »Second Step« gemeistert haben? All diese Fragen beschäftigen mich bis in die Träume.
Erst 1953, bei ihrer neunten und perfekt organisierten Expedition, standen Edmund Hillary und der Sherpa Tenzing Norgay auf dem Gipfel des höchsten Berges der Welt. Sie kamen auch heil wieder zurück. Nicht eindeutig aber war die Antwort auf die Frage: Waren Hillary und Tenzing auch die ersten dort oben gewesen?
Weil Hillary keine Spuren möglicher Vorgänger gefunden hatte, blieben Zweifel.
Belustigt lese ich in meinem Hotelzimmer in Kathmandu in einem der alten Everest-Bücher die denkwürdigen Sätze:
»Es ist für ein dumpfes Hirn schwer, die eigene Dumpfheit zu erkennen, doch halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß Everest-Besteiger versuchen, ihre Speisen zu trinken, rückwärts zu gehen oder andere komische Dinge zu treiben. In dünner Luft ist es nicht nur schwer, klar zu denken, es ist auch äußerst schwierig, den Wunsch nach Nichtstun zu unterdrücken. Wenn irgend etwas uns den Erfolg zu rauben vermag, dann in erster Linie die durch Sauerstoffhunger verursachte Willensschwäche.«
Ich lege das Buch lächelnd beiseite und blicke auf meine Armbanduhr: Es ist sieben. Ich überlasse mich einer angenehmen Müdigkeit. Befriedigt, daß ich noch eine halbe Stunde im Bett bleiben kann, rolle ich mich auf den Rücken, verschränke die Arme hinter dem Kopf und überlege. Obwohl ich eben erst aus den Bergen zurückgekommen bin, bedrängt mich die fixe Idee von einer Alleinbesteigung des Mount Everest. Ich will 1980 einen Versuch wagen, koste es, was es wolle.