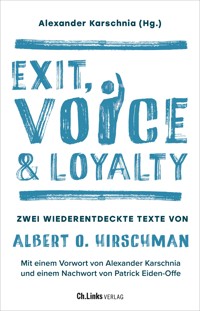
Exit, Voice & Loyalty E-Book
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Hirschman gehört zu den Hundertjährigen, die aus Klassikerregalen steigen und eine frische Botschaft anbieten.«Claus Leggewie
»Exit, Voice, and Loyalty« (1970) gehört zu den Standardwerken des 20. Jahrhunderts. Der Ökonom Albert O. Hirschman hat die Grenzen seines Faches gesprengt und einen Leitfaden für kollektives Handeln geliefert: Während Exit Abwanderung bedeutet, beschreibt Voice die politische Aktion (Widerspruch, Protest, Engagement). Zwischen beiden Polen besteht eine Spannung: Auch Wähler:innen können abwandern und Kund:innen sich beschweren. Wie passen die Ausreisewellen von DDR-Bürger:innen in dieses Schema? Hirschman, der erst kurz vor dem Mauerfall seine Heimatstadt Berlin wieder besuchte, hat seine Theorien mit großer Freude aktualisiert, um die »Wende« zu beschreiben. Beide Texte, der Klassiker von 1970 als auch der Essay von 1992 über das »Schicksal der DDR«, werden erstmals in einem Band publiziert, ergänzt um ein Vorwort des Herausgebers Alexander Karschnia und ein Nachwort von Patrick Eiden-Offe.
Albert O. Hirschmanwurde als Otto-Albert Hirschmann 1915 in Berlin geboren. Er stammte aus einer bildungsbürgerlichen säkularisierten jüdischen Familie. Im April 1933 flüchtete er aus Deutschland zunächst nach Paris und London. Er kämpfte im spanischen Bürgerkrieg, war im politischen Widerstand gegen die Mussolini-Diktatur in Italien, half neben Varian Fry ab 1940 im Emergency Rescue Committee in Marseille, von den Nazis Verfolgte aus Frankreich zu evakuieren. 1941 musste er sich schließlich selbst in die USA absetzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Hirschman u. a. im Büro des Marshallplans
und bei der Weltbank tätig. Von 1952 bis 1956 war er Wirtschaftsberater in Lateinamerika und gilt seitdem als Pionier einer kritischen Entwicklungspolitik. Ab 1956 lehrte er in Yale, Harvard und schließlich in Princeton. Von 1990 bis 1995 war Hirschman Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Er starb 2012 in den USA.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Hirschman gehört zu den Hundertjährigen, die aus Klassikerregalen steigen und eine frische Botschaft anbieten.«
Claus Leggewie
»Exit, Voice, and Loyalty« (1970) gehört zu den Standardwerken des 20. Jahrhunderts. Der Ökonom Albert O. Hirschman hat die Grenzen seines Faches gesprengt und einen Leitfaden für kollektives Handeln geliefert: Während Exit Abwanderung bedeutet, beschreibt Voice die politische Aktion (Widerspruch, Protest, Engagement). Zwischen beiden Polen besteht eine Spannung: Auch Wähler:innen können abwandern und Kund:innen sich beschweren. Wie passen die Ausreisewellen von DDR-Bürger:innen in dieses Schema? Hirschman, der erst kurz vor dem Mauerfall seine Heimatstadt Berlin wieder besuchte, hat seine Theorien mit großer Freude aktualisiert, um die »Wende« zu beschreiben. Beide Texte, der Klassiker von 1970 als auch der Essay von 1992 über das »Schicksal der DDR«, werden erstmals in einem Band publiziert, ergänzt um ein Vorwort des Herausgebers Alexander Karschnia und ein Nachwort von Patrick Eiden-Offe.
Die Stiftung Kommunikationsaufbau verleiht 2024 erstmals den VOICE Albert O. Hirschman Preis für Einmischung, Widerspruch und Erneuerung demokratischer Kultur
Über Albert O. Hirschman
Albert O. Hirschman wurde als Otto-Albert Hirschmann 1915 in Berlin geboren. Er stammte aus einer bildungsbürgerlichen säkularisierten jüdischen Familie. Im April 1933 flüchtete er aus Deutschland zunächst nach Paris und London. Er kämpfte im spanischen Bürgerkrieg, war im politischen Widerstand gegen die Mussolini-Diktatur in Italien, half neben Varian Fry ab 1940 im Emergency Rescue Committee in Marseille, von den Nazis Verfolgte aus Frankreich zu evakuieren. 1941 musste er sich schließlich selbst in die USA absetzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Hirschman u. a. im Büro des Marshallplans und bei der Weltbank tätig. Von 1952 bis 1956 war er Wirtschaftsberater in Lateinamerika und gilt seitdem als Pionier einer kritischen Entwicklungspolitik. Ab 1956 lehrte er in Yale, Harvard und schließlich in Princeton. Von 1990 bis 1995 war Hirschman Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Er starb 2012 in den USA.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
© Katia Salomon/Hernan Diaz, 1962
Alexander Karschnia (Hg.)
Exit, Voice & Loyalty
Zwei wiederentdeckte Texte von Albert O. Hirschman
Mit einem Vorwort von Alexander Karschnia und einem Nachwort von Patrick Eiden-Offe
Herausgegeben von Alexander Karschnia für die Stiftung Kommunikationsaufbau
Übersicht
Titelinformationen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Alexander Karschnia: Denken für die Zukunft: Der Albert-O.-Hirschman-Effekt
Albert O. Hirschman: Exit, Voice, and Loyalty
Vorwort zur amerikanischen Ausgabe
Vorwort zur deutschen Ausgabe
1. Einleitung und Überblick über die bisher vertretenen Lehrmeinungen
2. Abwanderung
3. Widerspruch
4. Eine besondere Schwierigkeit bei der Verbindung von Abwanderung und Widerspruch
5. Wie Monopole aus der Konkurrenz Nutzen ziehen können
6. Über räumliche Dyopole und die Dynamik von Zweiparteiensystemen
7. Eine Theorie der Loyalität
8. Abwanderung und Widerspruch in der amerikanischen Ideologie und Praxis
9. Das Problem der optimalen Mischung von Abwanderung und Widerspruch
Albert O. Hirschman: Abwanderung, Widerspruch und das Schicksal der Deutschen Demokratischen Republik
Einleitung
Das Zusammenspiel von Abwanderung und Widerspruch – eine Neuformulierung
Abwanderung als Gegenspieler von Widerstand: Die Jahre 1949–1988
Abwanderung und Widerspruch als Verbündete: Der Zusammenbruch des kommunistischen Regimes im Jahr 1989
Interpretation
Schlußwort
Patrick Eiden-Offe: Exit, Voice, and Loyalty – ein Klassiker der Selbstsubversion
Anhang
Die Autoren
Dank der Stiftung Kommunikationsaufbau
Fußnoten
Impressum
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
213
212
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
225
226
227
228
229
230
231
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
315
316
317
318
4
Denken für die Zukunft: Der Albert-O.-Hirschman-Effekt
von Alexander Karschnia
Im Zweifel für den Zweifel
Tocotronic
Exit, Voice, and Loyalty von Albert O. Hirschman (1915–2012) gilt als ein Schlüsselwerk und gehört zu den meistzitierten sozialwissenschaftlichen Büchern des 20. Jahrhunderts. Doch fragt sich, ob man dem Buch gerecht wird, liest man es nur als Beitrag zur Sozialwissenschaft. Seine Wirkungsgeschichte reicht weit über die akademische Welt hinaus – selbst innerhalb der Sozialwissenschaften überschreitet es Grenzen, v.a. jene zwischen der Wirtschafts- und der Politikwissenschaft. Als studierter Ökonom, dessen Interesse für die Wirtschaft seiner Leidenschaft für Politik entsprang, hat Hirschman beide Bereiche schon immer in ihrer Wechselwirkung betrachtet. Nun war er nicht nur einer der bedeutendsten Sozialwissenschaftler des vergangenen Jahrhunderts (er ist nur knapp dem Nobelpreis entgangen), sondern auch ein Aktivist.
Denken und Handeln hat er nie als Gegensätze begriffen, vielmehr als wechselseitig bedingt, ebenso wie das Verhältnis von Exit (Abwanderung) zu Voice (Widerspruch). Während die Strategie der »Abwanderung« vor allem Verbraucher:innen betrifft, die zur Konkurrenz überlaufen oder den Anbieter wechseln, beschreibt Voice das Aktivwerden mündiger Bürger:innen, die Einspruch erheben, Kritik üben oder Protest anmelden. Was passiert, wenn Konsument:innen ihre Stimme entdecken und sich einmischen? Oder umgekehrt, wenn Bürger:innen bei einer Wahl ihre Stimme im Wortsinne »abgeben« statt sich selbst zu Wort zu melden? Oder sogar Wahlenthaltung praktizieren, sich von öffentlichen Angelegenheiten abwenden und ins Privatleben zurückziehen? Weniger klar ist, wie es sich mit dem dritten Konzept verhält, der Frage nach der »Loyalität«, die im Titel der deutschen Übersetzung prompt ausgespart wurde: Abwanderung und Widerspruch lautet der Titel der Schrift, die exakt fünfzig Jahre vor dieser Neuveröffentlichung im Jahr 1974 im Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) als Band 8 der Schriften zur Kooperationsforschung erschien. Untertitel: Reaktionen auf Leistungsabfall bei Unternehmungen, Organisationen und Staaten (im Original: Responses to decline of firms, organizations and states).
Der Untertitel scheint das Werk klar in den Bereich der Organisationssoziologie mit Schwerpunkt auf ökonomischen Fragestellungen einzuordnen. Das ist insofern irreführend, als Hirschman selbst im Buch Beispiele bemüht, die von dem Untertitel nur indirekt abgedeckt werden, wie das Eheleben von US-Amerikaner:innen und die Entwicklung einer American Ideology oder die Entstehung der Black-Power-Bewegung, einer Gegenkultur und des neuen Sozialtypus der »drop-outs« (Aussteiger) usw. Vielleicht kann man sagen, dass die deutschen Herausgeber sich allzu sehr vom Untertitel in die Irre haben führen lassen. Die durchschlagende Wirkung des Buches und die notorische Bekanntheit seines Originaltitels beweisen, dass hinter Exit und Voice mehr stecken muss als der Vergleich von Konsument:innen und Wähler:innen. Tatsächlich war es Sinn und Zweck des Buches, den damals schon abgeschmackten Vergleich zwischen der Wahl von Parteien und Produkten hinter sich zu lassen. Bezeichnet Exit doch auch den Notausgang oder dramatischen Abgang. Und Voice ist noch stärker als »Stimme« im Deutschen die Meinungsäußerung, Willensbekundung, Entscheidung: Wer die eigene »Stimme« entdeckt, verschafft sich eine Bühne. So lautet das 1. Unterkapitel des 1. Kapitels im englischen Original: »Enter ›exit‹ and ›voice‹« – wie eine Regieanweisung in einem dramatischen Text (Auftritt von Abtritt und Widerspruch). Beide Optionen werden auch als »Verkörperungen« (impersonations) des Politischen und des Ökonomischen beschrieben. Hirschman eröffnet die Bühne der politischen Ökonomie, auf der verschiedene Akteur:innen (actors) auftreten, die eben nicht nur »Handlungsträger« sind, wie es in der Übersetzung heißt, sondern auch Schauspieler:innen. Fünfzig Jahre später ist uns dieser Gedanke weit weniger fremd als damals, hat sich doch der Begriff der »Performance« längst eingebürgert: »poor performance« ist mehr als eine »minderwertige Leistung«, es ist auch einfach schlechtes Theater.
Formel für Wandel
Das Buch, ein Kind des turbulenten Jahres 1968, lässt sich auch als eine Intervention Hirschmans verstehen. Überall auf der Welt kam es zu Protesten, von Prag bis Paris, Berkeley bis Berlin, Tokio, Mexico City … Anders als Herbert Marcuse blieb Hirschman den Protesten gegenüber zwar distanziert, doch war er ihnen auch nicht feindlich gesinnt. Als der Zeitgeist sich im Laufe der 1970er Jahre erneut änderte, wurde sein Buch zur »unzeitgemäßen Betrachtung«. Was dem Erfolg nicht abträglich war, im Gegenteil. Hirschman selbst hat den Wechsel von engagierten zu privaten Jahrzehnten sehr genau registriert und einige Jahre später in der Publikation Engagement und Enttäuschung. Über das Schwanken der Bürger zwischen Privatwohl und Gemeinwohl (Shifting involvements. Private Interest and Public Action) bündig beschrieben. Knapp zehn Jahre später nahm er in seinem Buch Denken gegen die Zukunft. Die Rhetorik der Reaktion(The Rhetoric of Reaction) reformfeindliche Diskursstrategien von Edmund Burke bis zur »konservativen Revolution« von Reagan und Thatcher ins Fadenkreuz. All diese Beobachtungen funktionieren auf Grundlage jener Matrix, die er in Exit, Voice, and Loyalty erstmals präsentiert. Erstaunt stellte Hirschman fest, dass sich das Buch wie von selbst schrieb. Was bei seiner Vorlesung 1968 zunächst noch wie eine Zusammenfassung seines bisherigen Nachdenkens über Fragen der Entwicklungspolitik erschien, weitete sich schnell aus zu einer Suche nach den Treibern gesellschaftlichen Handelns.
Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass Exit, Voice, and Loyalty funktioniert wie eine Formel für die Dynamiken sozialen Wandels. So skeptisch Hirschman gegenüber Maximalforderungen war, so kritisch war er gegenüber allen Vorstellungen von »Gleichgewicht«. Schon als Pionier der »Entwicklungspolitik« sprach er sich für »ungleichgewichtige Entwicklungen« (unbalanced growth) aus und gegen schematische Vorstellungen von »ein Schritt nach dem anderen«. Später bekannte er freimütig, in solchen Vorstellungen von Lenin beeinflusst worden zu sein, dessen Sinn für das Situative politischen Handelns er schätzte. Schließlich gelingt kein Wandel ohne Grenzüberschreitung, »crossing« oder »trespassing« (No trespassing!, deutsch: Betreten verboten!).
Die positive Umwertung negativ besetzter Begriffe ist ein schlagendes Beispiel für die Art von Hirschmans Interventionen. Leicht lässt sich eine Liste von Stichwörtern anlegen wie »commitment to doubt«, der Einsatz für den Zweifel. Und natürlich »bias for hope«, die Neigung oder gar das Vorurteil zugunsten von Hoffnung. Am deutlichsten wird die Umwertung in einem Wort, das er selbst kreiert hat: »reformmonger«; es gibt kaum eine bessere Selbstbeschreibung für ihn als jene Begriffsbildung, die sich schwerlich ins Deutsche übertragen lässt. Kannte man bis dahin doch nur eine Reihe negativ besetzter »monger«: vom »scaremonger« (Angstmacher:in) über den »doom-monger« (Untergangsprophet:in) bis hin zum »warmonger« (Kriegstreiber:in). Ebenso fragwürdig ist der »phrase-« oder der »mysterymonger« (Phrasendrescher:in, Geheimniskrämer:in) – was aber soll ein »reformmonger« sein? Handelsreisende im sozialen Wandel wäre eine allzu wörtliche Übersetzung – es ist der Typ, der Reformen vorantreibt, das glatte Gegenteil einer:s Defätist:in oder eines »Weltverschlechterers« (eine weitere Hirschman-Wortkreation).
Getting ahead collectively
Aus eigener Erfahrung waren Hirschman zwei Typen gleichermaßen verhasst: Expert:innen, die alles besser zu wissen glauben, und Revolutionär:innen, die glauben, alles müsse erst noch schlimmer werden, bevor es auf einen Schlag besser bzw. gut wird. Stattdessen ging es ihm sein Leben lang, ob in Theorie oder Praxis, um eine Sache: Getting ahead collectively – ein Buchtitel, der seine Absicht unmissverständlich preisgibt. Verbindet sich doch die Ausrichtung auf den Fortschritt bei Hirschman stets mit der Aufforderung zu kollektivem Handeln – wie in Graswurzel-Kooperativen in Lateinamerika oder in anderen Formen öffentlicher Aktion. Sollte das Wort »progressiv« jemals wieder einen positiven Sinn erhalten, ob als persönliche Eigenschaft oder als Beschreibung eines bestimmten Sozialtypus, wäre es hilfreich, sich auf Hirschmans Beispiel und seine Aufforderung, gemeinsam voranzukommen, zu besinnen. Lange genug wurde »Fortkommen« ausschließlich als individuelle Angelegenheit verstanden im Sinne einer »Meritokratie«. Hirschman dagegen beschreibt eine Form des Aktivismus, der es um »social promotion« geht, um sozialen »Aufstieg«, nicht um die Beförderung Einzelner: Fortschritt für alle!
Vita activa
Im Jahr 2024, ein halbes Jahrhundert nach dem ersten Erscheinen seines Schlüsselwerkes auf Deutsch, liest es sich wie eine Ermunterung zur Repolitisierung oder Rückbesinnung auf jene »vita activa«, der sich auch Hannah Arendt verschrieben hatte. Anders als Arendt jedoch, die streng unterscheidet zwischen den Bereichen des Privaten, Sozialen und Politischen, interessieren Hirschman ihr Zusammenspiel, ihre fließenden Übergänge und Wechselwirkungen. Davon abgesehen verbindet beide eine Neigung zur Dreiteilung: So unterscheidet Arendt in ihrem philosophischen Hauptwerk Vita activa zwischen Leben, Herstellen und Handeln und in ihrem Spätwerk Vom Leben des Geistes zwischen Denken, Wollen und Urteilen. Hirschman setzt seine Trias Exit, Voice, and Loyalty gleich in den Titel. Ohne den seriösen Untertitel klingt es fast wie ein Passwort, eine Parole oder die Überschrift eines politischen Kurzprogramms. Was nicht verwundert, verbirgt sich hinter dem weltberühmten Sozialwissenschaftler doch eine sehr spezielle Art von Aktivist. Und hinter dem Aktivisten ein Schriftsteller mit einer besonderen Freude an Sprachspielen, der seine wissenschaftlichen Ausführungen regelmäßig mit Beispielen aus der Literatur, mit Gedichten oder Witzen illustrierte. Nicht umsonst hieß es, er betreibe Sozialwissenschaften als »Literatur«. »Nach Hirschman wird man Montaigne und Flaubert zu den Klassikern der Wirtschaftstheorie zählen müssen«, wie Patrick Eiden-Offe 2013 in seinem Nachruf auf Hirschman im Merkur schrieb (»A man, a plan, a canal«). In Exit, Voice, and Loyalty blitzt das nur gelegentlich auf, etwa wenn der Autor mit dem Wort »slack« für »Leistungsabfall« spielt: »Thereʼs a slacker born every minute.« Es ist vielleicht kein Zufall, dass der »slacker«, der hier beschworen wird (unbeholfen übersetzt als »Abschlaffer«), zwei Jahrzehnte später zum zentralen Typus der Gegenkultur wurde, etwa durch Richard Linklaters Kultfilm Slackers (1991). Den tieferen Sinn der Aufforderung vieler Adoleszenter, »locker zu bleiben«, hat Hirschman früh durchschaut. Zugleich beschreibt diese Einstellung treffend die Eigenart seines Denkens. Alle entscheidenden Schläge werden schließlich mit der linken Hand geführt, wie bereits Walter Benjamin festgestellt hat.
Spätestens an dieser Stelle blitzt der ökonomische Sachverstand wieder auf, denn es geht Hirschman um nichts weniger als die Entdeckung einer »slack economy«: einer schlaffen im Gegensatz zu einer straffen Wirtschaftsform (slack/taut). Dem entspricht die Unterscheidung zwischen dem Verhalten von »regen« und »trägen« Kund:innen (alert/inert). Hier glückt die deutsche Übersetzung, fast möchte man meinen, Hirschman selbst habe hier mit seiner Muttersprache gespielt. Doch gehört Hirschman zu jenen Ökonomen, die sich durch ihr Fachgebiet keine Ignoranz haben antrainieren lassen, sein Interessengebiet ist und bleibt die politische Ökonomie. Und so gibt es auch im Politischen eine Bandbreite von Verhaltensweisen zwischen den Extremen eines »permanenten Aktivismus« und »totaler Apathie«. Hirschmans Geist – oder vielleicht wäre es angemessener von spirit oder gar esprit zu sprechen – versteht man am besten, wenn man sich anschaut, wie er aus einer schlechten Nachricht (es gibt immer Verfall, Leistungsabfall, Entropie) eine frohe Botschaft schlussfolgert (deswegen gibt es überall Gegenkräfte, die sich mobilisieren lassen): ein sehr pragmatischer Idealismus.
Many exits, different voices, difficult loyalties
Doch die Fragen von Exit, Voice, and Loyalty haben auch Hirschmans eigenes Leben zutiefst geprägt. Hirschmans legendäres Grenzgängertum zwischen Ländern, Sprachen, Kontinenten und verschiedenen Disziplinen werden erst vor dem Hintergrund seiner unglaublichen Odyssee verständlich. Sehr früh stand er selbst vor der Entscheidung zwischen Exit und Voice: Seit Jugendtagen in der Sozialistischen Arbeiter-Jugend in Berlin aktiv, erlebte er mit, wie sich die SPD kurz vor der Machtübertragung an die NSDAP wegen der »Tolerierungspolitik« gegenüber dem Kabinett Brüning spaltete. So schloss Willy Brandt sich damals der SAP (Sozialistische Arbeiterpartei) an, Hirschman hingegen blieb; bald sollten sie gegen die Nazis zusammenarbeiten. Es bleibt eine politische Grundsatzfrage, die sich jeder Generation neu stellt: Soll man einer Sache, einem Kurs, einer Partei treu bleiben, um Einfluss nehmen zu können, oder ist es sinnvoll, etwas Neues zu gründen? Ist es loyaler, seine Stimme zu erheben, oder kann ein Akt der Loyalität auch darin bestehen, eine Vereinigung schweigend zu verlassen?
In ihren Erinnerungen beschreibt Hirschmans Schwester Ursula, wie sie am 30. Januar 1933, dem Tag, an dem Hitler zum Kanzler ernannt wurde, gemeinsam auf Fahrrädern durch die Stadt fuhren und sich am damaligen Bülowplatz (heute Rosa-Luxemburg-Platz) an der Parteizentrale der KPD trafen, in der Hoffnung auf ein Signal zum Aufstand. Nichts geschieht, kurz darauf beginnen die Massenverhaftungen. Schnell stellt sich heraus, dass Voice in Deutschland kaum noch möglich ist; Exit ist das Gebot der Stunde. Spätestens als Hirschmans enger Freund und Genosse Peter Franck verhaftet wurde.
Am 2. April 1933, wenige Tage vor seinem 18. Geburtstag, verlässt Otto-Albert Hirschmann (so der Geburtsname) Deutschland und geht nach Paris ins Exil, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Als 1936 John Maynard Keynesʼ Opus Magnum Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes erscheint, studiert er an der London School of Economics. Als der Spanische Bürgerkrieg beginnt, bricht er mit anderen Freiwilligen nach Barcelona auf und wird bei Kampfhandlungen an der Aragon-Front verletzt. Schnell durchschaut er das fatale Agieren der Stalinisten und setzt sich nach Triest ab, wo seine Schwester mittlerweile mit ihrem Mann, dem Philosophen Eugenio Colorni, lebt. Nach anderthalb Jahren wird es für ihn dort zu gefährlich. Das faschistische Regime erlässt antisemitische »Rassengesetze«, und Hirschman kehrt kurz vor Colornis Verhaftung zurück nach Paris.
Sowie es möglich ist, nicht in der Fremdenlegion, sondern in der regulären Armee auf französischer Seite gegen die Nazis zu kämpfen, meldet er sich freiwillig. Als die Armee demobilisiert wird, entkommt Hirschman in die unbesetzte Zone nach Marseille, wo er erfolgreich Fluchthilfe organisiert, bis er selbst über die Pyrenäen flüchten muss, um von Lissabon aus in die USA einzureisen. Als die USA den Achsenmächten den Krieg erklären, meldet er sich wieder freiwillig. Bevor er in den Krieg zurückkehrt, heiratet er Sarah Chapiro und schreibt in Berkeley sein erstes Buch: National Power and the Structure of Foreign Trade. Schon damals untersucht Hirschman die politischen Konsequenzen wirtschaftlichen Handelns, in diesem Fall die ökonomische Seite faschistischer Machtpolitik. Es ist kaum zu glauben, wie er es schafft, in diesen Jahren intellektuell zu arbeiten, scheint er doch keine Gelegenheit auszulassen, den faschistischen Feind zu bekämpfen: ob im antifaschistischen Untergrund, den Internationalen Brigaden, den Forces armées françaises oder der US-Army und dem OSS (Office of Strategic Services), dem Vorläufer der CIA.
Bevor Hirschman wieder europäisches Festland betreten kann, sitzt er in Algerien fest. Dort trifft er Francine, die zweite Frau von Albert Camus, dessen Werk ihn tief beeindruckt. Sie ist bass erstaunt über die Ähnlichkeit der beiden Alberts. Auf Fotografien dieser Zeit sehen beide aus wie Film-Noir-Stars. Hirschman kann es kaum erwarten, seinen Schwager wiederzusehen, den er als seinen besten Freund und Mentor betrachtet. Jahrelang wurde Colorni auf der Gefangeneninsel Ventotene festgehalten, wo er zusammen mit Altiero Spinelli und Carlo Rossi das Manifest von Ventotene (Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto) verfasst hat, die Vision eines in Frieden und Freiheit vereinten sozialistischen Europas, niedergeschrieben auf Zigarettenpapier, herausgeschmuggelt in den Resten eines Hühnchens. Nach dem Sturz Mussolinis kann Colorni die Insel verlassen. Kurz vor der Befreiung Roms wird er auf offener Straße von Faschisten erschossen. Hirschmans Herz ist gebrochen, wie er seiner Schwester schreibt. Er verdankt Colorni die wichtigsten Lektionen seines Lebens. Exit, Voice, and Loyalty ist seinem Andenken gewidmet.
Im Zweifel für den Zweifel: Colorni & Co.
Die Geschwister Hirschmann kennen Colorni noch aus der Zeit ihres antifaschistischen Aktivismus in Berlin. Ursula hat den Leibniz-Spezialisten in der Bibliothek kennengelernt. Bald versteckt er den Vervielfältigungsapparat für ihre Flugblätter in seinem Pensionszimmer. Kaum ist Ursula ihrem Bruder nach Paris gefolgt, begegnen sie sich wieder. Sie werden ein Paar und gehen nach Italien, wo Colorni ein antifaschistisches Netzwerk aufbaut. Hirschman übernimmt Kurierdienste nach Paris, schmuggelt in Zahnpasta versteckte Botschaften zu den Genoss:innen von Giustizia e Libertà (Gerechtigkeit und Freiheit) und promoviert zugleich an der Universität in Triest. Selbst seine ökonomischen Arbeiten dienen der Feindaufklärung. Ihm gefällt das Detektivspiel: »Ich genoß es, wenn es mir gelang, die faschistischen Machthaber zu überlisten und ihnen auf die Spur zu kommen.« (»Zweifel und antifaschistische Aktivität in Italien, 1936–1938«, erschienen 1996 in Selbstbefragung und Erkenntnis)
Zugleich entdeckt er Montaignes Essays für sich und die Schriften Machiavellis. Neben den Lektüren ist eine wesentliche Lektion, die er Colorni verdankt, die Fähigkeit, aus Einfällen Ideen zu entwickeln. Wie entscheidend sie für Hirschmans gesamtes Denken ist, kann nur ermessen, wer die Bedeutung jener »petites idées« kennt, auf die Colorni immer wieder zurückkommt. Hirschman misstraut großen Theorieentwürfen von »Modellbauern« ebenso wie Weltanschauungspolitikern und plädiert im Zweifel für den Zweifel, wie er es bei Colorni und seinen antifaschistischen Genoss:innen (Liberale, Sozialist:innen und Republikaner:innen) erlebt hat: »Was mich faszinierte, war der enge Zusammenhang zwischen ihrer geistigen Haltung, welche die Abwesenheit einer festen ideologischen Bindung unterstrich, und ihrer Hingabe an eine gefährliche politische Aktivität.« Hirschman kam es so vor, als wollten Colorni und seine Leute beweisen, dass Hamlet unrecht hatte: Zweifel muss nicht lähmen, sondern kann sogar motivieren: A lesson for life. Heute existiert ein Institut, das nach den beiden benannt ist – und sich bewusst als »ein« Institut bezeichnet, um zur Nachahmung anzuregen: »A Colorni-Hirschman International Institute« (gegründet von Luca Meldolesi und Judith Tendler).
Neu Beginnen
Außer der Widmung an seinen Schwager findet sich in Exit, Voice, and Loyalty kein Hinweis auf Hirschmans biographischen Hintergrund, erst recht nicht auf sein antifaschistisches Engagement. Das ändert sich erst, als das Buch 1974 in Deutschland erscheint. Im Vorwort zur deutschen Ausgabe erwähnt er das Schicksal deutscher Jüdinnen und Juden in NS-Deutschland.
Hirschmans säkulare, assimilierte jüdische Familie hatte den Antisemitismus bereits vor dem Machtantritt der Nazis in Berlin erlebt. Dennoch schreibt Hirschman, der Umstand, dass viele jüngere Menschen ins Exil gingen, habe »eine ernstlich geschwächte Gemeinschaft« hinterlassen. Er fährt fort: »Sicher gab es damals praktisch keine Möglichkeit für einen wirksamen Widerspruch, wer immer auch ging oder blieb.« Vielleicht kann man diesen Satz als diskreten Verweis auf die Überzeugungen des Neu-Beginnen-Netzwerkes lesen, dem sich Hirschman wie Willy Brandt angeschlossen hatten – eine Gruppe linker Sozialdemokrat:innen und KPD-Dissident:innen, die früh verstanden hatten, wie fatal die Spaltung der Arbeiterparteien für den antifaschistischen Kampf war. Anders als den Führern jener Parteien war ihnen klar, dass der Nationalsozialismus nicht nur eine vorübergehende Krisenerscheinung sein würde. Statt etwas Neues zu gründen, bestand ihre Strategie darin, in den verfeindeten Parteien zu verbleiben und ein Netzwerk zu bilden. Ihnen war auch klar, dass direkte Widerstandsformen wirkungslos waren. Dennoch setzten sie alles daran, nicht isoliert von Gleichgesinnten, sondern als Zusammenschluss von Menschen das Regime zu überdauern. Tatsächlich gelang dies der Gruppe besser als vielen anderen. Ihr Tarnname war schlicht »Org« oder »O« wie der Buchstabe oder die Ziffer Null. Statt auf spektakuläre Sabotage-Aktionen setzten ihre Mitglieder auf Aufklärungsarbeit für Verbündete im Ausland. Noch 1936 reiste Willy Brandt mit norwegischem Pass für mehrere Monate nach Berlin, um den Austausch mit den in Feindesland verbliebenen Genoss:innen aufrechtzuerhalten.
In seinem Buch Neu Beginnen. Hannah Arendt, die Revolution und die Globalisierung glaubt der Philosoph Oliver Marchart, Spuren dieser Überzeugung auch in Arendts Pathos des Neuanfangs zu erkennen. Durch ihren Mann Heinrich Blücher, einen KPD-Aussteiger, dürfte sie über die politischen Hintergründe im Bilde gewesen sein. Kurioserweise war es Blücher, der den jungen Hirschman im Pariser Exil wegen dessen ideologischer »Bauchschmerzen« bearbeitete und auf Linie zu bringen versuchte. Damals befand Hirschman sich – ähnlich wie Hans Sahl – im Exil im Exil: Er hatte sich von rigiden Positionen emanzipiert und von linientreuen Parteigänger:innen entfremdet.
Nach dem Krieg gingen die Neu-Beginnen-Mitglieder verschiedene Wege, manche hatten sich im Exil der SPD wieder angenähert und bauten wie Richard Löwenthal und Willy Brandt die Berliner SPD auf. Andere wie Robert Havemann blieben in der DDR und wurden dort erneut zu Dissidenten. Wie neuere Forschungen belegen, ist ihr Einfluss auf die »young radicals« der Neuen Linken in den 1960er Jahren nicht zu unterschätzen. Schwer zu sagen, wie Hirschmans Einfluss auf die westdeutsche 68er Bewegung gewesen wäre, wenn er damals an einer deutschen Universität gelehrt hätte. Nicht nur über Voice, auch über Exit hätte Hirschman viel erzählen können.
Last Exit Marseille
Kaum hatte die Wehrmacht im Frühjahr 1940 Frankreich überrollt, erging von den deutschen Besatzungsbehörden der Befehl an das Vichy-Regime zur »Auslieferung auf Verlangen«: Surrender on Demand betitelte der US-amerikanische Journalist Varian Fry seine Autobiographie, in der er eine der ungewöhnlichsten und mutigsten Rettungsaktionen beschreibt, die während der beispiellosen Verfolgungen durch die Nazis während des Zweiten Weltkrieges unternommen wurden und an denen er selbst maßgeblich beteiligt war – ebenso wie Albert Hirschman bzw. Albert Hermant (sein »nome de guerre« auf den Entlassungspapieren der französischen Armee). Im Sommer 1940 fuhr Fry im Auftrag des Emergency Rescue Committee nach Marseille mit einer Liste, auf der die Namen von 200 Personen standen, die durch den Auslieferungsbefehl der Nazis in Lebensgefahr schwebten. Es waren Künstler:innen, Schriftsteller:innen und Intellektuelle wie Anna Seghers, Lion Feuchtwanger, Franz Werfel und dessen Frau Alma Mahler-Werfel, Heinrich Mann und sein Neffe Golo Mann, Siegfried Kracauer, Walter Mehring, Max Ernst, Marc Chagall, Marcel Duchamp, der Anführer der Surrealisten André Breton und der berüchtigte Berufsrevolutionär Victor Serge. Auch die damals noch unbekannte Hannah Arendt und Heinrich Blücher gehörten später zu den Geretteten.
Anna Seghers hat ihre Flucht im Roman Transit verarbeitet, 2018 kam Christian Petzolds Verfilmung in die Kinos. Fünf Jahre später wurde die Netflix-Serie Transatlantic von Anna Winger ausgestrahlt. Basierend auf dem Roman The Flight Portfolio von Julie Orringer wird hier die Geschichte des Emergency Rescue Committee in sieben Episoden erzählt – mit Hirschman als zentraler Figur. Während Winger sich poetische Freiheiten nimmt (z.B. bei einer fiktiven Begegnung von Arendt mit Hirschman, die Winger als »fan fiction« bezeichnet), baut Uwe Wittstocks Buch Marseille 1940. Die große ###PageStart_20Flucht der Literatur ausschließlich auf den literarischen Zeugnissen der Betroffenen auf. Auch hier spielt Hirschman eine prominente Rolle. Fry hatte ihm den Spitznamen »Beamish« verliehen: »Strahlemann«.
In seiner monumentalen Biographie Worldly Philosopher. The Odyssey of Albert O. Hirschman beschreibt Jeremy Adelman, wie Hirschman Fry bei seiner Ankunft in Marseille am Bahnhof Saint Charles mit strahlendem Lächeln empfängt und sofort zu seinem wichtigsten Mitarbeiter wird. Nach sieben Jahren auf der Flucht wird er zum »professionellen Flüchtling«, wie Lukas Englander alias Albert O. Hirschman aka Albert Hermant in Transatlantic sagt. Hirschman selbst hat sich lieber als »débrouillard« bezeichnet, ein Mensch mit Einfällen, ein Trickster, verfügte er doch über eine legendäre Geschicklichkeit, Dokumente zu besorgen. Mindestens einmal geriet er deswegen in eine brenzlige Situation, weil er bei einer Polizeikontrolle zu viele Ausweise bei sich hatte (darunter für einen von ihm erfundenen »Club der Clublosen«): »Wie ein Verbrecher mit zu vielen Alibis.« Unerschrocken baute er Kontakte zur Unterwelt im berüchtigten Vieux Port von Marseille auf, jener Welt, der Jean Malaquais in seinem Roman Planet ohne Visum ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Hirschman übernimmt den kriminellen Part, tauscht Dollars auf dem Schwarzmarkt, sucht Fluchtquartiere usw. Seine genaue Kenntnis der politischen Emigrantenszene macht ihn für Fry unentbehrlich, um sich vor Nazi-Spitzeln zu schützen. Hirschman kennt vor allem Menschen aus dem Umfeld der Gruppe Neu Beginnen, Leute wie Karl Frank alias Paul Hagen in den USA. Dieser war es, der Fry von der Notwendigkeit überzeugte, von den Nazis verfolgte Menschen, die in Panik aus Paris in den Süden des Landes flohen, vor Ort zu helfen. Dabei genoss Fry zwar die Unterstützung der Ehefrau des US-Präsidenten Eleanor Roosevelt, nicht jedoch die desState Department oder des US-amerikanischen Konsuls in Marseille.
Nach dem Krieg blieb eine Ehrung Frys lange aus. Auch Hirschman hat kaum über seine Heldentaten gesprochen. Erst in den 1990er Jahren erhielt die Rettungsaktion die offizielle Anerkennung, die sie verdient. Heute steht das International Rescue Committee (IRC) in der Tradition von Varian Fry.
More Exits
Hirschman erlebt das Kriegsende in Italien. Er arbeitet als Übersetzer im ersten Kriegsverbrecherprozess und kehrt erst 1946 in die USA zurück, wo er eine Stelle bei der US-Notenbank findet. Er wird zum »Mit-Denker des Marshall-Plans und zum Vordenker der europäischen Zahlungsunion«, wie Wolf Lepenies schreibt. Hirschman gilt als Experte für die italienische und die französische Wirtschaft, doch bald bekommt auch er zu spüren, dass an der »Loyalität« zu seinem neuen Heimatland gezweifelt wird. Ist es wegen seiner Arbeit mit Fry, seiner vielfältigen Kontakte zu den linkssozialistischen Kreisen von Neu Beginnen oder seiner Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg? War es der Anwerbeversuch eines kommunistischen Agenten im International House in Berkeley? Fakt ist, dass Hirschmans FBI-Akte so umfangreich war, dass sie in der McCarthy-Zeit ein wahres Eigenleben annahm: »The Biography of a File« nennt Adelman das entsprechende Kapitel in seiner Biographie. Hirschman selbst wusste davon zeitlebens nichts, doch muss er Hinweise erhalten haben.
Kaum bietet sich ihm die Möglichkeit, die USA zu verlassen, entscheidet Hirschman sich über Nacht und bricht mit seiner Frau und den Töchtern Lisa und Katia nach Kolumbien auf, wo er zunächst im Auftrag der Weltbank als ökonomischer Berater für die Regierung tätig wird. Bald entwickelt er eigensinnige Vorstellungen von »Entwicklung« und macht sich nach Konflikten mit Mitarbeiter:innen selbständig (Exit im Exit). Statt einem theoretischem Masterplan zu folgen, wie orthodoxe Marxisten oder marktfundamentalistische Neoliberale, interessiert er sich für praktische Möglichkeiten: Er reist, pflegt Kontakte mit den unterschiedlichsten Menschen und informiert sich über ihre Strategien. Ihn interessiert, wie die Menschen vor Ort ihre Probleme lösen. Bei seinen lateinamerikanischen Kolleg:innen bekämpft er den Defätismus, für den er den Ausdruck »fracasomania« prägt: ein »Versagerkomplex«, der sich in Redensarten ausdrückt wie: »Hier in den Tropen machen wir halt alles falsch herum.« Hirschman hält viel vom »Falsch-herum-Machen«, er nennt es »Gegen-den-Wind-Segeln«.
Seine Idee der »ungleichgewichtigen Entwicklung« besagt, dass es sinnvoll sein kann, in einen industriellen Sektor zu investieren, bevor die Infrastruktur komplett entwickelt ist. Es sind jene »unintendierten Nebenfolgen«, die Hirschman als »blessing in disguise« (verborgener Segen) faszinieren. Dabei spricht er gern von Koppelungen: Rückwärts-, Vorwärts-, aber auch Entkoppelung. So profitiert ab einem gewissen Level von Wohlstand die demokratische Entwicklung des Landes, bis sie sich entkoppelt und ein Eigenleben entfaltet, das ab einem bestimmten Punkt nicht länger abhängig ist von der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese »relative Autonomie« des Politischen widerspricht einem starren Basis-Überbau-Modell. Hirschman selbst nennt sein Vorgehen »Mikromarxismus«.
Wo genau stand dieser Mann, der sich von Friedrich von Hayek genauso inspirieren ließ wie von Lenin? War er ein notorischer Sozialdemokrat, ein Linkslibertärer oder gar ein liberaler Kommunist? Von radikaleren Kolleg:innen wird er wegen seines erklärten »Possibilismus« für einen sturen Weltverbesserer gehalten – ein unverbesserlicher Optimist, der sich scheue, die Wurzel des Übels anzupacken. Hirschman hat mit Worten widersprochen, die noch heute zu denken geben: »Nur weil ein Vorschlag konstruktiv ist, heißt es noch lange nicht, dass er konterrevolutionär sein muss.«
Reentries
1956 kehrt er in die USA zurück und schreibt Strategies of Economic Development. Bald gilt er als Pionier einer kritischen Entwicklungspolitik, wird an die besten Universitäten des Landes berufen und lehrt in Columbia, Yale, Harvard und Stanford. Zehn Jahre lang haben ihn Fragen der »Entwicklungspolitik« beschäftigt, er schreibt zwei weitere Bücher: AJourney to Progress und Development Projects Observed. Exit, Voice, and Loyalty wird zur »Brückenpublikation« zu den sozialphilosophischen Werken. Im selben Jahr, in dem die deutsche Übersetzung veröffentlicht wird, findet Hirschman seine Heimat am Institute for Advanced Study in Princeton, wo er mit dem Anthropologen Clifford Geertz und später mit Michael Walzer zusammenarbeitet. Zunehmend wird ihm bewusst, dass die Beobachtungen, die er in »Entwicklungsländern« gemacht hat, auch Rückschlüsse auf die westlichen Länder erlauben: »Ich war ausgezogen, um etwas über andere zu erfahren, und erfuhr schließlich etwas über uns selbst.« Was ihn vor allem beschäftigt, ist das Zusammenspiel von Exit und Voice: Das Beispiel der nigerianischen Eisenbahn hat ihm gezeigt, dass »Abwanderung« nicht immer zur Verbesserung der Leistungen führen muss. Oft können Kursänderungen nur durch »Widerspruch« erzielt werden. Dazu bedarf es jedoch eines ausgeprägten öffentlichen Interesses. In den »Entwicklungsländern« ist dieses Interesse größer, wodurch sich mehr Möglichkeiten ergeben für Voice als in frühindustrialisierten Ländern.
Doch diese Ressource verkennen sogar Politikwissenschaftler:innen, die selbst eine Art »Versagerkomplex« gegenüber Ökonom:innen zu empfinden scheinen. Auch sie sollten einmal alles »falsch herum machen«, rät Hirschman: Statt Bürger:innen wie Kund:innen zu behandeln, empfiehlt er, Kund:innen als Bürger:innen zu betrachten, die ein Recht haben, gehört zu werden. Es ist eine Kampfansage an die Milton-Friedman-Doktrin, die populär zu werden beginnt. Derspätere Nobelpreisträger vermarktet die Demokratie (im Wortsinn). Mit dem Ergebnis, dass wir es fünfzig Jahre später mit dem Typus des »tyrannischen Konsumenten« zu tun haben, den Philipp Lepenies in seinem Buch Verbot und Verzicht. Politik aus dem Geiste des Unterlassens mit Hirschmans Hilfe anschaulich beschreibt. Wer vertraut ist mit den politischen Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg (so der Untertitel von Hirschmans sozialphilosophischem Werk Leidenschaften und Interessen), wird unschwer erkennen, dass das neoliberale Credo die Apologie des Kapitalismus von den Füßen auf den Kopf stellt: Statt (destruktive) Leidenschaften durch (produktive) Interessen einzuhegen, werden sie entfesselt, bis sie die Grundfesten der Gesellschaft bedrohen. War Konsumverzicht einmal die Triebfeder des »Geists des Kapitalismus«, ist der ungehinderte Konsum zu seinem Lebenselixier geworden – mit den bekannten desaströsen Folgen für den gesamten Planeten. Der häretische Ökonom Hirschman hätte wohl zustimmend gelacht über den Spruch, wer auf einem begrenzten Planeten an unbegrenztes Wachstum glaube, müsse entweder verrückt oder Wirtschaftswissenschaftler sein.
Interessen und Leidenschaften
In Leidenschaften und Interessen, Hirschmans Lieblingsbuch, das ihn zum »Klassiker zu Lebzeiten« machte, geht er Montesquieus Idee des »doux commerce« nach: wie es zu der Vorstellung kam, dass Handel sanft, zivilisiert, friedfertig mache. Elegant verfolgt er, wie aus der »unheiligen Trinität« Ehrsucht, Herrschsucht und Habsucht, die er aus den drei Geißeln der Menschheit Krieg, Hungersnot und Pest herleitet, der Konflikt zwischen Leidenschaft, Vernunft und Interessen konstruiert wird. Es ist die gleiche Bewegung, die wir schon kennengelernt haben von einer Triade bzw. einer »ménage à trois« zu einem Oppositionspaar bzw. einer Dichotomie: Leidenschaften und Interessen. Ehrsucht und Herrschsucht sind jetzt »Leidenschaften«, während unter »Interessen« materielle Interessen verstanden werden, die zum Gelderwerb verharmloste Habsucht.
Die Idee, dass nur Leidenschaften Leidenschaften in Schach halten können, hat sich wohl spätestens im Neoliberalismus als irrig erwiesen: Der Neoliberalismus ist nichts als die Affirmation, dass auch Gelderwerb eine Leidenschaft ist! Während es Hirschman darum ging, eine alternative Geschichte zu Max Webers Geist des Kapitalismus zu erzählen, in der eine Gegenelite eine neue Ideologie einführt, kann er uns heute dabei helfen, den »neuen Geist des Kapitalismus« (Boltanski/Chiapello) besser zu kritisieren, der davon ausgeht, dass die »Künstlerkritik« am Kapitalismus die »Sozialkritik« ausgehebelt hat. Hat doch die »Künstlerkritik« – im Sinne Marcuses – das Eindimensionale, Entfremdende am Kapitalismus kritisiert zugunsten der Vorstellung einer freieren Entfaltung der Persönlichkeit. Das hat Hirschman schon damals gewundert, war es doch das Versprechen des Kapitalismus, eine einförmigere Persönlichkeit zu produzieren – den harmlosen Händler als Alternative zum willkürlichen Herrscher oder aristokratischen Helden. Was es jedoch nach wie vor zu entwickeln gilt, ist, was Hirschman im Gegensatz zur »autoritären Persönlichkeit« der Frankfurter Schule die »demokratische Persönlichkeit« nannte. Sie wird sich, ähnlich wie Hirschman, nicht aufs Rechthaben versteifen, sondern an einer Fortsetzung des Gesprächs interessiert sein. Und so endet Hirschmans klassischer Text: Er will keine Streitfragen entscheiden, sondern das Niveau der Auseinandersetzung heben. Oder wie er im Anschluss an Albert Camus schreibt: »Man stelle sich Sisyphus vor, wie er selber den Felsbrocken hinabstößt.«
Anti-TinA
Nach Jahrzehnten des neoliberalen Triumphes stellt sich angesichts der drohenden Klimakatastrophe die Frage, ob Hirschmans Denken uns eine Alternative anbieten kann zur Welt der Alternativlosigkeit, bekannt als TinA (There is no alternative!). Für Hirschman galt stets: Es gibt immer Möglichkeiten! Man muss sie nur im richtigen Moment am Schopf packen – statt sie in der Rückschau als vertane Chancen zu bedauern. Haben die Menschen doch die hartnäckige Angewohnheit, Fortschritte nicht wahrzunehmen, während sie sich ereignen. Stattdessen erklären sie rückwirkend Zeitabschnitte zur »glorreichen Zeit« wie z.B. 1979 die drei Nachkriegsjahrzehnte, während andere Kräfte die Gelegenheit ergreifen, die Gesellschaft in ihrem Sinne zu transformieren. Hirschman selbst hatte kein Interesse daran, im Nachhinein recht zu behalten. Lieber korrigierte er aufgrund neuer Entwicklungen sein eigenes Denken. Er nannte das seinen »Hang zur Selbstsubversion«. Ein besonders eindrückliches Beispiel liefert die Erweiterung seiner Gedanken von Exit, Voice, and Loyalty im Zusammenhang mit der Entwicklung in Deutschland.
Ein Hang zur Selbstsubversion
1974 ist das Jahr, in dem Hirschman zum ersten Mal nach mehr als vier Jahrzehnten wieder Deutschland besucht. Ab Ende der 1970er Jahre werden seine Aufenthalte zahlreicher, bis er schließlich 1990/91 regelmäßig in Deutschland weilt, besonders nachdem er dank Wolf Lepenies Fellow am Berliner Wissenschaftskolleg geworden ist. Den Fall der Mauer nimmt er mit hellwachem Interesse zur Kenntnis, auch weil sein Buch Exit, Voice, and Loyalty von verschiedenen Seiten zur Erklärung der Friedlichen Revolution herangezogen wird. Die Frage war: Bestätigte der Mauerfall Hirschmans Konzept oder wurde es durch die Geschehnisse widerlegt? Hatte Hirschman die Strategien von Exit und Voice nicht zu sehr als Gegensätze konstruiert? In der Regel schwäche die Exit-Option die Möglichkeiten für Voice; um sich Gehör zu verschaffen, müsse man bleiben. Überraschend für alle Beobachter ist jedoch, dass die Bürger:innen der DDR gerade dadurch Veränderungen in Gang setzen konnten, dass viele nicht blieben, sondern in großer Zahl das Land verließen: eine »Abstimmung mit den Füßen«. Das ist eine historisch neue Erfahrung, hat man sich doch bislang in Ost und West darauf verlassen können, dass Abwanderung den Druck verringere (»Geh doch nach drüben!« – westdeutsche Variante des berüchtigten »Love it or leave it!«).
Hirschman stellt die eigenen Gedankengänge auf den Prüfstand: Er besorgt sich aktuelle Literatur, darunter Neuerscheinungen des im Dezember 1989 gegründeten Christoph Links Verlages. In seinem Text »Abwanderung, Widerspruch und das Schicksal der Deutschen Demokratischen Republik«, der zuerst in der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift Leviathan erscheint, untersucht er, inwiefern seine Theorie von der Praxis widerlegt wurde bzw. welche Modifikationen erforderlich geworden sind. Hatte er das Verhältnis von Exit und Voice zu sehr als »or« (oder) und zu wenig als »and« (und) gedacht? Die deutsche Übersetzung »Abwanderung und Widerspruch« hat in diesem Punkt recht behalten, ist es doch ein Kennzeichen von Hirschmans Denkens, dass er Gegensätze wie Engagement und Enttäuschung oder Leidenschaften und Interessen beim shifting, dem Gleiten, Ineinander-Übergehen oder Zusammenfließen, beobachtet, anstatt sie als starre Gegensätze zu fixieren – eine »gegenseitige Kontamination« oder Kreuzbefruchtung (cross-fertilization), wie Michele Alacevich in seinem Buch Albert O. Hirschman. An Intellectual Biography schreibt. Oder ein »endogener Prozess«, wie Hirschman selbst es nannte. Das Besondere an der Situation im Herbst 1989 ist, dass Voice durch Exit nicht geschwächt, sondern sogar verstärkt wurde. Wie im »Sommer der Migration« 2015 ist die massenhafte Entscheidung zum Exit nicht länger privat, sondern gewinnt eine nicht zu verleugnende politische Dimension. Die Provokation des Massenexodus von DDR-Bürger:innen bestand darin, dass die Ausreisenden gar keine Forderungen erhoben, aber durch ihr Fortgehen den Menschen vor Ort halfen, ein gemeinsames Fortkommen zu fordern – »a blessing in disguise«. Um sich die Ungeheuerlichkeit dieser Vorgänge zu vergegenwärtigen, hilft es, sich an die weltweiten Proteste von 2011/12 zu erinnern, besonders an Occupy Wall Street in New York. Auch die Proteste im Zucotti-Park zeichneten sich dadurch aus, dass sie keinerlei Forderung stellten. Gerade dadurch wurden sie umso hörbarer, da nun die Öffentlichkeit über die Beweggründe zu spekulieren begann. Durch neue Entwicklungen widerlegt zu werden, dürfte in Hirschman ein Gefühl der Bestätigung ausgelöst haben, hat er doch immer betont, dass die Sozialwissenschaften keine ewigen Gesetze zu verkünden haben, sondern nur Momentaufnahmen liefern. Ein weiteres Mal wurde Hamlet widerlegt: Um zu handeln, braucht es keine Weltanschauung! Was es jedoch braucht, ist eine »propensity for self-subversion« – eine Neigung, sich selbst zu untergraben, bzw. einen Hang, sich selbst zu befragen, wie man Hirschmans Formulierung etwas verharmlosend ins Deutsche übertragen hat.
Sozio-Autobiographie
Selbstbefragung und Erkenntnis lautet der Titel einer Sammlung von Texten, die Hirschman anstelle einer Autobiographie vorgelegt hat. Erinnerungen aufzuschreiben sei etwas für Leute, die keine Gedanken mehr haben, spottete er. Dabei habe er, wie Wolf Lepenies in seinen Erinnerungen an Hirschman sagte, die auf dem Blog Soziopolis erschienen sind, als Erster eine Frühform der Sozio-Autobiographie vorgelegt, die heute als hybrides Genre so beliebt ist (Annie Ernaux, Didier Eribon, Édouard Louis usw.). Eine alternative, altväterlich klingende Bezeichnung wäre »Bildungsroman« – ein Wort, das Hirschman in Bezug auf seine sozialwissenschaftlichen Arbeiten selbst verwendet hat. Auch sein eigenes Leben lässt sich treffender kaum beschreiben. Und zwar im buchstäblichen Sinne, ist es ihm doch nicht nur gelungen, als Widerstandskämpfer auf der Flucht zu studieren, zu promovieren und ein Buch zu publizieren, sondern auch später als Außenseiter seiner Zunft zu einem der berühmtesten Sozialwissenschaftler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu werden, der Ehrendoktorwürden einsammelte wie andere Bonuspunkte, mit zahlreichen Persönlichkeiten befreundet war, darunter der spätere Präsident von Brasilien Fernando Henrique Cardoso und der Schriftsteller Octavio Paz. Heute ist nach ihm der wichtigste Preis des Social Science Research Council benannt (unter den Preisträger:innen der weltbekannte Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen, Witwer von Hirschmans Nichte Eva Colorni) und ein Fellowship-Programm des Instituts für die Wissenschaft des Menschen in Wien, an dem Chantal Mouffe, Seyla Benhabib, Richard Sennett u.a. teilgenommen haben. Es ist jedoch weniger Hirschmans Beitrag zur Öffnung der Sozialwissenschaften, die die vorliegende Neuveröffentlichung bewogen hat, als seine immense Ausstrahlung, die weit über den wissenschaftlichen Bereich hinausgeht und sowohl im politischen Aktivismus als auch im Feld von Kunst und Kultur (auch Populärkultur) zu finden ist.
Eigenleben
Hirschman selbst ist immer wieder zu Exit, Voice, and Loyalty zurückgekehrt: In Rival Views of Market Societies (1986) versucht er, die Anwendungsfelder seiner Trias noch einmal abzustecken – von Gewerkschaften über politische Parteien, öffentliche Dienstleistungen, Märkte und Hierarchien bis zu Ehescheidung und Adoleszenz. Der Aufsatz endet mit den Worten, damit seien die »Grenzen seines Anwendungsbereiches« erreicht. Das ist ein frommer Wunsch geblieben, ist seinen Stichworten im Diskurs doch das Gleiche widerfahren, was er im gesellschaftlichen Leben selbst oft beobachten konnte: Der Text löst sich vom Autor bzw. der Titel vom Text und beginnt ein Eigenleben. Um ein Beispiel aus der Populärkultur zu bemühen: Durch die Brille von Exit, Voice und Loyalty lässt sich auch die 2024 zum ersten Mal auf Netflix ausgestrahlte Science-Fiction-Serie 3 Body Problem betrachten, die auf der Romantrilogie des chinesischen Autors Cixin Liu beruht. Im ersten Band Die drei Sonnen versucht ein Computerspiel, die außerirdische Zivilisation, mit der die Protagonistin Kontakt aufgenommen hat, der irdischen Menschheit ihre Welt näherzubringen und sie zugleich für ihre Eroberungspläne zu rekrutieren. An jene, die sich nicht weiter verstricken wollen, ergeht folgende Weisung: »Alle, die aufhören wollen, klicken bitte ›Exit‹. Das Spiel ist an einem Punkt angelangt, wo es keinen Spaß mehr macht.« (Wie sich bald herausstellen wird, ist es kein »Spiel«, sondern ein Initiationsritus für eine Art Sekte.) Später heißt es zur Begründung, warum auch das revolutionäre China Botschaften ins All schicken sollte: »Andere haben bereits Nachrichten in den Weltraum gesendet. Es wäre gefährlich, wenn Außerirdische nur ihre Stimmen hören würden. Wir sollten unsere Stimmen ebenfalls erheben. Nur dann entsteht ein vollständiges Bild der menschlichen Gesellschaft. Die Wahrheit wird verloren gehen, wenn nur eine Seite Gehör findet.« Diejenigen, die sich zu Komplizen der geplanten Alieninvasion machen, werden als »Feinde der Menschheit« bekämpft. Die Frage der Loyalität wird dem größtmöglichen Stresstest unterworfen.
No Exit
So bizarr diese Sci-Fi-Welt erscheinen mag, hat sie doch einen gewissen Bezug zur Gegenwart. Dabei geht es weniger um eine Bedrohung durch Außerirdische als um das Begehren einiger Irdischer, die Erde zu verlassen und fremde Planeten zu besiedeln. Mit Bruno Latour kann man sie nur als »Erdflüchter« bezeichnen. Seyla Benhabib hat im Vorwort zu ihrem Buch Kosmopolitismus im Wandel. Zwischen Demos, Kosmos und Globus, das in ihrer Zeit als Albert-O.-Hirschman-Fellow in Wien entstand, dessen Art, Weltbürger zu sein, gepriesen und gegen das Beispiel eines Elon Musk, den Gründer von SpaceX und Hauptpropagandisten einer Marskolonisation, in Stellung gebracht. Tatsächlich sind es Hirschmans frühe Ideen zu einer geteilten, einer »Co-Souveränität«, die Benhabib inspirieren, den Kosmopolitismus neu zu denken und auszuweiten: nicht nur auf andere Weltregionen, sondern auch auf andere Lebensformen. Dabei sind Musks Pläne, den Mars zu kolonisieren nur der extremste Ausdruck eines Great Escape Game, das in Anbetracht des drohenden Kollaps des Klimasystems der restlichen Menschheit die Solidarität aufkündigt. Doch »der Notausgang ist verrammelt«, wie Latour in Dasterrestrische Manifest unmissverständlich feststellt: There is no exit from Planet Earth!
Es sind solche Fluchtphantasien aus einer ausweglosen Situation, die zu der ambivalenten Faszination für Hirschmans Exit-Konzeption führen. Wie ist es sonst zu erklären, dass Exit, Voice, and Loyalty heute sowohl für libertäre Rechte als auch für radikale Linke von Interesse ist? Um nur zwei Beispiele zu nennen: Als Beispiel für den »Crack Capitalism« bezieht sich Quinn Slobodian in seinem Buch Kapitalismus ohne Demokratie. Wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen zentral auf das Konzept der Charter City von Milton Friedmans Neffen Pattie – und zitiert als Referenz Exit, Voice, and Loyalty. Dabei geht es um Pläne für Enklaven, die der nationalstaatlichen Souveränität entzogen sind. Auffällig ist, dass die Exit-Option längst nicht nur fester Bestandteil des Finanzkapitalismus, sondern auch neoliberaler Alltagssprache ist. Exit ist nicht länger der Ausstieg aus einem Spiel oder krimineller Machenschaft, sondern Teil des Spiels; kein Austritt wie aus einer Kirche oder der Ausschluss aus einer Partei, sondern eine weitere Chance.
Zugleich bezieht sich der italienische Post-Operaist Paolo Virno bei seiner Beschreibung der »Autonomie der Multitude« ebenfalls auf Exit, Voice, and Loyalty. Die Abwendung seiner Generation von den traditionellen Institutionen der Linken wie Gewerkschaften oder Parteien wird als Mischung aus Desertion und »Exodus« beschrieben. Seit der Jahrtausendwende erproben Vertreter:innen der Generationen X bis Z die Flucht aus den Bullshit Jobs (David Graeber) als digitale Boheme: »intelligentes Leben jenseits der Festanstellung« (Holm Friebe/Sascha Lobo). Ohne selektive Lektüre von Hirschmans Text ist die einseitige Parteinahme für Exit jedoch kaum möglich. Doch auch Voice kann kooptiert werden: So ist es den Big-Tech-Konzernen gelungen, durch die Etablierung einer Feedback-Kultur die Kritik von Konsument:innen für sich produktiv zu machen, sie zu neutralisieren und zugleich Daten abzugreifen. Entwicklungen wie diese machen Hirschmans Text umso aktueller: Nie zuvor war Exit





























