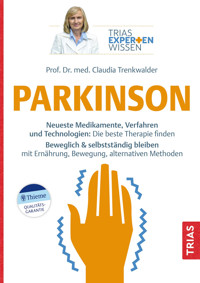
Expertenwissen: Parkinson E-Book
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TRIAS
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: TRIAS EXPERTENWISSEN
- Sprache: Deutsch
Neue Chancen für Parkinson-Patienten
In den letzten Jahren haben sich die Therapien von Parkinson enorm weiterentwickelt. Prof. Claudia Trenkwalder stellt Ihnen diese vor. Als eine der führenden Parkinson-Expertinnen in Deutschland ist sie ganz nah dran an den Betroffenen. Sie und ihr renommiertes Team erklären diese komplexe Erkrankung und zeigen die neuesten Forschungsergebnisse und Therapiemöglichkeiten auf – von altbewährt bis hochmodern.
- Medikamentöse Therapie: Wie L-DOPA-Präparate, Dopamin-Agonisten, MAO-B-Hemmer und andere Medikamente wirken und ideal gemäß den Leitlinien der Deutschen Neurologie (DGN) kombiniert werden, um Ihre Beweglichkeit zu unterstützen. Extra: Alles zu den aktuellen Medikamenten-Pumpen
- Tiefe Hirnstimulation: Für wen eignet sie sich und wann ist der richtige Zeitpunkt dafür?
- Selbst aktiv werden: Wie eine gezielte Ernährung, Bewegung und Entspannung die innere Balance verbessern und die Therapie verstärken.
- Moderne Technik: Nutzen oder auch nicht – das große Potenzial von Sensorsystemen, Wearables und Gesundheits-Apps einfach erklärt.
- Glücksfaktor Selbstständigkeit: Innovative Modelle der Alltagsbewältigung auch für fortgeschritten Erkrankte.
- Was bringt die Zukunft? Perspektiven in der Parkinson-Behandlung.
Bleiben Sie beweglich und aktiv – auch mit Parkinson
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Expertenwissen Parkinson
Neueste Medikamente, Verfahren und Technologien: Die beste Therapie finden. Beweglich & selbstständig bleiben mit Ernährung, Bewegung, alternativen Methoden
Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder
1. Auflage 2025
50 Abbildungen
Einleitung
Claudia Trenkwalder
Obwohl bereits im Jahre 1817 die Symptome und Beschwerden einer Parkinson-Krankheit detailliert vom Londoner Arzt James Parkinson beschrieben worden sind, hat sich doch vieles über unser Wissen zur Parkinson-Krankheit in den letzten 10 bis 20 Jahren verändert.
Die Parkinson-Krankheit ist nicht selten, sondern tritt gerade auch bei älteren Menschen auf, häufig ab dem Alter von 60–65 Jahren. Sie kann aber bereits auch bei jüngeren Menschen zwischen 30 und 50 Jahren beginnen. In Deutschland sind über 400.000 Menschen von der Parkinson-Krankheit betroffen. Die Prävalenz der Erkrankung, also die Krankheitshäufigkeit, beträgt bei den über 70-Jährigen 1:200. Das Lebenszeit-Risiko, an Parkinson zu erkranken, liegt für Männer bei 2,0% und für Frauen bei 1,3%.
Diskussionen gibt es derzeit über die sogenannte Inzidenz, d.h., wie viele Neuerkrankungen pro Jahr hinzukommen: Hier zeigten einige Statistiken seit 2015 einen rückläufigen Wert für Deutschland; die methodische Erfassung dieser Daten ist jedoch komplex, und es könnte sich hier auch laut Deutsche Parkinson Gesellschaft (DPG) um Probleme der Erfassung handeln. Möglicherweise bieten aber eine bessere und frühere Behandlung von Bluthochdruck und der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) sowie der Schutz vor toxischen Substanzen in verschiedenen Berufen eine Vorbeugung (Prophylaxe), die sich in diesen Zahlen widerspiegelt. Ähnliche Phänomene hat man in England bezüglich der Entwicklung der Alzheimer-Demenzen beobachtet.
Die Parkinson-Krankheit ist behandelbar, d.h., die Symptome der Erkrankung können gelindert werden. Die Erkrankungsursachen und ihr Verlauf können bisher jedoch nicht beeinflusst werden. Obwohl die Forschung in den letzten 20 Jahren zahlreiche neue Erkenntnisse über den Verlauf der Erkrankung und pathophysiologische, also krankheitsverursachende Zusammenhänge gewonnen hat, ist es bisher noch nicht gelungen, ein Medikament zu entwickeln, das im Verlauf der Parkinson-Krankheit eine Veränderung bewirkt. Die ▶ derzeitigen Medikamente, insbesondere die dopaminhaltigen Präparate, führen vor allem zu einer Verbesserung der Beweglichkeit, teilweise auch der Stimmung und anderer Bereiche. Viele Beschwerden, die durch Parkinson hervorgerufen werden, sind aber leider noch ausgeklammert: So können die Standstabilität und Stürze sowie die Haltungsstörungen und eine mögliche Demenz nicht ausreichend behandelt werden.
▶ Im Kapitel „Blick in die Zukunft“ werden jedoch die derzeitigen Entwicklungen zu nervenschützenden (neuroprotektiven) Therapien, die den Verlauf günstig beeinflussen können, erörtert.
Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung
Die Parkinson-Krankheit gehört zu den neurodegenerativen Erkrankungen. Dies bedeutet, dass durch einen noch unbekannten Auslöser und bedingt durch ein Zusammenspiel von vererblichen und anderen Faktoren, es zwar langsam, aber doch stetig zu einem vorzeitigen Verlust von spezifischen Nervenzellen im Gehirn kommt. Das Fehlen dieser spezifischen Nervenzellen führt zu den Beschwerden der Erkrankung. Möglicherweise geht dieser Prozess von Stoffwechselvorgängen im Darm aus und wandert dann nach „oben“ ins Gehirn. Möglich ist aber auch der umgekehrte Weg, dass über die Riechschleimhaut der Nase die Erkrankung ins Gehirn wandert und startet. Es werden Nervenzellen befallen, die den Nervenüberträgerstoff (Neurotransmitter) Dopamin, der für jeden Menschen lebenswichtig ist, produzieren.
Dieser Prozess beginnt sehr langsam und in den letzten Jahren hat man viele Erkenntnisse zu den ▶ Frühsymptomen der Erkrankung gewonnen, bevor die Diagnose einer Parkinson-Krankheit mit dem Vollbild der Beschwerden gestellt wird. Diese Diagnose ist weiterhin vor allem an den Bewegungseinschränkungen orientiert und beinhaltet die Unbeweglichkeit (Akinese, Bradykinese), Steifigkeit (Rigor) und das Zittern (Tremor), das aber nicht bei jedem Menschen mit Parkinson vorhanden sein muss. Hinzu kommt im Verlauf eine Verminderung der Standstabilität, und es sollte eine Verbesserung der Symptome durch die Gabe eines dopaminhaltigen Medikamentes dokumentiert sein. Viele weitere Beschwerden können bereits sehr früh oder im Verlauf auftreten.
Abzugrenzen von der Parkinson-Krankheit sind die ▶ atypischen Parkinson-Syndrome. Das sind Erkrankungen, die teilweise gemeinsame Symptome aufzeigen, aber sich doch bei genauerer Analyse und vor allem im Verlauf deutlich unterscheiden und deshalb auch kurz in einem ▶ eigenen Kapitel beschrieben werden.
Männer sind häufiger von Parkinson betroffen als Frauen
Die geringere Häufigkeit (Prävalenz) der Parkinson-Krankheit bei Frauen ist noch nicht ganz geklärt. Sie könnte aber teilweise durch geschlechtsspezifische Unterschiede in den Verschaltungen bestimmter Regelkreise im Gehirn (nigrostriatale Schaltkreise) und mögliche neuroprotektive Wirkungen von Östrogen erklärt werden. Die motorischen und nicht-motorischen Symptome der Parkinson-Krankheit unterscheiden sich zwischen den Geschlechtern. Weiterhin erfahren Frauen Ungleichheiten in der Versorgung, einschließlich einer Unterbehandlung mit der Tiefen Hirnstimulation und einem geringeren Zugang zu Pflegeleistungen.
Eine kürzlich erschienene große Metaanalyse legt jedoch nahe, dass der Unterschied der Häufigkeit zwischen Männern und Frauen bei Parkinson niedriger ist als früher berichtet. Der geringste Unterschied in der Häufigkeit der Parkinson-Krankheit zwischen Männern und Frauen wurde in Studien aus Asien festgestellt. Diese Ergebnisse könnten das Paradigma, dass die Parkinson-Krankheit eine „männlich“ dominierte Erkrankung ist, zumindest in einigen Regionen ins Wanken bringen.
Es gab kaum Anhaltspunkte dafür, dass das Alter Unterschiede im Geschlechterverhältnis erklären könnte. Frühere Studien haben gezeigt, dass das Verhältnis bei Patienten mit einem jüngeren Alter bei Krankheitsbeginn näher bei einer Gleichverteilung liegt. Entsprechende ▶ genetische Studien konnten bisher keine unterschiedlichen genetischen Risikofaktoren für die Parkinson-Krankheit zwischen den Geschlechtern identifizieren. In vielen dieser Studien waren Teilnehmer*innen europäischer Abstammung überrepräsentiert und die Einschlussrate von Frauen war jedoch niedriger. Eine weitere mögliche Erklärung liegt in den Umweltfaktoren. Landwirtschaftliche Berufe, bei denen mit toxischen Substanzen wie Insektiziden und Pestiziden gearbeitet wird, werden überwiegend von Männern ausgeübt, was die höhere Prävalenz der Parkinson-Krankheit bei Männern erklären könnte. Die zunehmende Verstädterung und der abnehmende Einsatz von bestimmten Insektiziden (Organophosphaten), die auch das menschliche Nervensystem schädigen, in einigen Regionen könnten die Variabilität der Häufigkeiten zwischen den Kontinenten erklären. Andere mögliche Risiko- bzw. Schutzfaktoren, einschließlich der mediterranen Ernährung, Typ-2-Diabetes, Rauchen und Alkoholkonsum, könnten ebenso zur überwiegenden Häufigkeit von Parkinson bei Männern beitragen.
Weiterhin bestehen Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung von Männern und Frauen, je nach Gesundheitssystem. Auch diese beobachteten Unterschiede könnten zur unterschiedlichen Prävalenz von Parkinson bei Männern und Frauen beitragen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beziehung zwischen Krankheitsprävalenz, Inzidenz und Überleben. Frauen haben eine höhere Lebenserwartung und eine geringere Inzidenz von Parkinson-Krankheit. Die Lebenserwartungs-Lücke zwischen Männern und Frauen hat sich im Laufe der Zeit verändert, und dies könnte teilweise erklären, warum die Prävalenz-Unterschiede ebenfalls geringer geworden sind. Die jüngste Verringerung des Lebenserwartung-Gefälles könnte mit Umwelteinflüssen zusammenhängen, wie z. B. dem Anstieg der Raucherquote bei Frauen oder der zunehmenden Integration von Frauen in Berufe, die traditionell von Männern ausgeübt werden.
Warum bei Männern häufiger eine Tiefe Hirnstimulation erfolgt: Eine kürzlich publizierte Studie aus den USA zeigte auffällige geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Häufigkeit der Anwendung der Neuromodulation bei Parkinson und dem essenziellen Tremor. Solche Ergebnisse gewinnen zunehmend an Bedeutung, da neuere Forschungen darauf hindeuten, dass es keine langfristigen Unterschiede im Ergebnis zwischen Männern und Frauen bei der ▶ Tiefen Hirnstimulation (THS) bei der Parkinson-Krankheit gibt. Eine weitere Studie und Literaturübersicht der University of Virginia hat ergeben, dass bei Parkinson-Patienten Männer häufiger als Frauen eine THS zur Behandlung von medikamentenresistenten Tremorsymptomen, motorischen Fluktuationen und Dyskinesien erhalten. Insgesamt ist die THS zwar für Männer und Frauen gleichermaßen wirksam, doch erhalten Frauen diese Behandlung deutlich seltener. Dieser Unterschied ist nicht allein durch die unterschiedliche Prävalenz der Erkrankung zu erklären.
Es wurde deshalb in einer Datenbank der Universität Miami, die über 3000 Parkinson-Patienten umfasste, die Anzahl der Patienten, die zur Operation überwiesen worden waren, untersucht, einschließlich aller Gründe für die Überweisung und warum ein Patient oder eine Patientin nicht operiert bzw. operiert wurde. Bei den Männern, die nicht operiert wurden, waren die häufigsten Gründe medizinische, bei den Frauen war jedoch einer der häufigsten Gründe die Patientenpräferenz (Bevorzugung des Patienten/der Patientin) und dieser Unterschied war im Vergleich zu Männern statistisch signifikant. Bei den postoperativen Ergebnissen gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied.
Schlussfolgerungen: Trotz ähnlicher postoperativer Verbesserungen unterzogen sich Frauen aufgrund ihrer eigenen Präferenz seltener einer THS-Operation, während bei Männern die Wahrscheinlichkeit höher war, dass sie die Nachuntersuchung nicht durchführten. Diese Daten aus den USA unterstreichen eigene Beobachtungen aus Deutschland, wobei Frauen seltener eine THS erhalten, möglicherweise auch seltener auf die Möglichkeit hingewiesen werden, da ein abwehrendes Verhalten vielen Expert*innen bekannt ist. Diese Daten unterstreichen die Notwendigkeit einer verstärkten Aufklärung und Sensibilisierung für die THS bei Frauen, damit alle Patientinnen und Patienten mit Parkinson, die für eine Operation infrage kommen, sich gut informiert entscheiden und von diesem Verfahren profitieren können.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Einleitung
Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung
Männer sind häufiger von Parkinson betroffen als Frauen
Parkinson: die Erkrankung verstehen
Welche Symptome treten wann auf? Was gehört zur Diagnostik?
Wichtige Abgrenzungen
Die Diagnose wird anhand der motorischen Symptome gestellt
Die nicht-motorischen Symptome treten meist schon viel früher auf
Riechstörungen sind ein Frühsymptom
Schlafprobleme und Traumschlaf-Verhaltensstörungen
Untersuchungen im Schlaflabor
Störungen des autonomen Nervensystems
Verdauungsstörungen
Regulation des Blutdrucks
Blasenprobleme und Erektionsfähigkeit
Schwitzen und Schweißsekretion
Fettige Haut und Schuppenbildung (Seborrhö)
Schmerzen
Schmerzgruppe 1: nozizeptiver Schmerz
Schmerzgruppe 2: neuropathischer Schmerz
Schmerzgruppe 3: noziplastische Schmerzen
Spezifisch Parkinson-verursachte Schmerzen
Symptome der Psyche
Viele Parkinson-Kranke leiden an Depressionen
Halluzinationen sind meist medikamentös bedingt
Denk- und Gedächtnisstörungen
Parkinson-Demenz
Sehstörungen sind sehr häufig bei Parkinson
Spezifische oder häufiger vorkommende Sehstörungen bei Parkinson
Diagnose der Parkinson-Krankheit
Wie sich die motorischen Symptome im Einzelnen zeigen
Verlangsamung der Bewegungsabläufe (Bradykinese oder Akinese)
Muskelsteifigkeit (Rigor)
Zittern (Tremor)
Gang- und Haltungsstörungen (posturale Störungen)
Was gehört zur modernen Parkinson-Diagnostik?
Bildgebung: Computertomografie (CT), Kernspintomografie (MRT)
Hirnparenchymsonografie (Ultraschall)
Dopamintransporter-Szintigrafie (DAT-Scan)
Positronenemissionstomografie (PET)
L-Dopa-Test, Apomorphin-Test
Nervenwasseruntersuchungen (Liquorpunktion)
Welche Rolle spielen die Gene?
Hinweise aus dem Stammbaum
Genetische Syndrome: Vererbungsmodus
Autosomal-dominante genetische Parkinson-Syndrome
Autosomal-rezessive genetische Parkinson-Syndrome
GBA – ein genetischer Risikofaktor
Für wen ist eine genetische Testung sinnvoll?
Welche Empfehlungen geben die DGN-Leitlinien?
Welche Faktoren beeinflussen das Erkrankungsrisiko?
Wie lassen sich die unterschiedlichen Parkinson-Syndrome abgrenzen?
Typische Merkmale der klassischen Parkinson-Krankheit
Wie sich eine Multisystematrophie (MSA) zeigt
Eine progressive supranukleäre Blickparese (PSP) ist eher selten
Die kortikobasale Degeneration ist sehr vielgestaltig
Vaskuläres Parkinson-Syndrom
Parkinson: die Behandlung
Es gibt gut wirksame Medikamente
Wem sollte die Diagnose mitgeteilt werden?
Wann sollte die medikamentöse Therapie beginnen?
Medikamentöse Therapie: leitliniengerecht und individuell
Überprüfung und Anpassung im Verlauf
Was empfehlen die DGN-Leitlinien?
Welche Substanzen stehen zur Verfügung?
L-Dopa-/Levodopa-Präparate
Dopaminagonisten
MAO-B-Hemmer
Welche Medikamente werden für die Frühphase empfohlen?
Im Verlauf sind weitere Substanzen zur Kombinationstherapie möglich
COMT-Hemmer
Anticholinergika
Wann kann eine Medikamenten-Pumpe sinnvoll sein?
Subkutane Apomorphin-Pumpe
Levodopa-Carbidopa-Gel (LCIG)
Levodopa-Entacapon-Carbidopa-Gel (LECIG)
Foslevodopa-Foscarbidopa-Infusion (CSFLI)
Wann sollte auf eine gerätegestützte Therapie gewechselt werden?
Warum im Verlauf Wirkfluktuationen auftreten können
Wie lassen sich Wirkfluktuationen vermindern?
Kombinationstherapien
Behandlung von Überbewegungen (Dyskinesien)
Was Sie über die Tiefe Hirnstimulation wissen sollten
Wie funktioniert die THS?
Was gehört zum Hirnschrittmacher dazu?
Wann kommt eine THS infrage? Und wann (eher) nicht?
Wie verläuft die THS-Operation?
Die Einstellung des Hirnschrittmachers nach der OP
Nachsorge
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Unverzichtbar: Bewegungs-, Sprech- und Entspannungstherapien
Die Motivationsbremse überwinden
Ausdauertraining und alltagsnahe Aktivitäten
Sicheres Radfahren
Parkinson-Ausdauertraining
Ausdauersport wirkt dem Abbau motorischer und kognitiver Funktionen entgegen
Besondere Sporttherapien
Therapeutisches Reiten
Boxen
Kickboxen
Karate
Therapeutisches Bogenschießen
Tischtennis: sehr positiv bei Parkinson
Nerven- und muskelstimulierendes (sanftes) Ganzkörpertraining
Thai-Chi und Krafttraining: eine gute Kombination
Mit Gyrokinesis die Körpermitte stärken
PNF
Pilates bei Parkinson
Aktivierende Therapien
BIG-Training wirkt der Bewegungsverkleinerung entgegen
Ergotherapie
Krankengymnastik „ZNS“
Rolfing – ganzheitliche Faszientherapie
Kraniosakrale Therapie
Trager-Methode: sanftes Schütteln
Parkinson-spezifische Sprech- und Atemtherapien
Evidenzbasiert: das LSVT-Konzept LOUD
Atemtherapie als zusätzliche Hilfe
Zilgrei-Methode
Sprech- und Atemtherapie kombinieren: das Beispiel Schlaffhorst-Andersen
Gestaltende Therapien: Freude am eigenen Ausdruck haben
Tanzen – vielfältige Angebote speziell für Parkinson
Tango ist besonders fordernd und fördernd bei Parkinson
Heilsames Singen
Entspannung und innere Balance
Die Parkinson-Komplexbehandlung nutzen
Finden Sie für sich den optimalen Mix
Bewegungsübungen bei Parkinson
Anti-Freezing-Strategien
Dreh-Dehnen
Brückenbauer
Dehnung der Hüftmuskulatur
Dreh-Dehnen auf einem Stuhl
Mobilisation des Schultergürtels
Kräftigung der vorderen Oberschenkelmuskulatur
Üben der Gewichtsübernahme in Vorbereitung auf das Aufstehen
Wadendehnung im Stehen
Dehnung der Oberschenkelrückseite
Ausfallschritt zur Seite zur Kräftigung der Beinmuskulatur
Einbeinstand
Schwungübungen (Vorstufe zum Gehen)
Joggen auf der Stelle
Gehen mit Nordic-Walking-Stöcken
Digitale Medizin bei Parkinson
Der Klassiker: Die Telemedizin in der Patientenversorgung
Mit Tablet und Tablette
Neue Sensorsysteme zur Symptomerfassung im Alltag
Wearables – am Körper tragbare Mini-Computer
Ein kritischer Blick auf Gesundheits-Apps
Webplattform zur Verbesserung der Lebensqualität: ParkProReakt
Hilfsmittel von Fuß bis Kopf – digital, aber auch mal analog
„Intelligente Einlegesohlen“, die das Gangbild erfassen und bei Freezing vibrieren
Analog: der Anti-Freezing-Stock
Anti-Freezing-Stepper für den Rollator
Augmented Reality: neue Entwicklungen speziell für Parkinson
Parkinson-Gesundheitsspiele
Und nun? – Wer die Wahl hat
Parkinson: gut zu wissen
Alltag mit Parkinson
Kompetenznetz Parkinson
Die Parkinson-Nurse
Innovative Wohn-Modelle auch für fortgeschritten Erkrankte
Parkinson und Arbeitsleben
Negativbeispiele
Positivbeispiele
Hinaus in die Welt: Reisen mit Parkinson
Die Rolle der Ernährung
Kann man mit der Ernährung vorbeugen? Was ist in Frühstadien wichtig?
Coenzym Q10: bisher kein Nutzen für Parkinson nachweisbar
Probiotika, Präbiotika und Synbiotika helfen bei Stuhlgangsbeschwerden
Einen Mangel an Vitamin B12 und Folsäure unbedingt ausgleichen
Nikotin: Bisher ist kein wirksames Medikament in Sicht
Polyphenole: am besten in Form gesunder Ernährung
Kaffeegenuss scheint positiv zu sein
Ballaststoffe und resistente Stärke sind empfehlenswert
Die mediterrane Ernährung wirkt vorbeugend
Was man bisher zur mediterranen Ernährung bei bestehendem Parkinson weiß
Was in fortgeschrittenen Stadien beachtet werden sollte
Ist Fasten bei Parkinson möglich und hilfreich?
Rezeptideen zur mediterranen Ernährung
Blick in die Zukunft – neue Diagnoseansätze und Therapien
Biologische Diagnose Parkinson und Synukleinopathien
Wie sinnvoll ist eine frühe biologische Parkinson-Diagnose?
Wie ist der Stand bei Immuntherapien?
Studien zu Gentherapien
Spezifische Therapien für Parkinson-Kranke mit genetischen Mutationen
Studien zu einem Prüfpräparat bei LRRK2-Mutationen
Welche Fortschritte macht die Zelltransplantation?
Aktuelle Entwicklungen bei nicht-invasiven Hirnstimulationen
Transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS)
Transkranielle Magnetstimulation (TMS)
Transkranielle direkte Wechselstromstimulation (transcranial direct current stimulation, tDCS)
Magnetresonanztomografie-gesteuerter fokussierter Ultraschall (MRgFUS)
Prävention: der Parkinson-Krankheit vorbeugen
Was das Parkinson-Risiko erhöht und was es senkt
Umweltgifte erhöhen das Parkinson-Risiko
Mit Bewegung vorbeugen
Ausblick: gesund Altern – ein Projekt der Zukunft
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
Impressum
© vegefox.com/stock.adobe.com |





























