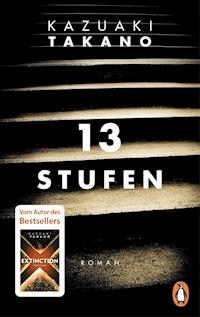5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jonathan Yeager wird im Auftrag der amerikanischen Regierung in den Kongo geschickt. Bei einem Pygmäenstamm sei ein tödliches Virus ausgebrochen. Die Verbreitung muss mit allen Mitteln verhindert werden. Doch im Dschungel erkennt Yeager, dass es um etwas ganz anderes geht: Ein kleiner Junge, der über unglaubliche Fähigkeiten und übermenschliche Intelligenz verfügt, ist das eigentliche Ziel der Operation. Kann es sein, dass dieses Geschöpf die Zukunft der Menschheit bedroht? Yeager weigert sich, das Kind zu töten. Er setzt alles daran, den Jungen in Sicherheit zu bringen. Eine gnadenlose Jagd auf die beiden beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Kazuaki Takano
EXTINCTION
Thriller
Deutsch von Rainer Schmidt
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Jenosaido« im Verlag Kadokawa Shoten, Tokio. Die deutsche Übersetzung folgt mit freundlicher Genehmigung der englischsprachigen Fassung (© 2014 by Philip Gabriel), die unter dem Titel »Genocide of One« im Verlag Mulholland Books/Little, Brown and Company, New York, erschien.
1. Auflage
Copyright © Kazuaki Takano, 2011
All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 beim Verlag C. Bertelsmann, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12596-7www.cbertelsmann.de
PROLOG
Diese Villa war nie ein Zuhause für ihn, auch wenn er schon jahrelang darin wohnte. Er schlief niemals gut hier; im besten Fall fiel er in einen leichten Schlaf, und das nicht nur, weil er älter wurde. Heute wurde Gregory S. Burns nach einer weiteren unruhigen Nacht von dem gewohnten Morgenanruf geweckt.
Er wechselte ein paar Worte mit der Telefonistin, blieb aber im Bett liegen und genoss die paar kostbaren Minuten seiner Gnadenfrist. Schließlich stand er aber doch widerwillig auf, reckte die Arme und gähnte ausgiebig. Er stellte sich unter die Dusche und ließ kühles Wasser laufen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Dann zog er den Anzug an, den seine Frau ihm herausgelegt hatte.
Im Esszimmer saßen seine Frau und die beiden Töchter bereits beim Frühstück. Die Töchter, eben erst aufgestanden und schlecht gelaunt, leierten eine Litanei von Beschwerden über die Schule herunter. Er hörte mit halbem Ohr zu und gab die entsprechenden Geräusche von sich, damit sie wussten, dass er sie nicht völlig ignorierte. Zum Glück unterließ seine Frau inzwischen ihre spitzen Bemerkungen, wenn er seine Familie vernachlässigte – ein kleines Zugeständnis, das er nach langen Kämpfen errungen hatte.
Seine Wohnung und sein Arbeitsplatz waren miteinander verbunden. Er brauchte nur in den Flur hinauszutreten und war in den öffentlichen Räumlichkeiten. Er hob den zwanzig Kilo schweren Aktenkoffer zu seinen Füßen auf und verließ das Zimmer. Wie der unheilvolle Spitzname des Koffers – Nuclear Football – schon andeutete, enthielt er den Auslöser, der die gesamte Menschheit vernichten konnte, die Einrichtung, die Burns brauchte, um einen Atomwaffenangriff auszulösen.
»Guten Morgen, Mr. President.«
Naval Commander Samuel Gibson kam ihm entgegen. Gibson besaß die höchste Sicherheitsfreigabestufe: Yankee White.
»Guten Morgen, Sam.«
Gibson nahm ihm den Aktenkoffer ab und kettete ihn mit einer Stahlmanschette an sein Handgelenk. Sie gingen die Treppe hinunter. Unten warteten Beamte des Secret Service, und zusammen gingen sie in den Westflügel. Unterwegs bekam Burns von einem NSA-Mitarbeiter eine kleine Plastikkarte mit der Codebezeichnung Biscuit. Auf der Karte stand eine Reihe von zufallsgenerierten Ziffern, die den für diesen Tag gültigen Schlüssel für den Auslöser der Atomraketen bildete. Die Eingabe dieser Zahlen in die Tastatur im Nuclear Football würde den Startbefehl authentifizieren. Burns schob die Karte in seine Brieftasche und die Brieftasche in die Innentasche seines Jacketts.
Auf den Rosengarten vor dem Oval Office schien die Sonne. Burns wartete, während sein Stab sich zur Tagesbesprechung versammelte. Nach der Sicherheitsüberprüfung kamen sie nacheinander herein: der Vizepräsident, der Stabschef des Weißen Hauses, der Nationale Sicherheitsberater, der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste und der Direktor der CIA.
Sie begrüßten einander und ließen sich auf den Sofas nieder. Burns sah, dass einer mehr als sonst da war, ein Mann mittleren Alters, der auf dem am weitesten entfernten Platz saß: Dr. Melvin Gardner, sein Berater für Wissenschaft und Technologie. Gardner saß vorgebeugt da, und ihm war sichtlich unbehaglich. Mit seinen freundlichen, intelligenten Augen, dem silbergrauen Haar und seiner zurückhaltenden, unauffälligen Erscheinung passte er nicht so recht zu einer Gruppe, die sich um den mächtigsten Mann der Welt versammelt hatte.
»Guten Morgen, Dr. Gardner«, sagte Burns leise.
»Guten Morgen, Mr. President.«
Als Gardner lächelte, entspannte sich die Atmosphäre kaum merklich. Unter allen Anwesenden hier besaß nur Gardner diese unschätzbare Eigenschaft – eine Aura der Harmlosigkeit, ja, Unschuld.
»Mr. Watkins hat mich gebeten, teilzunehmen«, erklärte Gardner.
Burns blickte zu Charles Watkins, den Direktor der Nationalen Nachrichtendienste.
»Wir brauchen Dr. Gardners Rat«, sagte Watkins.
Burns nickte, ohne sich seine Verärgerung anmerken zu lassen. Wenn Watkins Gardner in der Besprechung dabeihaben wollte, hätte er vorher um die Genehmigung bitten sollen. Der Posten des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste war neu eingerichtet worden, und Watkins hatte die Position erst seit Kurzem inne, aber schon jetzt gingen Burns seine ständigen Eigenmächtigkeiten auf die Nerven.
Nun, wir werden schon erfahren, warum Gardner dazugeholt wurde, dachte Burns und sammelte sich. In den letzten Jahren hatte er hart daran gearbeitet, seinen Jähzorn zu beherrschen.
»Sir, der tägliche Bericht der Nachrichtendienste«, sagte Watkins und nahm einen Stapel Papier aus einer Ledermappe. Es war ein zusammengefasster Bericht über die Aktivitäten der verschiedenen Dienste aus den letzten vierundzwanzig Stunden.
Die ersten beiden Punkte befassten sich mit den Kriegen, die Burns im Mittleren Osten führte. Weder im Irak noch in Afghanistan lief es gut. Die Sicherheitslage im Irak verschlechterte sich, in Afghanistan operierten nach wie vor verdeckte Terrorzellen, und die amerikanischen Verluste nahmen zu. Die Zahl der amerikanischen Kriegstoten und Burns Unbeliebtheit tendierten beide nach oben. Burns bereute inzwischen, dass er den Rat seines Verteidigungsministers befolgt und nur ein Fünftel der Bodentruppen eingesetzt hatte, die der Generalstabschef des Heeres gefordert hatte. Hunderttausend amerikanische Soldaten hatten genügt, um den Diktator zu stürzen und das kleine Land zu besetzen, aber der Aufgabe, die Ordnung wiederherzustellen, waren sie als Besatzungstruppe nicht gewachsen.
Der zweite Punkt behandelte einen Bericht, der noch beunruhigender war. Die CIA hatte den Verdacht, unter dem paramilitärischen Personal im Mittleren Osten gebe es einen Doppelagenten.
Robert Holland, der Direktor der CIA, bat um das Wort. »Wir haben es hier mit einer undichten Stelle zu tun, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Wenn unser Verdacht zutrifft, werden die Informationen nicht an ein feindliches Land weitergegeben, sondern an eine Menschenrechtsorganisation.«
»Eine NGO?«
»Richtig. Er gibt Informationen über unser Programm der außerordentlichen Überstellungen weiter.«
Burns hörte mit mürrischem Gesicht zu. »Holen wir den Rechtsberater dazu, bevor wir diese Sache weiter erörtern.«
»Sehr wohl«, sagte Holland.
Der nächste Punkt betraf den Staatschef eines Landes der Koalition, der an Depression erkrankt war und seinen Amtspflichten nicht mehr nachkommen konnte. Ein Führungswechsel sei nur noch eine Frage der Zeit. Dies werde aber keinen Einfluss auf die freundschaftlichen Beziehungen des Landes zu den Vereinigten Staaten haben.
Sie wandten sich den nächsten beiden Punkten zu. Burns hörte sich die Erläuterungen des Analysten an und kam dann zur letzten Seite. Sie trug die Überschrift: Potenzielle Ausrottung der Menschheit: Neue Lebensform in Afrika entdeckt.
Burns blickte von seiner Mappe auf. »Was ist das? Ein Hollywood-Drehbuch?«
Nur der Stabschef lächelte über den kleinen Scherz des Präsidenten. Die anderen schwiegen verwirrt. Burns schaute den Direktor der Nationalen Nachrichtendienste an. Watkins, älter als der Präsident, hielt dem Blick ungerührt stand. »Der Bericht kommt von der NSA«, sagte er.
Burns musste plötzlich an einen früheren Zwischenfall denken, bei dem in Reston, einem Vorort von Washington, ein tödliches Virus ausgebrochen war. Das Armee-Institut zur medizinischen Erforschung von Infektionskrankheiten, USAMRIID, und das Zentrum für Seuchenkontrolle, CDC, hatten das tödliche Virus, eine Ebola-Variante, gemeinsam in den Griff bekommen können. Hier musste es um etwas Ähnliches gehen.
Er las weiter.
Im tropischen Regenwald der Demokratischen Republik Kongo ist eine neue Lebensform in Erscheinung getreten. Sollte sie sich ausbreiten, stellt diese Lebensform eine Bedrohung nicht nur für die Vereinigten Staaten dar, sondern kann zur Ausrottung der gesamten Menschheit führen. Auf eine Situation dieser Art weist schon der Heisman Report hin, der 1975 vom Schneider Institute vorgelegt wurde …
Burns las den Text aufmerksam und lehnte sich auf dem Sofa zurück. Jetzt war ihm klar, warum der wissenschaftliche Berater zu dem Meeting dazugebeten worden war. Er konnte sich einen sarkastischen Scherz nicht verkneifen.
»Sind Sie sicher, dass es sich bei dieser neuen Lebensform nicht in Wirklichkeit um islamistische Extremisten handelt?«
Watkins blieb sachlich. »Die Erkenntnisse sind zuverlässig. Wir haben sie von Spezialisten analysieren lassen, und sie glauben …«
»Schon gut«, unterbrach Burns. Der Bericht erregte seinen Zorn. Nicht nur wegen seines Inhalts, sondern wegen seiner bloßen, unerträglichen Existenz. »Ich möchte hören, was Dr. Gardner zu sagen hat.«
Die Aufmerksamkeit der Anwesenden richtete sich auf den zögerlich wirkenden Wissenschaftler. Angesichts der schlechten Laune des Präsidenten geriet Gardner ins Stottern. »Man hat seit … seit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts vorausgesagt, dass … dass so etwas passieren könnte. Der in Ihrer Zusammenfassung erwähnte Heisman Report war eine Reaktion auf die Diskussion über diese Möglichkeit.«
Burns war über Gardners ernsten Ton überrascht. Anscheinend reichten die Gedanken des Wissenschaftlers zu diesem Thema weiter, als ein Laie es sich vorstellen konnte. Aber Burns wurde ein tiefgreifendes Gefühl der Demütigung nicht los. Eine neue Lebensform, die zur Ausrottung der Menschheit führt? Welcher vernünftige Mensch konnte an so etwas glauben?
»Und Sie halten diese Erkenntnisse für verlässlich?«, fragte er.
»Unbestreitbar.«
»Ich habe ein Exemplar des Heisman Report hier.« Watkins nahm ein weiteres Dokument aus seiner Mappe. »Den entscheidenden Teil habe ich markiert. Abschnitt fünf.«
Burns überflog den fast dreißig Jahre alten wissenschaftlichen Aufsatz. Gardner wartete, bis er zu Ende gelesen hatte, und sagte dann: »Die uns aktuell vorliegenden Informationen sind nur spärlich. Abgesehen von der Person, die darüber berichtet hat, wurde diese neue Lebensform noch von niemandem bestätigt. Ich denke, es könnte sich lohnen, amerikanisches Personal zu entsenden, um zu überprüfen, was da tatsächlich vorgeht.«
»Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte die Angelegenheit rasch zu erledigen sein«, fügte Watkins hinzu. »Und es würde nicht viel kosten. Ein paar Millionen Dollar dürften genügen. Wir müssen allerdings für absolute Geheimhaltung sorgen.«
»Haben Sie etwas geplant?«, fragte Burns.
»Ich habe das Schneider Institute angewiesen, einen Aktionsplan auszuarbeiten. Bis zum Wochenende dürfte ich die verschiedenen Optionen auf dem Schreibtisch haben.«
Burns überlegte. Er sah nichts, was dagegenspräche. Für den Präsidenten eines kriegführenden Landes war es ratsam, Randprobleme sofort zu lösen, und das hier war eine Sache, die er besonders abscheulich fand. »Okay. Zeigen Sie mir die Vorschläge, sobald sie vorliegen.«
»Jawohl, Sir.«
Die Morgenbesprechung war beendet, aber in der Kabinettssitzung um neun kam das Thema noch einmal auf den Tisch. Verteidigungsminister Geoffrey Lattimer fasste die kurze, zweiminütige Diskussion zusammen. Ein biologisches Problem. »Solche dummen Sachen sollte man dem Schneider Institute überlassen«, sagte er wegwerfend.
Auf Veranlassung des Präsidenten senkten alle den Kopf, um das Meeting mit einem Gebet zu beenden.
Als die Teilnehmer gegangen waren, kam ein CIA-Mitarbeiter herein und sammelte die Besprechungsunterlagen ein. Dieses Material war streng geheim und wurde in Langley archiviert. Auf der ganzen Welt gab es nur zehn Personen, die wussten, was in diesem Meeting im Spätsommer 2004 besprochen worden war.
TEIL EINSDER HEISMAN REPORT
1
Die Kolonne der drei gepanzerten Suburbans raste durch den wirbelnden Staub. Die Heckklappe des letzten SUV war offen, und ein Sofa ohne Füße stand, nach hinten gewandt, auf der Ladefläche. Auf dieser behelfsmäßigen Bordschützenstation saß Jonathan »Hawk« Yeager und beobachtete die Straße hinter ihm.
Vor fünf Minuten hatten sie ihre Unterkunft in der Green Zone verlassen. Für Yeager war es der letzte Einsatz, bevor seine drei Monate in Bagdad zu Ende gingen.
Western Shield, die Firma, für die er arbeitete, hatte ihn und seine Kollegen während ihrer ganzen Zeit im Irak als Personenschützer eingesetzt. Yeager und sein Team bewachten VIPs aus der ganzen Welt: Reporter aus den USA, einen britischen Ölmanager, der die Wiederaufbauarbeiten nach dem Krieg begutachtete, Diplomaten aus einem kleinen asiatischen Land.
Die irakische Sonne war glühend heiß gewesen, als Yeager seinen Dienst angetreten hatte, aber jetzt, drei Monate später, hatte die Hitze nachgelassen. Tatsächlich war es so kühl geworden, dass am Spätnachmittag die Kälte unter Panzerweste und Kampfanzug kroch. Die Temperatur würde weiter sinken, und er wusste, dann würde diese sandbedeckte, flache Stadt noch öder und trostloser aussehen. Nicht dass er sich auf den einmonatigen Urlaub freute, den er morgen antreten würde. Im Gegenteil, der Gedanke daran deprimierte ihn, und er wäre gern geblieben, wo er war. Für Yeager war diese Stadt, so weit entfernt von dem Frieden, den zivilisierte Leute für selbstverständlich hielten, so etwas wie ein nihilistischer Spielplatz, auf den er sich vor der Wirklichkeit flüchtete, die ihn zu Hause erwartete.
Ein gepanzerter Hubschrauber strich dicht über den Dächern dahin. In der kahlen Sandebene standen die Überreste eines ausgebrannten Panzers, im Wasser des Tigris trieben Leichen.
Die Wiege der Zivilisation: In ihrer 5200-jährigen Geschichte hatte sie zahllose Kriege erlebt – und jetzt, zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, war wieder eine feindliche Armee einmarschiert. Der Feindesstaat hatte die Invasion ideologisch begründet, aber seine wahren Ziele waren klar: die riesigen Ölvorräte im irakischen Boden.
Yeager wusste, dass es in diesem Krieg nicht um Gerechtigkeit ging. Nicht dass es ihn – so oder so – interessiert hätte. Wichtig war nur, dass es hier einen Job für ihn gab, gut bezahlte Arbeit. Seiner Familie gegenüberzutreten, das bedeutete, sich einer Realität zu stellen, die sehr viel härter war als alles, was er im Irak erlebt hatte. Solange er in Bagdad war, konnte er es vermeiden, seinen Sohn zu sehen, und sich mit seiner Dienstpflicht herausreden.
Vereinzelte Schüsse hallten in der Ferne. M-16-Sturmgewehre. Yeager hörte kein AK-47, das das Feuer erwiderte. Also handelte es sich nicht um ein echtes Feuergefecht.
Er spähte nach hinten und sah, wie sich ein kleiner Wagen aus der Gruppe der Fahrzeuge hinter ihnen löste und das Tempo beschleunigte. Ohne die Sonnenbrille abzunehmen, behielt Yeager den Wagen im Auge. Es war ein verbeulter japanischer Pkw. In Bagdad wimmelte es von ihnen: kleine unauffällige Autos, die von Terroristen gern zu Selbstmordattentaten benutzt wurden. Anscheinend bemerkte man sie immer erst, wenn sie explodierten.
Ein Adrenalinstoß verengte sein Gesichtsfeld. Die Hauptstraße, auf der seine Kolonne unterwegs war, galt als Todeszone. In der Einsatzbesprechung hatten sie gehört, wie gefährlich es hier war. In den letzten dreißig Tagen waren die Aufständischen dazu übergegangen, statt amerikanischer Soldaten die privaten Militärunternehmen aufs Korn zu nehmen. Allein auf diesem kurzen Straßenabschnitt war ein rundes Dutzend Sicherheitskräfte ums Leben gekommen.
Sein Funkgerät knisterte, und von dem vorderen SUV kam die Meldung: »Verdächtiges Fahrzeug vor uns auf der rechten Seite. Steht unter der Straßenbrücke. War heute Morgen nicht da.«
Höchstwahrscheinlich enthielt das Fahrzeug eine USBV – eine Unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung. Sicher waren Aufständische in der Nähe, die erpicht darauf waren, die Fernzündung zu betätigen. Solche Sprengsätze mochten improvisiert sein, aber sie hatten genug Durchschlagskraft, um ein gepanzertes Fahrzeug in Stücke zu reißen.
»Sollen wir umkehren?«
»Moment«, sagte Yeager in sein drahtloses Mikro. »Von hinten nähert sich ein Wagen.«
Das japanische Auto war jetzt bis auf fünfzig Meter herangekommen.
Verschwinde! Yeager schwenkte den M4-Karabiner und signalisierte dem Wagen mit dem linken Arm, er solle zurückbleiben. Aber er kam immer schneller heran.
»Störsender überprüfen!«, rief der Kolonnenführer, McPherson. Die Aufständischen benutzten oft Handys, um ihre Sprengfallen zu zünden, und ein Störsender konnte das Signal ausschalten.
»Störsender aktiviert«, meldete der vordere SUV.
»Weiterfahren«, befahl McPherson. »Und schaff uns den Wagen vom Hals.«
»Roger«, antwortete Yeager und schrie zu dem Wagen hinüber, er solle Abstand halten.
Aber der Wagen gehorchte nicht. Durch die staubige Frontscheibe funkelte ihn das feindselige Gesicht des irakischen Fahrers an. Den Einsatzregeln für private Sicherheitsunternehmen entsprechend, gab Yeager ein paar Schüsse ab. Die vier Kugeln trafen auf den Asphalt vor der Stoßstange des Wagens. Splitter flogen auf.
Die Warnschüsse brachten den kleinen Wagen nicht dazu, langsamer zu fahren. Yeager hob den Karabiner und zielte auf die Motorhaube.
»Achtung, USBV!«
McPhersons Warnruf kam durch das Funkgerät, und ein paar Sekunden später erschütterte eine dunkel grollende Explosion den SUV. Die Bombe war nicht vor ihnen explodiert, sondern zweihundert Meter weit hinter ihnen auf der Straße, hinter dem Punkt, auf den Yeagers Karabiner zielte. Schwarzer Rauch waberte um eine einsame Dattelpalme am Straßenrand. Wieder beißt ein hasserfüllter religiöser Fanatiker ins Gras, dachte Yeager. Ein normaler Tag in Bagdad. Aber wenn der Wagen, der ihnen folgte, auf die gleiche Weise explodieren sollte, würde man ihn hier von der Straße kratzen können.
Yeager gab nicht erst den üblichen zweiten Warnschuss ab, sondern richtete das M4 gleich auf den Fahrer. Der rote Punkt des Laserstrahls leuchtete zwischen den Augen des Irakers auf.
Mach ja nicht die Augen zu!, schrie Yeager lautlos. Zeig mir bloß nicht diesen miesen Gesichtsausdruck eines Bombenattentäters vor der Explosion. Sonst bist du tot.
Jetzt sah der irakische Fahrer aus, als habe er Angst. Hatte er vor, zu sterben?
Yeager krümmte den Zeigefinger um den Abzug, und im selben Moment schrumpfte das Gesicht in seinem Zielfernrohr. Der Wagen wurde langsamer.
Für einen Augenblick wurde es dunkel, als die Kolonne unter die Straßenbrücke rollte. Das verdächtige Fahrzeug, das dort am Straßenrand stand, explodierte nicht.
Yeager wartete ab, bis der Wagen, der ihnen folgte, abschwenkte. »Alles in Ordnung«, meldete er dann.
»Roger«, antwortete McPherson aus dem vorderen SUV. »Rückkehr zur Basis.«
Vielleicht war der Fahrer des Pkw kein Terrorist gewesen, sondern ein normaler Bürger, der die Amerikaner herausfordern wollte. Und vielleicht war der Wagen unter der Überführung keine Straßenbombe, sondern ein Pannenfahrzeug.
Yeager wusste nur, dass ein schrecklicher Hass auf ihn gerichtet war, er spürte das Rauschen der Angst in den Adern, und ihm war klar, dass er nur um Haaresbreite davon entfernt gewesen war, einen Menschen zu erschießen, mit dem er noch nie ein Wort gesprochen hatte.
Die drei gepanzerten SUVs passierten den amerikanischen Checkpoint, schlängelten sich durch die Sperren, die dazu dienten, Bombenfahrzeuge aufzuhalten, und gelangten in die Green Zone im Zentrum von Bagdad, in deren Mitte der Palast des ehemaligen Diktators stand.
Die Kaserne von Western Shield lag nicht weit vom Palast entfernt am Rand der Straße, ein langgestrecktes, zweigeschossiges Gebäude aus Betonblöcken, an dessen Fassade die Farbe abblätterte. Es hatte so viele Räume, dass Yeager sich fragte, wozu es gedient hatte, bevor es an das private Militärunternehmen vermietet worden war. Wohnungen für Regierungsangestellte? Oder war es ein Studentenheim gewesen? Niemand wusste es.
Die Kolonne hielt vor dem Gebäude, und die sechs Sicherheitsexperten stiegen aus. Alle sechs, Yeager eingeschlossen, hatten früher bei den Special Forces gedient: ehemalige Green Berets. Sie stießen die Fäuste zusammen und gratulierten einander damit zum erfolgreichen Ende des Einsatzes. Ein Wartungsteam kam aus dem Gebäude. Sie entdeckten das Einschussloch eines Hochleistungsprojektils in der Motorhaube des vorderen Fahrzeugs, aber das brachte niemanden aus der Fassung. Mit so etwas war zu rechnen.
»Hey, Hawk!«, rief McPherson zu Yeager herüber, als sie das Gebäude betraten. »Ein Bericht über den Schießzwischenfall ist nicht nötig. Heute Abend gibt’s eine Party auf dem Dach.«
»Roger«, sagte Yeager.
Anscheinend plante McPherson eine Abschiedsparty für ihn. Morgen würde die Ablösung kommen, und Yeager wäre raus. Die übliche Rotationsdauer bei diesem Unternehmen betrug drei Monate Dienst, einen Monat Urlaub. Es gab keine Garantie dafür, dass er bei seinem nächsten Einsatz wieder mit demselben Team arbeiten oder das gleiche Aufgabengebiet haben würde. Und je nachdem, wohin die Kugeln flogen, würde er vielleicht keinen von ihnen wiedersehen.
»Wohin geht’s im Urlaub? Nach Hause?«
»Nein, nach Lissabon.«
McPherson wusste, warum er nach Portugal wollte, und nickte. »Hoffentlich klappt’s.«
»Das hoffe ich auch.«
Yeager ging in sein Zimmer im ersten Stock, legte das M4 aufs Bett, zog den Kampfanzug aus und verstaute ihn in seinem Spind. Munition und den Rest der Ausrüstung würde er hier lassen, wenn er abreiste. Nur ein Rucksack mit ein paar persönlichen Sachen würde mitkommen.
Yeager betrachtete das Familienfoto, das an seiner Spindtür klebte. Es war sechs Jahre zuvor aufgenommen worden, zu Hause in North Carolina. In glücklicheren Zeiten. Yeager, seine Frau Lydia und sein Sohn Justin saßen auf einem Sofa und lächelten in die Kamera. Justin, der auf dem Schoß seines Vaters saß, war so klein, dass er in Yeagers Armen fast verschwand. Er hatte das dunkelbraune Haar seines Vaters und die blauen Augen seiner Mutter. Wenn er spitzbübisch lächelte, sah er aus wie Lydia, aber wenn er schlechte Laune hatte, war er das Miniaturebenbild seines toughen Vaters, des ehemaligen Green Beret. Yeager und seine Frau hatten sich oft gefragt, wem er wohl ähnlicher sehen würde, wenn er groß war.
Yeager klemmte das Foto in ein halb gelesenes Taschenbuch, zog sein Handy heraus und wählte die Nummer seiner Frau in Lissabon. Der Zeitunterschied betrug drei Stunden. Jetzt war dort Mittagszeit, und er wusste, er würde sie nicht gleich beim ersten Mal erreichen. Er hinterließ eine Nachricht auf ihrer Mailbox: Sie solle ihn zurückrufen. Dann reinigte er sein M4 und ging mit Handy und Laptop die Treppe hinunter.
In dem kleinen Aufenthaltsraum herrschte immer Hochbetrieb. Hier gab es einen alten Fernseher, eine Polstergarnitur, eine Kaffeemaschine und ein paar Computer, die jeder benutzen konnte. Zwei der Männer saßen vor den Monitoren, klickten sich durch Porno-Seiten und rissen ihre Witze.
Yeager setzte sich an einen anderen Platz und verband seinen Laptop mit dem Highspeed-Kabel. Er wusste, er würde enttäuscht werden, aber er rief trotzdem eine wissenschaftliche Suchmaschine auf.
Wie erwartet – nichts. Keine Berichte über eine dramatische neue Behandlungsmethode für pulmonale Alveolarepithelzellensklerose.
»Yeager!«
Er schaute sich um und sah, wie Al Stephano, der Leiter der Unterkunft, ihm von der Tür her zuwinkte. »Hawk, kannst du in mein Büro kommen? Du hast Besuch.«
»Ich?« Yeager fragte sich, wer ihn hier besuchen könnte. Er folgte Stephano aus dem Aufenthaltsraum zu dessen Büro am Fuß der Treppe.
Als sie dort eintraten, erhob sich ein Mann vom Sofa. Er war ungefähr eins achtzig, so groß wie Yeager, und genauso gekleidet wie die Security-Truppe: in T-Shirt und Cargohose. Er mochte um die zwanzig Jahre älter als Yeager sein, Anfang bis Mitte fünfzig. Mit dem strengen Blick eines Soldaten, gepaart mit einem leisen Lächeln, streckte er die Hand aus.
»Das ist William Liban, der Leiter von Western Shield«, erklärte Stephano.
Den Namen kannte Yeager. Das private Militärunternehmen, bei dem er arbeitete, war von ehemaligen Mitgliedern der Delta Force gegründet worden, und Liban war die Nummer zwei in der Firma. Der schnelle Erfolg von Western Shield war auf die engen Beziehungen zwischen der Unternehmensleitung und dem Militär zurückzuführen. Liban besaß offensichtlich Gefechtserfahrung, aber ihm fehlte das harte, aggressive Auftreten, das die meisten Ex-Mitglieder der Delta Force auszeichnete.
Förmlich und unverbindlich bleiben, ermahnte Yeager sich, als er dem Mann die Hand schüttelte. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Liban. Jonathan Yeager.«
»Haben Sie einen Rufnamen?«, fragte Liban.
»Die Leute nennen mich Hawk.«
»Hawk, setzen wir uns. Reden wir miteinander.« Liban deutete auf das Sofa und drehte sich zu Stephano um. »Könnten Sie uns allein lassen?«
»Selbstverständlich.« Stephano ging.
Als sie allein waren, schaute Liban sich in dem kleinen Raum um, als bemerke er erst jetzt, wo er war.
»Ist dieser Raum sicher?«
»Solange Stephano nicht mit dem Ohr an der Tür klebt«, sagte Yeager.
Liban lächelte nicht. »Gut. Kommen wir gleich zur Sache. Können Sie Ihren Urlaub verschieben?«
»Worum geht es?«
»Ich habe gehofft, Sie könnten vielleicht noch einen Monat dranhängen.«
Yeager stellte sich vor, was Lydia sagen würde, wenn er ihr erzählte, dass aus seiner Reise nach Lissabon vorläufig nichts werden würde.
»Es ist ein guter Job. Sie bekommen 1500 Dollar pro Tag.«
Das war mehr als das Doppelte dessen, was er jetzt bekam. Er wurde wachsam. Wieso nahm die Nummer zwei der Unternehmensleitung den weiten Flug auf sich, um ihm einen Job anzubieten? »In Hillah?«
»Wie bitte?«
Hillah war die gefährlichste Front im ganzen Irak. »Ist es ein Einsatz in Hillah?«
»Nein, der Auftrag wird nicht hier stattfinden. In einem anderen Land. Sie hätten zwanzig Tage Vorbereitungszeit, und der Einsatz dürfte höchstens zehn Tage dauern. Vielleicht schaffen Sie es sogar in fünf. Aber Sie werden auf jeden Fall für dreißig Tage bezahlt, egal, wie schnell es geht.«
45000 Dollar für einen Monat Arbeit – das klang nicht schlecht. Im Moment brauchte die Familie Yeager so viel Geld, wie sie nur kriegen konnte. »Was wäre das für ein Einsatz?«
»Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber sagen kann ich Folgendes: Der Auftrag kommt aus einem der Koalitionsstaaten, nicht aus einem Land wie Russland oder China oder gar Nordkorea. Und zweitens, die Sache ist nicht allzu gefährlich. Weniger gefährlich als Bagdad. Drittens, dieser Einsatz dient keinem speziellen Land. Eher könnte man sagen, Sie erweisen der Menschheit einen Dienst.«
Yeager hatte keine Ahnung, was für ein Job das sein könnte, aber übermäßig riskant klang es nicht. »Warum ist die Bezahlung dann so gut?«
Die Falten um Libans Augen vertieften sich unwillig. »Ich hatte gehofft, Sie würden zwischen den Zeilen lesen. Es ist ein … schmutziger Auftrag.«
Ein schmutziger Auftrag. Also ein Attentat. Eines, das keinem speziellen Land etwas nutzte. Aber war ein Attentat nicht immer politisch?
»Wenn Sie den Job übernehmen, müssen Sie eine Vereinbarung unterschreiben. Wenn Sie dann mit dem Training anfangen, werden Sie alle nötigen Informationen erhalten. Aber Ihnen muss klar sein: Sobald Sie unterschrieben haben und über die Details Bescheid wissen, können Sie nicht mehr zurück.«
»Sie haben Angst, ich könnte plaudern? Müssen Sie nicht. Meine Sicherheitsfreigabestufe ist bei Top secret.«
Für Geheimdienstmitarbeiter des amerikanischen Militärs gibt es drei Sicherheitsfreigabestufen: Vertraulich, Geheim und Top secret. Bei jeder Freigabestufe ist eine strenge Sicherheitsüberprüfung vorgeschrieben, zu der unter anderem eine Befragung mit dem Lügendetektor gehört. Auch nach dem Abschied von der Army hatte Jonathan Yeager seine TS-Freigabe behalten, denn ohne sie würde er nicht jeden Auftrag ausführen können, den das Verteidigungsministerium an private Sicherheitsunternehmen vergab.
»Hören Sie, ich kenne Ihren Lebenslauf. Ehemals Special Forces, absolut verlässlich. Aber in diesem Fall müssen wir besonders streng auf Geheimhaltung achten.«
Libans unbestimmte Formulierung war ein weiterer Hinweis für Yeager. Der ehemalige Delta-Force-Mann redete von einem Auftrag, der eine noch höhere Sicherheitsfreigabestufe als TS erforderte: TS/SI – Top Secret/Special Intelligence – oder sogar TS/SCI, die Freigabe für sicherheitsempfindliche Teilinformationen. Angesichts dieser Andeutungen konnte es sich um eine vom Weißen Haus in Auftrag gegebene Ermordung handeln, eine Operation also, die auf höchster Geheimhaltungsebene stattfand. Warum beauftragten sie dann nicht die Delta Force oder das Navy SEAL Team 6 damit? So etwas war doch kein Einsatz für eine private Sicherheitsfirma.
»Was sagen Sie?« Liban drängte auf eine Entscheidung. »Würden Sie gern einsteigen?«
Yeager hatte ein komisches Gefühl bei der Sache. Das gleiche Gefühl hatte er als Teenager gehabt, als seine Eltern sich scheiden ließen und er entscheiden musste, bei wem er leben wollte. Die gleiche Unschlüssigkeit angesichts der unumgänglichen Entscheidung hatte er empfunden, als es nach der High School darum gegangen war, ein College-Stipendium der Reserveoffiziersausbildung anzunehmen. Er wusste, dass er an einem wichtigen Scheideweg stand. Ganz gleich, wie seine Entscheidung ausfiel, sie würde sein Leben für immer verändern.
»Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Ich werde sie beantworten, so gut ich kann.«
»Sie sind sicher, dass es ungefährlich ist?«
»Solange Sie keinen Mist bauen.«
»Ist es ein Ein-Mann-Einsatz?«
»Nein, Sie werden in einem Vier-Mann-Team arbeiten.«
Ein Vier-Mann-Team war die kleinste Operationseinheit bei den Special Forces.
»Die übrigen Konditionen sind wie immer«, fuhr Liban fort. »Wir stellen die Waffen, und wenn Sie bei dem Einsatz ums Leben kommen sollten, erhält Ihre Familie nach dem Versorgungsrecht 64000 Dollar.«
»Kann ich die Vereinbarung sehen?«
Liban lächelte beifällig und nahm ein Dokument aus seinem Aktenkoffer. »Zögern Sie nicht. Vertrauen Sie auf Ihr Glück. Sie sind doch ein Glückspilz.«
»Ich? Ein Glückspilz?« Yeager lächelte gequält. »Ich habe mich immer eher als Pechvogel gesehen.«
»Aber ganz und gar nicht. Sie haben das Glück gehabt, zu überleben.« Liban setzte eine bekümmerte Miene auf. »Wir hatten sechs weitere Kandidaten für diesen Auftrag vorgesehen, aber sie sind alle tot. Sie sind bei Schießereien mit Aufständischen ums Leben gekommen, einer nach dem anderen. In letzter Zeit haben sie es immer öfter auf Sicherheitsunternehmen abgesehen.«
Yeager nickte.
»Heute konnte ich zum ersten Mal einen unserer Kandidaten persönlich kennenlernen.«
Yeager ließ sich die Zahlen durch den Kopf gehen und hoffte, sie würden das ungute Gefühl vertreiben. 45000 Dollar in einem Monat. Konnte er ein solches Angebot wirklich ablehnen? Ein schmutziger Job – na und? Er war ein ersetzbares Werkzeug, so oder so, nicht anders als die Waffe in seiner Hand. Auch wenn er jemanden umbrachte, konnte er nicht der Waffe die Schuld geben. Schuld hatte der, der wirklich den Abzug betätigte: derjenige, der den Mord in Auftrag gab.
Er überflog die Vereinbarung, fand aber keine weiteren Hinweise. Jetzt musste er sich entscheiden.
Liban hielt ihm einen Stift hin. Als Yeager die Hand danach ausstreckte, vibrierte das Telefon in seiner Hemdtasche, und er ließ die Hand sinken.
»Entschuldigen Sie.« Er zog das Handy aus der Tasche und warf einen Blick auf das Display. Lydia rief aus Lissabon zurück. »Ich müsste kurz mit meiner Frau sprechen. Ich habe ihr gesagt, dass wir uns morgen sehen.«
Liban sah aus wie ein Jäger, dem gerade seine Beute durch die Lappen ging. »Na klar, nur zu.«
Yeager drückte auf die Annahmetaste. Bevor er etwas sagen konnte, hörte er Lydias dünne Stimme. Den Ton von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit kannte er nur zu gut.
»Jon? Ich bin’s. Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
»Was ist passiert?«
Sie schluckte ihre Tränen hinunter. »Sie haben Justin auf die Intensivstation verlegt.«
Das wird noch mehr Geld kosten, dachte Yeager. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. »Beruhige dich, Lydia. Das hatten wir schon öfter, und es geht ihm dann jedes Mal wieder besser.«
»Diesmal ist es anders. In seinem Auswurf ist Blut.«
Das war ein Zeichen dafür, dass die Krankheit seines Sohnes ins Endstadium eintrat. Es lief ihm eiskalt über den Rücken. Er bat Liban mit einer Handbewegung um Entschuldigung und ging hinaus. Draußen auf dem Flur liefen Leute lärmend die Treppe hinauf und hinunter.
»Bist du sicher?«
»Ich habe es selbst gesehen. Ein roter Faden, wie eine Staubfaser.«
»Ein roter Faden«, wiederholte Yeager leise. »Was sagt Dr. Garrado?« Garrado, Justins portugiesischer Arzt, war einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Epithelzellensklerose.
Sie schluchzte, sodass Yeager nicht verstehen konnte, was sie sagte. »Was meint Dr. Garrado dazu?«, wiederholte er.
»Er sagt, Justins Herz und die Leber versagen … und er hat nicht mehr viel Zeit.«
Yeagers Gehirn war zu Eis gefroren. Er zwang sich, wieder klar zu denken und sich an das zu erinnern, was er über die Erkrankung wusste. Eine Blutung aus der Lunge bedeutete, dass der Patient noch ungefähr einen Monat zu leben hatte.
»Du bist morgen hier, ja?« Lydias Schluchzen klang flehentlich.
Ich muss meinen Sohn sehen, bevor es zu spät ist, dachte Yeager. Aber wie zum Teufel sollen wir seine Behandlung bezahlen? Yeager starrte auf die geschlossene Bürotür. Er bemühte sich um Haltung, aber die Situation überstieg allmählich seine Kräfte, und sein Verstand taumelte am Rand des Chaos entlang.
Warum stehe ich hier im Flur einer dreckigen Kaserne in Bagdad und halte dieses Telefon in der Hand? Warum zum Teufel bin ich hier?
»Jon?«, hörte er die tränenerstickte Stimme seiner Frau. »Jon? Bist du da?«
2
Das Unglück fühlt sich ganz anders an, wenn man es am eigenen Leib erlebt.
Der Wagen mit dem Leichnam seines Vaters schlängelte sich durch die engen Einkaufsstraßen von Atsugi in der Präfektur Kanagawa. Kento Koga saß in einer schwarzen Limousine des Bestattungsinstituts, die langsam dem Leichenwagen folgte.
Es war früh an einem Werktagsnachmittag. In der milden Wintersonne drehte sich kaum jemand von denen, die hier zum Einkaufen unterwegs waren, nach der Kolonne der schwarzen Fahrzeuge um, die da vorbeifuhr. Und niemand ahnte etwas von dem Schock, der den jungen Mann getroffen hatte.
Seit er die Nachricht vom plötzlichen Tod seines Vaters Seiji erhalten hatte, war Kento sich seiner eigenen Gefühle nicht mehr sicher – als wäre das, was ihn am Laufen gehalten hatte, einfach weggebrochen. Fünf Tage zuvor, als er ins Krankenhaus geeilt war und dort erfahren hatte, die Todesursache sei ein Aneurysma der Thorax-Aorta, waren er und seine Mutter nicht in Tränen ausgebrochen. Vielmehr schauten sie seitdem wie gelähmt zu, wie die Ereignisse über sie hinwegrollten. Der ältere Bruder seines Vaters und andere Verwandte, die hastig aus der Präfektur Yamanashi angereist waren, übernahmen die Bestattungsformalitäten, ohne dass man sie darum bitten musste. Sie sahen gleich, dass der Witwe, einer nicht berufstätigen Hausfrau, und ihrem Sohn, einem schmächtigen Universitätsabsolventen, nicht viel zuzutrauen war.
Kento hatte seinen Vater nie wirklich respektiert. Seiji war allen Dingen gegenüber immer sehr negativ eingestellt gewesen, ein Mann mit einer verkorksten, zynischen Weltsicht. Er hatte eine respektable Position innegehabt – als Universitätsprofessor –, aber in Kentos Augen war er als Erwachsener immer ein schlechtes Vorbild gewesen. Deshalb war Kento sehr überrascht gewesen, als er eine halbe Stunde zuvor beim Ablegen der Blumen am Sarg seines Vaters plötzlich zu weinen angefangen hatte. Es war kein Zeichen der Trauer, dachte er, als er die Tränen hinter den Brillengläsern wegwischte, sondern eher eine instinkthafte Reaktion, die etwas mit Blutsverwandtschaft zu tun hatte.
Der Sarg wurde geschlossen, und der von bunten Blumen umgebene Leichnam verschwand für alle Zeit. Kento würde ihn nie wiedersehen, diesen Professor mit dem langen hageren Gesicht. Sie hatten einander nur kurze vierundzwanzig Jahre lang gekannt.
Die Autokolonne mit den trauernden Verwandten und dem Bestattungspersonal hielt vor dem Krematorium, und der Sarg wurde in den Einäscherungsofen geschoben. Es gab zwei Arten von Einäscherungsöfen; sie waren unterschiedlich teuer, und Seijis Sarg kam in den billigeren. Selbst im Tode teilt man die Menschen nach dem ein, was sie sich leisten können, dachte Kento. Die japanischen Ansichten zu Leben und Tod waren ihm schon immer ein Gräuel gewesen.
Die versammelten Trauergäste, ungefähr dreißig Verwandte und Freunde, begaben sich in den Warteraum im ersten Stock. Nur Kento blieb zurück und starrte die fest verschlossene Tür des Verbrennungsofens an. Dahinter wurde sein Vater von den Flammen verzehrt. Kento musste an einen Absatz aus einem Buch denken, einem naturwissenschaftlichen Lehrbuch aus seiner Zeit in der Grundschule.
… das Eisen in unserem Blut entstand bei der Explosion einer Supernova vor 4,6 Milliarden Jahren. Es schwebte durch den endlosen Raum und wurde Teil der Erde, als das Sonnensystem entstand. Über die Nahrung wurde es Teil deines Körpers. Wenn wir diesen Gedanken weiterführen, sehen wir, dass der Wasserstoff und andere Elemente, die sich in deinem Körper finden, bei der Geburt des Universums geschaffen wurden. Sie existieren mit dem Universum seit 13,7 Milliarden Jahren und sind jetzt ein Teil von dir …
Jetzt würden die Elemente im Körper seines Vaters dahin zurückzukehren, wo sie hergekommen waren. Diese wissenschaftlichen Tatsachen halfen Kento ein wenig dabei, sich damit zurechtzufinden.
Er wandte sich von dem Ofen ab, ging in den weitläufigen Flur hinaus und stieg die Treppe zum Warteraum hinauf.
Die Trauernden saßen im Kreis mitten auf der Tatami in dem großen Raum. Seine Mutter Kaori konnte ihre Erschöpfung nicht mehr verbergen, aber sie hielt sich tapfer. Sie saß in formeller Haltung auf der Matte und bedankte sich höflich bei den Freunden und Verwandten ihres Mannes, die zu ihr kamen und ihr Beileid aussprachen.
Kentos Großeltern aus Kofu waren gekommen und auch sein Onkel mit seiner Familie. Die Kogas waren eine ziemlich wohlhabende Kaufmannsfamilie aus Kofu in Yamanashi. Sie hatten zwar in letzter Zeit einige Kunden an einen großen Supermarkt verloren, der in der Nachbarschaft eröffnet worden war, aber Kentos Onkel, der das Geschäft der Familie übernommen hatte, konnte es trotzdem erhalten. Der zweite Sohn der Familie, Seiji, war der Ausreißer der Familie gewesen: Er hatte an der örtlichen Universität studiert und dann in Tokio promoviert, und statt sich einen Job in der Wirtschaft zu suchen, war er als Forscher an der Universität geblieben.
Die väterliche Seite seiner Verwandtschaft bereitete Kento immer Unbehagen. Einen Moment lang blieb er stehen und überlegte, ob er sich setzen sollte, und schließlich ließ er sich auf einem Kissen in der hintersten Ecke nieder.
»Hallo, Kento.«
Ein schlanker Mann mit grau meliertem Haar auf der anderen Seite des Tisches sprach ihn an – ein Freund seines Vaters, ein Zeitungsreporter namens Sugai. Der Mann hatte sie schon ein paarmal zu Hause in Atsugi besucht, deshalb wusste Kento, wer er war.
»Ich habe dich lange nicht gesehen. Du bist wirklich groß geworden.« Sugai kam um den Tisch herum und setzte sich neben ihn. »Du bist im Promotionsstudium?«
»Ja.«
»Und womit beschäftigst du dich da?«
»Ich arbeite in einem chemisch-pharmazeutischen Labor an organischer Synthese«, antwortete Kento knapp, um zu zeigen, dass er keine Lust auf ein Gespräch hatte, aber Sugai ließ sich davon nicht beirren.
»Was genau tust du da?«
Kento antwortete widerwillig. »Wir entwerfen mithilfe von Computern neue Medikamente und stellen sie auf der Grundlage dieser Planung auch her. Dabei kombinieren wir alle möglichen Elemente.«
»Du stehst im Labor und schüttelst ein Reagenzglas?«
»Könnte man so sagen.«
»Aber es hört sich an, als würde deine Forschung den Menschen helfen.«
»Vermutlich …« Das Lob war Kento unangenehm. »Jedenfalls ist es das Einzige, was ich kann.«
Sugai sah ihn verwundert an und ließ dann den Kopf sinken. Er war Reporter, aber es gelang ihm nicht, die Zweifel ans Licht zu bringen, die Kento tief in seinem Innern an seinen eigenen Fähigkeiten und seiner Eignung für seine Arbeit hegte. Der junge Kento war niemand Besonderes, und Sugai rechnete auch nicht damit, dass sich daran jemals etwas ändern würde.
»Die wissenschaftliche Forschung in Japan hat ein paar ernsthafte und fundamentale Probleme. Wir zählen auf dich.« Mehr sagte Sugai nicht.
Fundamentale Probleme. Der Kerl ist Wissenschaftsredakteur bei einer großen Zeitung und hat keine Ahnung, wovon er redet, dachte Kento wütend. Etwas an Sugai ging ihm gegen den Strich. Er hätte nicht genau sagen können, was es war, aber seine Freundlichkeit hatte einen feindseligen Unterton, und Kento war ein wenig gekränkt.
Zehn Jahre zuvor war in den Wissenschaftsspalten aller großen Zeitungen über die Forschung seines Vaters berichtet worden. Zum ersten und einzigen Mal hatte Seiji in seiner Rolle als Wissenschaftler im Scheinwerferlicht gestanden. Sugai hatte über ihn geschrieben. Der Ausdruck »Umwelthormone« war in aller Munde gewesen, und bei seiner Forschung im Labor der Universität hatte sein Vater nachgewiesen, dass die Inhaltsstoffe eines synthetischen Waschmittels das menschliche Endokrinsystem nicht schädigten. Ein Aufsatz von Prof. Seiji Koga, Polytechnische Universität Tama, hatte es in den Schlagzeilen geheißen, und damals war Kento zum ersten und einzigen Mal im Leben stolz auf seinen Vater gewesen. Aber der neugewonnene Respekt war bald wieder verblasst, als er herausfand, dass sein Vater beträchtliche Forschungsmittel von dem betroffenen Waschmittelhersteller erhalten hatte.
Seijis Fachgebiet war die Virologie gewesen. Warum hatte er diesmal Stoffe erforscht, die das endokrine System schädigten? War diese Arbeit wirklich objektiv gewesen? Oder hatte er Daten gefälscht, um dem Unternehmen gefällig zu sein, das so viel Geld ausgespuckt hatte?
Seitdem hatten Wissenschaftler auf der ganzen Welt sich für die Wirkung von Umwelthormonen auf den menschlichen Körper interessiert, und niemand hatte einen schlüssigen Beweis dafür gefunden, dass sie schädlich waren. Aber ihre Befunde waren alles andere als zufriedenstellend gewesen, denn sie hatten nicht abschließend belegen können, dass diese Hormone harmlos waren.
Das Ganze war nur ein weiteres Beispiel für die Grenzen der Wissenschaft, hatte Kento gedacht. Dennoch hatte die Geschichte in ihm eine gewisse Abneigung gegen seinen Vater geweckt, ein Misstrauen, das er nicht abschütteln konnte. Und Sugai, den Autor des Artikels, hatte er der gleichen Kategorie zugerechnet: zwei Männer, die in einer korrupten Erwachsenenwelt lebten.
»Es ist wirklich traurig. Er hatte noch so viele gute Jahre vor sich«, bemerkte Sugai, für den der plötzliche Tod seines gleichaltrigen Freundes offensichtlich ein Schock gewesen war.
»Danke, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben, um bei uns zu sein.«
»Es war das Mindeste, was ich tun konnte.« Sugai senkte den Kopf.
Um das Schweigen zu überspielen, nahm Kento die Teekanne und goss beiden eine Tasse ein.
Sugai trank einen Schluck Tee und fing an, von seinen Erinnerungen an Kentos Vater zu sprechen. Es waren die typischen Anekdoten, die man bei einer billigen Fernsehserie erwarten würde – wie sehr man Seiji wegen seiner Arbeit geachtet habe und wie stolz er in seinem tiefsten Innern auf seinen Sohn gewesen sein müsse. Das alles machte Kento nur noch deutlicher bewusst, wie langweilig und profan das Leben seines Vaters gewesen war.
Schließlich war das Thema erschöpft, und Sugai fand ein neues. »Ich habe gehört, du wirst jetzt die Gedenkfeier für deinen Vater abhalten?«
»Ja.«
»Ich muss gleich danach gehen. Deshalb erzähle ich es dir lieber jetzt, bevor ich es vergesse.«
»Was denn?«
»Hast du schon mal vom Heisman Report gehört?«
»Vom Heisman Report?« Wahrscheinlich handelte es sich um eine wissenschaftliche Abhandlung, auch wenn er noch nie von einem Forscher namens Heisman gehört hatte. »Nein, den kenne ich nicht.«
»Dein Vater hat mich gebeten, einen Blick hineinzuwerfen, und ich habe mich gefragt, was ich jetzt tun soll.«
»Was ist der Heisman Report?«
»Ein amerikanischer Thinktank hat diesen Aufsatz vor knapp dreißig Jahren für den Präsidenten verfasst. Dein Vater wollte Einzelheiten wissen.«
Dann hatte es sicher etwas mit einer Virenepidemie zu tun. Das war ja das Fachgebiet seines Vaters gewesen. »Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen«, sagte Kento.
Es klang unerwartet unbeteiligt, und Sugai starrte ihn sichtlich erstaunt an. »Ich verstehe. Dann zerbrich dir nicht weiter den Kopf darüber.«
Kento war es egal, was Sugai über ihn dachte. Das Verhältnis zwischen einem Vater und seinem Sohn ging niemanden etwas an. Perfekte Beziehungen zwischen Eltern und Kindern waren ohnehin ein Mythos.
Bald darauf kam der Bestatter, um sie abzuholen. Die Trauergäste, die sich in gedämpftem Ton miteinander unterhalten hatten, erhoben sich raschelnd und folgten ihm die Treppe hinunter.
Kento trat an den Einäscherungsofen und nahm die Gebeine seines Vaters in Empfang. Die weißlichen Knochen, die da so schlicht und trostlos vor ihm ausgebreitet lagen, erzählten auf anschauliche Weise, dass ein menschliches Wesen von der Erde verschwunden war.
Seine Großeltern und sein Onkel schluchzten leise. Und zum zweiten Mal seit dem Tod seines Vaters kamen Kento plötzlich die Tränen.
Die Totengedenkfeier begann, und dann waren die Zeremonien, mit denen der Verstorbene verabschiedet wurde, beendet.
Früh am nächsten Morgen riss das Summen des Weckers Kento aus dem Schlaf, und nach einem kurzen Frühstück verließ er das Haus seiner Eltern in Atsugi. Er musste zurück in sein Postgraduiertenleben, zurück in sein Ein-Zimmer-Apartment, zurück in den Trott der langweiligen Experimente unter der Aufsicht eines Assistenzprofessors.
Als er aus dem Haus im Unterbezirk 3 LDK in die morgendliche Kälte hinaustrat, dachte Kento mit Sorge an seine Mutter, die jetzt allein war. Ihre Eltern würden noch eine Weile bei ihr bleiben, aber irgendwann würden sie nach Hause fahren. Er konnte sich nicht vorstellen, was ihr durch den Kopf ging, jetzt, da sie mit vierundfünfzig Jahren Witwe war.
Zum Abschied hatte sie gesagt: »Komm mich ab und zu besuchen.«
»Natürlich«, hatte er gesagt und sich auf den Weg zum Bahnhof Hon-Atsugi gemacht.
Die Tokioter Universität für Natur- und Geisteswissenschaften lag von Atsugi aus auf der anderen Seite von Tokio in Kinshi-cho, dem der Präfektur Chiba am nächsten gelegenen Ort. Sie hatte 15000 Studenten und war eine Viertelstunde Fußweg vom Bahnhof Kinshi-cho entfernt. Wenn man den Bahnhof in nordöstlicher Richtung verließ, kam man an einen Kanal, der Yokojikken hieß. Er teilte den Campus in zwei Hälften: Am linken Ufer waren die Natur- und am rechten die Geisteswissenschaften angesiedelt. Nur die medizinische Fakultät mit der Uniklinik lag für sich allein, näher am Bahnhof. Die Universität blickte stolz auf eine neunzigjährige Geschichte zurück, und nach den ständigen Neubauarbeiten war im Lauf der Jahre auch das ausgedehnte Ackerland, das zur Landwirtschaftsschule gehört hatte, unter neuen Universitätsgebäuden verschwunden. Wie bei den anderen innerstädtischen Universitäten von Tokio bestand der Campus auch hier aus einer weitläufigen Ansammlung von tristen, fantasielosen Betonbauten.
Die Fahrt von seinem Elternhaus zur Universität dauerte zwei Stunden, und er musste einmal umsteigen. So hatte Kento reichlich Zeit, um über seine Zukunft nachzudenken. Die finanzielle Situation seiner Familie war seine größte Sorge. Im zweiten Jahr seines Magisterstudiums hatte er beschlossen, sich keinen Job zu suchen, sondern gleich zu promovieren, und das bedeutete, er war noch drei weitere Jahre darauf angewiesen, dass seine Eltern ihm Studium und Lebenshaltungskosten finanzierten.
Einer seiner Freunde, ein Student der Geisteswissenschaften, machte sich darüber lustig, dass er immer noch seinen Eltern auf der Tasche lag. Er hielt ihm Vorträge darüber, wie notwendig es sei, dass er sich einen Teilzeitjob suchte, aber das war typisch für die Denkweise in den Geisteswissenschaften: Die Studenten dort spielten herum und studierten nie ernsthaft. Fast alle Kurse in der pharmazeutischen Forschungsabteilung waren Pflichtseminare, wenn man auch nur einen einzigen ausließ, war man durchgefallen. Hatte man das staatliche pharmazeutische Zulassungsexamen und alle Abschlussprüfungen bestanden, wartete im Postgraduiertenstudium ein Leben voller Experimente und neuer Experimente, Tage von so unglaublicher Hektik, dass sie mit dem Wort »hart« nicht annähernd beschrieben waren. »Unvorstellbar« traf es eher. In der pharmazeutischen Forschungsabteilung, der Kento angehörte, verbrachte man jeden Werktag im Labor und führte Testreihen durch, von morgens zehn bis tief in die Nacht hinein. Nur an Sonn- und Feiertagen hatte man frei, aber oft zogen sich die Tests in die Länge, sodass man auch diese Tage zur Hälfte im Labor verbrachte. Ein längerer Urlaub kam nicht infrage. Wenn man zum Obon-Fest im Sommer oder zu Neujahr fünf Tage hintereinander frei bekommen konnte, hatte man Glück. Neun Jahre verbrachte man so, um schließlich »Doktor« zu werden. Ein Teilzeitjob? Also bitte.
Bis vor einem Monat hätte er einen Vollzeitjob bekommen können, statt in der Forschung zu bleiben. Kento verfluchte sein schlechtes Timing. Ihm wäre beides recht gewesen. Das Promotionsstudium hatte er nur angetreten, weil er sich noch nicht dazu bereit fühlte, in die Welt hinauszugehen, nicht, weil er darauf brannte, in der Forschung zu arbeiten. Im Gegenteil: Seit er auf der Uni war, fühlte er sich fehl am Platz, als habe er eine falsche Wahl getroffen. Er hatte nie echte Freude an Pharmakologie oder organischer Synthese gehabt, und er war nur dabeigeblieben, weil er nichts anderes konnte.
Er sah es deutlich vor sich: In zwanzig Jahren wäre er genau wie sein Vater, ein langweiliger Forscher auf irgendeinem abgelegenen Gebiet der Wissenschaft.
Kento erreichte den Campus, und als er den Komplex der Natur- und Ingenieurwissenschaften durch den Hintereingang betrat und sich dem Pharmakologie-Gebäude näherte, wurden seine Schritte schwer. Je länger er an den trostlosen Weg seines Leben dachte, auf dem er unterwegs war, desto schleppender wurde sein Gang. Schließlich riss er sich zusammen und ging schneller.
Er nahm die linoleumbelegte Treppe zum Labor Sonoda im zweiten Stock, das nach seinem Vorgesetzten benannt war. Er ging durch einen Korridor und öffnete die Tür, hinter der ein zweiter Korridor begann. Zu beiden Seiten lagen kleine Räume. In einigen standen Spinde, und einer war ein Seminarraum. Am Ende des Korridors hatte Professor Sonoda sein Büro, links dahinter war das Labor.
Kento zog seine Daunenjacke aus, hängte sie in einen Spind und ging in Jeans und Sweatshirt in das Büro des Professors. Die Tür war offen, und Professor Sonoda war da, wie üblich in Hemd und Krawatte.
»Guten Morgen«, sagte Kento.
Professor Sonoda blickte von dem Papierstapel auf seinem Schreibtisch auf. Als er sah, dass es Kento war, wurde sein Blick sorgenvoll. Normalerweise war Sonoda ein lebhafter Mensch, viel energischer, als man es bei einem Mann von Ende fünfzig erwarten würde, und stets dabei, seine jungen Promotionsstudenten anzutreiben. Jetzt war sein Gesicht ernst und fürsorglich.
»Es tut mir leid, zu hören, was passiert ist«, sagte er. »Wie geht es Ihnen?«
»Ganz gut, glaube ich«, sagte Kento und bedankte sich für den Blumenstrauß, den der Professor zur Bestattung geschickt hatte.
»Ich hatte nie das Vergnügen, Ihren Vater kennenzulernen«, sagte Professor Sonoda. »Aber wir waren Berufskollegen, deshalb hat mich die Nachricht von seinem Tod tief getroffen. Es ist ein schrecklicher Verlust.«
Kento war aufrichtig dankbar für die freundlichen Worte seines Vorgesetzten. Sonoda war ein herausragender Forscher, der eine Reihe von neuen Medikamenten für namhafte Pharmaunternehmen entwickelt hatte und der allen arbeitsreichen Forschungsprojekten zum Trotz immer noch die Zeit für wissenschaftliche Publikationen fand, was ihm zu seiner Professur an der Universität verholfen hatte. Außerdem war er sehr geschickt darin, beträchtliche Mittel für gemeinsame Entwicklungsprojekte mit Arzneimittelherstellern einzuwerben. Kento hatte seinen Vater oft zu dessen Nachteil mit dem Professor verglichen und sich gefragt, warum Seiji nicht mehr Ähnlichkeit mit ihm haben konnte.
Vielleicht weil er annahm, zu viele Beileidsworte würden nur wieder traurige Erinnerungen wecken, wechselte Professor Sonoda das Thema. »Und, sind Sie bereit, Ihre Arbeit wiederaufzunehmen?«
»Ja, ich …« Kento brach ab. Gab es abgesehen von der förmlichen Beisetzung der Asche seines Vaters noch etwas, das er zu erledigen hatte? »Vielleicht muss ich noch einmal ein paar Tage Urlaub nehmen.«
»Das ginge selbstverständlich in Ordnung. Sie können es ruhig sagen.«
»Danke, das ist sehr freundlich.«
»Na, die Arbeit wartet.« Der Professor lächelte aufmunternd und brachte ihn zur Tür.
Das Labor, in dem die Postgraduierten arbeiteten, war zu riesig, um noch als Raum bezeichnet zu werden. Es war ein Saal, so groß wie vier Klassenzimmer am Gymnasium zusammen. In der Mitte standen vier Labortische mit diversen Testapparaturen und Chemikalien, und drei der vier Wände waren von studentischen Arbeitsplätzen und Luftabzugsschächten mit Ventilatoren im Industrieformat gesäumt. Es wirkte beinahe chaotisch, aber die funktionale Schönheit des Ganzen war von einem sehr eigenen, machtvollen Reiz.
Das Labor Sonoda konzentrierte sich auf die Entwicklung neuer Medikamente gegen Autoimmunkrankheiten. Der Professor, sein Assistent und ungefähr zwanzig Postgraduierte arbeiteten daran, aber um diese Jahreszeit, im Januar, war es im Labor relativ ruhig. Studentische Hilfskräfte, die hier beschäftigt waren, bereiteten sich auf die pharmazeutische Zulassungsprüfung vor, und die kürzlich examinierten M.A.-Studenten waren fast alle zu Einstellungsgesprächen unterwegs.
»Kento, tut mir wirklich leid wegen deines Vaters«, sagte Nishioka, sein unmittelbarer Vorgesetzter. Er war Promotionsstudent im zweiten Jahr. Seine Augen waren gerötet, als hätte er geweint. Aber er hatte keine Tränen des Mitgefühls vergossen, sondern eine lange schlaflose Nacht im Labor verbracht.
»Danke für die SMS«, sagte Kento, als ihm die Kondolenznachricht einfiel, die Nishioka geschickt hatte.
»Es tut mir leid, dass ich nicht zur Bestattungsfeier kommen konnte.«
»Alle haben viel zu tun. Da kann ich nicht erwarten, dass sie kommen. Eher sollte ich mich entschuldigen, weil ich mir fünf Tage Urlaub genommen habe.«
»Nein, mach dir deswegen keine Sorgen.« Nishioka blinzelte mit seinen blutunterlaufenen Augen.
Einer nach dem anderen kamen auch die übrigen Kollegen und kondolierten mit warmherzigen Worten. Selbst die weiblichen Postgraduierten, die sonst so knapp und geschäftsmäßig waren, sprachen ungewöhnlich freundlich mit ihm. Kento begriff, dass er nur mit der Hilfe all dieser Kollegen in der wissenschaftlichen Forschung so weit gekommen war.
Er ging an seinen Platz und machte sich an die Arbeit. Bei der organischen Synthese geht es um die Herstellung kohlenstoffbasierter Präparate. Kohlenstoff hat, so könnte man sagen, vier Hände, mit denen er sich an andere Elemente anhängen kann. Sauerstoff hat zwei. Wenn diese beiden Elemente sich verbinden, hängen sich zwei Sauerstoffatome an ein Kohlenstoffatom und bilden CO2, Kohlendioxid. Aber so einfach sind die Dinge leider nicht immer. Viel schwieriger ist es, aus einfachen Bausteinen neue organische Verbindungen zu schaffen. Zahlreiche Reaktionsbedingungen können die Resultate beeinflussen: die chemische Konzentration, die Reihenfolge der Zutaten, die Temperatur, der Katalysatortypus, das Lösungsmittel, um nur einige wenige zu nennen.
Die Forscher in Professor Sonodas Labor waren ständig auf der Suche nach Molekularstrukturen mit medikamentöser Wirkung, die sie dann weiter modifizieren könnten, um daraus pharmakologische Wirkstoffe herzustellen.
Kentos derzeitige Arbeit bestand darin, eine einfache Kernstruktur aus Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoffmolekülen zu nehmen und weitere funktionelle Gruppen daran anzuschließen. Der Assistenzprofessor hatte dazu das Rezept mit Klebstreifen über seinem Arbeitstisch befestigt, die Anweisungsschritte, die nötig waren, um die gewünschte Reaktion zu erreichen. Pharmakologische Experimente hatten tatsächlich Ähnlichkeit mit dem Kochen. Ob wirklich ein Zusammenhang bestand, war nicht klar, aber es blieb eine Tatsache, dass mehr Frauen als Männer Pharmazie studierten.
ENDE DER LESEPROBE