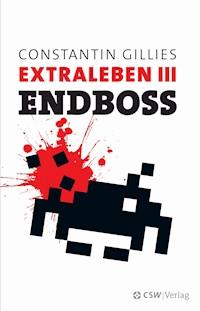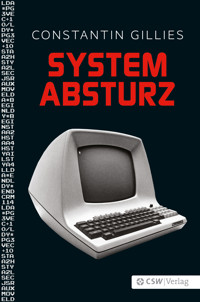Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: CSW-VerlagHörbuch-Herausgeber: Marctropolis
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Extraleben
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollen Nick und Kee nur ihren Commodore 64 abstauben. Noch einmal in die Welt von Space Invaders, Pac-Man und Donkey Kong zurückreisen. Doch der Nostalgietrip endet mit einer Überraschung: In einem Spiel aus den Achtzigern entdecken die alternden Joystickhelden eine geheime Botschaft: Welcome to Datacorp. Plötzlich erwacht der alte Hackerinstinkt wieder. Die Freunde gehen im Dschungel der Bytes auf die Jagd - und entdecken eine weitere Spur: Sie führt nach Iowa, mitten in die amerikanische Provinz. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Von der digitalen Schnitzeljagd magisch angezogen, tritt das Duo die Reise in die USA an. Für die Hobby-Computerarchäologen beginnt eine Odyssee um die halbe Welt - und durch die Geschichte der Games. Doch am Ende wird das Spiel ernster, als die Freunde ahnen. Die meisten, für die in den 1980ern C64, Atari & Co. der Mittelpunkt des Lebens waren, haben inzwischen den Weg in die Wirklichkeit gefunden, sich aber ein wenig Sehnsucht nach der aufregenden Computer-Pionierzeit bewahrt. Genau davon handelt der Roman Extraleben: Zwei weitgehend normale Enddreißiger, gefangen zwischen Pubertät und Midlifecrisis, die der Eintönigkeit ihres Lebens entfliehen, nachdem sie einer Verschwörung auf die Spur kommen, die sie unvermittelt in ihre Hacker-Tage zurückversetzt. So unglaubwürdig das auch klingen mag, so glaubwürdig entwickelt das Buch ein Generationen-Portrait einerseits und einen Thriller-Plot andererseits. Extraleben ist spannend wie ein Krimi - aber gleichzeitig als Kommentar zur Gegenwartskultur treffsicher. Haarklein recherchiert, reich an Seitenhieben auf das Establishment und garniert mit Spitzen gegen den Zeitgeist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
EXTRALEBEN
CONSTANTIN GILLIES
EXTRALEBEN
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
unter http://dnb.ddb.de abrufbar
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Freigrenzen des Urheberrechts ist
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
8. Auflage, August 2012
© 2008 beim CSW-Verlag,
Weidenstraße 13/1, 71364 Winnenden
www.csw-verlag.de
Titelfoto Marc Dietrich
Gestaltung und Satz redtrump.weimar
Druck und Bindung Dimitar Blagoev Printing House, Sofia
Schriften Thesis von LucasFonts,
Adore64 und Service Games Oldskool von Freaky Fonts
ISBN 978–3–9811417–5–7eISBN 978-3-941287-90-7
Printed in Bulgaria
Für Coach
»Nein, Herr Vorstandsvorsitzender, ich kann jetzt nicht mehr weiter telefonieren. Ich muss Papierchen aufkleben!« Nick brüllt so laut, dass es selbst in unserer zwei-mal-drei-Meter-Zelle hallt. Ich schrecke hoch und schaue direkt in sein grinsendes Gesicht. Natürlich hat er mit seinem Finger längst auf die Gabel gedrückt. Großes Gelächter.
»Sicher, dass du aufgelegt hast?«, frage ich.
»Klar«, behauptet Nick, wirft aber trotzdem noch einen verstohlenen Blick zum Telefon und legt ein paar Mal auf. Klick, klick, klick, sicher ist sicher. Wir ringen uns ein weiteres halbherziges Lachen ab, das nach ein paar Sekunden in Gähnen übergeht.
»Tja ja«, sage ich.
»Tja ja«, seufzt Nick und wendet sich wieder den Belegen zu. Drei Papierstapel – Bahnfahrscheine, Taxiquittungen und Hotelrechnungen – liegen fein säuberlich getrennt vor ihm und warten darauf, einzeln – und bitte schön mittig – auf A4-Bögen aufgeklebt zu werden. Er fährt den Prittstift ungefähr fünf Zentimeter raus, sodass er sofort abbricht. Mehr als ein geflüstertes Homer-Simpson-Nein! ringt ihm das Missgeschick nicht ab.
Es ist kurz vor Weihnachten, und wie jedes Jahr um diese Zeit drehen alle in der Redaktion durch. Die Redakteure tippen und telefonieren wie irre, damit sie genug Artikel zusammenkriegen, um an den Feiertagen nicht ins Büro kommen zu müssen. Gleichzeitig treiben sie die Assistenten an, die Fahrtkostenabrechnungen fertig zu machen, damit zum Fest die Kasse stimmt. Das heißt, wir müssen den Prittstift schwingen und gleichzeitig wertvolle Artikel recherchieren, was so kurz vor dem Fest nur eines bedeuten kann: Der gefürchtete Beitrag über die Weihnachtsfeier steht an.
So sicher wie das Christkind selbst und das Gejammer über zu früh im Supermarkt angebotene Christstollen – Pflichtsatz: »Können die ja gleich zu Ostern rauslegen« – besucht dieser Bekannte uns im Ressort »Karriere« alle Jahre wieder. Mal kommt er unter der Schlagzeile »So überstehen Sie die Weihnachtsfeier«, mal als »Survivalguide X-Mas« oder »Weihnachtsfeier-Knigge« daher. Drin steht natürlich immer dasselbe: Bieten Sie dem Chef nicht betrunken das Du an, fotokopieren Sie nicht Ihren Hintern, weil – so wird der unvermeidliche Bürotechnik-Experte warnen – das Glas Ihr Gewicht nicht aushält. Trinken Sie außerdem genug Mineralwasser. Dieses Feuerwerk an Selbstverständlichem recyceln die Journalisten dann meistens noch mal zur Karnevalszeit, unter der Überschrift: »So machen Sie sich nicht zum Narren«. Tusch!
Da kein Redakteur Lust hat, die Rundfahrt um den Allgemeinplatz selbst anzutreten, bleibt es an den Assis hängen, ein paar Statements zu beschaffen, mit denen der Artikel ausgeschmückt wird. Wir müssen also alle Jahre wieder eine Stilberaterin finden, die empfiehlt, als Grundlage reichlich Nudeln zu essen, und einen politisch-korrekten Personaler, der ernsthaft behauptet, dass die Zeiten der wilden Weihnachtsfeiern ohnehin vorbei sind. Jedes Jahr die gleichen Dementis: Es gibt keine mittelalten Angestellten, die ihre Weihnachtsmann-Mützen zwei Stunden zu lange tragen, und der Satz »Sie stehen doch auf mich, oder?« fällt auch niemals.
Normalerweise sammeln wir diese Phrasen am Telefon in einer halben Stunde ein. Doch hin und wieder landet man bei einem Presseschneckchen, das noch nicht verstanden hat, wie total unwichtig unsere Anfrage ist, und die prompt ein Telefoninterview mit dem Personalvorstand organisiert. Da sitzen wir dann und müssen mit einem Menschen, der für das Schicksal von 15 000 Mitarbeitern verantwortlich ist, über die Dicke seines Kopiererglases reden. Danach ist ein Stapel Taxiquittungen die reinste Erlösung.
Nick hat seinen Belegberg als Erster fertig und fängt an, die Prittreste unter seinen Fingernägeln herauszukratzen. »Sag mal, Alter, was machste heute Abend?«
Ab und zu, nicht sehr oft, fällt mir noch auf, wie total peinlich wir sind. Allein dieses »Alter« – seit wie vielen Jahren sagt man das nicht mehr? Zehn, fünfzehn? Hat man das überhaupt mal gesagt, und vor allem als Mensch jenseits der Dreißig? Aber an Nick prallt der Zeitgeist eben ab, und da er mich in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr mit meinem Vornamen angesprochen hat, bleibe ich ebenfalls beim »Alter«, zumal ich weiß, wie sehr er es hasst, wenn man seinen richtigen Namen Niklas auch nur erwähnt. Auf Außenstehende müssen wir langsam ziemlich zwangsjugendlich wirken; wie diese Typen, die mit ihrem alten BMX-Rad vor dem abbezahlten Eigenheim ihre Runden drehen und danach erst mal ein ABC-Pflaster brauchen, weil, Zitat, »der Rücken nicht mehr mitmacht« – ein Satz übrigens, den man im Bekanntenkreis immer häufiger hört.
Altern kann eben eine verdammt traurige Angelegenheit sein – auch wenn wir beide von diesem Thema natürlich nicht betroffen sind. »Ich bin nicht retro, sondern actro«, behauptet Nick steif und fest und erzählt dann – als ob das ein Beweis wäre –, dass er mit seinem Commodore 64 jetzt auch online ist. Mit seinem C64! Aber im Grunde genommen weiß er, dass er in der Vergangenheit lebt, und fühlt sich auch wohl dabei.
Dabei ist Nick optisch weder nach vorne noch nach hinten gerichtet. Er hat eigentlich gar keine Richtung, sondern gehört eher zu diesen modelosen Typen. Wenn er was anhat, dann ist das nie richtig modern, sondern höchstens praktisch. Man könnte ein Foto von Nick in jede beliebige Aufnahme aus den Achtzigern, Neunzigern oder von heute reinmontieren, und er würde nicht auffallen. Seit ich denken kann, trägt er Jeans oder Cordhosen, eine Jeansjacke und Turnschuhe, die manchmal aus Wildleder und meistens irgendwie retro sind. Informatiker-Chic eben. Wie jeder echte Geek träumt er davon, unsichtbar zu sein, und da das noch nicht geht, versucht er in der Zwischenzeit, möglichst wenig aufzufallen. Dabei sieht er nicht mal schlecht aus, ein bisschen wie der junge Emilio Esteves zu Zeiten des Breakfast Club. Als er damals auf dem Abiball eine Krawatte anhatte, konnte man ihn sich sogar gut als Chef von irgendwas vorstellen.
An dem Platz, wo wir arbeiten, spielen Klamotten aber ohnehin keine Rolle. In der Redaktion sieht jeder aus, als wäre er gerade aufgestanden. Und da die Assis in der Nahrungskette der Zeitung nur kurz vor den Praktikanten rangieren, wäre es total lächerlich, zu versuchen, »dressed for success« auszusehen. Denn der »success« wird nicht kommen, egal, wie man sich anzieht.
Beim Bewerbungsgespräch klang das natürlich noch ganz anders: »Wir wollen diese Stelle zum Researcher ausbauen, nach amerikanischem Vorbild«, hatte der Verlagsheini mit seinem Dreiteiler damals erzählt. In den USA recherchiere schließlich auch kaum ein Journalist selbst, sondern lasse sich alle Fakten von seinem Assi beschaffen. Das sei eine anspruchsvolle »Querschnittsfunktion«, die hier zu besetzen sei, meinte der Typ. Das gleiche Blabla musste sich Nick zwei Monate später noch mal anhören; er war wie üblich, um nichts selbst entscheiden zu müssen, meinem Vorbild gefolgt und hatte sich auf eine andere Assi-Stelle beworben. Nur so als Nebenjob, vorübergehend halt.
Spätestens jedenfalls, als wir den Wagen unseres Redakteurs das erste Mal zum TÜV fahren mussten, wurde uns die wahre Bedeutung des Wortes »Querschnittsfunktion« klar: Wir sind Mädchen für alles – und schreiben tun die anderen. Also traben wir weiter mit dem Pulk und fühlen uns sehr amerikanisch.
Was nicht heißt, dass wir nichts können. Doch, doch, wir verfügen über ein breites Querschnittswissen. Alles, was in der Redaktion an Software benutzt wird, beherrschen wir im Schlaf, auch Grafik und Layoutzeug, was eigentlich nicht in unser Ressort fällt. Manchmal fragen uns die Kollegen sogar mal, wenn sie nicht weiterkommen. Das gibt einem zumindest für ein paar Minuten das Gefühl, kein totaler Low Potential zu sein. »Also, ich finde uns ziemlich kompetent«, sagt Nick in solchen Situationen immer. Und obwohl er danach laut lacht, meint er es tief in sich drinnen, glaube ich, ernst.
Das passt zu ihm: Als echter Nerd denkt er wirklich, es reicht im Leben aus, die Softwaretricks du jour zu beherrschen und bei den anderen Geeks in irgendwelchen Foren mitreden zu können. Ich sehe die Sache nüchterner. Unser Problem liegt darin, dass fast alle unsere Bekannten genauso fit sind wie wir. Das bisschen Pixel rumschieben hat heutzutage halt jeder Autodidakt drauf, die paar Fetzen Code kann jeder reinhacken, und hinter hyperteurer Hardware kann man sich – seit dem Tod von Silicon Graphics, 10 000-Dollar-Workstations und jeder Art von Virtual Reality – nicht mehr verstecken. Was wir können, kann jeder, und deshalb treten wir auf der Stelle. Wir sind vom Querschnitt gelähmt.
Doch was noch viel schlimmer ist: Man braucht uns anscheinend nicht mal mehr. In letzter Zeit beobachten wir immer häufiger, dass Kollegen mit Computersorgen bei den jungen Praktikanten unten in der Produktion anklopfen. So nervig es sein kann, Helpdesk zu spielen – das trifft einen doch irgendwie. Ein Nerd, der nicht mehr nach IT-Rat gefragt wird, hat seine Daseinsberechtigung verloren.
Wahrscheinlich ist es höchste Zeit, der Wahrheit ins Auge zu sehen: Wir haben diesen Punkt im Leben eines Mannes erreicht, an dem er von seinem Computer nur noch erwartet, dass er funktioniert, und eben nicht auch noch die hinterletzte Funktion des Betriebssystems kennen und verstehen will. Bei 99 Prozent aller Männer fällt dieser Moment zusammen mit der Geburt des ersten Kindes und/oder der Hochzeit – dachte ich zumindest immer. Aber je mehr Zeit vergeht, desto sicherer bin ich mir, dass diese Sache nichts mit Äußerlichkeiten zu tun hat. Sie läuft eher wie eine Sanduhr ab: Irgendwann fällt das letzte Korn, und der Update-Trieb versiegt.
Erst mal kämpft man natürlich dagegen an, redet sich ein, nur gerade keine Zeit zu haben, die Software zu aktualisieren. Irgendwann gewinnt die PC-Resignation dann doch die Oberhand: Es fängt damit an, dass man eben nicht um 18:01 Uhr eine neue Programmversion herunterlädt, die um 9 Uhr amerikanischer Westküstenzeit veröffentlicht wurde, sondern erst um 19 Uhr. Dann verschiebt man das Update auf den nächsten Tag, und schließlich klickt man die Dialogboxen mit den Hinweisen auf neue Versionen nur noch weg.
Bei mir lag dieser Punkt irgendwo zwischen Mac OS 9.1 und 9.2. Nick, der Mann für alle x86-Sachen, hat sich, glaube ich, ausgeklinkt, als der Support für Windows 98 eingestellt wurde. Erst mal plagt einen natürlich das schlechte Gewissen, sich so schamlos vom IT-Zeitgeist abgekoppelt zu haben. Aber nach einiger Zeit tritt an die Stelle der Phantomschmerzen eine wohlige Wärme. Es ist das Gefühl, in den alten Systemen eine Heimat gefunden zu haben, die Schönheit von etwas Abgeschlossenen. So in etwa müssen sich die Sammler von DDR-Briefmarken nach der Wiedervereinigung gefühlt haben; nichts beruhigt mehr als die Gewissheit, dass nichts Neues mehr kommt. Ich finde, nach einem Leben voller Updates haben wir uns das verdient.
»Altaaah, was machen wir denn heute Abend jetzt?« Nick hat seine Caterpillar-Boots auf den Schreibtisch abgelegt. Heute ist er mit seinem Motorrad zur Arbeit gekommen und präsentiert sich wieder äußerst modisch. Seine Beine stecken in einer fleckigen Danese-Lederhose, dazu trägt er einen schwarzen Rolli mit Reißverschluss. Wie immer gegen fünf kramt Nick seinen Nachmittagssnack raus: ein Comtess-Schokokuchen und eine Dose Cola, weder light noch koffeinfrei. Er schneidet eine Scheibe vom Bahlsenblock ab und schaut seelenruhig zu, wie die Krümel auf den Boden rieseln. Ich beobachte ihn dabei aus dem Augenwinkel und bin neidisch auf seine Genügsamkeit; wenn er seinen Kuchen isst, dann hat das was von Zen. Völlig entspannt schiebt er sich drei dicke Scheiben hintereinander in den Mund und spült mit der Cola nach. Unfassbar, dass er bei der Kost immer noch so sportlich aussieht. Müssen wohl die Gene sein.
Überhaupt gehört mein Kollege zu diesen beneidenswerten Menschen, die in einem prä-kalorischen Bewusstsein leben. Nick weiß weder, dass seine Comtess das 75fache des Tagesbedarfs an Fett deckt und Millionen von Kalorien enthält, noch, dass er ungefähr dreieinhalb Stunden auf dem Fitnessrad schwitzen müsste, um auch nur eine Scheibe wieder abzubauen. Beneidenswert. Mir hatte eine Freundin Anfang der Neunziger mal eine Kalorientabelle gezeigt; danach war Feierabend, das Ende der Unschuld. Seitdem bestelle ich bei McDonald’s nur noch zwei Hamburger ohne alles – maximal viel Eiweiß bei minimalem Fettanteil – und nehme mir oft vor, an einen Ort zu gehen, wo die Menschen von einer »Jahres-Currywurst« sprechen, weil sie nur eine im Jahr essen. Ins Fitness-Studio also. Manchmal denke ich, Nick hat es besser.
»Was ist denn jetzt mit heute Abend?«, fragt er.
»Zocken«, schlage ich vor.
»Wenn du meinst …«
Da ist sie wieder: die große Indifferenz. Wenn Nick eine Sache hasst, dann Entscheidungen. Manchmal habe ich das Gefühl, er würde sich gerne mal entführen lassen, nur um an diesem Tag eben nichts entscheiden zu müssen. Das ist einerseits angenehm, da er so ziemlich alles ohne Widerstand mitmacht, nervt andererseits aber wahnsinnig, weil man ständig alles für ihn mitentscheiden muss.
So richtig schlimm wird die Sache, wenn es mal wieder zwei neue Medienformate gibt, so wie seinerzeit bei den hochauflösenden DVDs. Das stürzt meinen Kumpel regelmäßig in eine echte Existenzkrise, denn da geht es um ein Thema, wo ich ihm die Entscheidung nicht abnehmen kann: Elektronik. Nick gehört nämlich zu diesen Dolby-Surround-Existenzen, die in unserer Altersklasse häufig anzutreffen sind: Menschen, deren gesamte Wohnungseinrichtung – man könnte sogar sagen: deren ganzes Leben – auf Elektronik ausgerichtet ist. Das war bei Nick schon zu Schulzeiten so. Er hatte als Erster in der Klasse dieses orange Donkey Kong-LCD-Spiel mit Doppelbildschirm, den ersten Amiga und später – als wohl Einziger in der Stadt – einen Laserdisc-Player.
Doch anders als viele andere kaufkräftige Scheidungskinder, denen es nur darum ging, das jeweils neueste Gadget zu besitzen, wollte er sie auch verstehen. Während die meisten von uns ihren Commodore 64 nur zum Spielen benutzten, nahm Nick die Maschine ernst: Ihn interessierte nicht nur, welcher Poke einem bei Fort Apocalypse unendlich Leben verlieh, sondern er wollte wissen, wofür jede einzelne Adresse auf der Zeropage da war. Während ich gerade mal Disketten kopieren konnte, schrieb er schon mit vierzehn eigene Demos in Maschinensprache und brannte sich einen eigenen Zeichensatz auf Umschalte-ROM – selbst, wenn man den Brotkasten danach nicht mehr zuschrauben konnte. Ihn interessierte schon immer die Technik hinter den Dingen.
In letzter Zeit ist ihm dieser Forscherdrang allerdings ein wenig abhandengekommen. Er schaut lieber nur noch nach hinten. Das begann zunächst als trendiger Retrofimmel, hat sich mittlerweile aber zu dieser Art von dumpfer Nostalgie ausgewachsen, wie man sie bei Fans von Oldie-Musik beobachten kann, Stichwort: »Die alten Sachen waren besser.« Ich bilde mir zumindest ein, noch ein bisschen kritische Distanz zu wahren. Wenn ich für alte Mac OS schwärme, dann nur wegen der reduzierten Ästhetik, der kompromisslosen Funktionalität. Niemals im Leben käme ich auf die Idee, mit einem solchen Betriebssystem heute ernsthaft zu arbeiten.
Nick sieht das ganz anders: Bei ihm bedeutet älter immer auch besser. Letztens habe ich auf seinem Rechner sogar eine Riesensammlung von Achtzigerjahre-Pornos gefunden; Movies mit Frauen wie Celeste oder Rocky Roads, wo das Bild unten am Rand so verzerrt ist, weil der Kopf vom Videorecorder verstellt war. Ich vermute, Nick hat da heimlich ein Experiment in Sachen Retronanie laufen. Auf meine Frage, warum er sich freiwillig die ganzen Bärte und damals noch kruden Brust-OP-Narben anschaut, bemerkte er nur, das seien eben »Klassiker«. Als ich dann wissen wollte, was denn bitteschön einen Klassiker ausmacht, meinte er ungerührt: »Klassiker ist alles, was in meiner Kindheit cool war!«
Eine Ausnahme gönnt sich der Retromane allerdings: sein Heimkino. Da versucht Nick nach wie vor, ganz vorne mitzuspielen. Zentrum seiner Bude ist ein gigantischer Bildschirm, gekoppelt an ein Soundsystem mit einer Gazillion von Kanälen, und ein Sofa, das perfekt im Surround-Quadrat positioniert ist. Weniger Mühe hat er sich mit dem Rest der Einrichtung gemacht. Er folge eben dem Prinzip »form follows function«, witzelt Nick immer und meint damit, dass er die Sachen vom Sperrmüll hat. So sehen sie leider auch aus: Fast an jedem Möbelstück kommen irgendwo die Spanholzsplitter raus, wirft das einmal feucht gewordene Plastikfurnier Blasen. Seine Einrichtung ist der Beweis dafür, dass Ikea-Möbel eben nicht mehr als einen Besitzer vertragen. Nicht, dass es bei mir stylischer zugeht.
Dabei müssten wir eigentlich schon mitten im achso ernsten Ernst des Lebens drinstecken, wie die meisten unserer Bekannten, und uns sehr viele Gedanken um die Inneneinrichtung machen. Müssten. Und da ist er wieder, der große, lähmende Konjunktiv. Müsste. Seit Jahren bestimmt er unser Leben. Egal, was wir tun – im Hinterkopf läuft ständig diese »Eigentlich müsste«-Subroutine ab: Eigentlich müsste man das Studium zu Ende bringen. Eigentlich müsste man in eine vernünftige Wohnung umziehen, eine Frau finden und sich überhaupt altersgemäß verhalten. Eigentlich, eigentlich. Dieser kategorische Konjunktiv lässt sich sogar noch steigern: »Eigentlich müsste man mal irgendwie.«
Aus irgendeinem Grund haben wir den Abschied vom Studenten-Style trotzdem nie richtig hingekriegt. Wir hausen beide noch auf 30 Quadratmetern in einer Wohnung, die unsere Eltern früher wahrscheinlich »Bude« genannt hätten – schön in Uninähe, was seit Jahren schon nichts mehr bringt, da die Redaktion ziemlich genau am anderen Ende der Stadt liegt. Der Typ im Reisebüro bietet uns ganz automatisch die billigsten Flüge mit dreimal Umsteigen an statt der bequemen Direktdampfer. Und Nick kommt zu Partys manchmal noch ernsthaft mit einer Isomatte unterm Arm.
Die wenigen Möbel, die in seiner Bude auch nur annähernd nach einem Einrichtungsplan aussehen, hat seine langjährige Freundin Sabina, ein Mädchen aus der Provinz mit dem Geschmack der Provinz, eingeschleppt. Leider sieht man das den Sachen auch an: An der Decke wellt sich eine Edelstahl-Halogenleiste entlang, die an beiden Seiten mit einer kleinen Pyramide aus fliederfarbenem Plastik abschließt; aus dem Nachlass ihrer Oma hat Sabina außerdem einen von innen beleuchteten Vitrinenschrank mitgebracht, und in der Küche zeugt noch reichlich Alessi-Kram von der Anwesenheit einer Frau. Kurz gesagt: Nick lebt in einer postmodernen Hölle. Und obwohl er das meiste Zeug auch hasst, will er partout nichts davon rausschmeißen, allein aus nostalgischen Gründen – wie sollte es anders sein.
Denn Sabina hat vor zwei Monaten mit ihm Schluss gemacht. Es gehe »irgendwie nicht weiter«, sagt sie. Obwohl mir klar war, was sie damit meinte, nahm ich ihren Abflug nicht ernst – wahrscheinlich, weil ich ohnehin nie verstanden habe, was Nick an ihr so toll fand. Klar sagt sich das als Single einfach, aber Sabina ist eben eine dieser Frauen, die von außen wie von innen blass sind. Selbst mit ordentlich Make-up und hochhackigen Besorg’s-mir-Sandalen – die an der Wade hochgeschnürten – fällt sie nicht wirklich auf. Für ihre einssechzig hat sie eine ordentliche Figur, wenn auch mit leichter Tendenz zur rheinischen Silhouette, Birne statt Sanduhr eben. Außerdem sind ihre Haare so Salz-und-Pfeffer-mäßig gesträhnt; damit sieht sie aus wie eine der Frauen aus der Internetporno-Kategorie »M.I.L.F.« – Mother I’d like to fuck.
Doch was mich immer richtig an Sabina gestört hat, war diese Tranigkeit. Sie hatte nach der elften Klasse die Schule abgebrochen und eine Lehre als Bürokauffrau bei einer Spedition gemacht; zu dem Zeitpunkt war sie schon mit Nick zusammen. Seitdem hat sie nichts auch nur halbwegs Interessantes gesehen, gelesen oder gemacht. Ihr einziges Hobby ist Bogenschießen, und zwar die Lowtech-Variante mit Holzbogen und Darmsaite, und zu allem Überfluss im mittelalterlichen Kostüm. Auf eine ihrer Burgfräulein-Eskapaden hat sie Nick sogar mal mitgeschleift. Wie diese Tusse eine derartige Weisungsbefugnis über meinen sonst eher rationalen Kumpel bekommen konnte, wollte nie in meinen Kopf. Vielleicht nervte mich aber auch nur, dass ich jetzt nicht mehr weisungsbefugt war. Wer weiß.
Jedenfalls erschien mir das Ende ihrer Beziehung wie eine Erlösung. Ich sah uns schon, zwei freie Männer, wie früher auf der Piste zu Zeiten von KLF, so gegen drei Uhr morgens. Daraus wurde jedoch nichts. Nick hat total abgebaut, ist noch entscheidungsfauler als je zuvor und macht insgesamt einen ziemlich mitgenommenen Eindruck. Zum Beispiel hat er in letzter Zeit immer häufiger diese senioren Momente: Dann starrt er mit seinen Paul-Newman-blauen Augen traurig ins Leere, als ob sein Hirn mit einer emotionalen Garbage Collection beschäftigt ist. Wir haben natürlich nicht drüber geredet. Warum auch? Es gibt halt Signale, die man als Kumpel sofort erkennt, dafür braucht man kein Gespräch bei Duftkerzen und Prosecco: Wie viele Assistenten in der Redaktion hört auch Nick, wenn er nicht gerade telefonieren muss, mit einem Kopfhörer Musik. Als ich letztens an seinem Schreibtisch vorbeigegangen bin, meine ich etwas gehört zu haben, was nach Joni Mitchell klang.
Freitagabend, in einer mittelgroßen Stadt am Rhein. Nicks Wohnung liegt in einem Block, der Anfang der Achtziger gebaut wurde, also in einer Phase, als Messing und Rauchglas furchtbar angesagt waren. Bis heute gibt sich die Hausverwaltung alle Mühe, das Ambiente zu erhalten, und hat erst kürzlich auf allen Etagen neue gerahmte Kandinsky-Poster aufhängen lassen. In diesem Museum wohnt Nick, so lange ich denken kann. Wie lange genau, könnte ich gar nicht sagen, jedenfalls hat er schon ungefähr fünf Nachbarn überlebt. Das läuft immer gleich ab: Irgendein Student fährt mit seinem Kleinwagen vor, packt alles in die 40-Quadratmeter-Bude nebenan, klingelt bei Nick und verspricht, mit ihm mal einen trinken zu gehen. Wenn man den Typen das nächste Mal sieht, hat er sein Vordiplom in der Tasche und ein Mädel kennen gelernt, das schon provisorisch eingezogen ist. Nach ungefähr vier Monaten scheitert das Experiment, es zu zweit in diesem Stall auszuhalten. Dann fährt ein Kastenwagen fährt vor, und ihre Kommilitonen helfen ihnen beim Umzug in eine 100-Quadratmeter-Wohnung – wahrscheinlich ihr letzter Umzug mit Kumpelunterstützung. Und pronto: Der nächste Student kommt. Obwohl Nick immer steif und fest behauptet, dass er es »interessant« fände, wenn wieder ein neuer Nachbar einzieht, frisst es ihn insgeheim natürlich an – schließlich führt ihm jeder neue Ersti vor Augen, dass alle weiterziehen und nur er auf der Stelle tritt. Das, und die Sache mit Sabina, liegen ihm schwerer auf der Seele, als er zugibt.
Umso wichtiger ist es mir, meinen besten Kumpel heute Abend ein wenig aufzuheitern, und womit ginge das besser als mit Ballern bis tief in die Nacht. Ich stehe im Aufzug und checke meine Ausrüstung: zwei Sechser Corona – Check, eine Packung Quaxi-Fröschli von Haribo für Nick – Check, eine Packung fettreduzierte Ofenchips für mich – Check. Das müsste für die ersten Runden reichen. Der Aufzug rumpelt in den dritten Stock, und ich stehe vor der Türmatte, die Nicks Mutter ihm zum Einzug geschenkt hat und auf der in großen grünen Buchstaben »Bed & Breakfast« steht; ihre Augen waren ein bisschen feucht, als sie ihm die überreicht hat, deshalb bringt es der alte Melancholiker nicht übers Herz, das zerfranste Jutemonster wegzuschmeißen. Es dauert eine Minute, bis Nick zur Tür geschlorrt ist.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!