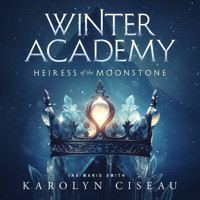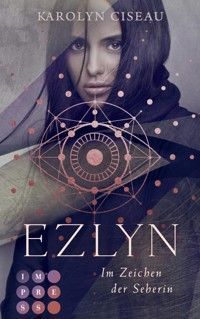
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Kannst du das Schicksal aufhalten?** Ezlyn hat eine besondere Gabe, sie kann das Ende eines jeden Menschen voraussehen. Tag und Nacht verfolgen sie die schrecklichen Bilder ihrer Visionen. Und eine hat sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis eingebrannt: ihr eigener Tod, verursacht durch die Hand eines Schattenkriegers. Einer jener Männer, die bekannt und gefürchtet sind für ihre Fähigkeit, durch bloße Berührung Leben zu nehmen. Als Ezlyn schließlich in den Dienst einer reichen Adelsfamilie tritt, führt ihr Schicksal sie ausgerechnet an die Seite eines solchen Schattenkriegers. Der schweigsame und unnahbare Dorian könnte der sein, der ihr den Tod bringt – und dennoch bewegt er ihr Herz wie kein anderer ... Neues von der Finalistin des Kindle Storyteller Awards 2018! Ein schicksalhafter Fantasy-Liebesroman von der beliebten Autorin Karolyn Ciseau. Sie erschafft in "Ezlyn" eine dunkle Welt, in der nichts ist, wie es scheint, und Vertrauen und Verrat dicht beieinander liegen. Diese romantische Liebesgeschichte entwickelt von der ersten Seite an einen Sog, dem sich niemand entziehen kann. Hast du den Mut zu lieben, wenn der Mann deines Herzens dir den Tod bringen kann? //Hol dir auch die wunderschön veredelte Print-Ausgabe als Schmuckstück für dein Bücherregal!//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Karolyn Ciseau
Ezlyn. Im Zeichen der Seherin
**Kannst du das Schicksal aufhalten?**Ezlyn hat eine besondere Gabe, sie kann das Ende eines jeden Menschen voraussehen. Tag und Nacht verfolgen sie die schrecklichen Bilder ihrer Visionen. Und eine hat sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis eingebrannt: ihr eigener Tod, verursacht durch die Hand eines Schattenkriegers. Einer jener Männer, die bekannt und gefürchtet sind für ihre Fähigkeit, durch bloße Berührung Leben zu nehmen. Als Ezlyn schließlich in den Dienst einer reichen Adelsfamilie tritt, führt ihr Schicksal sie ausgerechnet an die Seite eines solchen Schattenkriegers. Der schweigsame und unnahbare Dorian könnte der sein, der ihr den Tod bringt – und dennoch bewegt er ihr Herz wie kein anderer …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© Simply Photographs by Miró Meckelburg
Karolyn Ciseau wollte schon immer Schriftstellerin werden. Vielleicht, weil man mit Büchern so wunderbar in ferne Welten eintauchen kann. Der Ausflug ins Unbekannte spielt auch jenseits des gedruckten Wortes für sie eine wichtige Rolle. Nach ihrem Germanistik-Studium war sie unter anderem in Island, Schottland, Thailand und der Karibik unterwegs. Wenn sie nicht gerade auf Reisen nach Inspiration für neue Geschichten sucht, lebt sie mit ihrem Mann im beschaulichen Niedersachsen.
Kapitel 1
Du bist keine Kriegerin.
Unzählige Male hatten sie mir das gesagt. Sie hatten es mir vorwurfsvoll ins Gesicht geschleudert, lachend vor die Füße geworfen und kopfschüttelnd vor sich hin gemurmelt, wenn sie dachten, ich würde nicht zuhören.
Du bist keine Kriegerin, Ezlyn.
Wenn ich mit den anderen Todesseherinnen im Tempel saß, während Schwester Caterina aus dem Buch des Lebens zitierte, glaubte ich ihnen manchmal. Dann drückte ich den vom vielen Sitzen schmerzenden Rücken durch und versuchte mich auf Schwester Caterinas Worte zu konzentrieren. Worte, die uns daran erinnern sollten, dass es eines Tages unsere Pflicht sein würde, den Lords und Ladys am Hofe zu dienen, indem wir sie mit unseren Visionen ein ums andere Mal vor den kalten Händen des Todes bewahrten.
Unsere Waffe war nicht das Schwert, sondern unsere besondere Gabe, in die Zukunft blicken zu können. Aber in diesem Augenblick, da sich der Mond hinter den Wolken hervorschob und die Klinge meines Kurzschwertes im Licht glitzerte, war ich mir sicher, dass sie sich täuschten.
Ich war eine Kriegerin.
Jede meiner Bewegungen war tödlich – oder sie würde es sein, wenn ich einem echten Gegner gegenüberstünde. Es war eine kalte, klare Frühlingsnacht, und mein Atem hinterließ weiße Wölkchen, während ich bei meinem Kampftraining Hiebe und Stiche ausführte und dabei mein Gewicht von einem Fußballen auf den anderen verlagerte.
Das Wichtigste war es, in jeder Bewegung sein inneres Zentrum zu finden. So hatte es Kova, der Sohn des Hufschmieds, mir beigebracht. Ich erinnerte mich noch genau daran, wie er seinen Vater zu den Stallungen des Ordens begleitet hatte. Er war groß und schlaksig und gelangweilt gewesen. Eigentlich sollte er seinem Vater zur Hand gehen, aber er war ihm entwischt und hatte es sich auf einer grauen Steinmauer gegenüber der Gebetshalle gemütlich gemacht. Die Sonne schien ihm in den Nacken und er hatte die Augen zusammengekniffen, um trotz der Helligkeit etwas erkennen zu können.
Vermutlich hatte er gehofft, einen Blick auf die Todesseherinnen und ihre berühmten Feuervögel werfen zu können. Stattdessen fand er mich: ein achtjähriges Mädchen mit sommersprossigem Gesicht, schiefergrauen Augen, buschigen Brauen und einem dick geflochtenen Zopf, aus dem sich einige der pechschwarzen Haare gelöst hatten. Anstatt meine neu erwachte Gabe als Seherin, die mich in den Tempel gebracht hatte, zu trainieren, übte ich mich mit einem alten Schürhaken, den ich hinter den Stallungen gefunden hatte, im Schwertkampf. Oder, wie er es nannte, ich fuchtelte wild herum.
Kova selbst hatte nur wenig Erfahrung im Umgang mit dem Schwert. Er hatte vor Kurzem mit der Ausbildung am Hof eines angesehenen Lords begonnen und brachte mir alles bei, was er wusste. Und als er zwei Monate später mit einem richtigen Schwert wiederkam, um meinen Unterricht fortzusetzen, wartete ich bereits auf ihn.
Das war nun schon zwölf Jahre her. Aus dem kleinen Mädchen war eine erwachsene Todesseherin geworden, die dem Tag der Auswahl durch die Lords mit gemischten Gefühlen entgegensah. Kova war irgendwann nicht mehr aufgetaucht. Was blieb, waren seine Instruktionen:
Studiere deinen Gegner. Ahne seine Bewegungen voraus.
Sei präsent im Hier und Jetzt. Finde dein inneres Zentrum.
Bleib ruhig und wachsam. Dein Geist muss klar wie ein Gebirgsquell sein, bevor du angreifst.
Ikarus schien anderer Meinung zu sein. Mein Feuervogel legte den Kopf schief, spreizte seine imposanten orangefarbenen Flügel und stieß einen empörten Schrei aus.
»Du wirst noch alle aufwecken«, warf ich ihm vor und wedelte mit der Hand, damit er sich einen anderen Ort suchte, um seinen scharfen Raubtierblick schweifen zu lassen.
Für gewöhnlich jagte er zu dieser nächtlichen Uhrzeit Mäuse, aber auch er schien zu spüren, dass heute etwas anders war. Seine schwarzen Augen blickten wachsam auf mich herab, beobachteten, wie ich mein Schwert sinken ließ und einen Stein über den vom Mond beschienenen Hof trat.
»Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, den er noch aufwecken könnte. Wir sind alle viel zu nervös, um zu schlafen. Schließlich ist es in wenigen Stunden so weit.«
Meine Freundin Rhiannon schlenderte langsam auf mich zu, als wollte sie sich jeden noch so kleinen Winkel der Tempelanlage einprägen. Den Säulengang, der den Hof umrahmte. Den mit Ornamenten verzierten Springbrunnen. Den Apfelbaum, der in voller Blüte stand und auf dem es sich Ikarus bequem gemacht hatte.
Sie seufzte.
»Lass mich raten«, sagte ich zu ihr. »Du bist unglücklich, weil der Tag der Auswahl unmittelbar bevorsteht und unsere Freundinnen immer noch nicht vorbereitet sind. Delia hat irgendeinen Makel an ihrem Kleid gefunden, der noch schnell ausgebessert werden muss. Isabeau überarbeitet schon wieder ihre Vorstellungsworte und Sybil treibt mit ihrer Ruhelosigkeit alle in den Wahnsinn.«
Rhiannons glockenhelles Lachen würde mir fehlen. Sie streckte den Arm aus, und Ikarus kam bereitwillig angeflogen, um sich von ihr am Kopf kraulen zu lassen. Unsere Feuervögel waren mittlerweile so gewaltig, dass Rhiannon den Arm anspannen und die Hand zur Faust ballen musste, um das Gewicht des Vogelkörpers tragen zu können. Ihre langärmelige dunkelrote Robe, über der sie einen blaugrauen Umhang trug, schützte sie vor den Krallen. Normalerweise trugen wir einheitliche Gewänder, doch für mein Kampftraining hatte ich mir Hosen und ein weites Leinenhemd genäht, die bequem und praktisch waren.
»Also, habe ich recht?«
»Fast«, erwiderte Rhiannon. »Delia ist mit ihrem Kleid zufrieden, aber ihre Frisur will einfach nicht sitzen. Und Sybil hat die Halskette verlegt, die ihre Mutter ihr eigens für den Tag der Auswahl hat anfertigen lassen. Was Isabeau betrifft, liegst du natürlich richtig.«
Schon seit Wochen bestimmte nichts anderes unsere Tagesordnung. Jedes unserer Gespräche drehte sich um die Auswahl – darum, an welchen Hof wir kommen würden und wie es sein würde, unsere Gabe für das Wohl unseres neuen Herrn einzusetzen. Delia war sich als Einzige sicher, dass die Entscheidung über ihre Zukunft bereits gefallen war. Ein Bekannter ihrer Eltern würde sie bitten, an seinem Hof zu dienen, und sie würde seine Einladung dankbar annehmen.
Nicht, dass wir wirklich eine Wahl gehabt hätten. Die Lords zahlten dem Orden, in dem wir lebten, ein hübsches Sümmchen, damit wir in ihren Besitz übergingen und ihnen fortan dienten. Schwester Caterina nannte es eine Aufwandsentschädigung. Schließlich waren wir im Orden großgezogen und ausgebildet worden. Aber ich hatte einmal mitbekommen, wie das Geld für eine Todesseherin den Besitzer wechselte, und es war weit mehr als eine Entschädigung gewesen. Es waren die ersten Goldmünzen gewesen, die ich zu Gesicht bekam, und es hatte mich zornig gemacht, dass wir einfach so verkauft wurden. Dass jemand anders über unsere Freiheit bestimmte.
Rhiannon betrachtete mich nachdenklich. Sie hätte nie zu mir gesagt, ich solle den Schwertkampf denen überlassen, die dazu geboren waren, und mich lieber auf den Tag der Auswahl vorbereiten, aber ich wusste, dass sie genau das dachte.
»Alle sind ganz kribbelig vor Aufregung, Ezlyn. Nur du stehst hier und schwingst deine Schwertklinge – als wäre es eine Nacht wie jede andere.«
»Du weißt, warum.«
Ich warf Rhiannon einen gequälten Blick zu. Nicht der Tag der Auswahl machte mir Sorgen, sondern das, was die Zukunft für mich bereithielt: Wir alle kannten unser Ende. Das ist das Schicksal einer Todesseherin. Sie sieht nicht nur den Tod der Menschen, deren Hand sie berührt, sondern auch ihren eigenen. Und ich würde durch die Hand eines Angelus Mortis sterben – eines Schattenkriegers, der einem anderen durch die bloße Berührung die Lebenskraft rauben konnte.
Ich hatte gesehen, wie seine Hand auf meiner Wange lag und dunkle Schatten mich gierig umfingen. Entsetzen und Verwunderung hatten in meinen Augen gestanden. Mein Mund war leicht geöffnet gewesen, als wollte ich etwas sagen, und getrocknetes Blut klebte an meinem Hals. Ich hatte ihn gesehen. Seinen stechenden Blick, seine schmalen, zusammengepressten Lippen.
Es war nur ein Bild gewesen, ein winziger Ausschnitt vom Augenblick meines Todes. Und was mich am meisten daran erschreckte, war mein Gesicht, auf dem sich keine einzige Falte zeigte. Kein Anzeichen dafür, dass ich auch nur ein Jahr älter war als jetzt.
Als ich diese Vision zum ersten Mal hatte, war ich noch zu jung gewesen, um sie zu begreifen. Später hatte ich geweint und getobt, doch das hatte mich nicht weitergebracht. Es änderte nichts an den Bildern, die mich noch heute in meinen Träumen heimsuchten. Schließlich hatte ich zum Schwert gegriffen und beschlossen, mich im Kampf zu trainieren, um mich gegen mein Schicksal aufzulehnen.
Rhiannon bedachte mich mit diesem mitleidigen Blick, den ich an ihr hasste. Dann schüttelte sie ihre dunkelblonden Haare, die ihr störrisch vom Kopf abstanden.
»Unsere Voraussagen sind nicht in Stein gemeißelt. Sie können sich ändern«, sagte sie.
Ich hatte ihr schon vor langer Zeit von meiner Vision erzählt.
»Genau deswegen bin ich hier – um den Schattenkrieger zu töten, bevor er mir zuvorkommt.«
Ich umklammerte den Griff meines Schwertes fester.
Sei präsent.
Bleib ruhig und wachsam.
Vielleicht war ich keine große Kriegerin, aber ich musste auch nicht in die Schlacht ziehen. Ich hatte nur einen einzigen Gegner, den es zu besiegen galt. Und ich bereitete mich auf diesen Kampf schon mein ganzes Leben lang vor. Wenn ich dem Angelus Mortis begegnete, würde ich bereit sein.
***
Auf unserem Flur herrschte Chaos. Die Sonne ging erst in wenigen Stunden auf, aber vermutlich würde keine von uns mehr ein Auge zumachen. Sybil war gerade dabei, sich von den jüngeren Todesseherinnen zu verabschieden, die erst im darauffolgenden Jahr den Tempel verlassen würden. Ich hörte sie beharrlich an Türen hämmern, bis ihr die schlaftrunkenen jungen Frauen öffneten.
»Schwester Caterina wird ihr den Kopf abreißen, wenn sie das mitbekommt«, feixte Delia, während sie eine Locke aus ihrer Zopfkrone zupfte und sich kritisch in ihrem kleinen Handspiegel betrachtete.
»Ich glaube, heute drückt sie ein Auge zu«, erwiderte ich.
Rhiannon und ich setzten uns auf das Bett nahe der Tür, in dem Delia sonst schlief. Sie schob eine Haarbürste, Haarnadeln und hellblaue Seidenblumen zur Seite, die überall verstreut lagen.
Wir teilten uns zu fünft ein Zimmer. Unsere Betten standen so dicht beieinander, dass Rhiannon und ich uns als kleine Mädchen immer an den Händen gehalten hatten, bis wir einschliefen. Manchmal war das enge Zusammenleben mit den anderen unerträglich gewesen. Aber von nun an würde ich es vermissen. Ich fürchtete mich davor, an einem fremden Hof, in einem fremden Zimmer aufzuwachen und ganz allein zu sein.
Rhiannon schien den gleichen Gedanken nachzuhängen, denn sie legte ihre Hand in meine und drückte sie kurz. Nach dem Tag der Auswahl würden wir uns nicht mehr wiedersehen. Wenn wir einander durch Zufall begegneten, war es uns verboten, Worte zu wechseln. Die Lords fürchteten, dass wir von den Todesarten sprechen könnten, die wir gesehen hatten, und uns somit in politische Belange einmischten.
»Solltet ihr euch nicht langsam fertig machen?«, fragte Delia.
Sie war endlich mit ihrer Frisur zufrieden und griff nach ihrem elfenbeinfarbenen Kleid, das auf einem Bügel direkt neben unseren hing. Unsere Alltagskleidung war aus robustem Baumwollstoff, aber diese festlichen Gewänder waren etwas ganz anderes. Die feine Seide fühlte sich glatt und kühl auf der Haut an. Winzige Silberperlen blitzten auf dem ausladenden Stoff. Bei der Anprobe hatte ich mich unwohl gefühlt, weil ich noch nie etwas so Wertvolles getragen hatte. Und auch jetzt scheute ich davor zurück, mein Kleid anzuziehen.
»Na komm, ich helfe dir«, sagte Rhiannon, die mein Zögern bemerkte.
Ich zog mich bis auf die Unterwäsche aus und stopfte meine Kampfkleidung in die Ausbuchtung unter meiner Matratze, wo ich sie vor Schwester Caterina versteckt hielt. Mein Schwert hatte ich in den Stallungen in einer alten Holzkiste verborgen. So machte ich es immer, doch diesmal war ich nicht sicher, ob ich es je wieder in der Hand halten würde. Blieb mir noch genug Zeit, um es hervorzuholen und zu meinem neuen Herrn mitzunehmen? Und würde ich meine Waffe unbemerkt an seinen Hof schmuggeln können? Sicher wäre kein Lord begeistert, wenn seine Todesseherin das Schwert schwingen wollte.
»Du siehst ganz blass aus«, stellte Rhiannon fest, nachdem sie mir das Kleid angezogen hatte.
Delia trat neben sie und kniff mir in die Wangen, dann musterte sie mich prüfend.
»Wir müssen ihr Haar neu flechten.«
Ich ließ es über mich ergehen, dass Rhiannon und Delia um mich herumsprangen, meine Haare kämmten und flochten, meine Lippen rosig färbten und meine Wangen mit Puder bestäubten, um die mir verhassten Sommersprossen abzudecken. Sie hatten Spaß daran. Und obwohl ich mir wie eine Puppe vorkam, die zurechtgemacht wurde, färbte ihr Lachen auf mich ab. Irgendwann kam Isabeau zur Tür herein und warf sich mit einem erschöpften Stöhnen auf ihr Bett.
»Weißt du jetzt, wie du dich den Lords vorstellen willst?«, fragte Delia geistesabwesend. Sie war damit beschäftigt, die Ärmel meines Kleides zurechtzuzupfen.
»Ich habe alles noch einmal neu formuliert«, antwortete Isabeau. »Wollt ihr es euch anhören?«
Wir murrten einstimmig. Isabeau hatte uns ihre Vorstellung schon etliche Male vorgelesen. Ich wusste gar nicht, warum sie sich so viel Mühe gab. Für die Lords waren wir nicht kostbar, weil wir besonders intelligent oder sprachlich gewandt, höflich oder hübsch waren. Unser Wert lag ausschließlich in unserer Gabe als Todesseherinnen und diese stand nicht auf dem Prüfstand. Wir hatten sie bereits vor vielen Jahren bewiesen, als man uns in den Orden aufnahm. Manche von uns freiwillig und manche eher nicht.
Sybils und Delias Eltern waren stolz auf ihre Töchter, als sie ihre Gabe entdeckten. Sie besuchten sie auch heute noch jede Woche im Tempel, brachten ihnen Schmuck oder besondere Leckereien und erzählten ihnen, wie sehr sie zu Hause vermisst wurden. Isabeau dagegen hatte als Fünfjährige die Krankheit und den Tod ihrer Mutter vorhergesagt. Als er tatsächlich eintrat, bekam ihr Vater solche Angst vor ihr, dass er sie in den Orden abschob und sich nie wieder bei seiner Tochter meldete.
Rhiannon und mich verband ein besonderes Schicksal. Wir waren unseren Eltern gewaltsam entrissen worden, weil sie uns nicht hergeben wollten. Die Ordensschwestern trugen keine Schuld an dem, was uns passiert war. Ein alvenisches Gesetz besagte, dass die Todesseherinnen äußerst wichtig für die Gesellschaft waren, sodass ihre Eltern ihr persönliches Wohl hintanstellen mussten. Daher durften wir nicht im Schoße unserer Familie aufwachsen und unseren Lebensweg auch nicht selbst bestimmen. In dem Moment, in dem unsere Gabe zutage trat, wurden wir zu Dienerinnen.
Es war eine bittere Ironie, dass wir über den Tod herrschten, aber gezwungen waren, den Lebenden zu dienen. Einmal hatte ich das gegenüber Schwester Caterina erwähnt, und sie hatte mir vor Schreck eine Ohrfeige verpasst. Es war das einzige Mal gewesen, aber ich hatte es nicht vergessen. Nie wieder hatte ich Zweifel an meinem Schicksal als Todesseherin geäußert, aber das hieß nicht, dass ich nicht damit haderte.
Ich wusste nicht, ob meine Eltern inzwischen tot waren, ob man sie für ihr Vergehen, mich zu verstecken, bestraft hatte oder ob sie mich einfach vergessen hatten. Und es spielte wohl auch keine Rolle. Ich konnte mich kaum noch an ihre Gesichter erinnern. Alles, was mir im Gedächtnis blieb, war ein altes Lied, mit dem meine Mutter mich immer in den Schlaf gesungen hatte. Manchmal summte ich die Melodie, aber der Text war mir entfallen. Auch jetzt gingen mir die Töne durch den Kopf und verflochten sich zu einem bittersüßen Lied.
»Du denkst wieder an deine Familie, nicht wahr?«, fragte Rhiannon.
Offenbar hatte ich leise vor mich hin gesummt.
»Ja, ich habe an meine Eltern gedacht«, erwiderte ich. »Aber sie sind lange fort. Ihr seid jetzt meine Familie.«
»Oh, Ezlyn.«
Rhiannon strich mir über die Wange. Tränen glitzerten in ihren Augen. Einen Moment waren wir beide stumm, während Delia mit dem Pinsel in einem Pudertöpfchen rührte und so tat, als hätte sie uns nicht gehört. Ihr waren solche Gefühlsäußerungen unangenehm.
Sybil stürmte ins Zimmer und riss uns aus unseren rührseligen Gedanken. Sie trug bereits ihr Festgewand. Offenbar hatte sie darin ihre Abschiedsrunde gedreht und nun war der Stoff ganz verknittert. Delia stieß ein missbilligendes Geräusch aus, aber dann musste sie unwillkürlich grinsen. Es war typisch für Sybil, dass ihre Kleidung unordentlich und sie in Gedanken ganz woanders war.
»Oh, seht ihr schön aus!«, rief sie, beugte sich über ihr Bett und durchwühlte die Kissen. »Wenn ich doch nur meine Halskette finden könnte! Sie soll mir Glück bringen. Mama wird beleidigt sein, wenn sie erfährt, dass ich sie verlegt habe.«
»Hast du schon unter dem Bett nachgesehen?«, fragte Rhiannon.
Und schon ließ sich Sybil in ihrem hellen Kleid auf die Knie fallen. Ich wusste nicht, wann wir zum letzten Mal den Boden gewischt hatten, aber vermutlich war es egal. Sybil würde auch in einem schmutzigen und verknitterten Kleid einen Lord finden. Schließlich konnte sich jeder Adlige glücklich schätzen, dem es gelang, eine Todesseherin an seinen Hof zu holen. Unsere Gabe war selten und kostbar.
Triumphierend reckte Sybil die Hand in die Höhe.
»Hab sie.«
Tatsächlich baumelte eine zweireihige Perlenkette von ihren Fingern herab. Es war mir ein Rätsel, wie sie unter das Bett geraten war.
»Warte, ich helfe dir, sie umzulegen«, bot Delia an und nahm Sybil die Kette ab.
Mittlerweile hatten wir alle unsere Kleider angezogen. Ich schaute in die Runde, und mir wurde ganz mulmig zumute. Zehn Jahre lang hatte ich mit diesen Mädchen im Tempel gelebt und nun würde man uns auseinanderreißen. Als hätten die festen Bande, die zwischen uns entstanden waren, nie existiert. Wir hatten immer gewusst, dass es eines Tages so kommen würde. Doch das machte es nicht weniger schmerzhaft.
Auf dem Weg nach unten, die gewundene Steintreppe hinab, wurden wir plötzlich ganz still. Selbst Sybil, die sonst unaufhörlich plapperte, sagte kein Wort mehr. Sie strich nur unablässig über den Rock ihres Kleides, als wären ihr die Knitterfalten darin gerade erst aufgefallen. Rhiannon schnupperte und zog die Nase kraus. Der beißende Geruch von Weihrauch erfüllte die Gänge und wurde stärker, je näher wir der Gebetshalle kamen. Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch die Bogenfenster und beleuchteten das graue Gemäuer, das in den vergangenen Jahren unser Zuhause gewesen war.
Wir würden diesen Tag wie jeden anderen mit der Morgenandacht beginnen. Nach dem Eintreffen der Lords folgte ein Kennenlernen, dann ein gemeinsames Mittagessen, und schließlich durften sie ihre Gebote abgeben.
»Wie auf einem Viehmarkt«, hatte Rhiannon mir zugeflüstert, als Schwester Caterina uns den Ablauf erklärte, und ich stimmte ihr im Stillen zu. Wir wurden verkauft. Und obwohl wir diejenigen waren, die den Lords künftig mit ihrer Gabe dienen würden, sahen wir keine einzige Münze als Lohn.
In der kuppelförmigen Gebetshalle war es kühl, und wir fröstelten in unseren dünnen Seidenkleidern. Ich spürte, wie sich die Härchen an meinen Armen aufrichteten, und ballte die Hände, um die Wärme in meinen Körper zu pressen. Sybil verschränkte zitternd die Arme.
»Aufrecht stehen«, zischte Schwester Caterina uns augenblicklich zu. »Dies ist ein heiliger Ort.«
Sybil zuckte zusammen wie ein junges Reh. Ihr Blick huschte zu Schwester Caterina hinüber, die neben der breiten, bogenförmigen Eingangstür stand und mit einem Streichholz die Kerzen in einem der fünfarmigen Leuchter entzündete.
Wir traten in die Mitte der Halle und bildeten einen Halbkreis um das Buch des Lebens, das aufgeschlagen auf einem Marmorpodest lag. Eine nach der anderen legten wir eine Hand auf das Buch und sprachen ein stummes Gebet. Dabei hielten wir unseren Blick auf das Auge der Vorsehung gesenkt – eine Tätowierung auf unserem mittleren Fingerknöchel, die ein Auge zeigte, umschlossen von einem Dreieck. Es war das Zeichen der Todesseherinnen, das wir bei unserer Aufnahme in den Orden erhalten hatten.
Schwester Caterina hatte uns in den vergangenen Jahren jeden Morgen aus diesem dicken, in Leder gebundenen Buch vorgelesen, das mit Blattgold geprägt war. Ihr langer dünner Finger mit dem kurz geschnittenen, halbmondförmigen Nagel glitt über die schnörkeligen Buchstaben, und die Enden ihrer langen weißgrauen Haare kitzelten über die Seiten. Meistens horchte ich gar nicht richtig hin, aber heute würde ich ihre sonore Stimme zum letzten Mal hören. Und so schloss ich die Augen und konzentrierte mich auf die Geschichte, die mir so wohlbekannt war, dass ich die Worte hätte mitsprechen können:
So aber trat Eira vor die drei Götter und bat sie darum, ihr Volk zu retten. Und weil sie ihr Ansinnen voll Demut hervorbrachte, erhörten die Götter sie und gaben ihr drei Geschenke mit auf den Weg.
Der erste Gott gab ihr das Versprechen, ein Menschenleben zu verschonen, wenn ein anderes dafür geopfert würde.
Der zweite Gott schenkte ihr die Gabe, um dieses Leben zu bitten.
Der dritte Gott war voller Mitleid und deswegen erfand er eine List. Er schenkte Eira die Kraft, ihre Gabe so oft einzusetzen, wie es ihr beliebte.
So kam es, dass Eira dem Tod immer einen Schritt voraus war. Sie rettete ein Menschenleben, und wenn der Tod sich ein anderes holen wollte, bat sie ihn, auch dieses zu verschonen. Und weil es der Wille der Götter war, musste der Tod gehorchen. Eiras Volk aber blühte und gedieh wie ein Blumenfeld im Frühlingsregen.
Als Schwester Caterina schon fast geendet hatte, befiel Sybil ein nervöser Schluckauf. Wir anderen hielten die Köpfe gesenkt und pressten die Lippen aufeinander, um nicht laut zu lachen. Schwester Caterina hielt inne. Ich blinzelte unter meinen Lidern hervor und sah, dass sie zornig war. Die arme Sybil war schon zum wiederholten Mal unangenehm aufgefallen und ihr knittriges Kleid machte es bestimmt nicht besser.
Schwester Caterina fing sie ab, als wir die Gebetshalle verließen.
»Du wirst nachher bei der Auswahl neben mir gehen und dich im Hintergrund halten. Und du wirst nur reden, wenn ich es dir erlaube«, befahl sie mit knappen, strengen Worten.
Sybil traten die Tränen in die Augen. Sie hatte vor den Lords glänzen wollen. Nun würde sie wie ein kleines Mädchen, das nicht für sich selbst sprechen durfte, an der Seite der Ordensschwester stehen müssen.
Selbst die Götter kannten Mitleid. Doch bevor ich Schwester Caterina daran erinnern konnte, wurde draußen Hufgetrappel laut. Kies knirschte und Wagenräder quietschten. Das Bellen von Hunden mischte sich unter die eilig ausgetauschten Befehle der Dienstboten, alles gedämpft durch die geschlossene Eingangstür.
Delia drängte sich nach vorn, um die Gebetshalle als Erste zu verlassen. Aber als ihre Hand auf dem dunklen Holz der Tempeltür lag, zögerte sie und drehte sich noch einmal um. Schwester Caterina nickte, und mein Herz pochte lauter, als ich es für möglich gehalten hatte.
Ich atmete langsam und konzentriert ein und aus. Auf der anderen Seite dieser Tür wartete meine Zukunft, und ich würde ihr entgegentreten wie einem Schwertkampf: mit scharfem Verstand und meinem Gegner immer einen Schritt voraus – so wie Eira im Buch des Lebens dem Tod entgegengetreten war.
Kapitel 2
»Lady Ezlyn Davarin«, stellte Schwester Caterina mich vor, und ich versank mit einem tiefen Knicks in meinen Röcken, wie ich es gelernt hatte.
Noch nie hatte ich so viele Augen auf mir gespürt. Augen, die mich abschätzten und meinen Wert bemaßen, obwohl er mir wohl kaum an der Nasenspitze anzusehen war.
Ich musste an den Tag denken, als ich im Orden aufgenommen worden war. Drei Ordensschwestern hatten mir damals in langen, dunklen Roben gegenübergestanden, während ich auf einem unbequemen Holzstuhl saß und die Beine baumeln ließ, weil meine Füße noch nicht bis zum Boden reichten. Die Älteste war vor mir in die Hocke gegangen und hatte meine Hand in ihre genommen. Sie war warm und rau und faltig gewesen.
»Sag mir, was du siehst«, hatte sie mich mit sanfter Stimme gebeten.
Ich wollte meine Hand wegziehen und den Kopf schütteln, denn ich hatte gesehen, wie sie starb, und es war kein schöner Tod gewesen. Wenn ich ihr davon erzählt hätte, wäre sie wütend geworden. Aber sie fragte mich noch ein zweites Mal und ich hatte Angst, mich ihr zu widersetzen. Also wisperte ich meine Antwort und wartete darauf, dass sie mich schlagen oder eine Lügnerin schimpfen würde. Doch sie lächelte nur zufrieden.
Die drei anwesenden Ordensschwestern hatten damals genickt und meinen Wert bemessen, und sie hatten beschlossen, dass er hoch war. Ich war nicht sicher, ob die Lords heute zu dem gleichen Schluss kommen würden.
Es gab elf von ihnen. Sie waren aus ihren glänzenden schwarzen Kutschen gestiegen und hatten sich in einem Halbkreis um uns herum aufgestellt. Ich musste blinzeln, um sie sehen zu können, weil wir im Schatten des Säulenganges standen und sie auf dem sonnigen Hofplatz. Sie beäugten mich wie eine Ziege auf dem Markt, die zu wenig Fleisch auf den Rippen hatte.
Die Dienstboten schlossen eilig die Türen der Kutschen und gaben den Fuhrknechten ein Zeichen, sich zu den Stallungen zu begeben. Dort würde man die Pferde versorgen. Es waren schöne Tiere, kräftig und mit voller Mähne. Ein Schimmel schüttelte schnaubend den Kopf, als einer der Fuhrknechte die Peitsche knallen ließ, aber wenig später setzten sich die Pferde gehorsam in Bewegung und die Kutschen ruckelten davon.
Jetzt standen nur noch die Lords vor uns. Sie strichen ihre Gewänder glatt, zupften die schwarzen Handschuhe zurecht und warteten auf Schwester Caterinas Worte. Einer von ihnen war so alt, dass er bereits am Stock ging. Seine Stirn war voller Falten und das rotgoldene Gewand hing ihm schwer von den gebückten Schultern. Doch sein Blick war aufmerksam, während er erst die Ordensschwester und anschließend mich musterte. Der Jüngste war ein oder zwei Jahre älter als ich. Er stand an der Seite eines anderen Mannes, der vermutlich sein Vater war, und hatte die Lippen zu einem schmalen Strich aufeinandergepresst. Erst dachte ich, er sei verärgert, aber dann sah ich das amüsierte Funkeln in seinen grünen Augen. Er beugte sich zu dem Mann neben ihm und flüsterte ihm etwas zu.
Ich wurde unruhig von ihrem Getuschel. Meine Hände krampften sich in den Stoff meines Kleides und mein Lächeln gefror in meinem Gesicht. Als Schwester Caterina zu Isabeau trat, um sie vorzustellen, und damit die Aufmerksamkeit von mir ablenkte, atmete ich erleichtert auf.
»Allesamt hübsche Mädchen«, kommentierte ein dickbäuchiger Lord mit rotem Gesicht und Vollbart, als die Vorstellungsrunde beendet war. »Aber wie steht es um ihre Fähigkeiten?«
Ich konnte beinahe spüren, wie sich Schwester Caterina hinter unserem Rücken versteifte. Unsere Gabe war etwas Heiliges und sie infrage zu stellen ein Frevel. Der jüngste Lord gab ein unterdrücktes Prusten von sich. Um Schwester Caterinas Unmut zu entgehen, senkte er den Kopf und starrte auf seine polierten schwarzen Lederstiefel.
»Ich kann Euch versichern, Lord Theon, dass wir unsere Mädchen sorgfältig prüfen und ausbilden. Aber vielleicht wollt Ihr Euch bei einem Rundgang durch unsere Tempelanlage selbst davon überzeugen?«
Lord Theon brummte zustimmend und Schwester Caterina nickte, zufrieden darüber, dass ihr Tagesplan nicht aus dem Takt geriet.
***
Wir teilten uns in drei Gruppen auf. Delia hatte drei Lords um sich geschart, die ihre Fähigkeiten als Todesseherin offenbar genauso schätzten wie ihre Schönheit. Mir war es unerträglich, wie ihre Blicke über Delias ebenmäßiges Gesicht und die wohlgeformten Rundungen ihres Körpers glitten, aber ihr schien es nichts auszumachen. Sie lächelte, als wäre sie eine Braut auf ihrer Hochzeit, und das elfenbeinweiße Kleid tat sein Übriges, um dieses Bild zu unterstreichen. Nur dass sich statt eines Bräutigams gleich mehrere um sie drängten.
Rhiannon und Isabeau führten eine Gruppe mit vier weiteren Lords an, und ich gesellte mich zu Schwester Caterina und Sybil, die Lord Theon, den gebückten Alten, und den jungen Lord mit seinem Vater durch den Tempel führten.
Wir starteten in der Bibliothek, die den jungen Lord nur wenig interessierte, obwohl der Bau mit seinen kunstvollen Deckengemälden und den mit Gold verzierten Marmorsäulen recht eindrucksvoll war. Er hielt die Arme hinter dem Rücken verschränkt und die blonden Locken fielen ihm in die Stirn, während er hinter uns herschlenderte. Einmal musste er sogar ein Gähnen unterdrücken. Schwester Caterina redete und redete – über die heiligen Schriften, die Geschichte des Tempels und seine Architektur. Irgendwann wurden selbst meine Lider schwer.
»Wie wäre es mit ein wenig frischer Luft?«, schlug der junge Lord unvermittelt vor.
Schwester Caterina hielt mitten im Satz inne. Ich spürte, dass ihr eine scharfe Erwiderung auf der Zunge lag, weil sie unterbrochen worden war, aber sie fing sich schnell wieder und lächelte.
»Natürlich, Mylord. Lasst uns einen kleinen Spaziergang zu den Kräutergärten unternehmen.«
»Habt Ihr nichts Fesselnderes? Es fiel mir schon immer schwer, mich für Unkraut zu begeistern.«
»Malachi«, zischte der Vater des jungen Lords vorwurfsvoll.
Er sah aus, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Seine langen Haare flogen hin und her, während er warnend den Kopf schüttelte.
Je länger ich Vater und Sohn betrachtete, desto unähnlicher kamen sie mir vor. Sie waren beide groß und schlank, hatten blonde Haare und das gleiche hochmütige, etwas steife Auftreten. Aber während der ältere Lord mit seiner langen, spitzen Nase und dem verkniffenen Zug um den Mund beinahe beängstigend wirkte, hatte Malachis Gesicht etwas Offenes, wenn auch ein wenig Verwöhntes.
»Das ist schon in Ordnung, Lord Caius«, beschwichtigte ihn Schwester Caterina.
Aber ihr war anzumerken, dass gar nichts in Ordnung war. Sie hätte Malachi sicher am liebsten bei den Ohren gepackt, ihn gezwungen sich hinzuknien und die Handflächen zu heben, um ihm zur Strafe für sein Benehmen zehn Rutenhiebe zu verpassen. So machte sie es mit uns, wenn wir uns unangemessen verhielten. Aber natürlich musste sie gegenüber den Lords die Fassung bewahren.
Malachi wirkte gänzlich unbeeindruckt von der zornigen Furche, die sich auf der Stirn seines Vaters gebildet hatte.
»Was ist mit den Feuervögeln?«, fragte er munter. »Wo sind die untergebracht?«
Lord Theon lachte, laut und tief und leicht besorgt.
»Der junge Lord beweist Mut«, sagte er.
Die Feuervögel der Todesseherinnen waren für ihre Schönheit ebenso bekannt wie für ihr Misstrauen gegenüber Fremden. Es war schon häufig vorgekommen, dass eine unbedachte Annäherung mit einem zerkratzten Gesicht oder einem abgebissenen Finger geendet hatte. Einmal mussten wir einen neugierigen Stallknecht, der sich in die Falknerei geschlichen hatte, von einer aufgebrachten Vogelschar befreien, die ihr Heim mit Schnäbeln und Klauen verteidigt hatte. Es hätte den Mann fast das Leben gekostet. Er trug noch heute Narben an Gesicht und Körper und nahm jedes Mal Reißaus, wenn ein Feuervogel in der Nähe war.
Malachis Augen leuchteten.
»Nun, ich mag gefährliche Dinge«, sagte er.
Ich war nicht sicher, was ich von dem jungen Lord halten sollte. Er sah attraktiv aus, doch er war überheblicher, als gut für ihn war. Er schien sich der Provokation seiner Worte wohl bewusst zu sein und genoss Schwester Caterinas sichtliche Empörung und die Verärgerung seines Vaters.
»Dann sollten wir keine Zeit verlieren«, sagte ich. »In der Falknerei findet gerade die Fütterung statt.«
Ich war neugierig, ob Malachi angesichts der Feuervögel immer noch so gelassen und selbstsicher wirken würde.
Sybil stieß einen unwilligen Laut aus. Sie hasste die Fütterung. Sie konnte es einfach nicht mit ansehen, wie die Vögel erst kleine Happen aus den toten Mäusekörpern pickten, um die Tiere dann im Ganzen hinunterzuschlingen. Schwester Caterina widerstrebte es ebenfalls, unsere Gäste in die Falknerei zu führen, aber nun konnte sie keinen Rückzieher mehr machen.
Wir schlenderten durch den Kreuzgang und über den Hof, vorbei am Kräutergarten und den Hügel hinauf zum Turm, in dem die Falknerei untergebracht war. Unsere Feuervögel konnten sich frei bewegen, aber sie flogen nicht allzu weit weg, und zu den Fütterungszeiten kamen sie immer zurück zum Turm. Über uns kreisten bereits die ersten Tiere, die orangefarbenen Flügel weit ausgestreckt. Sie sahen bedrohlich aus, als würden sie jeden Moment auf uns herabstoßen und ihre scharfen Krallen in unser Fleisch bohren. Doch sie suchten nur nach ihren Besitzerinnen. Ikarus konnte ich nirgends entdecken. Er hatte einen weißen Fleck am Bauch, den ich selbst aus dieser Entfernung sicher erkannt hätte.
»Vielleicht sollten wir hier unten bleiben und die Feuervögel besser aus der Ferne beobachten?«, schlug Schwester Caterina vor. Sie wusste, dass ein verwundeter Lord für großen Ärger sorgen würde.
Aber Malachi hatte seinen Fuß bereits auf die unterste Steinstufe des Turms gesetzt und beachtete sie gar nicht. Der alte Lord musterte die gewundene Treppe stirnrunzelnd.
»Ich werde hier unten warten«, sagte er. »Meine Beine machen das nicht mehr mit.«
»Natürlich, Lord Abbot.«
Sybil machte den Mund auf. Wahrscheinlich wollte sie dem Lord anbieten, ihm Gesellschaft zu leisten. Doch dann schien sie sich wieder an Schwester Caterinas Verbot zu erinnern, nicht unaufgefordert zu sprechen, und sie hielt inne. Ich drängte mich an ihr vorbei und folgte Malachi. Auf keinen Fall wollte ich seine Reaktion auf die Feuervögel verpassen. Ich konnte es nicht erwarten, dass endlich die Langeweile aus seinem Gesicht gefegt wurde.
Unsere Schritte hallten, während wir den engen, dunklen Treppenaufstieg erklommen. Die Stufen waren schon ein wenig verwittert. Hier und da zogen sich Risse durch den grauen Stein. Ich heftete meinen Blick auf die goldenen Schnallen an Malachis Stiefeln. Er rannte fast, so ungeduldig war er.
Als wir den oberen Treppenabsatz erreicht hatten, waren die meisten Vögel bereits in der Falknerei gelandet. Sie scharten sich um Schwester Ingrid, die mit der Fütterung beschäftigt war. Die Ordensschwester stellte den Eimer mit den toten Mäusen vor einen der Vögel und warf ihm zwei der fetten Tiere zu. Der Feuervogel fing die erste Maus aus der Luft und schlang sie hastig herunter. Seine schwarzen Augen musterten uns wachsam.
Jetzt sah ich auch Ikarus, der sein Gewicht ungeduldig von einer Kralle auf die andere verlagerte. Er hatte Hunger. Als er mich erblickte, krächzte er zufrieden und riss den Schnabel auf wie ein Vogeljunges, das von seiner Mutter gefüttert werden wollte. Ich griff in den Eimer mit den Mäusen, packte eine von ihnen am Schwanz und warf sie ihm zu. Das Tier war mit einem Happs verschlungen.
Es war zugig in dem kreisrunden Raum unter dem Dach. Der Wind heulte durch die viereckigen Maueröffnungen. Von dem Stroh, das überall auf dem Boden lag und mit Vogelkot und ausgewürgten Fell- und Knochenresten vermengt war, ging ein widerwärtiger Geruch aus. Malachi rümpfte die Nase, doch er schien fasziniert von den Feuervögeln. Er musterte die Tiere mit zusammengekniffenen Augen und konzentriertem Blick.
Ein Feuervogel kam von draußen her angesegelt, ließ sich mit ausgebreiteten Flügeln in einer der Maueröffnungen nieder, die er fast gänzlich ausfüllte, und stieß einen lauten Schrei aus. Zufrieden bemerkte ich, wie die Lords zusammenzuckten. Die Tiere machten Eindruck auf sie. Doch Schwester Ingrid beachtete den Vogel gar nicht. Sie war von zwei anderen abgelenkt, die zeternd um eine Maus kämpften und mit den Schnäbeln nacheinander hackten.
»Ruhig! Es ist genug für alle da«, rief sie.
»Ich kann das nicht«, stieß Sybil da plötzlich würgend hervor.
Keinem von uns war aufgefallen, wie bleich sie beim Anblick der toten Mäuse geworden war. Eine Haarsträhne klebte an ihrem schweißnassen Gesicht, und ich bekam Angst, dass sie sich gleich übergeben würde.
»Soll ich dich hinunterbringen?«, fragte ich, aber da hatte sie sich schon umgedreht und war fluchtartig die Treppe hinuntergerannt.
Wir lauschten ihren leiser werdenden Schritten, und Schwester Caterinas Hand zitterte vor Wut, vermutlich weil schon wieder etwas nicht nach Plan verlaufen war.
»Sie kann Lord Abbot unten Gesellschaft leisten«, versuchte ich die Situation zu entschärfen.
Lord Theon hustete in ein blütenweißes Taschentuch, dann zwinkerte er vertraulich in die Runde.
»Man kann es dem Mädchen nicht verdenken, auch wenn diese Tiere außerordentlich faszinierend sind. Wollt Ihr uns nicht etwas über die Feuervögel erzählen, ehrwürdige Schwester? Ich bin sicher, Ihr habt einige spannende Geschichten parat.«
Während die Ordensschwester zu einem neuen Vortrag ansetzte, beobachtete ich Lord Caius und seinen Sohn. Sie hatten sich von uns abgewandt und standen Schulter an Schulter vor Rhiannons Feuervogel, der in einer Mauernische auf einer Stange saß und sein Gefieder putzte.
»Was meinst du?«, fragte der Lord mit gesenkter Stimme.
Malachi zuckte die Schultern.
»Hübsch sind sie beide nicht. Aber das Pferdegesicht ist auch noch feige. Hast du gesehen, wie sie die toten Mäuse angeschaut hat. Erbärmlich!«
Wut flammte in mir auf. Wir alle hatten uns schon über Sybil lustig gemacht, weil sie einen so empfindlichen Magen hatte. Doch wir hätten sie deswegen nie als feige bezeichnet, und als Pferdegesicht schon gar nicht. Was fiel diesem Lord ein, so über uns zu sprechen?
»Wir sollten uns auf den Rückweg machen. Das Mittagessen wird bald aufgetragen«, schlug Schwester Caterina vor, deren Redefluss schließlich zu einem Ende gekommen war.
»Das klingt nach einem großartigen Vorschlag.«
Lord Theon rieb sich den Bauch, als könnte er es kaum erwarten. Dicht gefolgt von der Ordensschwester stieg er die Wendeltreppe hinab, Lord Caius direkt hinter ihnen. Einzig Malachi konnte sich von dem Anblick der Feuervögel nicht losreißen. Ich trat neben ihn und streckte meine Hand nach Ikarus aus, der sofort angeflogen kam. Seine Krallen zerrissen den Ärmel meines Kleides, als er sich darauf niederließ, aber das war es mir wert.
»Er ist wunderschön, nicht wahr?«, sagte ich.
Malachi runzelte die Stirn, weil ich es gewagt hatte, ihn einfach so anzusprechen, aber er nickte.
»Das ist er.«
»Wollt Ihr ihn streicheln?«
Statt einer Antwort zog er seinen schwarzen Handschuh aus und streckte seine Hand nach Ikarus aus.
»Vorsichtig!«, stieß ich hervor.
Ich bezweifelte, dass Ikarus Malachi etwas antun würde, solange er auf meinem Arm saß, und selbst wenn, hätte ich mich vermutlich bei Ikarus dafür bedankt. Der junge Lord verdiente es nicht anders, nach dem, was er über Sybil gesagt hatte. Doch meine vorgetäuschte Sorge erlaubte es mir, nach Malachis Hand zu greifen und sie zögerlich auf das Gefieder des mächtigen Vogels zu legen.
Die Berührung war ungehörig, aber Malachi war viel zu sehr mit Ikarus beschäftigt, um sich darüber Gedanken zu machen. Erst als ich einen Schritt zurücktrat und erschrocken keuchte, sah er mich verwirrt an.
»Was ist los?«
Ich hob meinen Arm und bedeutete Ikarus davonzufliegen, was er auch folgsam tat. Dann umklammerte ich meine Hand, die eben noch auf Malachis gelegen hatte, und starrte ihn entsetzt an.
»Nichts, Mylord. Es tut mir leid.«
Malachis Blick flog zu meiner Hand und er zählte endlich eins und eins zusammen. »Ihr habt etwas gesehen, habe ich recht? Ihr habt meinen Tod gesehen.«
»Nein, ich … Ich darf nicht … Es tut mir leid«, stammelte ich.
Er trat einen Schritt auf mich zu, packte meine Schultern und schüttelte mich.
»Sagt mir, was Ihr gesehen habt! Sofort.«
Jetzt sah er definitiv nicht mehr gelangweilt aus, eher ein wenig panisch. Ich unterdrückte ein Grinsen und riss meine Augen weit auf.
»Die Treppe«, stieß ich hervor. »Ihr müsst sehr vorsichtig sein.«
Dann machte ich mich von ihm los, schlug die Hand vor den Mund und tat so, als müsste ich ein Schluchzen unterdrücken. Während ich mich umdrehte und wie ein verängstigtes Kaninchen die Treppe hinablief, war ich mir sicher, er würde mir hinterherrennen, mich zu sich herumreißen und mir mein mieses Schauspiel mit einer Ohrfeige danken. Ich hatte es eindeutig übertrieben. Er wusste mit Sicherheit, dass ich nichts dergleichen gesehen hatte.
Aber er folgte mir nicht.
***
»Wo bleibt mein Sohn?«, fragte Lord Caius, nachdem wir einige Zeit vor dem Turm gewartet hatten.
Er hatte eine goldene Uhr aus der Innentasche seines schwarz-grünen Gewands gezogen, deren Deckel er nun ungeduldig auf- und zuschnappen ließ. Er war kein Mann, der es gewohnt war, zu warten. Malachi würde seinen Ärger sicher gleich zu spüren bekommen.
»Er ist vermutlich noch bei den Feuervögeln«, antwortete ich mit einem höflichen Lächeln. »Er schien sehr angetan von ihnen.«
Ich konnte ja schlecht sagen, dass Malachi sich zitternd vor Angst die Treppe hinunterkämpfte. Stufe für Stufe. Und alles nur, weil er Sybil ein feiges Pferdegesicht genannt hatte.
Kapitel 3
Schwester Caterina hatte uns ermahnt, beim Mittagessen nur »höfliche Bissen« zu uns zu nehmen. Beim Anblick der vielen köstlichen Speisen fragte ich mich, was das überhaupt sein sollte: »höfliche Bissen«. Den saftigen Truthahn, den würzigen Wildschweineintopf, das herrlich duftende, warme Brot und die verschiedenen Obst- und Käseplatten konnte man wirklich nicht höflich verschmähen. Rhiannon, die neben mir saß, hatte offenbar den gleichen Gedanken, denn sie schaufelte sich unter Schwester Caterinas missbilligendem Blick den Teller voll. Ich beschloss, von allem etwas zu probieren, achtete aber darauf, nur kleine Portionen zu nehmen.
Wir saßen den Lords in einer langen Reihe gegenüber, mit Schwester Caterina am Kopf des Tisches. Auch Schwester Ingrid und zwei weitere Ordensmitglieder hatten sich zu uns gesellt. Während um mich herum erste Gespräche in Gang kamen, stierte ich auf meinen Teller. Mein Kopf war wie leer gefegt. Ich fühlte Malachis brennenden Blick auf mir. Natürlich hatte er begriffen, dass ich ihm einen Streich gespielt hatte, doch anders als erwartet, schien er nicht verärgert. Er musterte mich wie einen der Feuervögel. Als hielte er mich nun für ebenso gefährlich und faszinierend.
Die Tiere waren auch beim Essen Gesprächsthema.
»Ich muss schon sagen«, begann Lord Theon schmatzend, »Eure Feuervögel sind ganz außergewöhnlich. Aber mir machen sie ein wenig Angst.«
»Es sind eben Raubtiere, das darf man nie vergessen«, erwiderte Schwester Caterina.
Das Thema raubte ihr offenbar den Appetit. Sie hatte ein Stück Truthahnfleisch in dunkle Soße getunkt und schob es nun auf ihrem Teller von links nach rechts.
Malachis Augen wurden schmal.
»Der Mensch ist ebenfalls ein Raubtier. Sagt, fürchtet Ihr Euch vor Lady Sybil oder Lady Ezlyn, Lord Theon?«, fragte er seinen Sitznachbarn.
Der dickbäuchige Lord sah mich an und stieß ein tiefes, gutmütiges Lachen aus. Ein wenig Bratensoße tropfte von seiner Gabel auf seinen hüpfenden Bauch.
»Natürlich nicht.«
»Vielleicht solltet Ihr das«, sagte Malachi. »Ich bin sicher, einige der Ladys sind zu weitaus Schlimmerem als ein Feuervogel fähig, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Was denkt Ihr, Lady Ezlyn? Würdet Ihr Eure Krallen zeigen, wenn Lord Theon Euch angriffe?«
Die Gespräche am Tisch verstummten. Augen wanderten zwischen dem jungen Lord und mir hin und her. Die Luft knisterte förmlich vor Spannung. Malachi erwartete wohl, dass ich stumm den Kopf schüttelte. Er wollte, dass ich zugab, einen Fehler gemacht zu haben, als ich ihn in der Falknerei vor seinem angeblich nahenden Tod gewarnt hatte. Denn keine Todesseherin durfte es wagen, einen Lord in die Irre zu führen.
Ich aber hatte es getan. Aus gutem Grund. Und ich würde mich nicht dafür entschuldigen.
Schlage deinen Gegner mit seinen eigenen Waffen. Mache den Schwung, mit dem er vorwärtsstürmt, zu deinem eigenen.
Malachi hatte Sybil feige genannt. Ich beugte mich ein wenig vor und erwiderte seinen herausfordernden Blick. Seine grünen Augen bohrten sich wie Dolchspitzen in meine, aber ich blinzelte nicht.
»Wir sind uns sicher einig, Mylord, dass Feigheit keine Tugend ist«, erwiderte ich.
Schwester Caterina zog scharf die Luft ein, als hätte ich Malachi gerade einen Handschuh vor die Füße geworfen und ihn zum Duell aufgefordert. Und angesichts des entzückten Leuchtens in seinen Augen hätte man meinen können, ich hätte es tatsächlich getan.
Lord Caius runzelte verärgert die Stirn. »Was für ein groteskes Thema. Ich bin sicher, niemand will hier irgendwen in die Enge treiben oder angreifen.«
»Gewiss nicht, Vater«, sagte Malachi.
Hatte er mir gerade zugezwinkert? Rhiannon kniff mir unter dem Tisch in den Oberschenkel. Also hatte sie es ebenfalls bemerkt. Ich wandte mich wieder meinem Teller zu. Mittlerweile war der Wildschweineintopf kalt geworden und das Brot von der Bratensoße ganz aufgeweicht. Aber die Lust am Essen war mir ohnehin vergangen. Ich konnte nur noch daran denken, dass ich einen Kampf begonnen hatte, dem ich vielleicht nicht gewachsen war.
»Ihr müsst in heller Aufregung sein, ehrwürdige Schwester Caterina. Schließlich steht der Besuch des Kaisers noch in diesem Jahr bevor«, lenkte Lord Caius das Gespräch in eine andere Richtung.
Sein gekräuselter Mund verriet, dass er von den Provokationen seines Sohnes noch immer unangenehm berührt war. Schwester Caterina nickte ihrem Sitznachbarn dankbar zu.
»Durchaus, Lord Caius. Es wird uns eine große Ehre sein, Seine Majestät in unserem Tempel willkommen zu heißen. Und wir sind Euch sehr verbunden für die Unterstützung bei der Organisation dieses Festtags.«
Sie schaute in die Runde und tauschte Blicke mit einigen anderen Lords, die ebenfalls an der Vorbereitung der Festlichkeiten beteiligt zu sein schienen.
Acht Jahre war es her, dass der Kaiser den Tempel das letzte Mal besucht hatte. Ich dachte daran, wie Rhiannon und ich uns damals hinter einigen Büschen versteckt hatten, um den Mann zu sehen, der unser Land regierte. Wir waren zu jung gewesen, um an der Feier teilnehmen zu dürfen. Aber zwischen Zweigen und grünen Blättern hatten wir einen kurzen Blick auf sein goldenes, mit funkelnden Diamanten besetztes Gewand erhascht, bevor uns eine der Ordensschwestern entdeckte und auf unser Zimmer scheuchte.
Vielleicht würde ich ihn diesmal zu Gesicht bekommen. An der Seite meines neuen Lords, den ich zu diesem Fest begleiten und dem ich treu dienen würde. Bei dem Gedanken legte sich ein unsichtbares Gewicht auf meine Brust.
***
Nach dem Essen zogen die Lords sich gemeinsam mit den Ordensschwestern zurück. Sie würden nun ihre Gebote für jede von uns abgeben. Wir gingen in den Hof, setzten uns an den Rand des Springbrunnens und ließen uns die Sonne ins Gesicht scheinen. Sybil rang unablässig die Hände. Vielleicht weil sie befürchtete, dass keiner der Lords für sie bieten würde. Delia und Isabeau unterhielten sich über die Tempelführung und darüber, welchen Eindruck die Lords auf sie gemacht hatten. Und Rhiannon ließ abwesend ihre Hand durch das klare Wasser gleiten.
Ich betrachtete das türkis-gelbe Mosaik auf dem Grund des Brunnens, das durch die unruhige Wasseroberfläche verzerrt wirkte. Es zeigte das Auge der Vorsehung. Als wir jünger waren, hatten wir im Sommer oft unsere Strümpfe ausgezogen, die Röcke gerafft und waren durch das Wasser getanzt. Auch jetzt verlockte es mich, die Fußspitze in das kalte Nass zu tauchen.
Rhiannon sah zu mir auf und ich grinste breit.
»Wollen wir? Ein letztes Mal?«, sagte sie.
Delia stemmte entrüstet die Hände in die Hüften, als wir kichernd die Schnallen unserer Sandalen öffneten und den Saum unserer Seidenkleider hoben.
»Ihr werdet euch nass machen. Was sollen die Lords denken?«
»Und was die Ordensschwestern?«, fügte Isabeau hinzu.
Doch Rhiannon und ich standen schon bis zu den Knien im Wasser. Es war herrlich. Ich konnte spüren, wie die Kühle meine Haut sanft umspielte, wie sie über die Blase strich, die ich mir am kleinen Zeh zugezogen hatte, und den Schmerz linderte.
»Kommt schon!«, rief ich den anderen zu.
Ich hielt Isabeau meine Hand hin, damit sie uns folgte. Rhiannon tat das Gleiche bei Sybil.
»Ihr seid unverbesserlich.« Isabeau verdrehte die Augen, aber sie zog ebenfalls ihre Sandalen aus.
Sybil drehte wachsam den Kopf von rechts nach links, als befürchtete sie, Schwester Caterina könnte hinter einer Säule oder einem Baum hervorspringen und uns zur Ordnung rufen.
Im nächsten Moment war auch Delia zu uns in den Brunnen geklettert, bevor wir sie überhaupt darum gebeten hatten. Und dann tanzten wir zu fünft durch das Wasser und es war wieder wie früher. Es spritzte nach allen Seiten, Tropfen glitzerten im Sonnenlicht und Wellen schlugen gegen den Rand des Springbrunnens. Wir fassten uns an den Händen, drehten uns im Kreis und lachten, bis wir keine Luft mehr bekamen.
Ich schwor mir, diesen Moment niemals zu vergessen. Die lachenden Gesichter der anderen Mädchen. Das Glück, das in meinen Adern pulsierte. Den Geschmack von Freiheit auf meinen Lippen. Würde es je wieder so sein? Konnte ich am Hof eines reichen Lords dieses sorglose, unverfälschte Glück finden, das wir uns mit vereintem Frohsinn geschaffen hatten?
»Das darf nicht wahr sein.« Schwester Ingrids strenge Stimme ließ uns abrupt innehalten. Unser Gelächter verstummte. »Ihr seid Todesseherinnen, keine kleinen Mädchen, also benehmt euch auch so!«
Die Ordensschwester kam durch den Säulengang auf uns zugeeilt, die Brauen gehoben und die Hände in einer vorwurfsvollen Geste ausgestreckt.
»Ja, Schwester Ingrid.«
»Es tut uns leid, Schwester Ingrid.«
Eine nach der anderen kletterten wir mit gesenktem Kopf und betroffenen Mienen aus dem Brunnen. Doch es lag ein kleines Lächeln auf unseren Lippen. Schwester Ingrids missmutigem Blick entging es, aber es würde uns für immer miteinander verbinden.
***
»Was läuft da zwischen dir und dem jungen Lord?«, fragte mich Rhiannon, während wir uns die Beine abtrockneten und wieder in unsere Sandalen schlüpften.
Die anderen waren bereits vorausgegangen. Delias Haare waren in Unordnung geraten, und Isabeau und Sybil hatten ihr angeboten, sie in unserem Zimmer wieder herzurichten. Ich starrte auf meinen Schatten, der noch immer ruhig und beherrscht aussah, während meine Wangen vom Tanzen glühten und winzige Wasserflecke mein Seidenkleid sprenkelten.
»Gar nichts.«
»Er hat dich beim Mittagessen keinen Moment aus den Augen gelassen«, erwiderte Rhiannon. »Irgendwas musst du getan haben, um dir seine Aufmerksamkeit zu verdienen.«
Oh ja, das hatte ich. Aber wenn ich es Rhiannon verriet, würde sie sich nur Sorgen um mich machen. Dabei war der heutige Tag sowieso schon nervenaufreibend genug.
»Ich habe ihn Ikarus streicheln lassen. Vielleicht lag es daran. Er schien sehr begeistert von unseren Feuervögeln.«
Zumindest war das nicht gelogen. Ich hatte Rhiannon nur nicht alles erzählt. Sie zwirbelte ihren dunkelblonden Zopf, aus dem sich einige Strähnen gelöst hatten, und runzelte die Stirn.
»Ich wette, er wird ein Gebot für dich abgeben.«
»Wird er nicht.«
»Oh, doch. Daran besteht kein Zweifel.«
Delia, Sybil und Isabeau hätten mich sicherlich dazu beglückwünscht, aber Rhiannon wirkte nachdenklich.
»Worüber grübelst du?«, fragte ich sie.
»Ich weiß es nicht. Irgendetwas an dem jungen Lord gefällt mir nicht.« Sie ließ ihren Zopf los, stand ruckartig auf und zwang sich zu einem Lächeln. »Aber wahrscheinlich bilde ich es mir nur ein. Er sieht sehr gut aus. Das ist viel wert. Zumindest wirst du keine dicke, fleischige Hand halten müssen, während du deine Voraussagen aussprichst.«
So hatte ich Rhiannon noch nie reden hören. Sie schien sich wirklich Sorgen um mich zu machen.
»Sein Vater ist derjenige, der das Gebot für die Familie abgibt. Er wird sich gewiss nicht für mich entscheiden«, versuchte ich sie zu beruhigen. Doch ich war mir absolut nicht sicher. »Gibt es einen Lord, zu dem du gern gehen würdest?«
Meine Freundin zuckte die Schultern.
»Letzten Endes sind sie alle gleich: reich und vornehm, ein bisschen arrogant und vom Leben verwöhnt. Wir sind Bedienstete für sie, nichts weiter. Vermutlich spielt es keine Rolle, zu wem wir kommen. Sobald sie uns an ihren Hof gebracht haben, sind wir für sie unsichtbar – solange wir unsere Arbeit gewissenhaft verrichten.«
Das klang wieder mehr nach Rhiannon. Ein bisschen rebellisch und weniger ängstlich. Ich hob tadelnd den Zeigefinger.
»Lass das bloß nicht Schwester Caterina hören!«
Die Ordensschwester hätte unsere Gabe nie als Arbeit bezeichnet. Jede von uns war in ihren Augen ein heiliges Geschöpf, ein Gefäß der Götter. Aber ich stimmte Rhiannon zu, dass es sich nicht im Geringsten so anfühlte.
***
Das Warten war das Schlimmste. Wir standen in einer Reihe hintereinander, vor uns die geschlossene Tür der Gebetshalle. Delia war als Erste hineingegangen, dann Sybil. Keine von ihnen war zurückgekehrt. Sie harrten nun an der Seite ihrer neuen Lords im Inneren der Halle auf das Ende der Zeremonie.
Das Ritual der Reinigung und die feierliche Übergabe – bislang hatte ich mir noch keine Gedanken über diesen Teil des Tages gemacht. Er war mir immer so weit weg erschienen. Aber nun war er gekommen, und ich konnte meinen Blick nicht von Rhiannons Rücken lösen, die als Nächste durch die Tür treten würde.
Wenn ich ihr noch etwas sagen wollte, war jetzt der Zeitpunkt gekommen. Stand sie erst einmal an der Seite ihres Lords, durfte es keine Gespräche mehr zwischen uns geben – nie wieder. Doch jedes Wort, das ich sagen wollte, zerfiel mir im Mund. Es wirkte unbedeutend gegenüber dem, was uns erwartete. Und gleichzeitig gab es so vieles, was ich ihr noch mit auf den Weg geben wollte:
Pass auf dich auf.
Lass dich nicht unterkriegen.
Vergiss mich nicht.