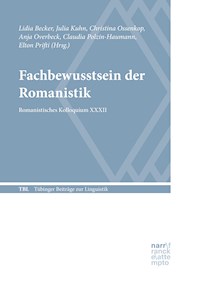
Fachbewusstsein der Romanistik E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
- Sprache: Deutsch
Die Beiträge des XXXII. Romanistischen Kolloquiums haben die Reflexion über den aktuellen Stand und die Perspektiven des Faches Romanistik an deutschsprachigen Universitäten zum Gegenstand. Einen Schwerpunkt bilden methodologische und forschungstheoretische Überlegungen im Spannungsfeld zwischen dem Fortbestehen der traditionsbewussten vergleichenden Vollromanistik, einer zunehmenden Aufspaltung in romanistische Einzelphilologien und der Anknüpfung an die allgemeine, germanistische und anglistische Linguistik. Eine Reihe von hochschuldidaktischen Impulsbeiträgen beschäftigt sich mit der Frage, welche Lehrinhalte für das moderne romanistische Lehramtsstudium relevant sind. Plädoyers für die Orientierung an den romanistischen Kernkompetenzen der Interkulturalität, Mehrsprachigkeit, Interdisziplinarität und Verantwortungsethik runden den Band ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fachbewusstsein der Romanistik
Romanistisches Kolloquium XXXII
Lidia Becker / Julia Kuhn / Christina Ossenkop / Anja Overbeck / Claudia Polzin-Haumann / Elton Prifti
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8418-2 (Print)
ISBN 978-3-8233-0242-1 (ePub)
Inhalt
Einleitung
Das XXXII. Romanistische Kolloquium, das vom 15. bis zum 17. Juni 2017 an der Leibniz Universität Hannover veranstaltet wurde, widmete sich dem Thema „Fachbewusstsein der Romanistik“. In Zeiten der fortschreitenden Ökonomisierung und der einseitig verstandenen „Internationalisierung“ der universitären Forschung und Lehre, die sich in den beiden ersten Jahrzehnten des 21. Jh. vor allem durch substantielle Stellenkürzungen auf das Fach Romanistik ausgewirkt haben, muss die Frage „Quo vadis, Romani(stic)a?“ neu gestellt werden. Die hier zu präsentierenden Antworten darauf lassen sich schwerpunktmäßig drei Themenblöcken zuordnen: Theorien und Methoden, Romanistik-Studium und Zukunftsperspektiven des Faches. Den roten Faden, der sich durch die Mehrheit der Texte zieht, bilden Überlegungen zum Sinn und Zweck der sogenannten „Voll-„ bzw. „Mehr-Fach-Romanistik“ und zum heutigen Selbstverständnis der romanischen Sprachwissenschaft. Weitere Schwerpunkte betreffen „zentrale“ und „randständige“ Gebiete der Romanistik, den Stellenwert identitätsstiftender Wissenschaftsdiskurse, eine Verzahnung zwischen der Romanistik und der Politik, den Ist-Zustand der romanistischen Studierendenschaft, das methodische Verbesserungspotenzial sowie die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Engagements seitens der Fachvertreter*innen. Der vorliegende Band versammelt die in Hannover gehaltenen Vorträge, Impulsreferate im Rahmen der Diskussionsrunden „Was soll der romanistische Nachwuchs können?“ und „Vollromanistik: Pro und Contra“ sowie zwei ergänzende Beiträge von Johannes Kramer und Georg Kremnitz.
Der Beitrag von Johannes Kramer, „Selbstdarstellungen der Romanistik während der Gründungsphase, um 1900 und nach 1988“, bietet einen fachgeschichtlichen Einstieg und vergleicht Meilensteine der romanistischen Forschung von den Anfängen bis heute. Die Gründerväter der Romanistik beschäftigten sich zunächst mit älteren Texten aus hermeneutischer Perspektive und hielten die Nähe zur klassischen Philologie sowie die Einheit von Sprach- und Literaturwissenschaft für selbstverständlich. Am Anfang des 20. Jh., in der Blütezeit der historisch-vergleichenden Romanistik, wurde eine Synthese der bereits umfangreichen Forschungsergebnisse in einer Reihe großangelegter Einführungswerke und Handbücher geleistet. Zwischen den beiden Weltkriegen wurde das Fach auf das Essentielle reduziert, ein Neuanfang gelang erst in den 60er Jahren des 20. Jh. Der Übergang vom 20. zum 21. Jh. zeichnete sich erneut durch romanistische Großprojekte wie das Lexikon der romanistischen Linguistik und die Romanische Sprachgeschichte aus. Das aktuelle romanistische Großunternehmen, die Reihe Manuals of Romance Linguistics, behandelt eine prinzipiell offene Menge von romanistischen Teilgebieten und übertrifft somit in seinem Anspruch und Umfang die früheren Summae Romanisticae, wobei das Deutsche als Publikationssprache nicht mehr zugelassen ist.
Ulrich Hoinkes stellt im Beitrag „La valeur méthodologique des quatre axiomes constitutifs de l’analyse philologique des langues romanes“ die folgenden vier Grundprinzipien der romanischen Sprachwissenschaft zur Diskussion: Die romanischen Sprachen gehen auf das gesprochene „Vulgärlatein“ zurück (Prinzip der Mündlichkeit); die romanischen Sprachen stammen nicht nur von einer, sondern von mehreren Sprachen ab (Prinzip der Heterogenität); die romanischen Sprachen haben sich aus protoromanischen Varietäten (Dialekten) im geographischen Raum kontinuierlich weiterentwickelt (Prinzip der Arealität); die romanischen Sprachen sind in einem komplexen Prozess der normativen Ausdifferenzierung entstanden (Prinzip der Standardisierung). Obwohl bereits dargelegt wurde, dass das „Vulgärlatein“ ein Konstrukt ist, fällt ein Abschied von diesem identitätstiftenden Konzept schwer, wie der Autor feststellt. Auch das Prinzip der Heterogenität, das dem bekannten romanistischen „Dia-Modell“ der „Spracharchitektur“ mit diatopischen, diastratischen, diaphasischen und diamesischen Varietäten zugrundeliegt, birgt Gefahren, wenn es unkritisch weiter tradiert wird. Das Prinzip der Arealität, dass mit der Sprachgeographie seine Blüte erfahren hat, sollte einer differenzierten historisch-sozial-kulturellen Betrachtung des Sprachraums weichen. In Bezug auf das Prinzip der Standardisierung schlägt der Autor eine auf Mündlichkeit basierende Standardologie vor, die im Unterschied zur diasystematischen Variation innersprachliche Nivellierungsprozesse in den Fokus rücken und die Dynamik sowie die sozial-normative Dimension der Standardisierungsprozesse berücksichtigen sollte.
Antje Lobin widmet sich im Beitrag „Von sprachlich korrekt zu politically correct. Normkonzepte im Wandel und Implikationen für die italienische und französische Sprachdiskussion“ einem kontrastiven Vergleich der Entwicklung und des Status quo der genderneutralen Sprache in Frankreich und Italien. Diese Form des politisch korrekten Gebrauchs wird sowohl in der Forschungsliteratur zum Italienischen als auch in derjenigen zum Französischen mehrheitlich negativ bewertet. Unterschiede lassen sich zum einen bei den Einstellungen der allgemeinen Bevölkerung gegenüber staatlichen Eingriffen in die Sprachnorm feststellen (Skepsis in Italien vs. Akzeptanz in Frankreich) und zum anderen bei den Positionen der beiden traditionsreichen Normierungsinstitutionen, der Accademia della Crusca, die sich inzwischen gegenüber der Feminisierung im institutionellen Kontext offen zeigt, und der Académie française, die den inklusiven Formen nach wie vor eine Absage erteilt. Die Autorin plädiert für ein Engagement der Romanistik zum Zweck einer umfassenden Deutung gesellschaftlicher Dynamiken rund um die Sprachnorm.
Felix Tacke rekonstruiert im Beitrag „Notizen zu einer historisch-vergleichenden kognitiven Grammatik“ die Geschichte der Sprachpsychologie, die im junggrammatischen Programm ihren Ursprung nahm und innerhalb der Romanistik mehrfach aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. Am Beispiel des morphosyntaktischen Wandels von Zeigeaktkonstruktionen stellt er heraus, dass der sprachpsychologische Ansatz die Prämissen der aktuell einflussreichen Cognitive LinguisticsUS-amerikanischer Prägung vorweggenommen hat, während die modernen kognitivistischen Ansätze aber auch wichtige Aktualisierungen bereitstellen. Der Autor spricht sich für eine reflektierte und traditionsbewusste Synthese der junggrammatischen Sprachpsychologie mit den neueren kognitivistischen Modellen aus, um einen interpretatorischen Beitrag zum historisch-vergleichenden Studium der Grammatik der romanischen Sprachen zu leisten.
Silke Jansen und Alla Klimenkowa gehen im Beitrag „‚Zentrale‘ und ‚randständige‘ Gebiete in der Romanistik? Die Beispiele Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit und Kreolsprachen“ der Frage nach, welche Rolle die Themenfelder Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit und Kreolisierung im romanistischen Fachkanon gespielt haben. Sie stellen fest, dass obwohl die Beschäftigung mit mehreren Sprachen seit je zum Wesenskern der romanischen Sprachwissenschaft gehört hat, bis zur Jahrtausendwende die Erforschung romanischer Standardsprachen aus eurozentrischer Perspektive richtungsweisend war. Anhand reichen Datenmaterials zu Publikations- und Tagungsaktivitäten, Qualifikationsarbeiten, DFG-Forschungsprojekten, Stellenausschreibungen und Schwerpunktsetzungen bei Masterstudiengängen zeichnen die Autorinnen nach, dass aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz von Themen wie Migration und Mobilität, Schutz der Minderheitenrechte, Globalisierung und Postkolonialismus die einstigen Randgebiete sich inzwischen zu einem hochdynamischen Feld innerhalb der Romanistik entwickelt haben.
Carsten Sinner behandelt im Beitrag „Methodologische Probleme in der romanischen Sprachwissenschaft. Über fehlendes Varietätenbewusstsein, Verallgemeinerungen und Mängel in der Quellennutzung“ einige wesentliche Probleme der sprachwissenschaftlichen Auseinandersetzung aus der varietätenlinguistischen Perspektive: die Frage nach den Ebenen des innerromanischen Vergleichs bzw. die bei Aussagen zu verschiedenen Varietäten einer Sprache anzusetzenden Vergleichsebenen, u.a. die Frage nach der Abgrenzung von Idiolekt, Soziolekt und Funktiolekt, die Überbewertung des eigenen Idiolektes, Verallgemeinerung von Forschungsergebnissen sowie das Problem des sorglosen Umgangs mit Quellen und Ergebnissen anderer Studien. Eine Schieflage sieht der Autor ferner in der unkritischen Orientierung mancher Romanist*innen an den Postulaten der allgemeinen und der angloamerikanischen Sprachwissenschaft. Obwohl hinsichtlich der methodischen Sorgfalt Verbesserungspotenzial besteht, zeigen romanistische Untersuchungen aus romanischen Ländern und aus dem deutschsprachigen Raum eine stärkere Sensibilisierung für varietätenlinguistische Fragestellungen als US-amerikanische und englische Autor*innen aus denselben Fachgebieten oder Vertreter*innen der Germanistik und der allgemeinen Sprachwissenschaft.
Der Beitrag von Sylvia Thiele „Sprachenvielfalt schützen – Mehrsprachigkeit(sdidaktik) einfordern“ leitet den Abschnitt zum universitären Romanistik-Studium ein. Die Autorin setzt sich dafür ein, dass methodische Ideen zur rezeptiven Mehrsprachigkeit stärker in den Vordergrund gerückt werden, vor allem in Bezug auf romanische Klein- und Minderheitensprachen, und über den romanischen Sprachraum hinaus kultur- und sprachübergreifend, auch im Hinblick auf genetisch nicht verwandte Idiome Gebrauch finden sollten. Die Aufgabe mehrsprachiger Lehrender bestehe darin, Lernende für eine solche analytisch-didaktische Arbeitsweise zu sensibilisieren. Diese Kompetenzen sollten im ‚mehrsprachigen Klassenzimmer‘ an Schulen und Universitäten, u.a. auch in internationalen Studiengängen, eingeübt werden.
Die von Sandra Herling und Holger Wochele aufgeworfene Frage „Soll der wissenschaftliche Nachwuchs Lateinkenntnisse haben? – Bemerkungen zu Pro- und Contra-Standpunkten“ stellt bereits seit einigen Jahrzehnten einen Stein des Anstoßes in der Romanistik dar. Der Beitrag systematisiert die Argumente von Latein-Befürworter*innen, die einschlägigen romanistischen Publikationen entnommen sind, sowie von Latein-Gegner*innen am Beispiel der Debatte in Nordrhein-Westfalen über die Abschaffung des Latinums für Lehramtsstudiengänge. Ferner stellen die Autorin und der Autor die Frage nach der Angemessenheit der aktuell während des Universitätsstudiums erteilten ‚Crash‘-Latinumskurse. Auch ein Blick auf die Ausrichtung einzelner Studiengänge an Romanischen Seminaren Nordrhein-Westfalens zeigt, dass historische Inhalte, die Lateinkenntnisse voraussetzen würden, kaum mehr Berücksichtigung finden. Angesichts der sich wandelnden Studiengangs- und Forschungslandschaft erscheint eine Abschaffung der Latinumspflicht nachvollziehbar.
Alf Monjour stellt im Beitrag „Romanistik nach Bologna? Zum Nachdenken über zukünftige Positionen der romanistischen Sprach- und Kulturwissenschaften“ das Postulat der „Vollromanistik“, d.h. des Fachzuschnitts nach den Kriterien der historischen-vergleichenden Sprachwissenschaft, zur Debatte. Möglicherweise hat gerade dieser derzeit einzigartige Zuschnitt der romanistischen Fremdsprachenphilologie zu den Stellenkürzungen beigetragen, da wenige Professuren nach wie vor viele romanische Sprachen vertreten können. Der Ist-Zustand der Studierendenschaft am Beispiel eines mittelgroßen romanistischen Instituts an der Universität Duisburg-Essen lässt erkennen, dass die Mehrheit der Studierenden sowohl in den Lehramts- als auch in den Fachstudiengängen nur ein romanistisches Fach (Französisch oder Spanisch) belegen. Die Tatsache, dass zahlreiche Studierende bedingt durch aktuelle Migrationsbewegungen mehrsprachig sind, aber in der Regel nur eine romanische Sprache und kein Latein beherrschen, kann nicht ohne Folgen für das Fach und die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses bleiben. Die Konzentration der Romanist*innen auf die eine Zielsprache und die eine Zielkultur nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung scheint immer mehr überlebensnotwendig zu sein. An größeren Instituten dürfte die Möglichkeit einer Koexistenz romanistischer Komparatist*innen und einzelsprachlicher Sprach- und Kulturwissenschaftler*innen hingegen auch in Zukunft gegeben sein.
Aline Willems beschäftigt sich im Beitrag „Quo vadis, Romani(stic)a? Das romanistische Lehramtsstudium heute“ mit den Anforderungen an die Studierenden der romanistischen Lehramtsstudiengänge. Mit diesem Ziel untersucht sie die curricularen Vorgaben der Kultusministerkonferenz, die in den Prüfungsordnungen und Modulhandbüchern berücksichtigt werden müssen. Diese umfangreichen Vorgaben, unterteilt in fünf Studienbereiche Sprachpraxis, Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft sowie Fachdidaktik, wurden im Jahr 2017 darüber hinaus um das Themenfeld Inklusion ergänzt. Die Autorin stellt abschließend die Frage, ob dermaßen umfängliche Standards mit der Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie mit den allgemeinen Grundsätzen von Universitäten überhaupt vereinbar sind, so dass eine Rückkehr zu Pädagogischen Hochschulen bedacht werden sollte.
Der Abschnitt zu den Perspektiven des Faches Romanistik wird mit „Gedanken zu möglichen Konturen einer ‚engagierten‘ romanischen Sprachwissenschaft“ von Georg Kremnitz eingeleitet. Unter „Engagement“ versteht der Autor ethische Mindestanforderungen für wissenschaftliche Arbeiten und das Bewusstsein der Verantwortung für die Forschungsfolgen. Als Beispiel aus der Soziolinguistik nennt er die Auseinandersetzung zwischen den Vertreter*innen der Defizit- (Basil Bernstein) und Differenzhypothesen (William Labov), die einen erheblichen Einfluss auf die Unterrichtspraktiken in den westlichen Industriestaaten hatte, ohne jedoch das gewünschte Ziel – die sozialen Chancen der Unterschichten zu verbessern – erreichen zu können. Für ein vergleichbares Engagement in der Sprachwissenschaft, das humanistisch geleitet ist und sprach- bzw. bildungspolitische Reformen herbeiführen soll, empfiehlt der Autor entsprechend eine konsequent politisch denkende Vorgehensweise. Am zweiten Beispiel der unterschiedlichen Zählweisen der Sprachen zeigt er auf, welche Folgen die fragmentierenden und die synthetisierenden Darstellungen für die kommunikative Bedeutung der entsprechenden Varietäten haben können. Die Mindestvoraussetzung für soziolinguistische Forschung, insbesondere für die Beschäftigung mit Minderheitensprachen, ist folglich eine genaue Kenntnis der sozialen, politischen und sprachlichen Situation sowie eine eigene politische Positionierung.
Matthias Heinz reflektiert im Beitrag „Facheinheit vs. Auseinanderdriften der romanischen Sprachwissenschaft“ am Beispiel der Salzburger Romanistik über divergente und konvergente Entwicklungen innerhalb des Faches. Zunächst macht er auf fehlende Vergleichbarkeit zwischen kleineren und größeren Instituten sowie auf die stark aufgefächerten Fachmasterstudiengänge neben den klassischen Lehramtsstudiengängen aufmerksam. Neue Kombinationsstudiengänge wie Romanistik und Wirtschaft wurden zuletzt an mehreren Standorten, auch in Salzburg, gegründet. In der Forschung stehen die Vertreter*innen der allgemeinen und theoretischen Linguistik mit einem geringen Bezug zum Proprium des Faches den Romanist*innen traditioneller Prägung mit philologischen und sprachhistorischen Interessen gegenüber. Doch in vielen Fällen kommt es zu einem fruchtbaren Austausch, so dass unterschiedliche Sichtweisen auf Sprache sich ergänzen können. Um die Einheit des Faches zu bewahren, empfiehlt der Autor eine Reihe von Strategien: Allianzen mit der Slawistik, Skandinavistik und Latinistik, aber auch mit der Germanistik und Anglistik suchen; das Potenzial des komparatistischen Ansatzes ausschöpfen; Zusammenarbeit mit Romanistik-Instituten an anderen Universitäten fördern; die der Romanistik inhärente Internationalität nutzen; den Nachwuchs aus neuen Kombinationsstudiengängen gewinnen; wissenschaftliche Kommunikation auf Deutsch, in romanischen Sprachen und auf Englisch führen und den Mehrwert der Romanistik im Vergleich zur Linguistik tout court herausstellen (dazu gehört ein besonderes Verhältnis zur Sprachgeschichte, zum Sprachenvergleich und zur Variation).
Eva Martha Eckkrammer stellt im Beitrag „Romanische Philologie – Eintrittskarte in eine superdiverse Welt?“ die Frage nach adäquaten Bildungsinhalten sowie nach dem Stellenwert des Faches in der globalisierten und superdiversen Welt. Zum Einstieg diskutiert sie die aktuelle Situation der Romanistik in der Post-Bologna-Zeit auf der Grundlage einer Vollerhebung des Deutschen Romanistenverbandes e.V. im Studienjahr 2014/2015. Inzwischen hat eine flächendeckende Umstellung auf romanistische Monobachelor-Angebote stattgefunden, die als Folge der starren ECTS-Zähllogik gesehen werden kann. Genuine romanistische Studiengänge mit mindestens zwei romanischen Sprachen sind an nur wenigen Standorten vertreten, häufig beschränken sich diese entweder auf die Sprach- oder die Literaturwissenschaft. Ein weiteres Novum stellen zahlreiche mit anderen Fächern kombinierte Studiengänge dar. Obwohl gerade in Zeiten der Superdiversität und der EU-Erweiterung der Umgang mit Mehrsprachigkeit und Heterogenität eine Schlüsselrolle spielen sollte, wird der vergleichende Ansatz aufgegeben und die mehrsprachige Kommunikation, auch in der Romanistik, gibt dem einsprachigen Habitus auf Englisch statt. Die Autorin plädiert für den Einsatz der Romanist*innen für Minderheitensprachen sowie für eine selbstbewusste Kommunikation der romanistischen Expertise in den Bereichen der Interkulturalität, der sprachlichen Diversität sowie nicht zuletzt der Textkompetenz und der strukturierten Denkfähigkeit. Nicht zu unterschätzen ist außerdem der Appell, im Rahmen der europäischen Integration die hohe Bedeutung der romanischsprachigen Länder und ihrer Kulturen herauszustellen.
Elmar Eggert widmet sich im Beitrag „Interkulturelle Sensibilität als romanistische Kernkompetenz. Warum die Romanistik als übergreifend-vergleichendes Fach heute wichtiger denn je ist“ ebenfalls der romanistischen Expertise in den Bereichen der Interkulturalität und Diversität. Er hebt die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Einbindung der Romanistik hervor, die durch die Hinwendung zu kulturwissenschaftlichen und interkulturellen Fragestellungen erreicht werden kann. Als besonders geeignet für die Herausbildung interkultureller Kompetenzen sieht der Autor den gesamtromanistisch-vergleichenden Ansatz sowie die historische Betrachtung an. Die Romania ist dabei ein Raum, der nicht allein durch die genealogischen Verbindungen zwischen den romanischen Sprachen, sondern durch eine gemeinsame kulturelle Prägung zu begründen ist. Somit sollte die ausgeprägte interkulturelle Kompetenz, welche die Romanistik bereits seit ihrer Gründung auszeichnet, stärker nach außen transportiert werden.
Thomas Krefeld vertritt im Beitrag „FAIRness weist den Weg – von der Romanischen Philologie in die Digital Romance Humanities“ eine hoffnungsvolle Perspektive für eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der Digital Humanities. Er stellt zunächst die traditionellen Wege der Wissenschaftskommunikation den neuen Möglichkeiten gegenüber und kommt zum Schluss, dass Webtechnologien klare Vorteile mit sich bringen. Die Pluspunkte der webbasierten Wissenschaftskommunikation sind in einigen Bereichen der romanischen Sprachwissenschaft, etwa in der Lexikographie, augenfällig. Am Beispiel des Projekts VerbaAlpina zeigt der Autor, welche Elemente eine umfassende virtuelle lexikographische und kartographische Umgebung ausmachen.
Der Beitrag „Fortschritt durch Interdisziplinarität. Methodische Offenheit in der Romanistik“ von Anna Ladilova und Dinah Leschzyk schließt den Band ab. Die Autorinnen vertreten die Ansicht, dass die gesellschaftliche Bedeutung der Romanistik durch das Zusammenspiel mit anderen Disziplinen geprägt wird. Einerseits sollten die romanistischen Fachteile Sprach-, Literaturwissenschaft und die Fachdidaktik näher zusammenrücken, statt sich voneinander wegzubewegen, andererseits sollte sich die Romanistik gegenüber anderen Fächern, die ebenfalls romanischsprachige Länder erforschen, öffnen. Wie dies gelingen kann, wird an zwei Beispielen, dem Feld der politischen Online-Kommunikation in Kombination mit der Kritischen Diskursanalyse sowie der Gestikforschung, aufgezeigt. Die Autorinnen legen außerdem nahe, dass Romanist*innen eine stärkere Positionierung und mediale Wirksamkeit als Expert*innen für gesellschaftliche Vorgänge in romanischsprachigen Ländern anstreben sollten.
Die Herausgeber*innen bedanken sich bei Kathrin Heyng (Narr Francke Attempto Verlag) für die Betreuung der vorliegenden Publikation sowie bei Dr. Marta Estévez Grossi und Daria Mengert für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Erstellung der Druckvorlage.
Lidia Becker
Julia Kuhn
Christina Ossenkop
Anja Overbeck
Claudia Polzin-Haumann
Elton Prifti
I.Theorien und Methoden
Selbstdarstellungen der Romanistik während der Gründungsphase, um 1900 und nach 1988
1Die Aufgaben der philologischen Arbeit
Die Romanistik gehört zur Gruppe der neuphilologischen Fächer, die im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden, wie auch die Indogermanistik, die Germanistik und etwas später die Slavistik. Wenn man die Veröffentlichung des ersten Bandes der Grammatik der romanischen Sprachen von Friedrich Diez im Jahre 1836 als „Geburtsstunde“ der wissenschaftlichen Romanistik ansieht (Swiggers 2014, 48), so ist dieser Zweig der Wissenschaft etwa 180 Jahre alt, damit ein Menschenalter jünger als die Germanistik, wenn man deren Beginn mit dem ersten Band der Deutschen Grammatik von Jacob Grimm im Jahre 1819 ansetzen will, aber deutlich jünger als die Klassische Philologie, die mit den Forschungen der alexandrinischen Gelehrten am von Ptolemaios I. (367–283 v. Chr.) gegründeten Museion der Stadt begann (Pfeiffer 1970, 125–132) und die somit auf eine mehr als zweitausendjährige Geschichte zurückblicken kann.
Was man freilich mit der sprachlichen Arbeit an älteren Texten erreichen wollte, das hat sich seit der Zeit der Alexandriner nicht verändert: Man arbeitete sich an Texten wie den homerischen Epen ab, die lange vor der eigenen Zeit entstanden waren, in einer anderen gesellschaftlichen Umgebung und in verschiedenen literarischen Traditionen. Nach einer heutigen Einführung in die klassische Philologie gab es drei Hauptaufgaben:
Man musste versuchen, 1. In den Texten Echtes von Unechtem zu scheiden; 2. die Eigenheiten der fremden Sprachform festzustellen; 3. Schwierigkeiten des Textverständnisses zu klären“ (Jäger 1975, 11). Die Verständnisschwierigkeiten bei älteren Texten mussten in drei Bereichen überbrückt werden: „1. Es kann sich darum handeln, den authentischen Wortlaut des Textes zu ermitteln (Textkritik und Editionstechnik); 2. Es kann darum gehen, die Sprache des Textes zu verstehen bzw. zu erläutern (Lexikographie und Grammatik; sprachliche Kommentierung); 3. Es kann bei literarischen Texten auf ein angemessenes Verständnis des Textes als ein Stück Literatur ankommen (Interpretation). Dazu gehört auch die sachliche Klärung des Textes sowie seine Einordnung in den historischen Zusammenhang. (Jäger 1975, 12)
2Klassische Philologie und Romanistik
Anfänglich wichen die Arbeitsansätze und die Antworten, die die Romanistik auf diese Fragen gab, kaum von denen der zeitgenössischen klassischen Philologie ab, obwohl traditionellerweise die Beziehung zwischen beiden Fächern nicht allzu eng gesehen wurde und wird und man eher den Akzent darauf legte, dass die Romanistik in einigem Abstand der Herausbildung der Germanistik folgte (Christmann 1985, 21). Dennoch war die Verwandtschaft mit der Latinistik unübersehbar: Die romanischen Sprachen stammen aus dem Lateinischen ab, wie man in der Klassischen Philologie die beiden Zweige Gräzistik und Latinistik behandelte, so waren die nach damaliger Auffassung sechs romanischen Sprachen ein würdiger Gegenstand für die Romanistik, die vergleichende und historische Komponente der neuen Sprachbetrachtung passte gut zur philologischen Untersuchung, die gerade modern wurde, und die Herstellung guter mittelalterlicher Texte vertrug sich bestens mit den altphilologischen Bemühungen und originalnahe „Urtexte“ – die Textkritik, mit der man zuverlässige Ausgaben von Dante, den altfranzösischen Texten, den Troubadourliedern oder den altspanischen Romanzen herstellen wollte, waren die natürliche Verbindung zwischen den Forschungsinteressen der alten klassischen Philologie und der neuen Romanistik (Christmann 1985, 13).
Das frühe 19. Jahrhundert ist ja geprägt von der Romantik, und die Zugänglichmachung mittelalterlicher Textzeugnisse durch Ausgaben, Kommentare und Übersetzungen standen im Zentrum des Interesses. Friedrich Diez hatte, bevor er sich Grammatiken und Wörterbüchern widmete, 1821 ein Werk über Altspanische Romanzen veröffentlicht, und 1823 folgte Die Poesie der Troubadours. Man soll auch nicht vergessen, dass er 1863 eine Arbeit Über die erste portugiesische Kunst und Hofpoesie veröffentlichte und so die Aufmerksamkeit auf dieses oft vernachlässigte Randgebiet der Romanistik lenkte. Generationen von Studienanfängern sind durch die Chrestomathie de l’Ancien Français von Karl Bartsch in den Reichtum der altfranzösischen Literatur eingeführt worden, bevor diese Aufgabe 1921 vom Altfranzösischen Lesebuch von Karl Voretzsch übernommen wurde. Solange die Beschäftigung mit den altprovenzalischen (= altokzitanischen) Texten noch zum Kernprogramm der Romanistikstudien gehörte, lernte man die mittelalterlichen Texte durch die Chrestomathie provençale von Karl Bartsch kennen, bevor, was die Troubadour-Dichtungen anbetrifft, Texte und Nachdichtungen 1917 im Provenzalischen Liederbuch von Erhard Lommatzsch leicht aufzufinden waren. Bei diesen und bei vergleichbaren Ausgaben von Einzeltexten sieht man deutlich den Parallelismus zwischen den Aktivitäten der klassischen und der frühen romanischen Philologie: Man wollte zuverlässige Textausgaben verfügbar machen, und man wollte die „dunklen“ Stellen durch Einzelkommentare verständlich machen; Wortverzeichnisse und Kurzgrammatiken stellten das her, was man im Bereich der altphilologischen Zeugnisse durch die weit ausführlicheren Schulwörterbücher und Grammatiken zur Verfügung hatte. Ein Unterschied tat sich aber auf: Während es im 19. Jahrhundert noch zum normalen Handwerkszeug eines Latinisten gehörte, wissenschaftliche Abhandlungen auf Latein schreiben zu können, hatte man keine Fertigkeiten darin, altfranzösische oder altokzitanische Texte schreiben zu können, und selbst die Anfertigung einigermaßen korrekter neufranzösischer Texte brachte viele Romanisten an die Grenze ihrer sprachpraktischen Fähigkeiten.
Während die textkritische Arbeit an Ausgaben der antiken Zeugnisse zu einer Haupttätigkeit der klassischen Philologie wurde und die Erstellung von Kommentaren zu Einzelschriften für lange Zeit die Arbeit der Fachleute bestimmte, entwickelte sich die Romanistik in einer anderen Richtung: Herausgabe und Kommentierung der vor allem altfranzösischen Texte wurde zunehmend zu einer Art „Gesellenarbeit“ von begabten Studierenden, die damit zu beweisen hatten, dass sie die Grundzüge des historisch-philologischen Arbeitens beherrschten, bevor sie sich dann anderen Spezialgebieten zuwenden konnten. Typisch ist hier der Fall von Ernst Robert Curtius (1886–1956), der sich seinen Interessen für mittellateinische Literatur auf der einen Seite, als Spezialist für moderne französische Literatur auf der anderen Seite erst zuwenden konnte, nachdem er eine (mustergültige) Ausgabe der Quatre livre des Rois aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts veranstaltet hatte.
3Die Romanistik im Gefüge der Universitäten des 19. Jahrhunderts
Die eigentlichen wissenschaftlichen Höhepunkte der neuen Romanistik bildeten sich auf anderen Gebieten als im Bereich der Ausgaben von Einzeltexten heraus. Die Universitätsgeschichte in den deutschsprachigen Ländern hatte dazu geführt, dass sich ein tiefer Graben zwischen den Altphilologen, die einer allgemein wertgeschätzten Kategorie der Geisteswissenschaften angehörten, und den sogenannten modernen Philologen oder Neuphilologen, die mühsam um ihre Anerkennung rangen, auftat. Bei der Neukonstituierung der Universitäten 1810, die mit dem Namen Wilhelm von Humboldt verbunden zu sein pflegen, bekam die Altphilologie ganz selbstverständlich zwei Professuren in klassischer Philologie (Friedrich August Wolf, 1759–1824; August Boeckh, 1785–1867), während die erste ordentliche Professur für Romanistik in Berlin erst 1870 für den Schweizer Adolf Tobler (1835–1910) eingerichtet wurde, der seit 1867 Außerordentlicher Professor dort war. Für die vorangehende Zeit kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass man sich nicht mit den modernen Sprachen abgab, aber das erfolgte meist nicht auf der normalen professoralen Ebene. Zuständig waren vielmehr die sogenannten Sprachmeister (frz. maîtres), die prinzipiell aus der schulischen Tradition stammten, wo sie für die Vermittlung von Sprachkenntnissen (und gesellschaftlichen Verhaltensformen) an die fortgeschrittenen Schüler verantwortlich waren (Schöttle 2015, 89). Vom 17. und 18. Jahrhundert an gab es Sprachmeister auch im Umfeld der akademischen Ausbildung, und da man mit der Vergabe des Titels Professor oft freigiebig umging (Kramer 2018a, 9), gab es unter den Sprachmeistern auch Träger dieser Bezeichnung. Eine Zeitlang gab es noch Professoren „alten Stils“ und Professoren „neuen Stils“ nebeneinander (Kramer 2018a, 10), bevor die Sprachmeister spätestens in den achtziger Jahren von der Bildfläche verschwanden.
Die neue „wissenschaftliche Neuphilologie“ konnte sich auf programmatische Schriften berufen, die in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts erschienen. Hier ist zunächst der früh verstorbene Karl W.E. Mager (1810–1858) zu nennen, der Begründer des Realschulwesens, der wohl den Begriff „moderne Philologie“ erfunden hat und deren drei Bestandteile „Kritik, Exegese und Theorie der Dichtkunst und Beredsamkeit“ festlegte (Swiggers 2014, 45). Adelbert von Keller (1812–1883), der sich besonders als Editor mittelalterlicher Texte einen Ruf erworben hat, hat in einer „Inauguralrede“ die Beschäftigung mit Sprache und Literatur als Aufgabe der modernen Philologie festgelegt (Swiggers 2014, 45) und die historisch-vergleichende Untersuchung des romanischen Sprachstammes als Zukunftsprogramm herausgearbeitet (Christmann 1985, 17). Carl August Friedrich Mahn (1802–1887) plaidierte schießlich 1863 für ein umfassendes Programm der romanischen Philologie: „L’auteur, qui fut le maître de Karl Bertsch, y plaide pour une organisation scientifique de la philologie moderne, dont le domaine englobe l’histoire littéraire, la grammaire historico-comparative, la grammaire de l’état actuel d’une langue et l’explication des auteurs“ (Swiggers 2014, 45).
Diese theoretischen Überlegungen hatten inzwischen auch ihren Einzug in die universitäre Praxis gehalten, wenn auch unter dem hinhaltenden Widerstand der Klassischen Philologen, die ihre wirkliche oder vermeintiche Vorrangstellung gefährdet sahen: Der Vorreiter ist der Dante-Spezialist Ludwig Gottfried Blanc (1781–1866), der 1822 in Halle an der Saale zum Professor für romanische Sprachen und Literaturen ernannt wurde, Friedrich Diez folgte in Bonn 1823, Adelbert von Keller 1841 in Tübingen, Konrad Hofmann 1853 in München und Karl Bartsch 1858 in Rostock (Swiggers 2014, 45).
4Romanische Sprachwissenschaft in der Anfangsphase der Romanistik
Was die Neuphilologie prinzipiell von der Altphilologie unterschied, war die gleichwertige Behandlung der Sprach- und der Literaturwissenschaft. Die Altphilologie hatte die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft weitgehend an die Indogermanistik abgegeben, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre erste Blüte erlebte, und sie war so weitgehend zu einer reinen Literaturwissenschaft mit sprachpraktischen Bestandteilen („Stilübungen“) geworden. In der Romanistik bestimmte das Verhältnis der acht romanischen Schriftsprachen zum gut bekannten Latein die Aktivitäten der ersten Wissenschaftsgeneration: Zwischen 1831 und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges erfolgten die maßgeblichen Veröffentlichungen von Friedrich Diez und von seinem geistigen Erben Wilhelm Meyer-Lübke (1861–1936). In ihren gesamtromanischen Studien ging es prinzipiell darum, wie sich aus einer gemeinsamen lateinischen Basis eine Vielzahl romanischer Weiterentwicklungen ergeben konnten. Friedrich Diez verfolgt auf romanischem Gebiet die Erkenntnisse, die Franz Bopp auf indogermanischem Gebiet und Jacob Grimm in der Germanistik erzielt hatten, und Wilhelm Meyer-Lübke verfolgte die Ansätze der junggrammatischen Schule mit romanischem Material. Das Material ist in beiden Fällen eine historische Grammatik und ein etymologisches Wörterbuch: Zwischen 1836 und 1843 veröffentlicht Diez die drei Bände seiner Grammatik der romanischen Sprachen, denen im Jahre 1869 die dritte Auflage des ersten Bandes folgt, in der zum ersten Male klar zwischen Erbwörtern und gelehrten Elementen unterschieden wird. Durchgeführt wird eine dreifache Gliederung der romanischen Schriftsprachen: Im Osten das Rumänische (Walachische) und das Italienische, im Westen das Spanische und das Portugiesische, im Norden das Französische und das Okzitanische (Provenzalische). Freilich zeigt diese Grammatik durchaus noch die typischen Erscheinungen einer Erstlingsarbeit:
L’aspect comparatif se limite encore trop souvent à la juxtaposition de formes (le troisième volume a une allure trop comparative), et l’aspect historique n’est pas sans failles non plus: Diez estime que l’évolution linguistique est faite de processus dont les uns sont réguliers et les autres irréguliers, et très souvent il ne parvient pas à reconnaître le conditionnement linguistique des processus évolutifs. (Swiggers 2014, 48)
Ein Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen folgt 1853 und kennt mehrere Neuauflagen. Dieses Wörterbuch muss mit Umsicht benutzt werden: Wörter, deren Herleitung in den Augen von Diez offenkundig ist, wurden nicht aufgenommen. Die Wörter sind aufgeteilt nach den „gemeinromanischen Wörtern“, wo die italienischen Wörter das Stichwort bilden, gefolgt von den spanischen und französischen Formen; eine zweite Abteilung umfasst „Wörter aus einzelnen Gebieten“, in der Reihenfolge italienisch, spanisch, französisch.
Der walachischen in der fremde erzogenen, mit den übrigen nicht aufgewachsenen tochter der römischen mutter habe ich keine eigene stelle eingeräumt, sie nur zur vergleichung zugelassen, nicht anders als die churwälsche. Die volksmundarten […] habe ich überall zu rathe gezogen, so weit die mir gestatteten hülfsmittel ausreichten, ihnen auch zuweilen beispiele halber kleine artikel vergönnt“ [IX-X]. (Diez 1853, S. IX-X)
Wenn also das etymologische Wörterbuch schwer zu benutzen ist und die Auswahl der romanischen Wörter als recht subjektiv bezeichnet werden muss, so ist doch mit Pierre Swiggers (2014, 49) festzuhalten, dass es sich um eine „réalisation remarquable“ handelt, „par la masse des matériaux réunis, par le souci de méthode et l’attitude prudente de l’auteur, enfin par la présence d’ouvertures à l’histoire sémantique des mots et à des problèmes d’onomasiologie (avant la lettre), ce qui renforce le caractère plus ‚narratif‘ (et lisible) des articles du dictionnaire“.
Der begabteste Schüler von Friedrich Diez war zweifellos der früh verstorbene August Fuchs (1818–1847), der in seinem posthum veröffentlichten Werk über Die romanischen Sprachen in ihrem Verhältnisse zum Lateinischen die Einheit zwischen Latein und Romanisch darin sah, dass das gesprochene Latein im Romanischen seine natürliche Weiterentwicklung erlebte und dass es sich dabei nicht um eine Dekadenz der eigentlich vollendeten Sprache Latein, sondern um die Weiterentwicklung der lateinischen Umgangssprache zu einer Sprachform größerer Klarheit handele.
Ein wichtiges Bindeglied zwischen Diez und Meyer-Lübke stellt Gustav Körting (1845–1913) dar, nicht weil er wissenschaftlich große Neuerungen durchgeführt hätte, sondern weil er in seinem Lateinisch-romanischen Wörterbuch (1890) von den (oft rekonstruierten) Etyma ausging, die er durchgehend nummerierte.
5Die Blüte der Romanistik vor dem Ersten Weltkrieg
Wilhelm Meyer-Lübke stellte den Werken von Friedrich Diez parallele Neufassungen auf dem Stand der damaligen Junggrammatiker mit ihren unausweichlichen Gesetzen an die Seite: Die vierbändige Grammatik der romanischen Sprachen (1890–1901) und das Romanische Etymologische Wörterbuch (1911; 1935) bilden auch heute noch ein Nachschlagewerk für jeden Romanisten, seine Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft (1901; 1920) war für Generationen das Referenzwerk für Studienanfänger und ist in ihrem Materialreichtum bis heute unübertroffen.
Le modèle néo-grammairien, basé sur le couple „loi phonétique/actions analogiques“, est manié avec flexibilité, non seulement à cause de l’interprétation large des faits analogiques, mais aussi par l’inclusion de processus explicatifs comme le croisement, la réfection, la „réanalyse“. (Swiggers 2014, 51)
Einführungen in die Romanistik bildeten zu Anfang des 20. Jahrhunderts das Gerüst der wissenschaftlichen Bemühungen. Es ging hier von Werken mit Basiswissen wie die zwei schmalbrüstigen Göschen-Bände zur Romanischen Sprachwissenschaft bis zu enzyklopädischen Darstellungen wie die drei Lexikonbände des Grundrisses der romanischen Philologie von Gustav Gröber (1888–1902; zweite Auflage von Band I 1904–1906). Die erste Auflage hatte einen Absatz von über tausend Exemplaren, sehr viel für die damalige Zeit. Günter Holtus, der den Grundriss mit dem ein Jahrhundert später erschienenen LRLverglichen har, hat herausgearbeitet, dass sich die romanische Philologie am Ende des 19. Jahrhunderts „vornehmlich mit den nicht mehr unmittelbar verständlichen Zeugnissen vergangener Zeiten“ zu beschäftigen habe (Holtus 1997, 378), während des LRLweniger geschichtlich orientiert sei und „die romanischen Sprachen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung der diachronischen wie der synchronischen Betrachtungsweise“ behandeln müsse (Holtus 1997, 385) – also ein viel umfassenderes Informationsziel, aber natürlich war der literaturwissenschaftliche Teil von Gröbers Grundriss ersatzlos gestrichen worden.
Gröbers anspruchsvolles Werk, an dem 27 Mitarbeiter beteiligt waren, war nicht unbedingt auf Anhieb von Anfängern zu lesen, so dass ein eher auf ein studentisches Publikum ausgerichtetes Einführungswerk wie das Handbuch der romanischen Philologie von Gustav Körting eine weiter reichende Wirkung hatte, die über den engen Kreis der Spezialisten im engeren Sinne hinausging. Dadurch, dass bei Gustav Körting, der sein Werk allein geschrieben hat, Grundfragen wie die Definition der Philologie, die Geschichte der Romanistik, Sprache und Schrifttum, Latein und Romanisch, Wahl der Studienfächer (Zweitfach Latein und nicht etwa Englisch), praktische Beherrschung romanischer Sprachen, Privatlektüre, „Neuphilologische Vereine“ besprochen werden, kann man die Breitenwirkung dieser Einführung gar nicht hoch genug einschätzen; besonders Eltern von studierwilligen Jugendlichen und Lehrer der oberen Gymnasialklassen werden ihre Beratungen oft am diesem Werk von Gustav Körting ausgerichtet haben.
In der Zeit kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte die Romanistik in den deutschsprachigen Ländern den Höhepunkt ihrer Breitenwirkung erreicht, und von den wichtigen Werken etwa von Friedrich Diez oder Wilhelm Meyer-Lübke gab es französische und italienische Übersetzungen, so dass diese Arbeiten auch international zugänglich waren.
6Die Romanistik zwischen den beiden Weltkriegen
Es ist hier nicht der Ort, die weitere Geschichte der Romanistik zu skizzieren. Neu hinzukamen die Sprachgeographie, die Etymologika der romanischen Einzelsprachen, die verschiedenen strukturalistischen Schulen, die generativen Ansätze im Gefolge von Noam Chomsky, die Soziolinguistik, die angewandte Linguistik, die Textlinguistik und die Pragmatik, um nur einige hervorstechende Bereiche zu nennen (Kramer/Willems 2014). Es ist auffällig, dass die Epoche der Erneuerung der Romanistik sich nicht in gewichtigen Gesamtdarstellungen dieser Wissenschaft niederschlug: Es gab natürlich weiterhin Darstellungen der Romanistik als Wissenschaftszweig, aber das waren meist Neubearbeitungen von Werken aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, etwa Die romanischen Literaturen und Sprachen von Heinrich Morf und Wilhelm Meyer-Lübke (1925), womit ein umfänglicheres Werk von 1909 aktualisiert wurde.
Insgesamt gelangten die Länder, in denen die Kernbereiche der Romanistik intensiv betrieben wurden, sukzessive unter den Einfluss von rechtsgerichteten politischen Diktaturen: 1923 breitete sich der Faschismus über Italien aus, das hatte aber abgesehen vom zunehmend pompösen Stil der Abhandlungen wenig inhaltliche Auswirkungen auf die Romanistik, und Spanien war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass der Sieg der Franco-Allianz von 1936 Auswirkungen auf die Romanistik gehabt haben könnte. Anders war es in Deutschland, das ab 1933 im Sumpf des Nationalsozialismus versank. Schon 1933 wurden aus rassischen oder politischen Gründen 10 Professoren entlassen, das Französische war in der „Deutschen Oberschule“ seit 1935 kein Pflichtfach mehr, die Restromanistik geriet in den Sog der Rassenkunde und der Wesenskunde, Forschungen zur Völkerwanderungszeit wurden zu Abhandlungen über den Wettkampf zwischen romanischen und germanischem Volkstum (Romania Germanica von Ernst Gamillscheg [1887–1971], Verfasser des Romanistik-Artikels in der Hitler-Festschrift von 1939). Die Romanistik war freilich kein politisch bedeutsames Fach, und so konnte man immer noch unverdächtige Spezialbereiche finden, um den politischen Ansprüchen des Nationalsozialismus auszuweichen (Kramer 2008), und insgesamt kam „die deutsche Romanistik, gemessen an anderen Disziplinen, noch einmal glimpflich davon“ (Hausmann 1989, 47), freilich als auf das Essentielle zurückgeführtes Schrumpffach ohne Gefolgschaft in der jüngeren Generation.
7Neuanfang der Romanistik in Deutschland und Österreich nach 1945
1945 musste man in Deutschland und in Österreich einen romanistischen Neuanfang versuchen, aber es fehlte das Personal für diesen Neuanfang, denn man musste ja weitgehend auf diejenigen zurückgreifen, die vor den dreißiger Jahren studiert hatten – mit Romanistik konnte man ja in der Zeit des Nationalsozialismus keine Karriere machen. Der Neuanfang musste versucht werden mit Romanisten mit einer Prägung aus den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts, mit – wie damals üblich – kaum Auslandserfahrung oder Auslandskontakten, und neue Kontakte mussten ja erst geknüpft werden. So wurden die alten Themen (Ausgliederung der romanischen Sprachen, Germanen und Romanen, Dialektologie, verschiedene Sprachstufen) weiter betrieben, aber der Strukturalismus, die Textlinguistik oder die entstehende Soziolinguistik klopften noch sehr bescheiden an die Türe. In Deutschland bemühte man sich darum, Anschluss an die Zeit vor 1933 zu gewinnen, freilich unter Betonung der traditionellen Aspekte (Kuhn 1951; der vorgesehene Band über die Literatur ist nie erschienen). Der Versuch, eine Einführung unter Berücksichtigung des Strukturalismus zu schreiben, wurde 1956 von Heinrich Lausberg begonnen, aber die „Wortlehre und Synax“ dieses als Ersatz von Zauner 1905 gedachten Göschen-Werkes ist nie erschienen, obwohl die Bände über Vokalismus und Konsonantismus sehr positiv aufgenommen wurden und immer wieder neue Auflagen erlebten.
Ausländische Werke konnten in der Nachkriegszeit auch nur partiell Ergänzungen zum eingeschränkten deutschen Angebot bieten. In Frankreich hat sich die Romanistik unter anderen Vorzeichen entwickelt, so dass dort die Éléments de linguistique romane von Édouard Bourciez (1854–1946), die 1910 erstmals erschienen sind, bis zum Ende der sechziger Jahre als Pflichtlektüre für Studierende vorgeschrieben waren und natürlich unübertrefflich altmodisch waren. Auch die englische Einführung von William Dennis Elcock (1960) ist konservativ und eher auf die Bedürfnisse von Studienanfängern eingerichtet. Die ausgezeichnete und alle romanischen Einzelsprachen berücksichtigende Darstellung von Carlo Tagliavini litt lange darunter, dass nur das italienische Original vorlag und Übersetzungen in andere Sprachen erst spät erfolgten. Das Werk bleibt aber „le meilleur manuel en termes d’équilibre interne et de qualité du traitement“, und als Gesamturteil gilt: „Tagliavini reste insurpassable“ (Glessgen 2007, 35).
8Der Umbruch der Romanistik in den sechziger Jahren
Ein Moment der Krisis erlebte die internationale und besonders die deutsche Romanistik in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts: Der unvermeidliche Generationenwechsel fand statt, aber es fehlte die verbindende Generation, weil niemand sich in der Zeit des Nationalsozialismus für die Romanistik begeistern konnte. So drängten völlig neue junge Kräfte seit den sechziger Jahren nach vorne, so dass oft die Jüngeren es an Verständnis für die Älteren fehlen ließen und deutlich „Opas Romanistik“ verachteten. Man lehrte und forschte weitgehend aneinander vorbei, man schrieb eher in kurzlebigen Sammelbänden statt in etablierten Zeitschriften, statt gut geschriebener Beiträge in der eigenen Muttersprache begannen französische, spanische und vor allem englische Beiträge sich durchzusetzen, und nicht ganz selten ahmte man Fragestellungen nach, die sich schon in der Germanistik oder in der Allgemeinen Sprach- und Literaturwissenschaft „bewährt“ hatten. Die Diversifizierung der Universitätslandschaft mit der Neugründung zahlreicher Universitäten und der Erschaffung zahlreicher Sonderforschungsbereiche, oft ex nihilo, führte zur Konstituierung zahlreicher neuer – und oft auch nicht so neuer – Themenbereiche, an denen man sich gemeinsam abarbeitete, meist aber ohne Verbindung zu anderen Romanistinnen und Romanisten, die sich mit anderen Gebieten beschäftigten.
9Neue Lexika der Romanistik am Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert
Aus der Impasse der Romanistik mussten neue Gemeinschaftsunternehmungen und vor allem die umfangreichen Lexikonbände herausführen, die in Deutschland in drei Veröffentlichungsschritten den Stand der Wissenschaft darstellen und zugleich eine Öffnung zur Internationalität bilden. Neue englischsprachige Großpublikationen liefern außerdem neuerdings eine internationale Abrundung.
Kommen wir zunächst zu den Sammelbänden, die im Wesentlichen den Status der Romanistik abbilden, wie er in erster Linie, wenn auch keineswegs ausschließlich, im deutschen Sprachraum erzielt wurde! Die acht Bände des Lexikons für Romanistische Linguistik (LRL), die in 12 Einzelbänden zwischen 1988 und 1995 von Günter Holtus, Michael Metzeltin und Christian Schmitt veröffentlicht wurden, eröffnen die Reihe. Was die Wahl der Darstellungssprache anbelangt, war man offen: Man findet Beiträge in deutscher, englischer, französischer, spanischer, portugiesischer und italienischer Sprache; einen „nationalistischen Ausreißer“ stellen lediglich die auf Galizisch geschriebenen Beiträge zum „galego“ (Band VI, 2, 1–129) dar, die durch ihre Abkehr von den internationalen Wissenschaftssprachen schon dadurch auffallen, dass beispielsweise kein einziger Beitrag auf Rumänisch geschrieben ist. Insgesamt enthält das LRL583 Artikel (VIII, 98), die jeweils zwischen grob zehn und zwanzig Seiten mit Bibliographie umfassen. Die Artikel richten sich an die „Lehrenden und Studierenden der Romanischen Sprachwissenschaft“, darüber hinaus sollen sie ein Hilfsmittel für alle sein, die „in der Sprachwisssenschaft und speziell in der Romanistik eine funktionale Hilfswissenschaft erkennen“ können (VIII, 5).
Das zweite Unternehmen, das von Gerhard Ernst, Martin-Dietrich Gleßgen, Christian Schmitt und Wolfang Schweickard zwischen 2005 und 2008 herausgegeben wurde, trägt den Titel Romanische Sprachgeschichte; es handelt sich um drei umfängliche Lexikonbände, die als Band 23 in die Reihe der Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft eingeordnet werden. Thematisch sind die Bände auf die Sprachgeschichte eingeschränkt, wobei der Umfang der Beiträge umfangreicher als beim LRL ausgefallen ist.
Das zeitlich dritte, jetzt vom De Gruyter Verlag betreute Unternehmen, das inzwischen den Niemeyer-Verlag übernommen hat, firmiert unter dem (englischen!) Gesamttitel Manuals of Romance Linguistics, mit den romanischen Entsprechungen Manuels de linguistique romane = Manuali di linguistica romanza = Manuales de lingüística románica. Die Herausgeber sind Günter Holtus und Fernando Sánchez-Miret, und die Planung ist auf ungefähr sechzig Bände veranschlagt, also ein Riesenunternehmen wahrhaft pharaonischer Dimension; inzwischen (2019) sind mehr als ein Dutzend Bände erschienen, und man erkennt auch allmählich, dass die Menge der romanistischen Sondergebiete unendlich ist, die Menge der Romanstinnen und Romanisten aber nicht, so dass bislang viele Gebiete von denselben Persönlichkeiten unter verschiedenen Aspekten behandelt wurden – schlimm ist das nicht, aber es erhöht die Übersichtlichkeit keineswegs. Prinzipiell ist für jeden Band eine und nur eine romanische Darstellungssprache oder das Englische vorgesehen, wobei dieses Prinzip gelegentlich durchbrochen wurde; das Deutsche ist aus dem Kreis der Darstellungssprachen ausgeschlossen, wenn man so will, ein typischer Fall des autoodi cap a la llengua pròpia der deutschsprachigen Romanistinnen und Romanisten, der sich mit der zurückgehenden internationalen Fähigkeit, deutsche Texte zu verstehen, trifft.
Die englischsprachige Tradition der substantiellen Einführungen in Wissensgebiete basiert auf umfangreichen einbändigen Sammelbänden. Das beste Beispiel dafür ist der neue Oxford Guide to the Romance Languages (mit LIV + 1194 Seiten), der 2016 von Adam Ledgeway und Martin Maiden herausgegeben wurde. In 60 Kapiteln, aufgeteilt auf zehn Sachgebieten („parts“), wird ein Panorama der sprachwissenschaftlichen Romanistik geboten, das von internationalen Fachleuten dargeboten wird, die die einführenden Kapitel in englischer Sprache schreiben konnten oder wollten – der vielsprachige Charakter der Romanistik, in der im Wesentlichen jeder in seiner Lieblingssprache internationaler Verbreitung schreibt, wird damit natürlich zu Grabe getragen. Wir haben hier aber ein Werk vor uns, das das, „was man in der englischsprachigen Welt für das Grundwissen in der sprachwissenschaftlichen Romanistik hält“ überzeugend, wenn auch nicht immer leicht lesbar, darstelllt, technisch-struktureller ausgeführt, als man das in den Bänden aus dem Niemeyer-De Gruyter-Verlag findet, die eher kulturhistorische und soziolinguistische Fragestellungen mitberücksichtigen (Kramer 2018b, 1251).
10Die Rolle der Summae Romanisticae in der Wissenschaftsgeschichte
In der Rückschau kann man sagen, dass es drei Perioden in der Geschichte des Faches gibt, die umfassende Darstellungen der Romanistik bieten: Das ist einmal die Anfangsperiode der Wissenschaft, als man sozusagen das eigene Interessengebiet absteckte und von Nachbarterritorien (Latinistik, Indogermanistik, andere Neuphilologien) abgrenzte, dann ist da die Zeit vor dem Ausbruch der Ersten Weltkrieges, als man im Vollbewusstsein des sich vermeintlich abzeichnenden Triumphes der historisch-vergleichenden Methode darstellte, was die Romanistik erreicht hatte, und schließlich ist da die Gegenwart, in der man die Romanistik in den Kanon der anderen Sprachwissenschaften einzuordnen versucht und zugleich ihr Spezifikum herausstellt. In der Geschichte jeder Wissenschaft gibt es Momente, in denen sich das Bedürfnis herausstellt, eine Summa zu haben, weil das eigene Gebiet zu umfangreich geworden ist, um es auch nur einigermaßen zu übersehen, und wenn böse Zungen auch behaupten, dass die Entwicklung der mittelalterlichen Theologie an einem bestimmten Endpunkt angelangt war, als der „Markt“ mit verschiedenen Summae theologiae überschwemmt wurde, so muss man doch sagen, dass die systematische Wissenschaftsdarstellung jeweils einen Zielpunkt darstellten, von dem aus man neue Enzwicklungen angehen konnte. Hoffen wir, dass es bei den neuesten Guides, Manuals, Handbüchern und Lexika der Romanistik wie bei den spätmittelalterlichen Summae ist: Rekapitulation des Ist-Standes und Vorbereitung zukünftiger neuer Horizonte, von denen noch niemand wissen kann, was sie beinhalten werden.
Bibliographie
Bartsch, Karl (1875): Chrestomathie provençale, accompagnée d’une Grammaire et d’un Glossaire, Elberfeld, Friederichs.
Bartsch, Karl (1886): Chrestomathie de l’Ancien Français, accompagnée d’une Grammaire et d’un Glossaire, Leipzig, Vogel.
Bourciez, Édouard (51967 [1910]): Éléments de linguistique romane, Paris, Klincksieck.
Curtius, Ernst Robert (1911): Li quatre livre des Rois, Dresden, Gesellschaft für romanische Literatur.
Diez, Friederich (1818): Altspanische Romanzen, Frankfurt, Hermann.
Diez, Friedrich (1826): Die Poesie der Troubadours, Zwickau, Schumann.
Diez, Friedrich Christian (1836–1843): Grammatik der romanischen Sprachen, vol. 1, Bonn, Weber (31869 [1836]); vol. 2, Bonn, Weber (1838); vol. 3, Bonn, Weber (1843).
Diez, Friedrich (1853): Lexicon Etymologicum Linguarum Romanarum, Italicae, Hispanicae, Gallicae. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen, Bonn, Marcus.
Diez, Friedrich Christian (1863): Über die erste portugiesische Kunst- und Hofpoesie, Bonn, Weber.
Elcock, William Dennis (1960): The Romance Languages, London, Faber/Faber.
Fuchs, August (1849): Die romanischen Sprachen im ihrem Verhältnisse zum Lateinischen, Halle, Schmidt.
Grimm, Jacob (1819): Deutsche Grammatik, Erster Theil, Göttingen, Dieterich.
Gröber, Gustav (1888–1902): Grundriss der romanischen Philologie, vol. 1, Strassburg, Trübner (1888, 2. verbesserte und vermehrte Auflage, Strassburg, Trübner, 1903–1906); vol. 2 (1), Strassburg, Trübner (1902); vol. 2 (2), Strassburg, Trübner (1897); vol. 2 (3), Strassburg, Trübner (1901).
Glessgen, Martin-Dietrich (2007): Linguistique romane, Paris, Colin.
Hausmann, Frank-Rutger (1989): „Die nationalsozialistische Hochschulpolitik und ihre Auswirkungen auf die deutsche Romanistik von 1933 bis 1945“, in: Christmann, Hans Helmut/Hausmann, Franl-Rutger (eds.): Deutsche und österreichische Romanisten als Verfolgte des Nationalsozialismus, Tübingen, Stauffenberg, 9–54.
Holtus, Günter (1997): „Romanistik einst und jetzt: Gustav Gröbers Grundriss der romanischen Philologie und das Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL)“, in: Holtus, Günter/Kramer, Johannes/Schweickard, Wolfgang (eds.): Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag, vol. 3, Tübingen, Niemeyer, 371–389.
Jäger, Gerhard (1975): Einführung in die Klassische Philologie, München, Beck.
Körting, Gustav (21901 [1890–1891]): Lateinisch-romanisches Wörterbuch, Paderborn, Schöningh.
Körting, Gustav (1896): Handbuch der romanischen Philologie, Leipzig, Reisland.
Kramer, Johannes (2008):„Romanistik“, in: Elvert, Jürgen/Nielsen-Sikora, Jürgen (eds.): Kulturwissenschaften und Nationalsozialismus, Stuttgart, Steiner, 669–690.
Kramer, Johannes (2017): „Deutsch als Wissenschaftssprache der Romanistik“, in: Romanistik in Geschichte und Gegenwart23, 3–20.
Kramer, Johannes (2018a): „Zum Sonderweg der Romanistik in Deutschland“, in: Romanistik in Geschichte und Gegenwart24, 3–17.
Kramer, Johannes (2018b): Rezension von Ledgeway/Maiden 2016, in: Zeitschrift für romanische Philologie134, 1236–1251.
Kramer, Johannes/Willems, Aline (2014): „La linguistique romane après la Première Guerre mondiale“, in: Klump, Andre/Kramer, Johannes/Willems, Aline (eds.): Manuel des langues romanes, De Gruyter, Berlin/Boston, 65–88.
Kuhn, Alwin (1951): Die romanischen Sprachen, Bern, Francke.
Lausberg, Heinrich (1956–1968): Romanische Sprachwissenschaft I: Einleitung und Vokalismus, Berlin, de Gruyter (1956); II: Konsonantismus (1968); Formenlehre (1962).
Ledgeway, Adam/Maiden, Martin (2016): The Oxford Guide to the Romance Languages, Oxford, University Press.
Lommatzsch, Erhard (1917): Provenzalisches Liederbuch. Lieder der Troubadours mit einer Auswahl biographischer Zeugnisse, Nachdichtungen und Singweisen, Berlin, Weidmann.
Morf, Heinrich/Meyer-Lübke, Wilhelm (1925): Die romanischen Literaturen und Sprachen, Leipzig/Berlin, Teubner (zuvor: Zimmer, Heinrich/Meyer, Kuno/Stern, Ludwig Christian/Morf, Heinrich/Meyer-Lübke, Wilhelm (1909): Die romanischen Literaturen und Sprachen mit Einschluss des Keltischen, Berlin/Leipzig, Teubner).
Pfeiffer, Rudolf (1970): Geschichte der klassischen Philologie. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt.
Schöttle, Silke (2015): „Exoten in der akademischen Gesellschaft? Frühneuzeitliche Sprachmeister am Collegium Illustre und an der Universität Tübingen“, in: Häberlein, Mark (ed.): Sprachmeister. Sozial- und Kulturgeschichte eines prekären Berufsstandes, Bamberg, University of Bamberg Press, 87–102.
Steub, Ludwig (21871 [1846]): Drei Sommer in Tirol, Stuttgart, Cotta.
Swiggers, Pierre (2014): „La linguistique romane, de Friedrich Diez à l’aube du XXe siècle“, in: Klump, Andre/Kramer, Johannes/Willems, Aline (eds.): Manuel des langues romanes, Berlin/Boston, De Gruyter, 43–64.
Tagliavini, Carlo (61972 [1949]): Le origini delle lingue neolatine. Introduzione alla filologia romanza, Bologna, Pàtron. Deutsche Übersetzung: (21998 [1973]): Einführung in die romanische Philologie, Tübingen/Basel, Francke.
Thiele, Sylvia (2014): „Le ladin dolomitique“, in: Klump, André/Kramer, Johannes/Willems, Aline (eds.): Manuel de langues romanes, Berlin/Boston, De Gruyter, 389–412.
Voretzsch, Karl (1921): Altfranzösisches Lesebuch, Halle, Niemeyer.
Zauner, Adolf (1905): Romanische Sprachwissenschaft, Leipzig, Göschen.
La valeur méthodologique des quatre axiomes constitutifs de l’analyse philologique des langues romanes
Les langues romanes représentent un cas particulier de famille de langues et trouvent leur source dans une langue d’origine historiquement attestée : le latin. En cela, elles se différencient par exemple de la famille des langues germaniques ou slaves.1 Alors qu’en cherchant un proto-germanique ou proto-slave, il faut remonter à environ trois mille ans dans l’histoire, nous trouvons les débuts des langues romanes, donc le proto-roman, environ entre 500 et 800 après Jésus-Christ. Nous nous situons alors au haut Moyen Âge de notre histoire culturelle directe et bien documentée. Mais nous voici au cœur du problème : faut-il continuer à chercher l’origine des langues romanes dans un proto-roman, ce qui serait conséquent du point de vue des études indo-européennes, ou peut-on s’accommoder du latin comme langue d’origine des langues romanes, ce qui rendrait superflue la recherche d’un proto-roman ?
Voici le dilemme de la philologie romane, car le latin comme il nous a été transmis dans sa forme écrite, donc en l’occurence le latin classique et certaines formes de latin écrit médiéval, ne livrent, de par leur norme, que peu d’éclaircissements sur l’origine des langues romanes. Les romanistes doivent donc partir à la recherche du latin non-normatif qui était parlé dans l’Antiquité et au haut Moyen Âge, mais qui est peu documenté, en général de manière indirecte et dans tous les cas lacunaire. Lorsqu’ils entament cette recherche d’un latin parlé et non-normé, ils reconstruisent une langue d’origine dont nous ne connaissons pas le degré exact d’uniformité et de conformité avec le proto-roman, qui était parlé à une époque où le latin parlé n’était définitivement plus du latin. Ainsi, il est salvateur d’accepter qu’il ne reste pas grand-chose de la prémisse que « toutes la langues romanes sont issues du latin » en termes de clarté historico-linguistique lorsqu’on cherche à expliquer scientifiquement l’origine des langues romanes.2
L’histoire de la philologie romane se résume, dans ses grandes lignes, à l’effort de pallier au manque de clarté décrit. Une série d’axiomes a été énoncée ce faisant ; je voudrais les nommer ci-après comme principes constitutifs de la philologie romane.3
Axiome n°1 :
Les langues romanes ne proviennent pas du latin classique, donc le latin comme il nous a été transmis dans sa forme écrite. (principe d’oralité)
Axiome n°2 :
L’origine des langues romanes n’est pas monogénétique, c’est-à-dire qu’il n’existe pas une langue d’origine. (principe d’hétérogénéité)
Axiome n°3 :
Avant que les langues romanes existent, il y avait seulement des variétés romanes se développant constamment dans l’espace géographique (dialectes, « patois »). (principe d’aréalité)
Axiome n°4 :
Les langues romanes se sont constituées dans un processus complexe de diversification normative. (principe de standardisation)
Ces idées ne se sont établies qu’au cours de l’histoire de la discipline. Elles ont acquis néanmoins un caractère réellement axiomatique, c’est-à-dire qu’elles sont toujours constitutives de l’identité définitoire de la philologie romane comme discipline s’étant établie dans le temps. Ci-après, je voudrais tenter de mettre en lumière les corollaires, les conséquences méthodiques et interprétatives ainsi que les traditions et erreurs qui peuvent découler de ces quatre axiomes. N’omettons pas de souligner que les quatre axiomes sont intrinsèquement liés d’un point de vue méthodologique et que les explications relatives à chacun d’entre eux ne peuvent être lues qu’en relation aux autres. En règle générale, mes remarques peuvent donc être attribuées à plus d’un axiome à la fois.
Axiome n° 1: Les langues romanes ne proviennent pas du latin classique, donc le latin comme il nous a été transmis dans sa forme écrite. (principe d’oralité)
Cet axiome est un plaidoyer pour l’oralité de la langue, non seulement dans la recherche scientifique de l’origine des langues romanes, mais aussi quant à leur formation et développement au cours du temps. D’un point de vue méthodologique, ce plaidoyer pour l’oralité implique la reconnaissance du primat de la langue parlée. Les grandes contributions de romanistes à la linguistique générale s’inscrivent dans cette tradition. La théorie du romaniste influent Eugenio Coseriu (1921–2002), qui trouve écho jusqu’aujourd’hui, en est un exemple par excellence. Il a travaillé à transformer la philologie romane en une discipline moderne structuraliste, dont il voyait les fondements dans une théorie de la compétence linguistique et de l’usage de la parole :
Un changement radical de point de vue doit se produire dans l’observation de la compétence linguistique : à l’inverse de Saussure, c’est l’usage de la parole qui est l’élément essentiel du langage pour Coseriu. Il est composé d’une couche biologique et d’une couche culturelle. Culturellement, la parole est d’abord une activité qui repose sur un savoir et qui est produite de manière parlée et écrite. La parole est une activité linguistique générale qui est exercée de manière individuelle (discours) par les représentants d’une même tradition du savoir parler (langues historiques à part). Le produit de cette activité est, de manière générale, la totalité des propos, historiquement la langue abstraite et individuellement le texte. Coseriu en arrive ainsi à un élargissement de la théorie générale de l’usage de la parole.1
À la suite de Coseriu, les romanistes Peter Koch et Wulf Oesterreicher ont développé dans les années 1980 une théorie dans le cadre d’un projet de recherche de l’Université de Freiburg. Elle a engendré un nouvel élan au-delà des frontières de la discipline et quasiment unique pour la linguistique en Allemagne et dans certaines régions d’Europe. Il s’agit de la théorie de l’oralité que les fondateurs caractérisent eux-mêmes par le binôme « langue de proximité et langue de distance ». La proximité et la distance doivent être comprises comme deux dimensions du comportement communicatif et ne se résument pas à la description d’une seule langue.2 Koch et Oesterreicher définissent la proximité et la distance dans l’activité communicative d’une part au travers des conditions communicatives objectives, d’autre part au travers des stratégies langagières des usagers. Ils créent ainsi une base théorique communicative pour l’oralité du parler qui peut être employée à différents égards. Koch et Oesterreicher eux-mêmes ont mis l’accent sur deux emplois méthodiques. Ils utilisent leur concept de proximité et de distance de la parole dans le but d’élargir le modèle structuraliste de la variété linguistique d’une part. D’autre part, grâce au concept-clé de l’« oralité expressive », ils développent la signification de leur concept pour une théorie du changement linguistique fondée sur la communication.
La mise en exergue de l’oralité et des conséquences méthodiques qu’elle implique est donc fondamentale pour la philologie romane moderne. En regardant de plus près, on peut supposer que les convictions linguistiques et communicatives théoriques qui vont de pair avec elle ont particulièrement facilité le rapprochement entre la philologie romane et des disciplines de recherche encore plus jeunes, comme la pragmatique et la linguistique cognitive.
Mais revenons aux débuts dans le cadre d’une perspective historiographique et demandons-nous dans quelle mesure l’axiome selon lequel les langues romanes ne proviennent pas du latin écrit a été décisif dans la construction d’une théorie historico-linguistique. En nous intéressant à cette question, nous avons affaire – d’un point de vue actuel – à une philologie romane bien moins moderne. Cette dernière se contente jusqu’aujourd’hui d’éviter des points de vue exagérés et des idées fausses. Une erreur de jugement précoce ayant des conséquences pour la discipline fut la recherche de langues d’origine concrètes qui auraient pu représenter une alternative au latin. Au XIXe siècle, deux opinions s’opposent sur ce sujet.
Entre 1816 et 1821, le chercheur François-Juste-Marie Raynouard, alors reconnu de ses contemporains pour son travail sur le provençal, prononça l’idée que l’origine des langues romanes comportait deux volets.3 Dans la Romania centrale et occidentale, la langue originelle qui se forma aurait correspondu dans ses grandes lignes à l’ancien provençal. À l’opposé, le valaque, comme on appelait alors le roumain, se serait construit sur une autre variété romane originelle. Autant la forme occidentale qu’orientale se seraient constituées grâce à des mélanges linguistiques particuliers, un point de vue tout à fait courant à l’époque. Dans la tentative de réfuter cette opinion tout en accordant une origine commune aux langues romanes, les philologues allemands Friedrich Diez et Hugo Schuchardt prirent une place à part. C’est à leurs travaux et enseignements que l’on doit l’établissement d’une philologie romane comme discipline autonome, qui expliqua le développement de toutes les langues romanes à partir d’un latin populaire relativement uniforme, donc d’un latin avant tout parlé, pour lequel le terme de « latin vulgaire », c’est-à-dire latin du peuple, s’est imposé sur le plan terminologique.4





























