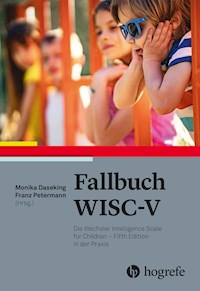
Fallbuch WISC-V E-Book
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die WISC-V gehört zu den international am weitesten verbreiteten Intelligenztests für die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen zwischen 6;0 bis 16;11 Jahren und wird bei sehr unterschiedlichen Fragestellungen in der psychologischen Praxis eingesetzt. In diesem Fallbuch werden nach einer Einführung in die Intelligenzdiagnostik mit der WISC-V zu verschiedenen kinder- und jugendpsychologischen sowie pädagogischen Fragestellungen WISC-V-Profile vorgestellt, analysiert und interpretiert. Die Profilinterpretationen decken ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten der WISC-V ab und beziehen sich auf Lernstörungen, neurologische und psychische Störungen sowie die Anwendung der WISC-V bei Kindern mit Migrationshintergrund, Hochbegabung und Intelligenzminderung. Alle Falldarstellungen sind nach einer einheitlichen Struktur aufgebaut und werden durch Empfehlungen für eine weiterführende Diagnostik und Intervention ergänzt. Testanwender erhalten in diesem Band praxisorientierte Hilfen für die Auswertung und Interpretation von WISC-V-Testergebnissen, um so die Interpretationsmöglichkeiten der Testprofile besser ausschöpfen zu können. Ein Glossar mit häufig gestellten Fragen zur WISC-V rundet den Band ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Monika Daseking
Franz Petermann
(Hrsg.)
Fallbuch WISC-V
Prof. Dr. Monika Daseking,geb. 1962. 1982–1987 Studium der Theologie in Halle. 1995–2000 Studium der Psychologie in Bremen. 2001–2015 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen. 2005 Promotion. 2011 Habilitation. 2015–2019 Vertretungsprofessur für Pädagogische Psychologie an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg. Seit 2019 Professorin für Pädagogische Psychologie an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg. Arbeitsschwerpunkte: Schulische Lernstörungen, Intelligenzentwicklung über die Lebensspanne, Exekutive Funktionen, Moralentwicklung.
Prof. Dr. Franz Petermann(1953–2019). 1972–1975 Studium der Mathematik und Psychologie in Heidelberg. Wissenschaftlicher Assistent an den Universitäten Heidelberg und Bonn. 1977 Promotion. 1980 Habilitation. 1983–1991 Leitung des Psychosozialen Dienstes der Universitäts-Kinderklinik Bonn, gleichzeitig Professor am Psychologischen Institut. 1991–2019 Lehrstuhl für Klinische Psychologie an der Universität Bremen. 1996–2019 Direktor des Zentrums für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com by Getty Images / StockPlanets
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2021
© 2021 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3008-9; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3008-0)
ISBN 978-3-8017-3008-6
https://doi.org/10.1026/03008-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|5|Vorwort
Seit der Veröffentlichung des ersten Bandes aus der Reihe der Fallbücher, des Fallbuchs HAWIK-IV, sind inzwischen mehr als zehn Jahre vergangen. Seitdem hat sich aus dieser Veröffentlichung eine Buchreihe etabliert, die Anwenderinnen und Anwendern anhand von konkreten Beispielen aus der psychologischen Praxis vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Befunde Informationen zur Interpretation von Testergebnissen aus sehr unterschiedlichen Anwendungsbereichen zur Verfügung stellt.
Testverfahren, insbesondere Intelligenztests, sollten regelmäßig überarbeitet und neu normiert werden. Zudem können neue wissenschaftliche Ergebnisse zu einer Veränderung in der Grundkonzeption oder in der inhaltlichen Ausgestaltung solcher Tests führen. Aber auch die Veränderung unserer Lebensumwelt führt dazu, dass Aufgabeninhalte beispielsweise nicht mehr aktuell sind oder sich ihre Schwierigkeit verändert. Auch die Wechsler Intelligence Scale for Children wurde daher in den letzten Jahren umfassend überarbeitet und liegt nun in ihrer fünften Version vor (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition, WISC-V). Die WISC-IV, also die Vorgängerversion, wurde in Deutschland zunächst unter dem Namen Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder (HAWIK-IV) publiziert; seit 2011 wurde aber auch in Deutschland die internationale Bezeichnung WISC-IV verwendet. Diese Testversion wurde nun durch die WISC-V abgelöst. Aber nicht nur inhaltliche Veränderungen haben ihre Spuren hinterlassen. Die Digitalisierung macht auch vor der psychologischen Testdiagnostik nicht halt. Für die WISC-V wird neben der herkömmlichen Paper-Pencil-Variante auch eine webbasierte Durchführungs- und Auswertungsalternative angeboten, die sich hinter den Bezeichnungen Q-global und Q-interactive verbirgt. Auf dieser Plattform werden sukzessive weitere Testverfahren als digitale Alternativen zur herkömmlichen Anwendung zur Verfügung gestellt.
Intelligenztests stellen wichtige Instrumente und zugleich Hilfsmittel dar, um kognitive Fähigkeiten von Menschen zu beschreiben. Dabei sollte unter Berücksichtigung der eigentlichen diagnostischen Fragestellung die Variabilität innerhalb eines kognitiven Profils im Vordergrund stehen und nicht der eine globale Intelligenzwert. Intelligenzdiagnostik ist zudem nicht gleichzusetzen mit der Vergabe eines Labels oder einer Klassifizierung! Die differenzierte Darstellung der kognitiven Leistungsfähigkeit, also der individuellen kognitiven Stärken und Schwächen, einer Testperson unter den Bedingungen der konkreten Situation, in der sich |6|diese Person befindet, kann wichtige Impulse für die weiterführende Diagnostik und/oder Intervention liefern.
Ein Test ist immer auch nur so gut, wie Testanwender_innen in der Lage sind, das Instrument sachgerecht anzuwenden und zu interpretieren! Die sachgerechte Durchführung und Auswertung lassen sich im Rahmen von Schulungsmaßnahmen erlernen und reflektieren. Für die Interpretation möchte das vorliegende Fallbuch Anregungen liefern, die wiederum als Grundlage von eigenen Fallvorstellungen beispielsweise im Rahmen von Fallsupervisionen dienen können.
Die Wechsler-Tests werden bei sehr unterschiedlichen Fragestellungen in der psychologischen Praxis eingesetzt. Anhand einer Auswahl an Problemstellungen und Einsatzmöglichkeiten der WISC-V sollen also in diesem Fallbuch diagnostische Strategien vorgestellt werden, die Interpretationsmöglichkeiten für Intelligenzprofile einschließen und durch Handlungsalternativen für eine weiterführende Diagnostik und die Intervention ergänzt werden. Im ersten Kapitel werden dabei zunächst allgemeine Informationen zur WISC-V zusammengefasst, wobei explizit auch auf die Veränderungen zur Vorgängerversion eingegangen wird. Zudem werden die grundlegenden Auswertungsoptionen aufgezeigt, wobei auch kurz auf die webbasierten Varianten eingegangen wird. Das zweite Kapitel betrachtet die intelligenztheoretische Einbettung der WISC-V vor dem Hintergrund des hierarchischen CHC-Modells der Intelligenz. Diesen grundlegenden Ausführungen schließen sich die verschiedenen thematischen Kapitel an, die ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten der WISC-V abdecken. Die Struktur dieser Kapitel wurde so gewählt, dass im Anschluss an eine kurze Einführung in das jeweilige Thema zwei Fälle detailliert aufbereitet und anschließend vergleichend bewertet werden. Diese Fallbeispiele sollen Testanwender_innen Sicherheit in der Interpretation von Testprofilen geben. Sie können aber nicht die intensive Einarbeitung in den Test an sich ersetzen. Die Manuale zur WISC-V enthalten differenzierte Hinweise zur Durchführung, Auswertung und Interpretation der WISC-V.
Bedauerlicherweise ist mein Mitherausgeber, Prof. Dr. Franz Petermann, viel zu früh verstorben und konnte somit nicht erleben, dass die gemeinsame Idee und Konzeption zu diesem Fallbuch auch in die Tat umgesetzt werden konnte. Ihm war es immer ein wichtiges Anliegen, die Testanwender_innen in ihrer praktischen Arbeit zu unterstützen.
Allen Autorinnen und Autoren, die mich durch ihre Beiträge unterstützt und somit zum Gelingen dieses Fallbuchs beigetragen haben, möchte ich auf diesem Weg noch einmal herzlich danken! Außerdem danke ich Valentin Mardin für die hilfreiche Unterstützung bei der Gestaltung und Formatierung des Manuskripts.
Auf einen Dialog mit Ihnen als Anwender_innen und Leser_innen freue ich mich ([email protected]).
Hamburg, im November 2020
Monika Daseking
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I Einführung in die WISC-V
1 Theoretische Grundlagen, Durchführung und Auswertungsstrategien der WISC-V
1.1 Struktur der WISC-V
1.2 Testdurchführung, Testauswertung und Testinterpretation
1.3 Zusammenfassung
2 WISC-V und ihre intelligenztheoretische Einbettung
2.1 CHC-Modell
2.2 WISC-V und CHC-Modell
2.3 Fallbeispiel: Leon, 9;2-jähriger Junge mit Verdacht auf Dyskalkulie
2.4 Zusammenfassung
II Fallbeispiele
3 Intellektuelle Hochbegabung
3.1 Problembereich
3.2 Rolle der WISC-V
3.3 Fallbeispiel 1: Johannes, 12;9-jähriger Junge mit Auffälligkeiten im Sozialverhalten
3.4 Fallbeispiel 2: Antonio, 9;7-jähriger bilingual aufwachsender Junge
3.5 Zusammenfassung
4 Intelligenzminderung
4.1 Klassifikation
4.2 Genetische Aspekte einer Intelligenzminderung
4.3 Diagnostik einer Intelligenzminderung und die Rolle der WISC-V
4.4 Fallbeispiel 1: Linus, 9;7-jähriger Junge mit einer leichten Intelligenzminderung
4.5 Fallbeispiel 2: Samuel, 9;0-jähriger Junge als Grenzfall einer leichten Intelligenzminderung
4.6 Zusammenfassung
5 Intelligenzdiagnostik bei 6- und 7-Jährigen: Der Überlappungsbereich von WISC-V und WPPSI-IV
5.1 Einführung
5.2 Fallbeispiel 1: Darja, 7-jähriges Mädchen mit sprachlichen Defiziten
5.3 Fallbeispiel 2: Jonas, 6-jähriger Junge mit deutlich überdurchschnittlichen Intelligenzleistungen
5.4 Zusammenfassung
6 Lese- und Rechtschreibstörung (LRS), isolierte Lesestörung und isolierte Rechtschreibstörung
6.1 Klassifikation
6.2 Diagnostik der Lese-Rechtschreibstörung und die Rolle der WISC-V
6.3 Fallbeispiel 1: Ben, 11;1-jähriger Junge mit Defiziten im Lesen
6.4 Fallbeispiel 2: Emma, 9;0-jähriges Mädchen mit Defiziten im Lesen und Rechtschreiben
6.5 Zusammenfassung
7 Rechenstörung
7.1 Einführung
7.2 Diagnostik der Rechenstörung und die Rolle der WISC-V
7.3 Fallbeispiel 1: Hannah, 8;5-jähriges Mädchen mit einer kombinierten Störung schulischer Fertigkeiten (F81.3)
7.4 Fallbeispiel 2: Anton, 13;4-jähriger Jugendlicher mit einer Rechenstörung (F81.2)
7.5 Zusammenfassung
8 Migrationshintergrund
8.1 Definition und Merkmalsverteilungen in der Population
8.2 Intelligenzdiagnostik mit der WISC-V
8.3 Fallbeispiel 1: Usama, 8;11-jähriger Junge mit Migrationshintergrund
8.4 Fallbeispiel 2: Mesut, 9;3-jähriger Junge mit Migrationshintergrund
8.5 Zusammenfassung
9 Das Vollbild der ADHS mit und ohne Beeinträchtigungen der Exekutivfunktionen
9.1 Klassifikation der ADHS
9.2 Diagnostik der ADHS und die Rolle der WISC-V
9.3 Fallbeispiel 1: Julian, 8;9-jähriger Junge mit einer Hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (F90.1)
9.4 Fallbeispiel 2: Mia, 10;2-jähriges Mädchen mit einer Einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.0)
9.5 Zusammenfassung
10 Aufmerksamkeitsstörung
10.1 Einführung
10.2 Fallbeispiel 1: Louis, 8;3-jähriger Junge mit Verdacht auf ADS (F98.80) und einer Störung des Sozialverhaltens (F91.3)
10.3 Fallbeispiel 2: Felix, 7;0-jähriger Junge mit Verdacht auf ADS (F98.80) und einer Lese- und Rechtschreibstörung (F81.0)
10.4 Zusammenfassung
11 Hirntumoren im Kindes- und Jugendalter
11.1 Allgemeine Einführung in das klinische Störungsbild
11.2 Bedeutung der Erfassung der kognitiven Leistungsfähigkeit mit der WISC-V
11.3 Fallbeispiel 1: Fabian, 15;1-jähriger Jugendlicher nach einer Hirntumorerkrankung (Medulloblastom mit Meningeose) im Alter von 9;9 Jahren
11.4 Fallbeispiel 2: Lena, 13;7-jährige Jugendliche nach einer Hirntumorerkrankung (Infratentorielles Ependymom) im Alter von 10;3 Jahren
11.5 Zusammenfassung
12 Epilepsie im Kindes- und Jugendalter
12.1 Einführung
12.2 Bedeutung der Erfassung der kognitiven Leistungsfähigkeit mit der WISC-V
12.3 Fallbeispiel 1: Melinda, 9;6-jähriges Mädchen mit ESES-Syndrom
12.4 Fallbeispiel 2: Laura, 7;3-jähriges Mädchen mit myoklonischen und absenceähnlichen Krampfanfällen
12.5 Zusammenfassung
13 Klinefelter-Syndrom
13.1 Klassifikation und Leitsymptome
13.2 Genetische Diagnostik und Beratung
13.3 Fallbeispiel 1: Hans, 11;6-jähriger Junge mit Klinefelter-Syndrom (47,XXY)
13.4 Fallbeispiel 2: Max, 11;11-jähriger Junge mit Klinefelter-Syndrom (Mosaik)
13.5 Zusammenfassung
14 Stark inhomogene WISC-V-Intelligenzprofile und dissoziierte Intelligenz in der Sozialpädiatrie
14.1 Begriffsklärung
14.2 Fallbeispiel 1: Anna-Lena, 10;10-jähriges Mädchen mit diskrepant schwachen verbalen Leistungen
14.3 Fallbeispiel 2: Manuel, 8;1-jähriger Junge mit diskrepant schwachen nonverbalen Fähigkeiten
14.4 Zusammenfassung
III Anhang
Glossar für die Praxis
A) Teststruktur und -überarbeitung
B) Durchführung
C) Auswertung
D) Interpretation
E) Q-global und Q-interactive
Testverzeichnis
Die Autorinnen und Autoren des Bandes
Bildnachweis
|11|I Einführung in die WISC-V
|13|1 Theoretische Grundlagen, Durchführung und Auswertungsstrategien der WISC-V
Monika Daseking
Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass Intelligenz und die kognitiven Leistungen, die in einem Intelligenztest erfasst werden, einen wichtigen Beitrag in der Vorhersage von schulischem Erfolg leisten können. Roth und Kollegen (2015) konnten in ihrer Metaanalyse einen Zusammenhang von p = .54 zwischen Schulnoten und Intelligenz ermitteln, wobei verbale und gemischte Intelligenztests Schulleistungen besser vorhersagen können als nonverbale Tests. Die in den Tests erfassten sprachlichen Leistungen scheinen dabei hoch mit einer erfolgreichen Teilhabe am Schulunterricht zusammenzuhängen. Dieser Zusammenhang erklärt sich auch dadurch, dass Schulnoten überwiegend auf der Basis von schrift(sprach)-lichen Arbeiten vergeben werden. Aber auch zur Abklärung schulischer Über- oder Unterforderung oder von Lernschwierigkeiten können Intelligenztests herangezogen werden. Bereits für die WISC-IV wurden verschiedene Indexwertdifferenzen beschrieben, die als typisch für spezifische Lernstörungen angesehen werden, wie beispielsweise Differenzen zwischen dem Allgemeinen Fähigkeitsindex (AFI) und dem Kognitiven Leistungsindex (KLI) oder dem AFI und dem Gesamt-IQ (s. Daseking, Petermann & Waldmann, 2008, für den AFI bei Hochbegabung oder Giofre, Toffalini, Altoè & Cornoldi, 2017, für Diskrepanzen bei spezifischen Lernstörungen).
Auch im klinisch-psychologischen Kontext gehören Intelligenztests zu den Standardverfahren, die regelmäßig eingesetzt werden. Bei vielen Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bildet eine Intelligenztestung eine wichtige Basis innerhalb des diagnostischen Vorgehens im Rahmen einer multiaxialen Beurteilung (Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2017).
Die Rolle der Intelligenzdiagnostik an sich und insbesondere auch von Intelligenzprofilanalysen im Kontext des diagnostischen Prozesses wird jedoch immer wieder diskutiert und hinterfragt, beispielsweise in Bezug auf das doppelte Diskrepanzkriterium bei der Diagnosestellung von umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (Beaujean, Benson, McGill & Dombrowski, 2018). Die oben beschriebenen Zusammenhänge verweisen auf die Vorhersagegüte von Intelligenztests im Rahmen diagnostischer Prozesse. Die Aufgabe eines Tests nur |14|darauf zu fokussieren, führt jedoch zu einer einschneidenden Verkürzung von diagnostischen Zielen und Möglichkeiten der Intelligenzdiagnostik. Die Kenntnis spezifischer Zusammenhänge und Risikofaktoren in kognitiven Fähigkeiten, die sich in einem Testprofil niederschlagen können, erlaubt es beispielsweise auch, frühzeitig Präventionsmaßnahmen einzuleiten, um die Entwicklung eines Kindes zu unterstützen. Eine weitere wichtige Aufgabe besteht darin, erkennbare Probleme, beispielsweise schulische Lernschwierigkeiten, zu (er)klären. In diesem Kontext können Profilanalysen, die die individuellen Stärken und Schwächen einer Testperson herausarbeiten, eine wichtige Rolle übernehmen.
Mit der deutschsprachigen Adaptation der Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V; Wechsler, 2014, 2017) liegt der Nachfolger der Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition (WISC-IV; Petermann & Petermann, 2011; Wechsler, 2003a, b) vor, die in Deutschland zunächst unter der Bezeichnung Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder – IV (HAWIK-IV; Petermann & Petermann, 2007) publiziert worden war. Sie gehört zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Intelligenztests (Raiford, 2018). Wichtige allgemeine Informationen zur WISC-V finden sich in Tabelle 1.1.
Tabelle 1.1: Steckbrief zur WISC-V
Allgemeine Testinformationen
Autor
Wechsler, D. (Bearbeiter der deutschen Fassung: F. Petermann)
Erscheinungsjahr
2017
Verlag
Pearson Assessment, Frankfurt a. M.
Altersbereich
6;0 bis 16;11 Jahre
Durchführungszeit
60 bis 90 Minuten für alle 15 Untertests, 40 bis 70 Minuten für die 7 Untertests zur Berechnung des Gesamt-IQ
Setting
Einzeltest
Übergeordnete Werte
Globale Fähigkeit
Gesamt-Intelligenzquotient (G-IQ)
Indexwerte
5 primäre Indexwerte:
Sprachverständnis (SV)
Visuell-Räumliche Verarbeitung (VRV)
Fluides Schlussfolgern (FS)
Arbeitsgedächtnis (AGD)
Verarbeitungsgeschwindigkeit (VG)
5 sekundäre Indexwerte
Quantitatives Schlussfolgern (QS)
Auditives Arbeitsgedächtnis (AAGD)
|15|Nonverbaler Index (NVI)
Allgemeiner Fähigkeitsindex (AFI)
Kognitiver Leistungsindex (KLI)
Untertests
10 primäre Untertests, 5 sekundäre Untertests
Auswertung
Verfügbare Werte
IQ-Werte (Vertrauensintervall)
Wertpunkte
Prozentränge
Testalteräquivalente
Wertebereich für Gesamt-IQ
40 – 160 (100 +/− 15)
Wertebereich für Wertpunkte
1 – 19 (10 +/− 3)
Normstichprobe
Stichprobenumfang
1 087 (ca. 100/Jahr)
Zeitraum der Datenerhebung
2015 – 2016
Stichprobenbeschreibung: Schichtungsvariablen
Alter
Geschlecht
geografische Region (Deutschland)
Kindergarten und 1. bis 4. Klasse: Bildungsstand der Eltern (höchster Schulabschluss)
ab 5. Klasse: besuchte Bildungseinrichtung
Testmaterial WISC-V-Gesamtsatz
Technisches Manual
Grundlagen
Testgütekriterien
Auswertung und Interpretation
Manual zur Durchführung und Auswertung
allgemeine Richtlinien zur Durchführung und Bewertung
Anweisungen zur Durchführung und Auswertung
Tabellenanhang
Stimulusbuch
Material zur Vorlage bei der Aufgabenbearbeitung
neun zweifarbige Würfel
Mosaik-Test
|16|Protokollbogen
Protokollierung der Antworten, Auswertung inkl. Profilanalyse
Aufgabenheft 1 A/B
Zahlen-Symbol-Test (ZST), Symbol-Suche (SYS)
Aufgabenheft 2
Durchstreich-Test (DT)
Auswertungsschablonen
ZST, SYS und DT
Digitale Testdurchführung und Testauswertung
Auswertungssoftware
als Einzelplatz- oder Netzwerklizenz
Q-global
webbasierte Plattform zur Testauswertung
Q-interactive
Anwendung zur digitalen Testdurchführung mittels iPads; für die nicht digital durchführbaren Untertests werden Ergänzungsmaterialien benötigt: Würfelset (Mosaik-Test), Aufgabenheft und Auswertungsschablone 2 (Durchstreich-Test)
Wie schon beim Übergang von WISC-III/HAWIK-III zu WISC-IV/HAWIK-IV wurden auch aktuell Veränderungen in Inhalt und Struktur vorgenommen, die sich in der Einführung neuer Untertests und Indexwerte widerspiegeln. Inhaltlich steht der Test einerseits in der Tradition der Wechsler-Skalen, andererseits werden aber auch neue psychometrische Theorien wie das Cattell-Horn-Carroll-Modell (CHC-Modell) rezipiert (vgl. dazu Schneider & McGrew, 2018; Wahlstrom, Raiford, Breaux, Zhu & Weiss, 2018 sowie Kapitel 2 in diesem Buch).
David Wechsler (1896 – 1981) hat seine Intelligenztests ursprünglich aus bereits bestehenden Verfahren zusammengestellt und für die jeweiligen Anwendungsbereiche psychometrisch überprüft. Mit der Bellevue Intelligence Scale (Wechsler, 1939), aus der er 1949 die Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) ausgliederte, schuf er ein Instrument zur Individualdiagnostik, das zudem deutlich durch seine Erfahrungen im Rahmen der Gruppentestungen bei der amerikanischen Armee und seine klinischen Erfahrungen im Bellevue Psychiatric Hospital beeinflusst war. Dabei folgte er der Idee, dass Intelligenz die Fähigkeit sei, zu lernen und sich an neue Bedingungen anzupassen. Bereits früh beschrieb er Intelligenz als Fähigkeit, Wissen zu erwerben und mit Erfahrungen erfolgreich umgehen zu können, und nicht als Wissen und praktischen Erfolg an sich (Wasserman, 2018; Wechsler, 1927). Aus diesen ersten Versuchen, Intelligenz zu beschreiben, entwi|17|ckelte Wechsler die bis heute bekannte Beschreibung von Intelligenz als einer „zusammengesetzten oder globalen Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen“ (Wechsler, 1944, S. 3). Mit dieser Definition nahm Wechsler Bezug auf die faktorenanalytischen Arbeiten von Spearman (g-Faktor) und die Beobachtungen von Binet, der Intelligenz als bestmögliche Anpassung an die Umwelt bezeichnete (Binet & Simon, 1916).
1.1 Struktur der WISC-V
Inhaltliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Tests. In die neue Version sind wie auch schon bei der Überarbeitung der Vorgängerversionen aktuelle Forschungsergebnisse aus der Entwicklungs- und Kognitionspsychologie sowie aus der klinischen Psychologie eingeflossen (Weiss, Holdnack, Saklofske & Prifitera, 2016). Dazu gehören auch Erkenntnisse aus der neuropsychologischen Grundlagenforschung zum Verhältnis zwischen Hirnfunktionen, Kognition und Verhalten, den sogenannten Brain-Behavior-Relationships, und zum Einfluss neurologischer Erkrankungen auf diese Beziehung. Für den Altersbereich der WISC-V bedeutet dies auch, dass Erkenntnisse aus dem Bereich der Neurobiologie zum Zusammenhang zwischen Hirnreifung und kognitiver Entwicklung einbezogen wurden, um neue Aufgaben einzubinden oder bestehende Konzeptionen weiterzuentwickeln. Darüber hinaus hat ein weiterer wichtiger Befund die Teststruktur direkt beeinflusst: Modelle zum Arbeitsgedächtnis (Baddeley, 2011) haben dazu geführt, dass neben Aufgaben zum auditiven Gedächtnis auch ein Untertest zum visuellen Arbeitsgedächtnis in die neue Testversion einbezogen wurde (vgl. Abb. 1.1).
Abbildung 1.1: Zuordnung der Untertests des Index AGD der WISC-V zum Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley und Hitch (1974)
Die Einführung neuer Untertests und neuer Indexwerte wirkt sich vor allem auch auf die Interpretation der Testergebnisse aus. In Tabelle 1.2 werden die bedeutsamsten Veränderungen systematisiert.
|18|Tabelle 1.2: Veränderungen von der WISC-IV zur WISC-V
Bereich
Änderungen
Strukturelle Veränderungen
Erweiterung der Indexstruktur (SV, VRV, FS, AGD, VG)
Teilung des Index Wahrnehmungsgebundenes Logisches Denken (WLD) in die Indizes Fluides Schlussfolgern (FS) und Visuell-Räumliche Verarbeitung (VRV)
Einführung von 3 neuen Untertests (Formenwaage, Visuelle Puzzles, Bilderfolgen)
Ergänzung des Untertests Zahlen nachsprechen um ZN – Sequentiell
Streichen von Untertests (Bildkonzepte, Bilder ergänzen, Begriffe erkennen)
zur Bestimmung der primären Indizes sind jeweils nur noch 2 Untertests notwendig, zur Bestimmung des G-IQ nur noch 7 Untertests
Einführung von sekundären Indexwerten (Quantitatives Schlussfolgern, Nonverbaler Index, Auditives Arbeitsgedächtnis, Allgemeiner Fähigkeitsindex, Kognitiver Leistungsindex)
Testdurchführung
Verkürzung der Testdauer für die Berechnung des Gesamt-IQ (nur 7 Untertests notwendig)
Vereinheitlichung der Abbruchregeln
Untertest
zusätzliche leichtere und schwierigere Aufgaben zur Verringerung von Boden- und Deckeneffekten
Entwicklung neuer Aufgaben (Aufgaben aus älteren Versionen wurden entfernt)
Verringerung des Zeitdrucks (Mosaik-Test, MT)
Lernaufgaben mit Rückmeldung
Übungsaufgaben
Aktualisierung des Materials
Einführung neuer Prozesswerte (z. B. Partialgesamtwert für MT)
Profilanalysen
insgesamt 4 Signifikanzniveaus in Abhängigkeit von der Anzahl der Vergleiche
Materialien
Stimulusbuch: Überarbeitung der Bildmaterialien (kindgerechtere Gestaltung)
Durchführungsmanual: Überarbeitung der Instruktionen, Überarbeitung der Auswertungskriterien
Normen
aktuelle Normdaten auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe
|19|Inhaltliche Veränderungen
Anpassung an den Entwicklungsstand des Kindes durch Lern- und Übungsaufgaben
Aktualisierung des Intelligenzkonzepts (stärkere Berücksichtigung der fluiden Intelligenz, stärkere Einbindung basaler kognitiver Fähigkeiten wie Verarbeitungsgeschwindigkeit und Gedächtnisleistungen, Erweiterung des Index Arbeitsgedächtnis (AGD) um einen Untertest zum visuellen AGD)
Erweiterung der Interpretationsmöglichkeiten für die klinische und pädagogische Praxis durch Einführung der sekundären Indexwerte
Teststruktur und Intelligenzmodell. Die Struktur der WISC-V lässt sich vor dem Hintergrund des dreistufigen Cattell-Horn-Carroll-Modells der kognitiven Fähigkeiten (CHC-Theorie) beschreiben (vgl. dazu ausführlich Kapitel 2). Die WISC-V bildet insgesamt fünf der zehn Faktoren des CHC-Modells ab (Flanagan & Alfonso, 2017).
Der Testentwicklung liegt also ein hierarchisches Intelligenzmodell mit einem g-Faktor zugrunde. Mit diesem übergeordneten Kennwert soll die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit einer Testperson abgebildet werden. Unterhalb des Gesamtwerts können auf der mittleren Ebene (Stratum II) fünf inhaltlich unabhängige kognitive Domänen interpretiert werden: Sprachverständnis, Visuell-Räumliche Verarbeitung, Fluides Schlussfolgern, Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Diese Indexwerte werden aus den zehn primären Untertests gebildet (Stratum I), wobei in jeden Indexwert jeweils zwei Untertestleistungen einfließen.
Neu in der Teststruktur ist, dass sich der Gesamt-IQ nur noch aus sieben Untertests zusammensetzt: jeweils beide Untertests aus den Indizes Sprachverständnis und Fluides Schlussfolgern sowie je ein Untertest aus den übrigen drei Indexwerten. Damit soll erreicht werden, dass sich bei den diagnostischen Fragestellungen, wo nur eine globale Einschätzung kognitiver Fähigkeiten erforderlich ist, die Testdurchführungsdauer deutlich reduziert. Diese Teststruktur ist faktorenanalytisch bestätigt. Einen Überblick über die Struktur der WISC-V bietet Abbildung 1.2.
Zusätzlich zu den zehn primären Untertests werden in der WISC-V fünf sekundäre Untertests zur Verfügung gestellt: Allgemeines Wissen, Buchstaben-Zahlen-Folgen, Durchstreich-Test, Allgemeines Verständnis und Rechnerisches Denken. Mit diesen Untertests lassen sich zusätzliche Informationen erheben.
Neben den primären Indexwerten können außerdem weitere Indizes berechnet werden, die in der diagnostischen Praxis vor allem im Zusammenhang mit spezi|20|fischen Fragestellungen, wie beispielsweise Lernstörungen, wertvolle Zusatzinformationen liefern können. Diese sekundären Indexwerte wurden auf der Basis von theoretischen Überlegungen zusammengestellt, sie sind nicht durch Faktorenanalysen bestätigt oder identifiziert. Daher ist es auch möglich, dass einzelne Untertests verschiedenen sekundären Indexwerten zugeordnet sind. Das trifft beispielsweise auf den Matrizen-Test zu, der sowohl im Nonverbalen Index als auch im Allgemeinen Fähigkeitsindex enthalten ist. Informationen zur Zusammensetzung der sekundären Indexwerte können Abbildung 1.3 entnommen werden. Die sekundären Indexwerte und insbesondere die Gegenüberstellung von Allgemeinem Fähigkeitsindex und Kognitivem Leistungsindex tragen dazu bei, auch Defizite in schulbezogenen Leistungen, wie beispielsweise Rechenfähigkeit oder Lese- und Rechtschreibleistung, erklären zu können (Saklofske, Weiss, Breaux & Beal, 2016).
Abbildung 1.2: Struktur der WISC-V: Zusammensetzung der primären Indexwerte und des Gesamt-IQ
Anmerkungen: SV = Sprachverständnis, VRV = Visuell-Räumliche Verarbeitung, FS = Fluides Schlussfolgern, AGD = Arbeitsgedächtnis, VG = Verarbeitungsgeschwindigkeit, GF = Gemeinsamkeiten finden, WT = Wortschatz-Test, MT = Mosaik-Test, VP = Visuelle Puzzles, MZ = Matrizen-Test, FW = Formenwaage, ZN = Zahlen nachsprechen, BF = Bilderfolgen, ZST =Zahlen-Symbol-Test, SYS = Symbol-Suche.
Veränderungen wurden aber auch auf Ebene der Untertests vorgenommen. So wurden drei neue Untertests eingeführt, in erster Linie, um die beiden neuen primären Indexwerte facettenreicher abbilden zu können: Formenwaage als Untertest für den Index FS, Visuelle Puzzles als Untertest für den Index VRV und der Untertest Bilderfolgen, um den Index AGD um die visuell-räumliche Arbeitsgedächtniskomponente zu erweitern. Darüber hinaus wurden auch bei bereits etablierten Untertests inhaltliche Änderungen oder Erweiterungen vorgenommen: Im Mosaik-Test wurden schwierigere Aufgaben ergänzt und im Untertest Zahlen nachsprechen wurde eine weitere Aufgabe eingefügt: das sequentielle (nach Größe geordnete) Nachsprechen von Zahlen. Weitere Veränderungen auf Ebene der Untertests betreffen die Durchführung und Auswertung und können im Manual zur Durchführung und Auswertung sowie im Abschnitt 1.2 dieses Kapitels nachgelesen werden.
|21|In Tabelle 1.3 werden alle Untertests der WISC-V in ihrer Zuordnung zum jeweiligen übergeordneten Index unter Angabe der erfassten kognitiven Fähigkeiten aufgelistet. Die inhaltlichen Beschreibungen wurden um die erfassten CHC-Fähigkeiten und die Reliabilitäten ergänzt (vgl. dazu auch Flanagan & Alfonso, 2017; Wechsler, 2017). Weiterführende Informationen finden sich im Technischen Manual zur WISC-V. Für eine Übersicht über die Veränderungen von der WISC-IV zur WISC-V unter CHC-theoretischer Perspektive siehe Kapitel 2.
Abbildung 1.3: Struktur der WISC-V: Zusammensetzung der sekundären Indexwerte
|22|Tabelle 1.3: Beschreibung der Indizes und Untertests der WISC-V unter Zuordnung zum CHC-Modell und Angabe der Reliabilitäten für die Gesamtstichprobe
Skalen – Untertests
CHC-Faktor*
r
Gesamt-IQ:
globale kognitive Fähigkeit, allgemeine Intelligenz
.96
Primäre Indexwerte
Sprachverständnis (SV):
sprachliche Begriffsbildung, sprachliches Schlussfolgern, Sprachentwicklung, kristalline Intelligenz; Fähigkeit, auf erworbenes (Wort)Wissen zuzugreifen und es anzuwenden
Gc
.92
GF
Gemeinsamkeiten finden
verbales Schlussfolgern und Konzeptbildung, auditives Verständnis, Gedächtnis, sprachliches Verständnis und verbaler Ausdruck (rezeptive und expressive Sprache), assoziatives und kategoriales Denken, Abruf aus Langzeitgedächtnis
Gc
.88
WT
Wortschatz-Test
Wortwissen eines Kindes und Begriffsbildung, Lernfähigkeit, Wortflüssigkeit, Sprachentwicklung (rezeptive und expressive Sprache), Abruf aus Langzeitgedächtnis
Gc
.86
AW
(Allgemeines Wissen)
kristalline Intelligenz, allgemeines Faktenwissen, Abruf aus Langzeitgedächtnis
Gc
.86
AV
(Allgemeines Verständnis)
verbales Schlussfolgern und verbale Konzeptualisierung, sprachliches Verständnis, sprachlicher Ausdruck, Wissen um gesellschaftliche und kulturelle Verhaltensstandards, soziales Urteil
Gc
.83
|23|Visuell-Räumliche Verarbeitung (VRV):
Wahrnehmungsorganisation, Analyse und Synthese visueller Reize, räumlich-konstruktive Leistungen, visuomotorische Integration, Teil-Ganzes-Beziehungen, visuelles Schlussfolgern
Gv
.91
MT
Mosaik-Test
Analyse und Synthetisierung abstrakter visueller Stimuli, nonverbale Konzeptbildung, visuelle Wahrnehmung und Organisation, visuomotorische Koordination, Figur-Grund-Unterscheidung bei visuellen Reizen, Geschwindigkeit der visuomotorischen Verarbeitung, Planungsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Konzentration
Gv
.84
VP
Visuelle Puzzles
Integration und Synthese von Teil-Ganzes-Beziehungen, visuell-analytische Fähigkeiten, visuelles Arbeitsgedächtnis
Gv
.87
Fluides Schlussfolgern (FS):
fluide Intelligenz, logisches Denken, konzeptuelle Beziehungen zwischen visuell dargebotenen Objekten, Erkennen und Anwenden von Regeln
Gf
.93
MZ
Matrizen-Test
fluide Intelligenz, Klassenbildung, räumliche Fähigkeiten, visuelle Verarbeitung, visuell-perzeptives Schlussfolgern, Diskriminieren und Organisieren
Gf, Gv
.85
FW
Formenwaage
induktives Denken, visuelle Verarbeitungsprozesse, Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration
Gf
.93
RD
(Rechnerisches Denken)
angewandte Rechenfähigkeit, numerisches schlussfolgerndes Denken, Konzentration, Aufmerksamkeit, Kurz- und Langzeitgedächtnis
Gf, Gc, Gsm
.87
|24|Arbeitsgedächtnis (AGD):
kurzfristiges Behalten im Gedächtnis, Durchführung von Operationen/Manipulationen, Aufmerksamkeit, Konzentration und Arbeitsgedächtnis; visuell-räumlicher Notizblock und phonologische Schleife
Gsm
.92
ZN
Zahlen nachsprechen
auditives Kurzzeitgedächtnis, Fertigkeit zur Reihenbildung (numerische Fähigkeiten), Aufmerksamkeit
Zahlen nachsprechen – Vorwärts: automatisiertes Lernen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit
Zahlen nachsprechen – Rückwärts: Arbeitsgedächtnis, mentale Manipulation, visuell-räumliches Vorstellungsvermögen
Zahlen nachsprechen – Sequentiell: Arbeitsgedächtnis, mentale Manipulation, visuell-räumliches Vorstellungsvermögen, Kenntnis der Zahlenreihenfolge, Zählfähigkeit
Wechsel: kognitive Flexibilität
Gsm
.91
BF
Bilderfolgen
visuelles Arbeitsgedächtnis
Gsm
.86
BZF
(Buchstaben-Zahlen-Folgen)
Reihenfolgenbildung, mentale Rotation, Aufmerksamkeit, auditives Kurzzeitgedächtnis, visuell-räumliches Vorstellungsvermögen, Verarbeitungsgeschwindigkeit
Gsm
.85
|25|Verarbeitungsgeschwindigkeit (VG):
Geschwindigkeit und Genauigkeit der mentalen und graphomotorischen Verarbeitung, visuelle Analysefähigkeit/Diskrimination, visuelles Kurzzeitgedächtnis, Aufmerksamkeit und visuomotorische Koordination
Gs
.89
ZST
Zahlen-Symbol-Test
kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit, Kurzzeitgedächtnis, Lernfähigkeit, visuelle Wahrnehmung, visuomotorische Koordination, Fähigkeit zum visuellen Scanning, kognitive Flexibilität, Aufmerksamkeit
Gs
.84
SYS
Symbol-Suche
kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit, visuelles Kurzzeitgedächtnis, visuomotorische Koordination, kognitive Flexibilität, visuelle Diskrimination, Konzentration
Gs
.81
DT
(Durchstreich-Test)
Verarbeitungsgeschwindigkeit, visuelle selektive Aufmerksamkeit
Gs
.80
Sekundäre Indexwerte
CHC-Faktor*
r
Quantitatives Schlussfolgern (QS):
Kapazität, mathematische Operationen mental durchzuführen, mengenbezogenes Wissen
→ Zusammenhang zu Leistungen im Rechnen und Lesen (insbesondere Leseverständnis, vermittelt über fluides Schlussfolgern; vgl. dazu u. a. McGrew & Wendling, 2010)
–
.93
Auditives Arbeitsgedächtnis (AAGD)
Leistungsfähigkeit des auditiven Arbeitsgedächtnisses, phonologische Schleife
–
.93
|26|Nonverbaler Index (NVI):
allgemeine kognitive Fähigkeiten mit reduzierten Anforderungen an expressive Sprachfähigkeit
–
.95
Allgemeiner Fähigkeitsindex (AFI):
Schätzung der allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit, in geringerem Umfang durch Leistungen des Arbeitsgedächtnisses und der Verarbeitungsgeschwindigkeit beeinflusst als Gesamt-IQ
–
.95
Kognitiver Leistungsindex (KLI):
Effektivität von Informationsverarbeitungsprozessen, Zusammenhang zu Lernprozessen, Problemlösefähigkeit und höheren kognitiven Funktionen
–
.93
Anmerkungen: Untertests in Klammern sind optionale Untertests. Gc = kristalline Intelligenz, Gv = visuelle Verarbeitung, Gf = fluide Intelligenz, Gsm = Kurzzeitgedächtnis, Gs = Verarbeitungsgeschwindigkeit. *Die Zuordnung der CHC-Faktoren erfolgt nach Schneider, Flanagan und Alfonso (2017, S. 23).
1.2 Testdurchführung, Testauswertung und Testinterpretation
Die im folgenden Abschnitt zusammengestellten Informationen und Prozeduren bilden die Basis für eine valide Testinterpretation. Alle hier nur überblicksartig dargestellten Durchführungsregeln und Auswertungsroutinen sowie die Hinweise zur Interpretation können im Manual zur Durchführung und Auswertung im Detail nachgelesen werden.
1.2.1 Allgemeine Hinweise zur Durchführung
Im Rahmen der Überarbeitung des Verfahrens haben sich auch Änderungen für die Durchführung und Auswertung der WISC-V ergeben. Da auch für diejenigen Untertests Veränderungen vorgenommen wurden, die bereits aus Vorgängerversionen bekannt sind, ist es auch für versierte Testleiter_innen erforderlich, sich |27|mit den Handbüchern und Regeländerungen vertraut zu machen. Änderungen betreffen beispielsweise die Vereinheitlichung der Abbruchregeln oder die Möglichkeit, Untertests für die Berechnung von übergeordneten Kennwerten zu ersetzen.
Für die Durchführung der WISC-V wurden verschiedene Aufgabentypen definiert und Regeln aufgestellt, die zu einem validen Testergebnis beitragen sollen. Mithilfe der im Folgenden dargestellten Aufgabentypen soll sichergestellt werden, dass eine Testperson die Aufgabenstellung erfasst bzw. die für die Bearbeitung der Aufgabe erforderlichen Kompetenzen mitbringt (vgl. Tab. 1.4).
Tabelle 1.4: Aufgabentypen in der WISC-V, um Aufgabenverständnis sicherzustellen
Aufgabentyp
Beschreibung
Kennzeichnung
Qualifikationsaufgaben
sollen für die Aufgabenbearbeitung notwendige Fähigkeiten prüfen und sicherstellen
Zahlen nachsprechen – Sequentiell: bis 5 zählen
Buchstaben-Zahlen-Folgen: bis 3 zählen und Alphabet bis C aufsagen
Q
Demonstrationsaufgaben
Aufgaben werden exemplarisch vorgeführt, wobei einzelne Lösungsschritte erklärt werden
werden nicht bewertet
D
Übungsaufgaben
werden vor Testaufgaben und bei Änderung der Aufgabenstellung durchgeführt
Testperson erhält Rückmeldung
werden nicht bewertet
Ü
Lernaufgaben
korrigierende Rückmeldung erfolgt nur bei nicht voller Punktzahl
werden bewertet (im Unterschied zu Übungsaufgaben)
Testpersonen, bei denen Lernaufgaben keine Einstiegsaufgaben sind, erhalten keine Rückmeldung
†
Änderungen in der Durchführung einzelner Untertests. Durch die strukturellen Veränderungen haben sich auch einige Veränderungen in der Ausgestaltung und Durchführung von Untertests ergeben, auf die kurz eingegangen werden soll. Die Untertests Zahlen-Symbol-Test (ZST) und Symbol-Suche (SYS) wurden überarbeitet. Im ZST betrifft es die Einführung neuer Zeichen, die soweit verändert wur|28|den, dass sie weniger Anforderungen an die feinmotorischen Fähigkeiten einer Testperson stellen. Für SYS wurde die Durchführung verändert: es muss nun entweder das richtige Zeichen selbst in der Suchgruppe oder das „N“ durchgestrichen werden, sollte das Zielsymbol in der Suchgruppe nicht vorhanden sein.
Im Untertest Zahlen nachsprechen (ZN) wurde eine weitere Aufgabe eingeführt, das ZN – Sequentiell (ZN-S), bei der die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge wiedergegeben werden sollen. Hier ist zu berücksichtigen, dass immer alle drei Aufgaben (Vorwärts, Rückwärts, Sequentiell) durchgeführt werden müssen, um den Wertpunkt für ZN berechnen zu können. Für das ZN-S wurde eine Qualifikationsaufgabe vorangestellt, um zu prüfen, ob die Testperson über ein Grundverständnis der Reihenfolge von Zahlen verfügt.
Für die Durchführung des Wortschatz-Tests werden die Aufgaben nur noch auditiv präsentiert, also vorgelesen. Das Mitlesen durch die Testperson entfällt.
Im Rechnerischen Denken war es in der WISC-IV möglich, Aufgaben noch einmal zu wiederholen, wobei die Zeitnahme nicht angehalten wurde. In der WISC-V dürfen die Aufgaben 1 bis 21 nicht wiederholt werden, ab Aufgabe 22 darf jede Aufgabe einmal wiederholt werden, wobei die Zeitmessung während der Wiederholung unterbrochen wird.
Die Regeln für die neu in die WISC-V aufgenommenen Untertests Formenwaage, Visuelle Puzzles und Bilderfolgen finden sich im Manual. Auch versierte Testleiter_innen sollten sich alle Hinweise zu diesen Untertests aufmerksam anschauen und die Durchführung selbst trainieren, um eine fehlerfreie Testdurchführung zu ermöglichen.
Änderungen in den Durchführungsregeln. Auf einige Regeländerungen soll im Folgenden kurz eingegangen werden.
Ersetzen von Untertests und Hochrechnen. Das Ersetzen eines Untertests zur Berechnung von übergeordneten Werten ist nur für den Gesamt-IQ möglich. Kann einer der sieben erforderlichen Untertests nicht durchgeführt oder ausgewertet werden, dann kann ein Untertest aus der gleichen kognitiven Domäne verwendet werden, um den fehlenden Wertpunkt zu ersetzen. Im konkreten Fall könnte das bedeuten, dass der Wortschatz-Test nicht durchgeführt werden konnte. An seiner Stelle kann der Untertest Allgemeines Wissen den fehlenden Wertpunkt für die Berechnung des Gesamt-IQ ersetzen. Das Allgemeine Wissen kann aber nicht für die Berechnung des Indexwertes Sprachverständnis genutzt werden. Auf Ebene der Indexwerte sind keine Ersetzungen möglich!
Abbruchregeln. Die Abbruchregeln sollen verhindern, dass Testpersonen durch die steigende Aufgabenschwierigkeit innerhalb von einzelnen Untertests überfordert und dadurch frustriert und entmutigt werden. Daher werden bestimmte Untertests nach einer festgelegten Anzahl von aufeinanderfolgenden Aufgaben mit 0 Punkten abgebrochen. Die Abbruchregel gilt nicht, wenn aufgrund einer Umkehrregel in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen wird, sie wird also immer |29|nur bei aufsteigender Aufgabenreihenfolge umgesetzt. Die Abbruchregeln wurden für die WISC-V vereinheitlicht (vgl. dazu auch Tab. 1.5).
Tabelle 1.5: Änderungen in den Abbruchregeln zwischen WISC-IV und WISC-V
Untertests
WISC-IV
WISC-V
Mosaik-Test
nach 3 x 0 Punkten
nach 2 x 0 Punkten
Gemeinsamkeiten finden
nach 5 x 0 Punkten
nach 3 x 0 Punkten
Wortschatz-Test
nach 5 x 0 Punkten
nach 3 x 0 Punkten
Matrizen-Test
nach 4 x 0 Punkten aus 5 aufeinanderfolgenden Aufgaben
nach 3 x 0 Punkten
Allgemeines Verständnis
nach 4 x 0 Punkten
nach 3 x 0 Punkten
Allgemeines Wissen
nach 5 x 0 Punkten
nach 3 x 0 Punkten
Rechnerisches Denken
nach 4 x 0 Punkten
nach 3 x 0 Punkten
Für die Untertests Gemeinsamkeiten finden, Wortschatz-Test, Allgemeines Verständnis und Allgemeines Wissen ist der folgende Hinweis zu beachten: Da sich einzelne Antworten nicht immer direkt eindeutig bewerten lassen, es also in solchen Fällen nicht unmittelbar klar ist, ob die Abbruchregel bereits greift, ist es sinnvoll, noch so viele Aufgaben zusätzlich durchzuführen, bis man sich sicher ist, dass die Abbruchregel eindeutig greift. Damit stellt man sicher, dass nicht zu früh abgebrochen wird (weil z. B. eine Antwort einer Testperson im Nachhinein eben doch noch mit 1 Punkt bewertet werden konnte). Hier ist aber wichtig, darauf zu achten, dass Antworten einer Testperson bei den Aufgaben nicht gewertet werden, die nach dem Erreichen des Abbruchkriteriums noch vorgegeben wurden, auch wenn sie richtig sind. Weitere Informationen zu den Abbruchregeln sowie die Regeln für die übrigen Untertests finden sich im Manual zur Durchführung und Auswertung.
Für die Testdurchführung gilt grundsätzlich, dass alle Ergebnisse gut protokolliert werden sollten. Antworten und Bewertungen bei nonverbalen Aufgaben können dabei eingekreist oder angekreuzt werden: die richtigen Antworten sind dafür auf dem Protokollbogen fett gedruckt. Zur Bewertung der verbalen Antworten werden im Manual zur Durchführung und Auswertung richtige Antworten bzw. Beispielantworten und weitere Hinweise zur Verfügung gestellt. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass sich hier nur typische bzw. im Rahmen der Normierung gegebene Antworten finden. Sollte eine Testperson eine Antwort geben, die sehr ungewöhnlich ist und sich nicht in den Beispielantworten im Manual wiederfindet, dann bedeutet dies nicht, dass die Antwort automatisch mit 0 Punkten zu be|30|werten ist, sondern dass es in der Verantwortung der Testleiter_innen liegt, diese Antwort in die richtige Bewertungskategorie einzuordnen. Da die Bewertungskriterien für Antworten in den Untertests zum Sprachverständnis aktualisiert wurden, sollte besonders bei „bekannten“ Aufgaben noch einmal ganz genau darauf geachtet werden, Antworten korrekt zu bewerten.
Für eine optimale Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Testergebnissen sollten alle bei der Testdurchführung angewendeten Sonderregeln kenntlich gemacht werden (Abbruch, Umkehr etc.). Dies gilt auch für alle Abweichungen von der standardisierten Testdurchführung. Nur so ist es nachträglich möglich, das Zustandekommen eines Ergebnisses nachvollziehen zu können.
Auch die Gestaltung des Protokollbogens weist Veränderungen auf. Wie bereits für die WISC-IV, wurden auch für die WISC-V bei jedem Untertest das Einstiegsalter sowie Umkehr-, Abbruch- und Bewertungsregeln in einer Kopfzeile zusammengefasst.
1.2.2 Allgemeine Hinweise zur Testauswertung und Interpretation
Im nachfolgenden Abschnitt zur Auswertung werden die verschiedenen Optionen (u. a. Primäranalysen oder Sekundäranalysen) skizziert, die in den Fallbeispielen in Teil II dieses Bandes eingesetzt werden, um Profile zu analysieren und zu interpretieren. Dabei soll noch einmal explizit darauf hingewiesen werden, dass ein WISC-V-Profil keine Diagnosestellungen für psychische und Verhaltensstörungen zulässt. Auf der Basis bestehender Diagnosen kann jedoch geprüft werden, welche kognitiven Einschränkungen oder Schwächen mit der jeweiligen Störung/Erkrankung möglicherweise verbunden sind und über welche individuellen Stärken die Testperson verfügt, die dann im Rahmen von Interventionsmaßnahmen auch genutzt werden können.
Die Auswertung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Es ist möglich, die WISC-V (1) im Sinne eines Paper-Pencil-Verfahrens händisch auszuwerten. Dafür werden alle erforderlichen Schritte im Manual zur Durchführung und Auswertung (S. 69 ff.) vorgegeben. (2) Zweitens kann die Auswertung über ein PC-Programm vorgenommen werden. Diese Variante ist ab Eingabe der auf dem Protokollbogen erfassten Daten zeitsparender und weniger anfällig gegenüber Fehlern. (3) Die dritte Option läuft über die digitale Auswertungsplattform Q-global, die der Pearson-Verlag zur Verfügung stellt (www.pearsonclinical.de/digitales-testen/q-global). Neben der digitalen Testauswertung, die vergleichbar dem Auswertungsprogramm funktioniert, besteht auch die Möglichkeit einer digitalen Testdurchführung mit der Anwendung Q-interactive. Die in den Fallbeispielen eingebundenen Ausschnitte aus den Protokollbögen wurden mit dem WISC-V-Auswertungsprogramm erstellt. Die Tabellen des Ergebnisberichts, den das computergestützte Auswer|31|tungsprogramm liefert, sind dabei mit den Tabellen des Protokollbogens der Paper-Pencil-Version identisch. Die Tabellen des Ergebnisberichts mittels der Online-Plattform Q-global haben eine davon abweichende Optik (vgl. dazu Abb. 1.4).
Die folgenden Auswertungsoptionen und -schritte basieren auf der Testauswertung anhand des Protokollbogens unter Heranziehung der Tabellen des Manuals, entsprechen also einem händischen Vorgehen. Aber auch wenn die Auswertung über die beiden digitalen Alternativen (Auswertungsprogramm, Q-global) vorgenommen wird, ist es wichtig, sich mit den verschiedenen Auswertungsebenen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, welche Werte auf welcher statistischen Basis miteinander ins Verhältnis gesetzt und analysiert werden. Außerdem ist es in allen Fällen erforderlich, Entscheidungen darüber zu treffen, auf welchem Signifikanzniveau und mit welcher Stichprobe man die individuellen Leistungen einer Testperson statistisch vergleichen möchte. Nur mit dem Wissen um die Relevanz dieser Entscheidungen ist eine zuverlässige und zutreffende Interpretation von Kennwerten möglich.
Abbildung 1.4: Tabelle zur Umrechnung von Rohwertsummen in Wertpunkte aus dem Q-global-Ergebnisbericht (aus: „WISC-V“, Autor: David Wechsler, deutsche Adaptation: F. Petermann © 2014 NCS Pearson, Inc.; deutsche Fassung © 2017 NCS Pearson, Inc.)
Auswertungsseiten des Protokollbogens. Auf dem Protokollbogen sind insgesamt vier Seiten für die Auswertung vorgesehen: Übersicht, Primäranalyse, Sekundäranalyse und Prozessanalyse. Die Analyseseiten sind so gestaltet, dass sich die Übersichtsseite zum Übertragen der Rohwertsummen aus den einzelnen Untertests in die Tabelle B (Umrechnung der Rohwertsummen in Wertpunkte) |32|ausklappen lässt. Aufgrund einer Perforierung lassen sich die Analyseseiten zur weiteren Verwendung (z. B. in der fachlichen Kommunikation mit anderen Professionen) nachträglich abtrennen.
Auf jeder Analyseseite sind mehrere Auswertungsschritte vorgesehen, die ineinandergreifen. Im Folgenden sollen die einzelnen Auswertungsschritte pro Analyseebene kurz benannt sowie auf wichtige Entscheidungen bei der Auswertung hingewiesen werden.
Übersicht. Die Auswertung erfolgt in mehreren Schritten und beginnt bei der Berechnung der Wertpunkte und Indexwerte auf der Übersichtsseite des Protokollbogens. Eine schematische Darstellung findet sich in Abbildung 1.5.
Abbildung 1.5: Auswertungsschritte für die Übersichtsseite des Protokollbogens der WISC-V
An dieser Stelle soll noch einmal besonders darauf hingewiesen werden, dass die präzise Messung, also der exakte IQ-Wert, messfehlerbehaftet ist. Um das damit verbundene Problem der eingeschränkten Aussagekraft eines diskreten Testwertes zu verringern, sollte immer das Konfidenzintervall (KI) mit angegeben werden. Dieses Intervall (bzw. die Intervallgrenzen) umschließt den tatsächlichen Wert einer Testperson in einer vorgegebenen Prozentzahl der Fälle. Für die WISC-V werden die Konfidenzintervalle für 90 % und 95 % angegeben. Möchte man eine höhere Gewissheit darüber haben, dass der Wert innerhalb der Grenzen liegt (also hier 95 %), müssen die Grenzen des Intervalls breiter gefasst sein. Für den IQ-Wert von 115 beträgt das KI (90 %) 110 bis 119 und das KI (95 %) 109 bis 121; das letztgenannte Intervall umfasst also einen breiteren Wertebereich.
Tabelle 1.6 listet die Wertebereiche für die einzelnen Ebenen (Untertestwerte, primäre und sekundäre Indexwerte) auf, innerhalb derer Leistungen in der WISC-V abgebildet werden können.
Primäranalyse. Für die Durchführung der Primäranalysen stehen Fragestellungen nach individuellen Stärken und Schwächen einer Testperson im Vordergrund. Um die Primäranalyseseite vollständig auszufüllen, sind zwei verschiedene Arbeitsschritte erforderlich: (1) die Analysen, um individuelle Stärken und Schwächen |33|auf Untertest- und Indexebene herauszuarbeiten, und (2) die primären Diskrepanzvergleiche auf Untertest- und Indexebene, um paarweise Unterschiede zwischen Untertests oder Indexwerten zu betrachten. Alle erforderlichen Schritte zur Durchführung der Primäranalysen finden sich im Manual zur Durchführung und Auswertung, Hinweise zu den verschiedenen Analysemethoden und Kennwerten können im Technischen Manual nachgelesen werden.
Tabelle 1.6: Standardisierte Werte in der WISC-V (MW = Mittelwert, SD = Standardabweichung)
Werte
MW
SD
Wertebereich
Zusätzliche Angaben
Wertpunkte
10
3
1 – 19
z-Werte
SV, VRV, FS, AGD, VG
100
15
45 – 155
Prozentränge, Konfidenzintervalle, z-Werte
AAGD, QS
100
15
45 – 155
Prozentränge, Konfidenzintervalle, z-Werte
NVI, AFI, KLI
100
15
40 – 160
Prozentränge, Konfidenzintervalle, z-Werte
G-IQ
100
15
40 – 160
Prozentränge, Konfidenzintervalle, z-Werte
Für alle Analysen sind im Vorfeld Entscheidungen zum Vergleichswert, zum Signifikanzniveau und zur Vergleichsgruppe (und damit zur Auswahl der Grundraten) zu treffen.
Als Vergleichswerte gelten Mittelwerte aus Indexwerten oder Untertestwertpunkten. Auf Indexebene kann entweder der Mittelwert aus den fünf primären Indexwerten (MIW) genutzt werden oder der Gesamt-IQ (G-IQ) selbst. Für die Untertests kann der Mittelwert wiederum aus allen zehn primären Untertests gebildet werden oder aus den sieben Untertests, aus denen sich der G-IQ zusammensetzt.
Die Auswahl des Signifikanzniveaus beeinflusst direkt die Höhe der kritischen Werte. Diese Werte sind gewissermaßen die Messlatte, die eine Differenz überspringen muss, um statistisch als signifikant zu gelten. Im Manual stehen kritische Werte für vier verschiedene Signifikanzniveaus zur Verfügung: .01, .05, .10 und .15. Um den Effekt dieser Entscheidung zu verdeutlichen, seien hier die vier kritischen Werte für den Vergleich des Index VG mit dem G-IQ dargestellt: .01 = 14.13, .05 = 11.75, .10 = 10.61 und .15 = 9.88. Je niedriger also das Signifikanzniveau gewählt wird, desto größer muss die Differenz ausfallen, um statistisch als signifikant (also als bedeutsam oder selten) zu gelten. Damit kann also das Ausmaß an Vertrauen kontrolliert werden, dass es sich bei der gefundenen Differenz um einen bedeutungsvollen, also reliablen Unterschied handelt, und dass eine solche Differenz bei einer Testwiederholung erneut zu beobachten |34|sein wird. Bei der Wahl des Signifikanzniveaus sollte zudem eine Balance zwischen statistischer Power und einem möglichen Fehler 1. Art (= α-Fehler oder falsch Positive) gefunden werden. Werden nur wenige Differenzen analysiert, kann mit einem .15-Niveau gearbeitet werden, werden hingegen alle Vergleiche durchgeführt, sollte ein stringenteres Niveau gewählt werden (vgl. dazu Technisches Manual, S. 137 ff.).
Statistische Signifikanz und Grundraten stellen unterschiedliche Informationen zur Verfügung. Zur Bewertung der praktischen Bedeutsamkeit von Differenzen kann also neben der Interpretation der statistischen Signifikanz geprüft werden, wie häufig die gefundene (oder eine größere) Differenz in einer definierten Vergleichsgruppe aufgetreten ist (= Grundrate). Die Vergleichsgruppe beruht auf der Normstichprobe der WISC-V, d. h. Grundraten beziehen sich auf die Häufigkeit, mit der bestimmte Differenzen in der Normstichprobe aufgetreten sind. Dazu können Vergleiche mit der gesamten Normstichprobe oder aber mit Testpersonen eines ähnlichen kognitiven Fähigkeitsniveaus vorgenommen werden. Grundraten können als ungewöhnlich oder selten – und damit auch als praktisch bedeutsam – beschrieben werden, wenn die ermittelte Differenz in dieser Höhe nur bei bis zu 10 % der Testpersonen der Grundgesamtheit (hier also der Normstichprobe der WISC-V) auftritt. Es liegt jedoch im Ermessen der Testleitung, insbesondere unter Berücksichtigung der Fragestellung, auch Grundraten bis zur Grenze von 15 % als auffällig zu interpretieren (Flanagan & Alfonso, 2017, S. 263; Sattler, 2018)1. Höhere Grundraten verringern nicht die Bedeutung signifikanter Differenzen, sondern zeigen lediglich an, dass eine solche Differenz relativ häufig auftritt. Grundraten sollten nur dann interpretiert werden, wenn eine statistische Signifikanz vorliegt.
Sekundäranalyse. Neben den primären Indexwerten, die über Faktorenanalysen bestätigt wurden, können in der WISC-V fünf sekundäre Indexwerte berechnet werden. Die Zusammenstellung der Untertests für die Berechnung erfolgte auf der Basis praktischer Überlegungen. Bei den sekundären Analysen handelt es sich um optionale Schritte, die es in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung oder dem Vorstellungsgrund ermöglichen, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Analyseschritte werden analog zu den Primäranalysen umgesetzt (vgl. Abb. 1.6).
Für die Interpretation bzw. die Einordnung von Indexwerten kann die nachfolgende Klassifikation (vgl. Tab. 1.7) genutzt werden. Die Einteilung der Intelligenzbereiche orientiert sich an der Standardabweichung von 15 IQ-Punkten. Auch wenn eine kognitive Leistung im Bereich der mittelgradigen Intelligenzminde|35|rung mit der WISC-V theoretisch abgebildet werden könnte, empfiehlt sich in diesem Fall jedoch der Einsatz von Testverfahren, die speziell für entsprechende Fragestellungen entwickelt und normiert wurden.
Abbildung 1.6: Auswertungsschritte für die Sekundäranalyseseite des Protokollbogens der WISC-V
Noch eine ergänzende Anmerkung zur Interpretation von Indexwerten und Gesamt-IQ (G-IQ): Die primären Indexwerte resultieren aus der Durchführung von insgesamt zehn Untertests (zwei pro Indexwert). In den Gesamt-IQ fließen davon nur sieben Untertests ein. Aus diesem Grund kann es durchaus vorkommen, dass der Gesamt-IQ deutlich außerhalb des Bereiches der primären Indexwerte liegt. Wenn eine Testperson beispielsweise in denjenigen drei Untertests aus VRV, AGD und VG, die nicht in den G-IQ einfließen, deutlich bessere Leistungen erreicht hat als in den drei entsprechenden Untertests dieser Indexwerte, die für den G-IQ herangezogen werden, dann fällt der G-IQ deutlich niedriger aus als man bei Betrachtung der Indexwerte erwarten würde. Der Gesamt-IQ sollte also nicht im Sinne eines „Mittelwertes“ aus den Indexwerten betrachtet werden!
Tabelle 1.7: Inhaltliche Beschreibung des Gesamt-IQ und der Indexwerte der WISC-V
IQ-Bereich
Beschreibung
Klassifikation
ICD-10
Anteil
≥ 130
weit überdurchschnittlich
Hochbegabung
2.3 %
115 – 129
überdurchschnittlich
13.6 %
85 – 114
durchschnittlich
68.2 %
70 – 84
unterdurchschnittlich
(Lernbehinderung)
13.6 %
50 – 69
weit unterdurchschnittlich
leichte Intelligenzminderung
F70
2.2 %
35 – 49
mittelgradige Intelligenzminderung
F71
0.1 %
Prozessanalyse. Um auf Untertestebene differenzierte Analysen zum Arbeitsstil einer Testperson vornehmen zu können, stehen die Prozessanalysen zur Verfü|36|gung. Die Prozesswerte sollen Auskunft darüber geben, wie eine Testperson zu der Lösung für eine Aufgabe gekommen ist. Diese Analysen orientieren sich am Boston Process Approach (Kaplan, 1988), einem neuropsychologischen Ansatz. Prozesswerte liegen für den Mosaik-Test, das Zahlen nachsprechen und den Durchstreich-Test vor. Eine differenzierte Beschreibung der einzelnen Kennwerte sowie zu den Auswertungsmöglichkeiten steht im Technischen Manual (S. 32 – 34) und im Manual zur Durchführung und Auswertung (S. 87 – 89) zur Verfügung.
1.3 Zusammenfassung
Mit den Auswertungs- und Analysemethoden und den Hinweisen zur Interpretation von WISC-V-Profilen sollen Testanwender_innen dabei unterstützt werden, die Testleistungen einer Testperson ins Verhältnis zu den Leistungen anderer Gleichaltriger zu setzen sowie Stärken und Schwächen innerhalb des kognitiven Leistungsprofils zu ermitteln. Damit soll gleichzeitig erreicht werden, die Perspektive auf die kognitiven Fähigkeiten zu erweitern, weg von einer isolierten Betrachtung eines globalen Gesamtwertes hin zu individuellen Stärken und Schwächen, die im psychologischen und pädagogischen Alltag dazu beitragen können, z. B. schulische Leistungen oder spezifische Verhaltensweisen einer Testperson zu erklären, weiterführende diagnostische Verfahren auszuwählen und/oder Interventionsmaßnahmen zu begründen. Die Profilanalysen haben damit also weniger eine statistische, sondern vielmehr eine praktische Bedeutung.
Klinische Diagnosen können – mit Ausnahme der Diagnosen zur Intelligenzminderung (F7) – weder auf Basis des Gesamt-IQ, der Indexwerte oder der Diskrepanzanalysen gestellt werden. Im Rahmen der Verhaltensbeobachtung während der Testung sowie auf der Grundlage anderer Leistungsindikatoren können zwar Hinweise auf das Vorliegen von klinisch relevanten Störungen gefunden werden, die Diagnose der Störung selbst kann aber nur auf der Basis störungsspezifischer Informationen (Fragebögen, spezifische Tests, Anamnese usw.) gestellt werden und muss sich an den entsprechenden Diagnosekriterien und nicht am Intelligenzprofil orientieren.
Aus den verschiedenen Analysen können andererseits aber Hinweise auf spezifische Leistungsdefizite gewonnen werden, die dazu beitragen, Lern- und Leistungsprobleme u. a. im Schulkontext zu erklären, die dann im Rahmen von Fördermaßnahmen flankierend behandelt werden können, wie beispielsweise Merkfähigkeitsstörungen oder räumlich-konstruktive Defizite. Damit kann die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen stabilisiert oder verbessert werden.
In den folgenden Kapiteln sollen die verschiedenen Auswertungsstrategien und -ebenen anhand von Fallbeispielen zu konkreten Fragestellungen beleuchtet wer|37|den. Am Ende des Buches finden sich in einem Glossar zusätzlich noch kurzgefasste Antworten auf häufig gestellte Fragen aus der diagnostischen Praxis.
Aufgrund der Diskussion um die Zulässigkeit von Diskrepanzanalysen (vgl. dazu Decker, Bridges, Luedke & Eason, 2020; McGill, Dombrowski & Canivez, 2018) wird empfohlen, die strengeren Grenzwerte (= 10 %) zu verwenden. Damit kann sichergestellt werden, dass nur sehr auffällige Differenzen berücksichtigt werden.
Literatur
Baddeley, A. (2011). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology,63, 1 – 29. Crossref
Baddeley, A. D. & Hitch, G. J. (1974). Recent advancess in learning and motivation. In G. A.Bower (Ed.), Working memory (Vol. 8, pp. 47 – 89). New York: Academic Press.
Beaujean, A., Benson, N., McGill, R. & Dombrowski, S. (2018). A misuse of IQ scores: Using the dual discrepancy/consistency model for identifying specific learning disabilities. Journal of Intelligence,6, 36. Crossref
Binet, A. & Simon, T. (1916). The development of intelligence in children. Baltimore: Williams & Wilkins.
Daseking, M., Petermann, F. & Waldmann, H. C. (2008). Der allgemeine Fähigkeitsindex (AFI) – eine Alternative zum Gesamt-Intelligenzquotienten (G-IQ) des HAWIK-IV?Diagnostica,54, 211 – 220. Crossref
Decker, S. L., Bridges, R. M., Luedke, J. C. & Eason, M. J. (2020). Dimensional evaluation of cognitive measures: Methodological confounds and theoretical concerns. Journal of Psychoeducational Assessment. Advance online publication.Crossref
Flanagan, D. P. & Alfonso, V. C. (2017). Essentials of WISC-V assessment. Hoboken, NJ: Wiley & Sons.
Giofre, D., Toffalini, E., Altoè, G. & Cornoldi, C. (2017). Intelligence measures as diagnostic tools for children with specific learning disabilities. Intelligence,61, 140 – 145. Crossref
Kaplan, E. (1988). A process approach to neuropsychological assessment. In T. J.Boll & B. K.Bryant (Eds.), Clinical neuropsychology and brain function: Research, measurement, and practice (pp. 129 – 167). Washington, DC: American Psychological Association.
McGill, R. J., Dombrowski, S. C. & Canivez, G. L. (2018). Cognitive profile analysis in school psychology: History, issues, and continued concerns. Journal of School Psychology,71, 108 – 121. Crossref
McGrew, K. S., & Wendling, B. J. (2010). Cattell-Horn-Carroll cognitive-achievement relations: What we have learned from the past 20 years of research. Psychology in the Schools,47, 651 – 675. Crossref
Petermann, F. & Petermann, U. (Hrsg.). (2007). Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder – IV (HAWIK-IV). Bern: Huber.
Petermann, F. & Petermann, U. (Hrsg.). (2011). Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition (WISC-IV, deutschsprachige Adaptation nach D. Wechsler). Frankfurt a. M.: Pearson Assessment.
Raiford, S. E. (2018). The Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition Integrated. In D. P.Flanagan & E. M.McDonough (Eds.), Contemporary intellectual assessment. Theories, tests, and issues (4th ed., pp. 302 – 323). New York: Guilford.
Remschmidt, H., Schmidt, M. & Poustka, F. (Hrsg.). (2017). Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 (7. Aufl.). Bern: Hogrefe. Crossref
Roth, B., Becker, N., Romeyke, S., Schäfer, S., Domnick, F. & Spinath, F. M. (2015). Intelligence and school grades: A meta-analysis. Intelligence,53, 118 – 137. Crossref
|38|Saklofske, D. H., Weiss, L. G., Breaux, K. & Beal, A. L. (2016). WISC-V and the evolving role of intelligence testing in the assessment of learning disabilities. In L. G.Weiss, D. H.Saklofske, J. A.Holdnack & A.Prifitera (Eds.), WISC-V assessment and interpretation (pp. 237 – 268). London: Elsevier. Crossref
Sattler, J. M. (2018). Assessment of Children. Cognitive Foundations and applications (6th ed.). La Mesa, CA: Sattler.
Schneider, W. J., Flanagan, D. P. & Alfonso, V. C. (2017). Overview of the WISC-V. In D. P.Flanagan & V. C.Alfonso (Eds.), Essentials of WISC-V assessment (pp. 1 – 52). Hoboken, NJ: Wiley.
Schneider, W. J. & McGrew, K. S. (2018). The Cattell-Horn-Carroll Theory of cognitive abilities. In D. P.Flanagan & E. M.McDonough (Eds.), Contemporary intellectual assessment. Theories, tests, and issues (4th ed., pp. 73 – 163). New York: Guilford.
Wahlstrom, D., Raiford, S. E., Breaux, K. C., Zhu, J. & Weiss, L. G. (2018). The Wechsler Preschool and Promary Scale of Intelligence – Fourth Edition, Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition, and Wechsler Individual Achievement Test – Third Edition. In D. P.Flanagan & R. M.McDonaough (Eds.), Contemoporary intellectual assessment. Theories, tests, and issues (4th ed., pp. 245 – 282). New York: Guilford.
Wasserman, J. D. (2018). A history of intelligences assessment. In D. P.Flanagan & E. M.McDonough (Eds.), Contemporary intellectual assessment. Theories, tests, and issues (4th ed., pp. 3 – 55). New York: Guilford.
Wechsler, D. (1927). Psychometric tests. In I. S.Wechsler (Ed.), Textbook of clinical neurology (pp. 104 – 116). Philadelphia: Saunders.
Wechsler, D. (1939). Wechsler-Bellevue Intelligence Scale. New York, NY: The Psycholocial Corporation.
Wechsler, D. (1944). The measurement of adult intelligence (3rd ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.
Wechsler, D. (2003a). The Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition (WISC-IV). Administration and scoring manual. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
Wechsler, D. (2003b). The Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition (WISC-IV). Technical and interpretive manual. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
Wechsler, D. (2014). Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V). Bloomington, MN: Pearson.
Wechsler, D. (2017). Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V). Deutsche Bearbeitung von F. Petermann. Frankfurt a. M.: Pearson Assessment.
Weiss, L. G., Holdnack, L. A., Saklofske, D. h. & Prifitera, A. (2016). Theoretical and clinical foundations of the WISC-V index scores. In L. G.Weiss, D. H.Saklofske, J. A.Holdnack & A.Profotera (Eds.), WISC-V Assessment and interpretation. Scientist-practitioner perspectives (pp. 97 – 121). Amsterdam: Academic Press. Crossref
|39|2 WISC-V und ihre intelligenztheoretische Einbettung
Manfred Mickley
Aus der weit über 100 Jahre währenden Entwicklungsgeschichte der Intelligenzdiagnostik (vgl. die Übersichten von Hagmann-von Arx, Beyer & Grob, 2008; Wasserman, 2018) werden die Wechsler-Tests als eine der Säulen psychologischer Diagnostik (Daseking, Petermann & Petermann, 2009) hervorgehoben. Vor über 60 Jahren traten im deutschsprachigen Bereich der Intelligenzdiagnostik von Kindern und Jugendlichen die Wechsler-Tests mit der Übertragung der US-amerikanischen Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC; Wechsler, 1949) in den Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder (HAWIK; Hardesty & Priester, 1956) prominent hervor. Es dauerte dann 40 Jahre, bis die von David Wechsler geschaffene Dichotomie zwischen Verbal- und Handlungs-IQ mit dem HAWIK-III (Tewes, Rossmann & Schallberger, 1999) im Rahmen eines 4-Faktoren-Modells zunächst erweitert und dann mit dem HAWIK-IV/der WISC-IV (Petermann & Petermann, 2007, 2011) aufgegeben wurde. In dieser Entwicklung spiegelte sich gleichzeitig auch die Debatte „g or not g?“ wider, d. h. die Frage, inwieweit aus klinischer Perspektive eine Kennzahl (g als „general intelligence“, ausgedrückt im Gesamt-IQ als beste Schätzung der allgemeinen Intelligenz) oder weitere Werte im Rahmen der Interpretation eines Intelligenzprofils bei der Beantwortung intelligenzdiagnostischer Fragestellungen zu bevorzugen seien.
Die vielfach insbesondere als Kritik an den Wechsler-Tests formulierte Klage, dass zwischen Intelligenz-Theorie und psychometrisch fundierter Intelligenz-Messung eine inakzeptable Lücke herrsche (vgl. Flanagan & McGrew, 1997), und dass Intelligenztests eher unklar an theoretische Modelle der Intelligenz gekoppelt seien, wurde Ende des 20. Jahrhunderts mit der Entwicklung des CHC-Modells aufgegriffen (McGrew, 1997). In den deutschsprachigen Manualen zum HAWIK-IV bzw. zur WISC-IV und aktuell zur WISC-V (Wechsler, 2017) findet diese theoretische Diskussion jedoch keinen ausdrücklichen Niederschlag. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle eine entsprechende Einbettung der WISC-V in aktuelle Intelligenztheorien vorgenommen werden.
|40|2.1 CHC-Modell
Neben Spearmans Theorie des Generalfaktors der Intelligenz (g) ist das CHC-Modell auch im deutschsprachigen Raum ein oft diskutiertes theoretisches Modell psychometrisch fundierter Intelligenzdiagnostik (vgl. Mickley & Renner, 2010, 2019; Süß & Beauducel, 2011). Die aktuellste Darstellung des CHC-Modells findet sich in Schneider und McGrew (2018). In der hier vorliegenden Darstellung wurde diese Weiterentwicklung jedoch nicht berücksichtigt, da die WISC-V in den USA vor der Publikation von Schneider und McGrew (2018) veröffentlicht wurde.





























