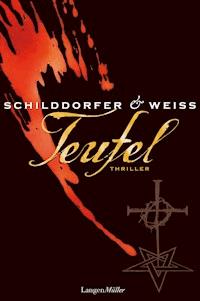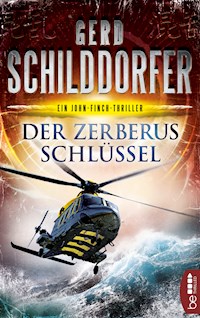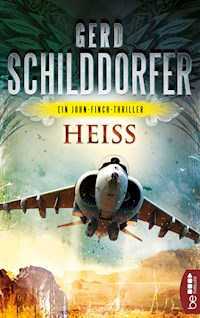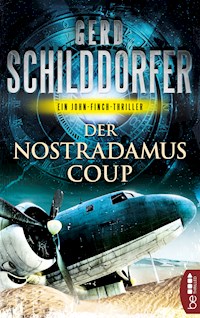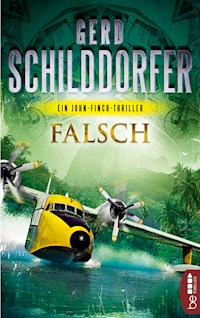
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Finch
- Sprache: Deutsch
Ein blutiger Überfall. Drei codierte Botschaften, von Brieftauben in die Welt getragen. Ein Wettlauf um ihre Entschlüsselung beginnt ...
In letzter Minute gelingt es dem alten Mann im kolumbianischen Dschungel, drei Brieftauben fliegen zu lassen. Dann stürmt eine Horde bewaffneter Männer seine Hütte, und der Alte schneidet sich mit einer Machete die Kehle durch. Die Tauben tragen verschlüsselte Botschaften in die Welt, die eine alte Schuld aus dem Jahr 1945 einfordern. Aber die Hinweise landen bei den falschen Empfängern. Bevor alles verloren ist, bietet ein geheimnisvoller deutscher Auswanderer ein Vermögen für die Entschlüsselung der Nachrichten.
Der Abenteurer und Pilot John Finch macht sich in Begleitung der attraktiven Fiona Klausner und einer durch das Schicksal zusammengeschweißten Truppe auf die Jagd nach den Botschaften. Der Weg führt sie nach Europa, wo sie auf ein spektakuläres Geheimnis aus der Nazizeit stoßen. Es beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen übermächtige Gegner ...
»Schnell wechselnde Schauplätze, eine souverän erzählte Geschichte, ein sorgfältig ausgearbeiteter Plot und nicht zuletzt auch die sympathischen Helden machen "Falsch" zu einem Leseerlebnis, das auf keiner der 670 Seiten nachlässt. Das ist internationales Thriller-Niveau.« WDR 5
Die John-Finch-Reihe - eine explosive Mischung aus Abenteuerroman und Verschwörungsthriller:
Band 1: Falsch
Band 2: Heiß
Band 3: Der Nostradamus-Coup
Band 4: Der Zerberus-Schlüssel
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 922
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel des Autors
Die John-Finch-Reihe:
Band 1: Falsch
Band 2: Heiß
Band 3: Der Nostradamus-Coup
Band 4: Der Zerberus-Schlüssel
Über dieses Buch
Ein blutiger Überfall. Drei codierte Botschaften, von Brieftauben in die Welt getragen. Ein Wettlauf um ihre Entschlüsselung beginnt …
In letzter Minute gelingt es dem alten Mann im kolumbianischen Dschungel, drei Brieftauben fliegen zu lassen. Dann stürmt eine Horde bewaffneter Männer seine Hütte, und der Alte schneidet sich mit einer Machete die Kehle durch. Die Tauben tragen verschlüsselte Botschaften in die Welt, die eine alte Schuld aus dem Jahr 1945 einfordern. Aber die Hinweise landen bei den falschen Empfängern. Bevor alles verloren ist, bietet ein geheimnisvoller deutscher Auswanderer ein Vermögen für die Entschlüsselung der Nachrichten.
Der Abenteurer und Pilot John Finch macht sich in Begleitung der attraktiven Fiona Klausner und einer durch das Schicksal zusammengeschweißten Truppe auf die Jagd nach den Botschaften. Der Weg führt sie nach Europa, wo sie auf ein spektakuläres Geheimnis aus der Nazizeit stoßen. Es beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen übermächtige Gegner …
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Über den Autor
Gerd Schilddorfer wurde 1953 in Wien geboren. Als Journalist arbeitete er bei der Austria Presse Agentur und danach als Chefreporter für verschiedene TV-Dokumentationsreihen (Österreich I, Österreich II, Die Welt und wir). In den letzten Jahren hat er zahlreiche Thriller und Sachbücher veröffentlicht. Gerd Schilddorfer lebt und arbeitet in Wien und Stralsund, wenn er nicht gerade auf Reisen für sein neues Buch ist.
Gerd Schilddorfer
FALSCH
Ein John-Finch-Thriller
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Gerd Schilddorfer
Originalverlag: Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © Ralf Roletschek/roletschek.at; Mark Poprocki/shutterstock.com; R McIntyre/shutterstock.com; grafalex/shutterstock.com; Paolo Costa/shutterstock.com; Angelina Babii/shutterstock.com
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-1761-8
be-ebooks.de
lesejury.de
Die Normalität ist eine gepflasterte Straße;
man kann gut darauf gehen –
doch es wachsen keine Blumen auf ihr.
Vincent van Gogh
PROLOG I
7. November 1917
ST. PETERSBURG/RUSSLAND
Die Roten Garden waren schneller da gewesen, als er geglaubt hatte. Samuel Kronstein warf einen prüfenden Blick in den Empire-Spiegel über der Anrichte des Speisezimmers und richtete sich die Krawatte mit dem gestickten Familienwappen.
Schüsse hallten in den Straßen, Menschen stoben in Panik davon.
Mit einer fast zärtlichen Geste fuhr sich der große Mann über das Revers seines Smokings, nahm seinen Spazierstock, wählte einen Hut und drehte sich einmal langsam um die eigene Achse. Dabei glitt sein Blick über die wertvolle Louis-seize-Einrichtung, die Sammlung an französischen Impressionisten und die Vitrine mit dem Sèvres-Porzellan. Er schüttelte bedauernd den Kopf. Nein, es gab Momente im Leben, da konnte man nichts mitnehmen. Und dies war einer jener Augenblicke, vor denen ihn seine Großmutter immer gewarnt hatte. Martha Kronstein war eine Überlebenskünstlerin gewesen, ihr Leben gezeichnet durch Pogrome und Hetzjagden, geprägt von lebenslanger Diskriminierung der jüdischen Population in der Zarenzeit, bevor sie im hohen Alter schließlich nachsichtig und gütig wurde.
Aber nie unvorsichtig.
Und sie hatte meist recht behalten mit ihren Warnungen, Gott hab sie selig, dachte Kronstein, schob die schwere Gardine zur Seite und blickte aus einem der großen Fenster auf den Newski-Prospekt. Die Schüsse waren wieder verstummt, die Straße wie leergefegt.
Erregte Stimmen ertönten nun von der Freitreppe. Seine Bediensteten schienen Eindringlinge aufhalten zu wollen. Braver Alexej, lächelte Kronstein traurig, du stemmst dich vergebens gegen den Strom der Geschichte. Die Zeit hat uns bereits überholt und überrollt zugleich.
Unten wurde lautstark gestritten. Das Palais Kronstein war nicht irgendein Ort, in den man so selbstverständlich eindrang, nicht einmal als Soldat der Revolutionsgarden. Hier waren Lenin und Trotzki ein und aus gegangen, hatten Nächte durchgetrunken und hitzig diskutiert. Der Salon des berühmtesten Schmuckhändlers Russlands hatte allen offengestanden. Wenn der russische Adel Wertvolles veräußern wollte, hatte man stets den diskreten Kronstein gerufen. Wenn die Revolutionäre Geld brauchten, hatten sie bei ihm angeklopft und waren selten mit leeren Händen abgezogen. Samuel Kronstein, einst einer der bekanntesten Mitarbeiter des Hofjuweliers Fabergé, hatte vor dreißig Jahren das goldene Handwerk an den Nagel gehängt und war in den Handel mit edlen Steinen und Pretiosen eingestiegen. Sein makelloser Ruf und seine untadelige Vergangenheit hatten ihn schnell zu einem der gefragtesten Schmuckhändler in St. Petersburg, ja in ganz Russland gemacht. Selbst der Zar hatte ihm schriftlich gedankt, seine schützende Hand über ihn gehalten, aber Kronstein hatte rasch gelernt, sich immer alle Optionen offenzuhalten.
Großmutter Martha sei Dank.
Eine Investition, die sich nun bezahlt machen könnte, dachte er und betrachtete sich ein letztes Mal im Spiegel. Trotz seiner siebzig Jahre sah er noch immer bemerkenswert gut aus. Schlank, hochgewachsen und mit einer weißen Mähne, die immer ein wenig zu lang, jedoch stets perfekt frisiert war, gehörte er zu den – im wahrsten Sinne des Wortes – herausragenden Persönlichkeiten der St. Petersburger Gesellschaft. Er war in die richtigen Schulen gegangen, hatte mit den richtigen Mädchen getanzt und mit einigen von ihnen geschlafen.
Nur die Richtige hatte er nie gefunden.
St. Petersburg hatte es immer gut mit ihm gemeint. Er würde diese Stadt vermissen, mit ihren rauschenden Festen und den weißen Nächten, in denen es im Sommer vierzehn Tage lang nicht dunkel werden wollte. Wie oft hatte man rund um die Uhr durchgefeiert, in Kaviar und Champagner geschwelgt und sich mit jungen Ballettratten amüsiert? Und immer wieder, zwischen opulenten Soupers und ausschweifenden Orgien, hatte man in lauten Trinksprüchen den Zaren hochleben lassen. Jetzt, in der neuen Zeit, würden es wohl eher frigide Revolutionärinnen, Lenin und proletarischer Wodka werden, dachte Kronstein und verzog missbilligend das Gesicht.
Da klopfte es laut an der Tür, und er fuhr herum. Im Haus war es ruhig geworden, und der alte Mann fragte sich überrascht, ob Alexej vielleicht erfolgreich gewesen war und die Revolutionäre hinausgeworfen hatte. Aber ein Umsturz machte nicht an der Türschwelle halt, auch nicht an der des Palais Kronstein …
Die schwere Doppelflügeltür öffnete sich mit einem Ruck, und hinter dem verärgert blickenden Alexej in seiner untadeligen Livree drängten Männer in wild zusammengewürfelten Uniformen in den Raum. Ihr Strom riss nicht ab. Schließlich war das Speisezimmer so voll wie bei einer der beliebten Soireen anlässlich des Geburtstags des Zarewitsch. Die Eindringlinge blickten sich staunend um und brachten angesichts der gediegenen Pracht des Raumes kein Wort hervor.
»Wer ist Ihr Kommandeur?«, fragte Kronstein leichthin und blickte auffordernd in die Runde.
Einer der Männer zog langsam seine Kappe vom Kopf und drehte sie verlegen in den Händen, bevor er antwortete. »Hm, das bin ich, Exzellenz.« Wie auf einen unhörbaren Befehl hin nahmen auch alle anderen ihre Kopfbedeckungen ab. Einige schauten betreten zu Boden. Ihre Gewehre baumelten von ihren Schultern.
Kronstein nickte und stützte sich auf seinen Ebenholzstock mit dem silbernen Griff. »Und was wollen Sie hier, Kommandant?«
»Wir haben Befehl, das Palais in Beschlag zu nehmen und alle anwesenden Nichtproletarier zu verhaften, Exzellenz«, meinte der rundliche Mann mit dem rosa Gesicht, dem der Auftrag sichtlich unangenehm war. Er kannte die Verbindungen des Hausherrn zu den Männern des Revolutionskomitees, seine Rolle als Finanzier. Und trotzdem … Er zuckte entschuldigend mit den Schultern.
Kronstein machte eine ausholende Handbewegung. »Bedienen Sie sich, Genosse, mein Haus ist Ihr Haus.«
Ein Raunen ging durch die Reihen der Männer, aber niemand wagte es, sich zu rühren. Der Kommandant trat unschlüssig von einem Bein aufs andere. Er schaute verlegen zu Boden und schien fieberhaft zu überlegen.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, kam ihm Kronstein jovial zu Hilfe und schaute in die Runde, in junge, picklige Bauerngesichter mit roten Wangen und wirren Haaren. Die meisten dieser Soldaten der Revolution hatten sicherlich zum ersten Mal ein Gewehr geschultert. »Ich werde Sie jetzt verlassen und das alles hier in Ihre Obhut übergeben. Ich werde nichts mitnehmen außer meinem Hut und meinem Stock.« Er machte eine Pause. »Dafür werden Sie sagen, Sie hätten mich nicht zu Hause angetroffen, und verschonen mein Personal.«
Der Kommandant hob den Blick und sah Kronstein dankbar an. Dann wandte er sich an seine Männer. »Ihr habt gehört, welch großzügigen Vorschlag Seine Exzellenz gemacht hat.« Ein zustimmendes Murmeln ertönte. »Vier Mann sorgen für sein freies Geleit bis an den Ort, der ihnen von … Herrn Kronstein genannt wird.« Er warf dem alten Mann erneut einen entschuldigenden Blick zu.
Seine Männer atmeten auf und nickten erleichtert. Vier von ihnen traten vor und salutierten kurz vor dem respekteinflößenden alten Mann, der sich kerzengerade hielt, bevor er ihnen mit großen Schritten voranging und die Treppen hinuntereilte.
Mit einem letzten Blick auf die makellos weiße klassizistische Fassade des Palais verließ Samuel Kronstein sein Stadtdomizil und bestieg das Automobil, das sein Chauffeur vorgefahren hatte. Als die vier Männer der Eskorte zugestiegen waren, rollte der Daimler an und gewann rasch an Geschwindigkeit.
Man sah Samuel Kronstein nie wieder in St. Peterburg, das wenig später in Leningrad umbenannt wurde. Niemand wusste, wohin er verschwunden war, seine Spur verlor sich in den Wirren der Nachkriegszeit. Seltsam war allerdings, dass sich auch die vier Männer seiner Eskorte in Luft aufgelöst zu haben schienen. Sie wurden für tot erklärt, »gefallen bei einem Gefecht um das Regierungspalais«, wie es in den Listen hieß, die nur lückenhaft geführt wurden.
Bald hatte man sie völlig vergessen.
PROLOG II
20. September 2010
NAHE MUZO/KOLUMBIEN
Die Zeit war reif, er spürte den Tod kommen.
Der schmächtige alte Mann in seinem engen, schmutzigen Verschlag am Ende der Welt seufzte, als er nach dem kleinen Messingschlüssel an der Lederschnur um seinen Hals tastete. Es war also so weit. Wie oft hatte er sich ausgemalt, was nun passieren würde? Bereute er die Geste, den Griff an die speckige Schnur, die ihn in den letzten 65 Jahren nie verlassen hatte? Allein die Vorstellung von dem, was nun passieren würde, bereitete ihm ein körperliches Wohlbefinden, jagte ihm Schauer über den Rücken und ließ ihm den Schweiß ausbrechen. Unwillkürlich musste er an Shakespeare denken. Cry »Havoc!« and let slip the dogs of war. Es würden Bluthunde sein, die losstürmten …
Von draußen drangen die Geräusche des Dschungels an sein Ohr. Die Sonne war fast hinter dem Horizont aus grünem Dickicht verschwunden, nur die obersten Zweige der Bäume warfen noch ihre langen Schatten auf die Lichtung vor der ärmlichen Hütte. An manchen Tagen kam ihm der Wald wie eine Wand vor, die jeden Morgen ein paar Zentimeter näher gerückt war. Unabänderlich, unaufhörlich, wie ein Bulldozer, der ihn und seine lächerliche Hütte bald überrollen würde. Eine riesige, erbarmungslose grüne Maschine. Noch wartete sie im Leerlauf oder schlich zentimeterweise voran. Aber eines Tages würde sie alles hier verschlucken und nie mehr ausspucken.
Er war ein Eindringling, seit Jahrzehnten geduldet, aber der Dschungel ließ ihn das nie vergessen.
Während er mit zitternden Fingern versuchte, den kleinen Schlüssel von der Lederschnur loszumachen, blickte er verstohlen zu der schlafenden Eingeborenen hinüber, die sich auf ein paar zerrissenen dünnen Decken eingerollt hatte und leise schnarchte. Sie lag auf dem gestampften Lehmboden, den Daumen im Mund, wie ein Baby. Es roch nach Erbrochenem und Urin in der stickigen, heißen Hütte.
Er traute ihr nicht über den Weg. Er musste handeln. Sie waren auf dem Weg, ihn zu holen, dessen war er sich sicher.
Die dunkelhäutige India mit ihren schwarzen Augen und den verklebten Haaren hatte vor vier Tagen plötzlich vor seiner Hütte gestanden und ihn mit einem irren Blick angeschaut, unverwandt. Eine regungslose Schlange, die das Kaninchen hypnotisiert. Er hatte versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie hatte seine Bemühungen nur stumm ignoriert. Als er ihr schließlich mit großen, hektischen Gesten bedeutete, wegzugehen, endlich zu verschwinden, war sie lediglich ein paar Schritte zurückgewichen und dann trotzig stehen geblieben.
Zwei Tage lang hatte sie ihn beobachtet, lauernd, mit ihren braunen, ausdruckslosen Augen. Nicht einmal, wenn er sich hinhockte und seine Notdurft verrichtete, war ihr starrer Blick von ihm gewichen.
Der alte Mann schüttelte den Kopf. Er sollte sie einfach im Schlaf erschlagen, dann wäre ein Problem gelöst. Aber er hatte noch zu viele andere Probleme, bevor …
Mit einer ungeduldigen Handbewegung wischte er ein paar Fliegen von seiner Stirn.
Zwei Nächte hatte sie vor seiner Hütte geschlafen, unter dem löchrigen Vordach im Gras, ihren Kopf auf einen flachen Stein gelegt. Er hatte gewacht, misstrauisch, die Machete in der Hand, hinter der dünnen Tür, die er aus den Brettern alter Teekisten gezimmert hatte. Aber sie war nicht näher gekommen, hatte nicht versucht, in seine windschiefe Behausung einzudringen. Ihr flaches braunes Gesicht, das ihm jeden Morgen bei Tagesanbruch entgegenblickte, war unbeweglich geblieben.
Sie tat nichts, sie aß nichts, sie stand einfach nur da und blickte ihn unverwandt an.
Als er sie schließlich am dritten Tag mit einer unwirschen Handbewegung in seinen Verschlag einlud und ihr den verbeulten Aluminiumbecher mit Tee entgegenhielt, setzte sie sich mit steinernem Gesicht auf den Boden und schlürfte gierig das heiße Getränk. Dabei blickte sie sich um. Nicht neugierig, nein, eher katalogisierend. Oder suchend? Das alte, durchgelegene Bett mit der verwanzten Matratze, die gestapelten Teekisten, die als Regal dienten, das vergilbte und gewellte Foto mit den Einschusslöchern und dem zersplitterten Glas. Es zeigte einen Weißen in Uniform, das junge Gesicht selbstsicher und forsch der Kamera zugewandt.
Hochnäsiger Blick. Gefährliche Ignoranz.
Die alten Pappschachteln unter dem Bett waren in verschiedenen Stadien der Auflösung begriffen und faulten vor sich hin. Auf dem unebenen gestampften Lehmboden lag ein Stück Stoff als Teppichersatz, das mehr Löcher hatte als das Gebiss des Bewohners.
Sie hatte sich lange wortlos umgeschaut, mit unbeweglichem Gesicht und einem abschätzigen Blick, der den alten Mann geärgert hatte. Dann war sie aufgestanden und an den Käfig mit den drei Tauben getreten. Der Alte glaubte plötzlich, so etwas wie Hunger in ihren Augen zu lesen. Oder war es Neugier? Er konnte es nicht deuten, aber instinktiv stellte er sich rasch beschützend vor den schmierigen Käfig und nahm ihr die Sicht auf das Wertvollste, was er noch besaß.
Die Vögel waren so erstaunt über den unerwarteten Besuch gewesen, dass sie zu gurren vergaßen.
Die Eingeborene schnarchte weiter. Kopfschüttelnd kniete der Alte nieder, bückte sich. Das Mahagonikästchen war noch da, wo er es vor einem Leben versteckt hatte, in der flachen Grube unter dem Kopfende seines Bettes. In braunes Wachspapier eingeschlagen, fest verschnürt.
Er richtete sich wieder auf und streifte mit fahrigen Bewegungen die Erde von dem kleinen Paket, bevor er vorsichtig die Bindfäden löste. Mit jedem geöffneten Knoten kam er der Entscheidung einen Schritt näher. Seine Hände zitterten, als er langsam und bedächtig das Papier entfernte und sich eine kleine, fast schwarze kubische Schatulle aus der Verpackung schälte.
Ein Geräusch hinter ihm ließ ihn herumfahren. Mit schiefem Grinsen und irrem Blick stürzte sich die Eingeborene auf ihn, flog ihm mit ausgestreckten Händen entgegen, die wie Krallen eines Raubvogels sein Gesicht suchten. Sie prallte auf ihn, bevor er ihr ausweichen konnte, riss ihn um, hinunter auf den rutschigen Boden. Er spürte einen Stich in seinem rechten Knie und stöhnte auf.
Die Schatulle kullerte wie ein Würfel davon, blieb schließlich auf dem löchrigen Teppich liegen, verfolgt von ihrem gierigen Blick. Sie hatte die Hände um seinen Hals gelegt und drückte zu, so fest sie nur konnte. Ihren Kopf jedoch hatte sie abgewandt, um das schwarze Kästchen nicht aus den Augen zu verlieren, und das war seine Chance. Mit einer Hand griff er unter das Bett, während es um ihn immer schwärzer wurde, tastete hektisch herum, bis er endlich gefunden hatte, was er suchte. Mit einer einzigen wütenden Bewegung riss er die Machete aus der Scheide, während sich die Hände des Mädchens noch fester um seinen Hals zu krampfen schienen.
Er keuchte schwer unter ihrem Gewicht. Der triumphierende Blick ihrer dunklen Augen sprach Bände: Ich bin jünger, stärker und zu allem entschlossen. Dann jedoch sah sie die Machete aufblitzen und schrie vor Schreck auf. Es war das erste Mal, dass er ihre Stimme hörte. Sie war schrill und spitz und klang wie eine Luftschutzsirene.
Sein erster halbherzig geführter Schlag traf sie seitlich. Die scharfe Klinge glitt vom Schädelknochen ab und trennte ihr glatt das Ohr und einen Teil der Wange vom Kopf. Ihr Griff um seinen Hals löste sich, und ein unmenschlicher Schrei hallte durch die Hütte und hinaus über die kleine Lichtung.
Er versuchte krächzend, tief Luft zu holen und aufzustehen, aber seine Beine versagten ihren Dienst. Sie war zurückgetaumelt, die Hände an den Kopf gepresst. Zwischen ihren Fingern schoss Blut hervor, ein dunkelrotes Geflecht aus purpurnen Nebenströmen, die sich auf ihrem Arm zu einem Fluss vereinten, der dann von ihrem Ellenbogen auf den Boden rann. Ihr hasserfüllter Blick ließ ihn keinen Moment aus den Augen, während sie sich vor Schmerzen krümmte.
Seine Hand mit den großen braunen Altersflecken öffnete und schloss sich um den Griff der Machete. Er spürte das Adrenalin durch seinen Körper jagen. Bilder von damals blitzten vor seinen Augen auf, schwarzweiß, ausgeblichen, unscharf und unwirklich. Wie ein Rausch setzte das Hochgefühl ein.
»Du miese kleine Ratte«, presste er hervor, »du Ausgeburt der Hölle. Ich schicke dich dahin zurück, wo du hergekommen bist.«
Täuschte er sich, oder schien sie auf etwas zu warten?
Er wischte den Gedanken beiseite und stützte sich mit einer Hand auf dem Bett auf, wuchtete ächzend den alten, gebrechlichen Körper hoch.
Wo war die Schatulle?
Da war die Eingeborene auch schon wieder über ihm, rasend vor Schmerzen und Wut. Sie riss ihn mit sich, und beide fielen aufs Bett, er auf den Rücken und sie auf ihn, wie ein Liebespaar in einer grotesken Umarmung. Blut und Speichel tropften auf sein Gesicht, während sich ihre Hände erneut wie ein Schraubstock um seinen Hals legten. Zugleich rammte sie ihm ihr Knie in den Unterkörper, immer und immer wieder, bis er Sterne vor den Augen sah und die Schmerzwellen seinen Verstand benebelten.
Mit letzter Kraft stieß er ihr die Machete in die Seite, drückte nach und ließ erst ab, als die Spitze des langen Messers auf der anderen Seite aus ihrem Körper drang. Sie krümmte sich stöhnend und erschlaffte mit einem Mal, sackte auf ihn herunter, schwer und regungslos.
Die feuchte Hitze und ihr Körper schienen ihn zu erdrücken wie eine Zwangsjacke. Erschöpft ließ er seinen Kopf auf die dünne Decke fallen und lauschte. Außer dem Gurren der Tauben war da nur sein schwerer Atem.
In der Ferne schrie ein Tier in der heranbrechenden Nacht.
Er wälzte mühsam ihren Körper von seinem und zog dabei die Machete heraus. Ein Schwall Blut tränkte ihr billiges Kleid, das hochgerutscht war, und er sah einen fleckigen, großen Slip, der ehemals einmal weiß gewesen sein mochte. Aber das war nicht wichtig. Als er sich aufrichtete, erblickte er die Schatulle mitten im Raum, unversehrt und schwarz glänzend. Er humpelte hinüber, ignorierte die Schmerzen in seinem Unterleib und hob das kleine Kästchen hastig auf. Mit einem Ende seines löchrigen T-Shirts wischte er behutsam den Staub ab, lauschte aufmerksam nach draußen und tastete dann schließlich erneut nach dem Schlüssel an seinem Hals. Er zog ihn von der Schnur ab und schloss auf.
Die alten Scharniere quietschten leise, als der Deckel nach oben klappte, und der dunkelrote Samt leuchtete ihm so frisch entgegen wie am ersten Tag. Der Anblick der drei Gegenstände, die klein und unscheinbar in einer Ecke der Schatulle lagen, ließen die Augen des Alten aufblitzen.
»… Andlet slip the dogs of war«, murmelte er, als er mit seinen gichtigen Fingern das Papierröllchen, den flachen Schlüssel und den Ring aus ihrem Versteck holte.
Achtlos warf er das leere Kästchen aufs Bett und stolperte zu dem Käfig mit seinen geliebten Tauben. Es waren zwei braunweiße und ein grauer Vogel, groß und kräftig, gut genährt und makellos sauber. Der Alte steckte seine zitternde Hand in den Käfig und strich zärtlich über das Gefieder seiner aufgeregt trippelnden Lebensgefährten. Würden sie sich noch erinnern, an die weit entfernten Ziele, die fremden Städte, oder waren die Reisen vergebens gewesen? Er hatte mit Geduld und Beharrlichkeit den Vögeln Dinge beigebracht, die außergewöhnlich waren. Sein gesamter Lohn aus den nahe gelegenen Smaragdminen war nach und nach dabei draufgegangen, die langen Flugreisen zu bezahlen. Und auch das übrige Geld …
Ein Geräusch ließ ihn hochschrecken. Misstrauisch legte er den Kopf schief. Irgendwo auf der Lichtung hatte ein Ast geknackt. Hatten die anderen ihren Schrei gehört? Er spürte, wie seine Zeit ablief, immer deutlicher. Rasch befestigte er das Papierröllchen, dann den Schlüssel an den Füßen der braunweißen Tauben. Endlich war der Ring an der Reihe. Er drehte ihn in seinen Fingern, sah die beiden Steine blitzen, strich mit seinem zerfurchten Daumen über die alten Symbole und spürte das Gewicht des Silbers. Der Ring fühlte sich kühl an und glänzte geheimnisvoll in der einbrechenden Dunkelheit. Mit schnellen Griffen streifte der alte Mann ihn der grauen, der stärksten seiner Tauben, über den Fuß und befestigte ihn sicher.
Als er fertig war, saßen die Tauben nebeneinander auf dem offenen Käfig und blickten ihn neugierig an.
Er wurde unsicher.
Keiner der Vögel machte Anstalten, davonzufliegen …
Dann brach mit einem Mal das Chaos über die kleine Hütte herein. Mit einem lauten Krachen wurde die Tür eingetreten und Männer stürmten in den Verschlag, Männer, so alt wie er. Grauhaarig oder mit Glatze, untersetzt, die meisten in Jeans und T-Shirts. Die kurzen Sturmgewehre wollten nicht recht zu ihnen passen. Eine Gehhilfe wäre in den Augen mancher Beobachter angemessener gewesen, doch das täuschte.
Die Lichtkegel von einem halben Dutzend starker Taschenlampen irrten durch die Hütte, blieben erst an der Leiche des Mädchens hängen, dann fingen sie schließlich die Figur des gebrechlichen, alten Mannes ein.
Erschreckt durch die Eindringlinge waren die Tauben aufgeflogen, flatterten aufgeregt in der Hütte herum, hinauf unter das Wellblechdach und wieder zurück zum Käfig, dann zur Tür, verängstigt einen Ausweg aus dem engen Raum suchend, während die Männer ihrerseits auf Englisch durcheinanderriefen, nach den Vögeln schlugen und von draußen der Rotorenlärm eines landenden Hubschraubers zu hören war.
Der alte Mann blickte den Bewaffneten ruhig entgegen. Er vermied es absichtlich, den Tauben nachzusehen, die eine nach der anderen die Tür gefunden hatten und nun im violetten Abendlicht verschwanden, wie er erleichtert feststellte.
Die Eindringlinge stutzten erst und stürzten dann hastig zurück ins Freie, rissen die Waffen hoch und schossen den Vögeln hinterher. Aber die hereinbrechende Nacht machte ein genaues Zielen unmöglich. Die Tauben verschwanden zielstrebig in Richtung Osten über den Bäumen, verschmolzen mit der Dunkelheit und waren nur mehr Schemen, die sich schnell in Nichts auflösten.
Als die Männer die Sturmgewehre herunternahmen und laut fluchend wieder in die Hütte stürmten, fanden sie den alten Mann sterbend auf dem Boden liegen. Er hatte sich mit seiner Machete die Kehle durchgeschnitten, sein Blut kam stoßweise und tränkte den Lehmboden wie verschütteter roter Sirup.
Auf seinen Zügen lag ein zufriedenes Lächeln.
Die Angreifer durchsuchten die Hütte gründlich, aber sie fanden nichts, bis auf das leere Kästchen und das vergilbte Porträt mit den Einschüssen. Sie nahmen die alte Photographie von der Wand, einer löste sie aus dem Rahmen und steckte sie ein. Währenddessen wurden bereits Benzinkanister aus dem Hubschrauber herbeigeschleppt. Wortlos und äußerst gründlich gossen die alten Männer die Flüssigkeit in jede Ecke des Verschlags. Sie würdigten die beiden Leichen keines weiteren Blickes.
Als der große Helikopter gestartet war und kurz über der Lichtung im Dschungel schwebte, brannte die trockene Hütte lodernd hell, meterhohe Flammen schlugen links und rechts aus dem Wellblechdach. Bald würde das Feuer die letzten Reste des Gringo loco, des verrückten Weißen, wie ihn die Eingeborenen immer genannt hatten, verschluckt haben.
Ein großer, massiger Mann mit eisgrauen Augen und militärisch kurzen weißen Haaren war der Einzige im Helikopter, der nicht nach draußen schaute. Er drehte vorsichtig das Porträtfoto in seinen Händen, die mit Altersflecken übersät waren. Darin ähnelten sie dem gelblichen Foto mit seinen zahllosen Stockflecken.
Die Einschüsse im Papier wollten nicht zu dem selbstbewussten und optimistischen Gesichtsausdruck des jungen Mannes passen, der sich in der SS-Uniform der »Leibstandarte Adolf Hitler« hatte fotografieren lassen.
Vor langer, langer Zeit, dachte der Weißhaarige.
Vor einem Menschenleben.
Nein, korrigierte er sich: vor einer Ewigkeit.
Kapitel 1DIE NACHRICHT
FLUGHAFEN FRANZ JOSEF STRAUSS, MÜNCHEN/DEUTSCHLAND
Christopher Weber war Loader von Beruf und lebte in einer Tiefgarage. Ersteres betrachtete er als erklärungsbedürftig, Zweiteres als ein gesellschaftliches No-Go. Das hatte er immer wieder festgestellt, wenn ihn sein jeweiliges Gegenüber im Verlauf einer Unterhaltung befremdet und verständnislos ansah, sich dann umdrehte und die Konversation mit jemand anderem fortsetzte.
Als »Loader« bezeichnete man jene Angestellten eines Airports, die Koffer und Sperrgut rechtzeitig in die richtige Maschine verluden. Und die Tiefgarage? Die war nicht eine Frage der Exklusivität, sondern eher des finanziellen Horizonts, der bei den Angehörigen seines Berufsstandes nahe an der Armutsgrenze lag. An eine Wohnung in München war nicht zu denken, nicht einmal an eine Wohngemeinschaft Marke Sardinenbüchse. Von der täglichen Anreise ganz zu schweigen. Also hatte Weber seinen orangen, rostgefleckten VW-Bulli in der letzten Etage der Flughafen-Tiefgarage abgestellt, ganz hinten an der Wand neben einem alten Chevrolet, der seit Jahr und Tag dort stand und noch nie bewegt worden war, so lange Christopher sich erinnern konnte.
Manchmal hegte er den Verdacht, die Garage war damals um den Chevrolet herumgebaut worden …
Die wahre Attraktion seiner bescheidenen Bleibe aber war eine Steckdose, die Christopher eines Abends bei einem Garagenspaziergang hinter einer Säule gefunden und sofort in Beschlag genommen hatte. Von da an floss illegal gezapfter Strom in Hülle und Fülle. Am Tag der Entdeckung der freien Elektrizität war er sich vorgekommen wie Christoph Columbus, oder besser noch wie ein Goldwäscher, der ein Riesen-Nugget in seiner Waschpfanne entdeckt hatte. Zur Feier des Tages musste eine Tetra-Packung Rotwein unbestimmter Herkunft dran glauben, der ihn in die Bewusstlosigkeit beförderte und am nächsten Morgen für einen ordentlichen Kater sorgte. Trotzdem mussten Tonnen von Gepäck bewegt werden, und Kneifen war keine Option für Christopher.
Seit diesem Tag der Erleuchtung hielt er seinen Wohnort möglichst geheim. Er wollte einerseits keinen Neid bei den Kollegen erwecken, die täglich stundenlange Fahrten ins billigere ländliche Umland auf sich nahmen, und andererseits niemanden auf dumme Ideen bringen. Das Letzte, was er brauchte, war eine Wagenburg von bedürftigen Loadern in seiner Etage, mit denen er womöglich noch seine Steckdose würde teilen müssen …
Christopher Weber war 25 Jahre alt, Waise und Single. Seine Eltern waren bei einem Flugzeugabsturz vor zehn Jahren in den Sümpfen Miamis ums Leben gekommen, und dass Chris Single war, wunderte niemanden. Welches halbwegs vernünftige weibliche Wesen würde schon in eine Tiefgarage ziehen? Außer einem sonnenscheuen Gothic-Mädchen, dem er bei seinem jähen Abschied keine Träne nachweinte, hatte niemals irgendjemand mehr als drei Tage mit ihm in seinem Bus gewohnt. Als sie schwarzberockt, zugekifft und gespornt wie der gestiefelte Kater eines Morgens wieder abgezogen war, hatte Christopher aufgeatmet.
Es war eng geworden zwischen Lenkrad und Heckklappe.
Chris war damals sogar versucht gewesen, Gott zu danken, falls der je in Tiefgaragen blickte. Er hatte aufgeräumt und dann das Ungezieferspray herausgeholt, die letzten Erinnerungen an die schwarzlila Fraktion weggesprüht und zur Feier des Tages eine Flasche billigen Sekt aus dem Supermarkt geleert. Dann war er euphorisch zur Arbeit gegangen und hatte darum gebetet, dass man seine Fahne nicht bis ins nächste Cockpit riecht.
So war es Ende September geworden, und Christopher feierte seinen ersten Jahrestag in der Garage. Diesmal musste ein Prosecco zum Frühstück dran glauben, den ihm ein Kollege geschenkt hatte, und er prostete sich so lange selbst zu, bis er den heftigen Geruch nicht mehr aushielt. Aber da es sein freier Tag war, wanderte er, einen Liegestuhl in der einen und einen neu erschienenen Thriller, den ihm sein Freund in der Flughafen-Buchhandlung geborgt hatte, in der anderen Hand zu einem der Außenparkplätze und legte sich in die Sonne.
Er schlug seine Liege direkt zwischen einem dunkelblauen Porsche 911 Turbo und einem schwarzen BMW Z4 mit cremefarbenem Verdeck auf und machte es sich bequem.
Als er sich gerade die Figur der Blondine ausmalte, der das Cabrio gehören musste, keuchte ein dicker, rotgesichtiger Geschäftsmann heran, klappte das Faltdach zurück und zwängte sich mühsam zwischen Lehne und Lenkrad, nicht ohne Christopher mit einem vernichtenden Seitenblick zu bedenken.
Daraufhin stellte Chris frustriert die mobilerotische Tagträumerei ein, zog sein T-Shirt aus und vertiefte sich in sein Buch.
Sein Job brachte es mit sich, dass jeder Fitnessstudio-Betreiber ihm eine kostenlose Mitgliedschaft angeboten hätte – um zwecks Kundenfangs hinter vorgehaltener Hand sagen zu können: »So können Sie nach vier Monaten intensivem Training auch aussehen.« Aber Christopher trainierte nicht, er arbeitete hart, und er wusste, warum. Sein Fernstudium war fast beendet.
In wenigen Wochen würde er endlich den Betriebswirt absolviert haben, hoffentlich mit Auszeichnung, und dann zum letzten Mal über die Rampe der Tiefgarage fahren – hinaus in ein neues Leben ohne Koffer, Fracht und diese Tiertransporte, die ihn regelmäßig die letzten Nerven kosteten. Mit Schaudern erinnerte sich Chris an den Affen, der vor wenigen Tagen vergnügt über das Rollfeld und die abgestellten Flugzeuge getobt war. Es hatte Stunden gedauert und einige Kilo Bananen gebraucht, um das Tier wieder in seinen Käfig zu locken. Wohlgemerkt erst, nachdem es Christopher in die Hand gebissen hatte. Von den animalischen Duftmarken an allen Ecken und Enden ganz zu schweigen.
Nein, das würde ihm nicht fehlen. Die Frage war nur, ob er sich mit den dunklen Anzugträgern in den klimatisierten Büros anfreunden könnte. Aber auch das würde sich bald zeigen.
Die Spätherbst-Sonne stieg höher in den azurblauen Himmel über München und hatte immer noch einige Kraft. Nach dem völlig verregneten Frühling und einem wechselhaften Sommer, der wieder einmal als Negativrekord in die Hundertjahresstatistik eingegangen war, betrachtete Christopher den Sonnenschein als wahren Segen. So dauerte es nur wenige Minuten, bevor er das Buch zur Seite legte und die Augen schloss. Als sein Freund Martin vom Pizza-Service neben ihm anhielt, war er in der prallen Sonne liegend selig entschlummert.
»Schläfst du dich wieder mal braun?«, rief Martin, nachdem er das Fenster seines kleinen Lieferwagens heruntergekurbelt hatte und sich, eine Pizza-Schachtel in der flachen, ausgestreckten Hand balancierend, hinauslehnte. »Die werden noch mal auf dir einparken.«
»Martin Schwendt, das Pizza-Orakel für die hungrigen Massen«, stöhnte Christopher, ohne die Augen aufzumachen. »Seit wann bist du wieder auf freiem Fuß?«
»Seit ich deine letzte Rechnung bei meinem Chef beglichen habe«, gab Martin ungerührt zurück. »Hier, nimm!«
»Ich kann mir keine Pizza zu Mittag leisten«, wehrte Christopher ab, »Monatsende kommt, und wir schnallen den Gürtel alle enger. Zumindest jene, die noch einen Gürtel haben.«
»Ach was, die ist übrig geblieben von der letzten Lieferung. Nimm und iss!« Martin ließ die Schachtel auf Christophers nackten Bauch fallen. »Und dafür hab ich eine Beratung zum Thema ›Erfolgsaktien mit Performance-Garantie‹ bei dir gut.«
»Du bist eine ganz üble Mischung aus Mutter Teresa und George Soros, weißt du das?«, gab Christopher zurück, klappte die Schachtel auf und warf einen Blick hinein. »Hmm, sieht aus wie Hawaii nach einem Erdbeben.«
»Ist mir zweimal aus der Hand gefallen«, gab Martin zu. »Aber willst du sie malen oder essen?«
Christopher beäugte die Pizzaschachtel von allen Seiten, vor allem die Reifenspuren, die sich auf dem Deckel abzeichneten. »Bist du sicher, dass du nicht drübergefahren bist?«
»Nix is fix«, erwiderte Martin mit verkniffenem Gesicht und streckte die Hand aus. »Gib sie mir zurück, wenn du Angst vor den Folgen hast.«
»Wenn ich es mir recht überlege, so ein wenig Straßenstaub hat noch niemandem geschadet«, grinste Chris, faltete das eingedellte Rund im Meridian und biss genussvoll hinein. »Kalt, aber gut«, stieß er kauend hervor. Ein startender Jumbo-Jet ließ seine Worte im Turbinenlärm untergehen. »Hast du vielleicht auch eine Bierdose, die dir entglitten ist?«
Martins Wagen enthielt ein Sammelsurium von allen möglichen Dingen, die man noch so nebenbei auf die Schnelle bei einer Pizza-Lieferung mitverkaufen konnte. Wein und Bier, natürlich gekühlt, Salate und Grappa, Schokolade und Kekse, die neuesten Zeitungen und für den Ernstfall Präservative mit Erdbeergeschmack.
»Du bist noch nicht ganz wach und bei Trost, mein kleiner Feinspitz«, gab Martin zurück, da quäkte sein Mobiltelefon, und er nahm das Gespräch an. »Ja, Chef … Nein, Chef … Ich komme gleich, Chef …« Schließlich drückte er die Beendigungstaste und verzog missbilligend das Gesicht. »Italienischer Sklaventreiber mit Migrationsvordergrund«, grummelte er und zuckte mit dem Schultern. »Ich muss los, aber das berührt Faulpelze wie dich ja nicht. Mach’s gut!« Er winkte Christopher zu und legte mit quietschenden Reifen einen Kavalierstart hin. Der kleine weiße Lieferwagen schaukelte wie eine kopflastige Fregatte in schwerem Seegang, als Martin im letzten Moment die Ausfahrt aus dem Parkplatz erwischte, auf das Öffnen der Schranke wartete und dann mit aufheulendem Motor im Verkehr verschwand.
Keine zwanzig Minuten später war Christopher satt und zufrieden wieder eingeschlafen. Er wachte auch nicht auf, als eine hochgewachsene, schlanke Frau im Yves-St.-Laurent-Business-Kostüm zwischen seinem Liegestuhl und dem Porsche stehen blieb, ihn etwas ratlos musterte, während sie in ihrer großen Handtasche hektisch nach dem Wagenschlüssel kramte. Endlich, nach einigem Suchen, hatte sie ihn gefunden, schloss ungeduldig den dunkelblauen Sportwagen auf, ließ sich in die heißen Lederpolster fallen und versuchte, den gutaussehenden, halbnackten Mann im Liegestuhl neben ihr geflissentlich zu ignorieren.
Dann startete sie den Sechszylinder, und die Klimaanlage erwachte fauchend zum Leben. Die Fahrerin schnallte sich an, warf dabei dem schlafenden Christopher einen letzten Blick zu und schüttelte ungläubig den Kopf. Mit einem dumpfen Röhren des Motors und dem leisen Knirschen der Reifen auf dem Split rollte der Wagen davon.
Ein landender Jet der bulgarischen Luftlinie, der zu spät aufgesetzt hatte und nun kräftig Gegenschub geben musste, weckte Christopher nach mehr als einer halben Stunde ruhigem Schlafs, erfüllt mit Träumen von Hawaii, Blumenketten und kreisenden Hüften. Er fuhr sich mit seiner Hand über die Augen und streckte sich. Die Sonne war hinter einem der kleinen Bäume verschwunden und warf einen schmalen Schatten genau über seinen Liegestuhl. Als er sich umblickte, sah er, dass ihn seine unmittelbaren automobilen Nachbarn verlassen hatten. Er erinnerte sich an den rotgesichtigen Geschäftsmann des Z4 und verspürte keinerlei Bedauern darüber, den Fahrer des Porsche verschlafen zu haben.
Seine Schicht würde bald beginnen, und so machte sich Chris an den Aufbruch. Als er den Liegestuhl zuklappte, bemerkte er den Abschnitt eines Tickets, das keinen halben Meter von ihm entfernt auf dem heißen Asphalt lag und ihn jungfräulich weiß anstrahlte. Er sah genauer hin. Daneben lag noch etwas. Es war ein deutscher Reisepass, das Foto zeigte eine attraktive junge Frau mit kurzgeschnittenen dunklen Haaren.
Neugierig hob Chris den Pass und den Abschnitt des Tickets auf. Auf der Rückseite waren zwei Gepäckabschnitte festgeklebt. Er las den Namen Mrs. B. Bornheim. Als er weiter in dem Pass blättern wollte, hielten links und rechts von ihm Wagen, und ein kurzes Hupen ließ ihn hochfahren. Ein ungeduldiger VW-Fahrer winkte ihn mit wedelnden Handbewegungen energisch beiseite, um ebenfalls einzuparken. Also steckte Christopher Pass und Ticket ein, nahm sein Buch und den Liegestuhl und klemmte sich die leere Pizza-Schachtel unter den Arm. So hatte er leider keine Hand frei, um dem VW-Fahrer den Stinkfinger zu zeigen.
Aber er dachte ihn sich dafür umso nachdrücklicher.
ARMENVIERTEL LA CRUZ, MEDELLÍN/KOLUMBIEN
Er hatte vor langer Zeit aufgehört zu zählen.
Als die Sonne endlich über den Bergen aufgegangen war, lagen eine anstrengende Nacht und zwei weitere Leichen hinter Alfredo. Das junge Mädchen in der blauen Schuluniform und der weißen Bluse am frühen Morgen hatte ihn nicht kommen hören. Sie starb schnell mit dem Gesicht im roten Staub des ausgedörrten Spielplatzes, über den ihr täglicher Schulweg führte. Die alte Frau war ein ganz anderes Kaliber gewesen. Schwer bepackt mit Taschen und Plastiktüten war sie vom Einkaufen nach Hause gewackelt, hatte ihm misstrauisch entgegengesehen. Als er die Pistole gezogen hatte, gellte ihr Schrei auch schon durch die morgendliche Straße. Alfredo schoss zweimal. Dann ergriff er ihre Tüten und rannte los.
Er fragte nie, weshalb er sie umbringen sollte. Er nahm die Fotos, zählte das dünne Bündel an Pesos, abgegriffene Noten bevorzugt. 250000 Pesos für normale Aufträge, minus dem Stammkundenrabatt, umgerechnet rund 90 Euro.
Menschenleben waren nicht teuer in Medellín.
Die Stadt hatte zu viele davon.
Alfredo war zuverlässig. Er tötete Menschen, gewissenhaft, erfolgreich, und das seit Jahren. Er verspürte keinen Hass, keinen Groll und keine Gewissensbisse.
Er tat es einfach.
Dann ging er, wie immer, in die Kirche La Candelaria im alten Berrío-Park, um zu beten.
Er beichtete nie. Wem sollte er es auch erzählen?
Wenn er das mächtige Gotteshaus aus zweifarbigen Ziegeln wieder verließ, wanderte er stets noch ein paar Minuten ziellos durch den Park, ließ sich mit der Menge treiben und ging in ihr unter. Aus dem gläubigen Sicario wurde wieder ein Teil der Stadt am Fuße der Anden, einer von vielen, ein Mörder unter Nichtsahnenden in der Hauptstadt der Blumen.
So hatte es der hagere, fast kahlrasierte 25-Jährige mit dem Totenkopf-Tattoo über dem gekreuzigten Jesus am schmalen Oberarm mit der Zeit zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht. In seinem Viertel, dem berühmt-berüchtigten Stadtteil Medellíns, der den bezeichnenden Namen »La Cruz« trug und in dem nur jeder Dritte über einen Job verfügte, betrachtete man ihn als reichen Mann, der bald tot sein würde.
Niemand überlebte als Auftragsmörder lange in Kolumbiens Drogenmetropole, egal, für wen er arbeitete, und ganz gleich, wie vorsichtig er auch war. Irgendwann machte jeder einen Fehler, früher oder später, fuhr in das falsche Viertel, lief den falschen Leuten vor den Lauf, kaufte seine Zeitung am falschen Kiosk. Und starb im mörderischen Kugelhagel, der in Medellín an der Tagesordnung war. Ob Paramilitärs, Milicianos oder Guerilla, alle waren bis an die Zähne bewaffnet, skrupellos und brauchten ständig Geld. Und davon gab es genug. Man musste nur die richtigen Leute kennen.
Alfredo hatte es irgendwann aufgegeben, über seinen Job nachzudenken. Dazu war es nach fast zehn Jahren sowieso zu spät.
Im Gegenteil – es war ein Wunder, dass er noch lebte. Aussteigen kam nicht mehr in Frage. Aus einem Job wie seinem stieg man nicht einfach aus. Man starb auf der Straße.
So erwartete Alfredo auch nicht, jemals die dreißig Kerzen auf seiner Geburtstagstorte auszublasen, unter den Klängen von einem misstönenden »Happy birthday«. Bis dahin sind es noch fünf Jahre, dachte er resigniert, eine Ewigkeit, die ich nicht erleben werde.
Dreißig war ein geradezu unerreichbares Alter für einen Sicario in Medellín.
Nachdenklich schaute er hinüber zu Vincente, der geschickt mit raschen Handgriffen das Mittagessen in der fensterlosen, stickigen Küche zubereitete. Teigfladen mit Fleischfülle und Guacamole, davor Broccolicremesuppe.
Der dürre Vincente, sein Mädchen für alles, war größer als er, hatte riesige Segelohren, die er hinter einer dichten schwarzen Mähne zu verstecken suchte. Der Junge hatte fünf Jahre seines Lebens in einem Abwasserrohr verbracht, nachdem ihn seine Mutter mit elf aus der Wohnung geschubst hatte, bevor sie sich an der Gasleitung erhängte, die durch ihre Toilette führte. Sie kam damit der Krankheit zuvor. AIDS war in Kolumbien ein Todesurteil.
Das Rohr, in dem Vincente danach hauste, führte unter der Straße Calle 102 im berüchtigten Elendsviertel Santo Domingo Savio hindurch. Es hatte eine blinde Abzweigung, eine unterirdische Sackgasse, die nie fertiggestellt worden war. Aus diesem dunklen Loch unter der Fahrbahn war der dürre Junge nur ungern hervorgekrochen, lediglich wenn er Hunger hatte und unbedingt Geld brauchte oder wenn es geregnet hatte und sein Zuhause wieder einmal überschwemmt war. Dann lief er durch die Straßen ins Zentrum oder in die reicheren Viertel und suchte sich sein Opfer.
Denn Laufen war seine Passion. Er hatte einen unbändigen Bewegungsdrang.
Vincente stahl oder überfiel Menschen nicht gern, aber er musste es tun, etwa wenn er seit Wochen kein Geld mehr für eine einzige kalte Mahlzeit am Tag hatte und knapp vor dem Verhungern war.
Aber laufen, das hielt ihn am Leben.
Essen musste er, laufen wollte er.
Und es half bei der Flucht vor der Polizei, die meist nicht lange fackelte. Ein toter Dieb war ein guter Dieb in Medellín, und niemand wagte nachzufragen, wenn wieder eine Leiche in einem Armengrab oder bei einer Massenbestattung unter der Erde verschwand.
Alfredo, der Sicario, war beim zehntägigen Blumenfest letzten August durch eine Verkettung unglücklicher Umstände an den spindeldürren Vincente geraten, als er sich nach einem der üblichen Aufträge überraschend einer Polizeikontrolle gegenübersah und in den Straßengraben springen musste. Leise fluchend hatte er gegen den Strom der Abfälle im braunen Brackwasser angekämpft und endlich ein Betonrohr gefunden, das unter der Straße hindurch auf die andere Seite ging. Minuten später hatten er und Vincente nebeneinander in der Scheiße gelegen, im wahrsten Sinn des Wortes, während oben genagelte Stiefel das löchrige Pflaster zum Klingen gebracht hatten.
Als die Gefahr vorüber gewesen war, hatte er den unterernährten, stinkenden Vincente mitgenommen, in seine kleine, aber saubere Wohnung im Viertel La Cruz mit dem farbenfrohen Bild der Mutter Maria über der Kommode und dem ausgeblichenen Foto von Che Guevara an der Klotür. Der Junge war erst nur zögernd über die Schwelle getreten, hatte sich neugierig umgesehen, mit seinen großen schwarzen Augen und einem gierigen Zug um den Mund. Dann war er auf den Rand eines Sessels niedergesunken, immer zum Sprung bereit.
Alfredo hatte einen Teller mit Chili con Carne in der Mikrowelle aufgewärmt und ihn vor Vincente auf den Tisch gestellt, einen Aluminium-Löffel danebengelegt. Augenblicke später war der Teller leer gewesen. Alfredo hatte noch niemals jemanden so schnell schlingen gesehen. Der Junge schien das Essen vertilgen zu wollen, bevor es ihm davonlaufen konnte. Dann tat Vincente etwas Seltsames. Er nahm wortlos Löffel und Teller mit in die Küche, hielt sie unter das fließende Wasser und spülte gründlich.
Alfredo wartete auf einen Dank, aber der kam nicht. Also wandte er sich achselzuckend um, legte die Beretta mit dem zerkratzten Griff auf den Tisch, räumte seine Taschen leer wie immer und ging ins Schlafzimmer, um sich die stinkenden Kleider auszuziehen. Als er wieder ins Wohnzimmer zurückkam, schwebte die Hand des Jungen über der Waffe. Er war völlig in den Anblick des gebläuten Stahls versunken, wollte fasziniert die Beretta berühren, darüber streichen, wie über die Haut einer Frau.
Mit zwei raschen Schritten war Alfredo neben ihm gewesen und hatte mit einer ausholenden Bewegung Vincentes knöchrige Hand auf die Tischplatte genagelt, mit dem Stilett seines Großvaters, das ihn nie verließ.
Der gellende Schrei des Jungen war noch drei Blocks weiter zu hören gewesen.
Doch damit waren die Fronten geklärt, ein für alle Mal. Und der Sicario wusste nun, dass der Junge stumm war, von Geburt an, wie Vincente ihm gestenreich erklärte und lallend auf seine verkümmerte Zunge zeigte.
Alfredo machte ihm daraufhin ein spontanes Angebot, das Vincente für immer aus seiner Höhle unter der Straße holte. Seitdem schlief der hagere Junge zusammengerollt auf dem weichen Sofa im Wohnzimmer mit der fleckigen Zudecke, kochte für seinen neuen Boss, machte Einkäufe und erledigte Botengänge.
Und schwieg. Das ersparte Alfredo, ihm die Zunge herauszuschneiden.
Vincente war ein Naturtalent, wenn es ums Kochen ging. Er hatte Spaß daran, und das sah und schmeckte man. Alfredo beobachtete ihn nach wie vor, während seine Gedanken zu dem Schulmädchen und der Alten zurückkehrten, was ihn selbst am meisten überraschte. Seine Opfer verschwanden sonst immer rasch in einem Nebel aus Vergessen und Verdrängen, Nichtigkeit und Bedeutungslosigkeit. Er dachte nicht mehr an sie, wie er auch das Zählen mit der Zeit eingestellt hatte. Das Gebet in La Candelaria war für ihn stets wie eine Decke gewesen, die er über seine Erinnerungen ausbreitet und glattstreicht.
Doch diesmal war es anders, und der Sicario fragte sich, warum. Das lange dunkle Haar der Kleinen, das ihr Gesicht eingerahmt hatte. Die Trageriemen ihrer Schultasche hatten tief in ihre Schultern geschnitten. Wem hatte sie im Weg gestanden? War es eine Strafaktion gewesen oder eine Warnung?
Alfredo versuchte die Gedanken zu vertreiben und schnüffelte in Richtung Küche. Er sollte Vincente auf eine Kochschule schicken oder zum Küchenchef ausbilden lassen, dachte er. Ehrliche Arbeit, guter Lohn und kein Leben auf der Straße. Vielleicht sogar ein Posten im Ausland, in den USA oder gar Europa. In einer anderen Welt, fern von dem Schmutz der Favelas. Der Junge könnte eine echte Chance haben. In einer großen Küche muss man nicht allzu viel reden, dachte Alfredo, bevor seine Gedanken wieder zum heutigen Morgen zurückkehrten.
Die alte Frau wäre sowieso bald gestorben, sie war aufgedunsen und ihre Beine voller Wasser. Alfredo sah sie vor sich, wie sie auf ihn zuwackelte, rechts und links prall gefüllte Plastiktaschen. Sah ihren alarmierten Blick, das Verstehen in ihren Augen. Hatte sie es geahnt?
Er stand auf, öffnete das Fenster und blickte auf die schmale Straße hinunter, in der kreischende Kinder in Windelhosen unter den wachsamen Augen ihrer Mütter herumkrabbelten oder Fangen spielten. Ein Schwall warmer Luft kam ins Zimmer. Die Stadt des »Ewigen Frühlings«, wie man Medellín nannte, machte ihrem Namen alle Ehre.
Als er sich umdrehte, hielt ihm Vincente grinsend eine eiskalte Bierflasche unter die Nase. Er hatte sich ein Küchentuch um die Taille gebunden, und über seinen nackten Oberkörper rannen Schweißtropfen. Mit ausgestreckten Händen und gespreizten Fingern bedeutete er ihm, dass es in zehn Minuten Essen geben würde.
Das war der Augenblick, in dem die Taube auf dem Fensterbrett landete.
AEROPUERTO INTERNACIONAL »EL DORADO«, BOGOTÁ/KOLUMBIEN
Der klapprige Pick-up zischte und rauchte an der Schranke der Security-Kontrolle zum Frachtterminal, als würde er jeden Moment in die Luft fliegen. Das ganze Auto zitterte, und irgendetwas im Motorraum quietschte erbärmlich. Der Sicherheitsbeamte hob seinen Blick von den abgegriffenen Papieren und schaute den Fahrer strafend an.
»Hast du eine Ziege eingesperrt in dieser fahrende Ruine?«, rief der dicke Uniformierte anklagend und machte eine wegwerfende Handbewegung, die das gesamte rostige Elend vor ihm mit einer einzigen Geste zu Schrott diskreditierte. »Du solltest eigentlich gar nicht durch diese Kontrolle kommen, weil der Wagen allein bereits ein Sicherheitsrisiko darstellt.«
Es war ein Ritual, das sich nun seit mehr als zwanzig Jahren jeden Tag aufs Neue wiederholte. Wagen und Fahrer waren gemeinsam älter geworden, mit unterschiedlichen Resultaten. Die grauen Schläfen standen Georg Gruber, Sohn deutscher Einwanderer, ausgesprochen gut. Der Rost zerfraß derweil seinen Wagen zu einem rollenden Schweizer Käse. Die Speditionsagentur, die Gruber vor Jahren von seinem Vater übernommen hatte, erlaubte es ihm gerade noch zu überleben, aber nicht, ein halbes Vermögen in einen neuen Pick-up zu investieren. Also musste es der alte noch einige Jährchen tun. Auch wenn er quietschte und jaulte.
»Du bist nur neidisch, weil dein neuer Golf überhaupt kein Geräusch mehr macht, Amigo«, erwiderte Gruber gut gelaunt. »Und gib mir die Papiere wieder, du kannst sowieso nicht lesen.«
»Mach weiter so, und ich denke über eine Leibesvisitation nach«, grummelte der Uniformierte grinsend und klappte die Mappe mit den Papieren und dem Ausweis Grubers zu.
»Ich bekomme gleich Angst«, erwiderte der Fahrer leichthin und streckte fordernd die Hand aus. »Transportgut – keines, Wagen – noch immer der alte, Chauffeur – hoffentlich bald in Frühpension. Also gib mir die Mappe zurück und halte mich nicht auf, meine Sekretärinnen warten auf mich.«
Mit aufjaulendem Motor bog der ehemals rote Pick-up wenige Minuten später auf die Verbindungsstraße entlang des internationalen Luftfrachtgeländes ein. Kolumbiens größter Flughafen im Nordwesten der Hauptstadt konzentrierte zwei Drittel des Flugaufkommens des Landes auf sich. Fast alle Waren und die meisten Passagiere mit der Destination Nordamerika, Europa oder Asien verließen oder erreichten Kolumbien über »El Dorado«.
Die IFAG, die International Freight Agency Gruber, lag im obersten Stockwerk des Blocks B der Frachtgebäude, drei kleine Räume unter dem Flachdach, was angesichts des Klimas in der 2640 Meter hoch gelegenen Stadt geradezu ideal war. Doch in dem langgestreckten, neugebauten Gebäude hatte der Architekt eine überdimensionierte Heizung eingeplant, die nun täglich auf niedrigster Stufe lief und trotzdem alle Räume hoffnungslos überheizte. So war es nur durch die ständig offenen Fenster möglich, ein halbwegs erträgliches Raumklima zu schaffen. Es war also kein Wunder, dass Gruber aus allen Poren schwitzte, nachdem er die vier Stockwerke zu Fuß hinaufgelaufen war. In allen Etagen hing am Lift das altbekannte Schild »Out of Order«.
»Buenos días!«, schnaufte er, als er schwungvoll die Tür zur Agency öffnete.
»Sie sind spät dran«, gab Margherita, die ältere der beiden Frauen, missbilligend zurück. Sie blickte nicht einmal von ihrer Arbeit auf.
»Viel zu spät, wieder einmal …«, kam ihr Rosina zu Hilfe, die demonstrativ auf die Uhr schaute. »Die ersten Sendungen sind raus, und wir haben jede Menge neue Anfragen reinbekommen. Die stapeln sich auf Ihrem Schreibtisch. Wenn Ihr Vater noch …«, setzte sie an, aber Georg unterbrach sie.
»… leben würde, hätte er Sie beide bereits längst in den Ruhestand entlassen und langbeinige, gutaussehende chicas mit hervorstechenden Merkmalen eingestellt.« Gruber senior war ein stadtbekannter Frauenheld Bogotás gewesen und an einem Herzschlag im berühmtesten Bordell der Stadt gestorben. Seinem Sarg war ein überdurchschnittlich hoher Anteil an jungen weiblichen Wesen gefolgt, ihre rotgeweinten Augen hinter großen Taschentüchern versteckend und dabei lautstark schluchzend.
Der giftige Blick, der aus Rosinas Richtung kam, hätte jede Klapperschlange eines Schlangenbeschwörers auf der Stelle in ihren Korb zurückgetrieben. »Was würde er bloß ohne uns machen?«, fragte sie dann kopfschüttelnd ihre Schwester.
»War das jetzt eine rein rhetorische Frage, oder wollen Sie das tatsächlich wissen?«, erkundigte sich Georg wie beiläufig und schnüffelte an einer Kanne mit einer undefinierbaren Flüssigkeit. »War das Kaffee?«
»Ja, drei Tage alt und in dieser Hitze reduziert auf ein Extrakt«, murmelte Margherita ungerührt. »Kaufen Sie endlich ein Kilo Kaffeebohnen, und ich brühe frischen.«
»Die Firma muss sparen, die Zeiten sind schlecht, die Heizkosten hoch, und Sie beide verdienen zu viel. Da bleibt nichts mehr für Vergnügungen übrig.« Georg Gruber stellte die Kanne entschieden nieder und verschwand rasch in seinem Büro, verfolgt von den strafenden Blicken der beiden Schwestern.
Der kleine Raum, sparsam eingerichtet mit einem antiken, mächtigen Safe, einem überladenen Schreibtisch und dem dazugehörenden plastiküberzogenen Chefsessel, war auf Backofentemperatur aufgeheizt. Georg wischte mit einer Armbewegung den Stapel an Anfragen zur Seite, stellte sein Laptop auf die Tischplatte und riss die Fenster auf. Die Luft, die hereinströmte, roch nach Kerosin. Auf der Landebahn von »El Dorado« startete gerade mit donnernden Triebwerken ein Jumbo der Lufthansa nach Frankfurt/Main und ließ die Scheiben zittern. Das große, gerahmte Schwarzweißfoto seines Vaters an der Wand über dem Safe, auf dem er wie ein General der Südstaaten-Armee auf Heimaturlaub aussah, vibrierte leise klirrend. Der Rahmen ist auch nicht mehr der jüngste, dachte Georg.
Du wirst bald fallen, Vater.
Er nickte Gruber senior zu und klappte seufzend seinen Laptop auf, um das Betriebssystem zu starten. Während er wartete, zog er den Stapel mit den Anfragen näher zu sich und begann ihn, entgegen seiner ganz persönlichen »Chaos-Theorie«, systematisch von oben abzutragen. Der Lärm der Turbinen verlor sich in der Ferne, und Georg stellte fest, dass er Heimweh hatte nach dem Kontinent, von dem ihm sein Vater immer so viel erzählt hatte. Er lehnte sich aus dem Fenster und blickte gedankenverloren der immer kleiner werdenden Boeing nach, die in einer langgezogenen Kurve aus langsam verklingenden Schallwellen lag.
Das Telefon holte ihn zurück in die Wirklichkeit. Etwas gedankenverloren drückte Georg auf den Lautsprecherknopf und nahm das Gespräch an. Die Stimme seiner Frau füllte das kleine Büro. Er hörte bereits an den ersten Worten, dass sie verwirrt war, was äußerst selten vorkam.
»Entschuldige die Störung, aber hier ist etwas Seltsames passiert …«, meinte sie zögernd.
»Wo ist etwas Seltsames passiert?«, fragte er nach und runzelte die Stirn. »Bist du noch zu Hause?«
Die Grubers wohnten in einem alten weißen Haus im Kolonialstil am Fuße des Montserrat, des berühmten Ausflugsberges der Acht-Millionen-Stadt Bogotá. Sein Vater hatte es nach seiner Ankunft in Kolumbien gekauft, renoviert und die riesige Dachwohnung mit dem atemberaubenden Mahagoni-Sternparkett als Familiendomizil behalten. Alle anderen Wohnungen waren nach und nach verkauft worden, an Ärzte und Rechtsanwälte, Mitglieder der deutschen Kolonie in Bogotá. Mit dem Geld hatte sein Vater schließlich die Agentur gegründet und eine Smaragdmine gekauft, die kurz danach durch einen Wassereinbruch überflutet wurde. Die Stollen stürzten ein, und Gruber senior schrieb das Geld für immer ab. Aber es hatte ihm nie wirklich viel bedeutet. Solange er genug zum Leben hatte, war er zufrieden.
Im Gegensatz zu der Mine gab es die Fracht-Agentur noch immer. Georg fragte sich manchmal, ob er es nicht lieber andersherum gehabt hätte – die Agentur wäre abgesoffen, und die Smaragdmine hätte sich als ergiebig herausgestellt …
Die Stimme seiner Frau riss ihn aus seinen Gedanken. »Ja, ich bin noch zu Hause und habe seit rund zehn Minuten Besuch. Auf dem Schrank im Salon sitzt eine graue Taube und lässt sich nicht verscheuchen.«
Georg hörte im Hintergrund seine beiden Töchter rufen, die heute schulfrei hatten und eigentlich mit ihrer Mutter einkaufen gehen wollten. Er runzelte die Stirn. »Wie ist sie dahin gekommen? Tauben fliegen nicht so mir nichts, dir nichts in eine Wohnung und richten sich da häuslich ein.«
»Die Fenster der Veranda standen offen, und ich vermute, dass sie so in unsere Wohnung gelangt ist. Als ich in den Salon kam, um meine Tasche zu holen, saß sie bereits da, gurrte und schaute mich an.«
»Dann nimm einen Besen, und nichts wie raus mit ihr«, murmelte er und griff nach der nächsten Anfrage auf dem Stapel. Gefahrgut nach Chile. Auch das noch! »Was ist daran so schwierig? Mach alle Fenster auf, und husch, husch – ab ins Grüne mit ihr. Wenn sie Glück hat, erreicht sie die nächste Gondel«, scherzte er. Direkt neben dem Garten der Grubers schwebte die Seilbahn vorbei, deren rote Gondeln unermüdlich Besucher auf den Montserrat brachten.
»Da ist noch etwas …« Ihre Stimme brach ab und Georg horchte auf. »Sie hat einen Gegenstand an ihrem Fuß befestigt …«
»Also eine Brieftaube«, unterbrach sie Georg, »die sich verflogen hat. Kommt selten vor, aber es passiert. Vielleicht ist sie wertvoll. Pass also besser auf, wenn du sie hinausscheuchst.«
Seine Frau schwieg, und Georg fühlte, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war mit der Taube in seinem Wohnzimmer.
»Sie hat keine zusammengerollte Nachricht an ihrem Fuß …« Seine Frau stockte. »Ich bin auf einen Sessel gestiegen, um näher an sie ranzukommen, und da hab ich es gesehen.«
»Was gesehen?«, warf er ein und unterbrach das Tippen des Angebots.
»Den Ring.«
»Das ist eine Brieftaube, also ist es normal, dass sie einen Ring trägt.« Georg seufzte. »Wirf sie endlich raus, ich muss noch mindestens fünfzig Angebote ausarbeiten, und die Sekretariatsguerilla da draußen zählt die Minuten, bis ich damit fertig bin.«
»Es ist ein Totenkopfring mit gekreuzten Knochen«, flüsterte seine Frau kaum hörbar.
Georg wurde mit einem Mal kalt. Er ließ das Blatt mit der Anfrage sinken und schaute ins Leere, seine Gedanken rasten. Mit fahrigen Bewegungen begann er, Papiere auf dem Schreibtisch hin und her zu schieben.
»Lass die Taube, wo sie ist«, murmelte er, »rühr sie nicht an. Ich kümmere mich darum, wenn ich nach Hause komme. Ich muss vorher nur noch etwas erledigen. Dann mach ich mich auf den Weg.«
»Was ist mit diesem Ring, Georg? Was bedeutet das? Er sieht so … so bedrohlich aus, so echt. Ich habe Angst«, meinte seine Frau leise und schluckte.
Georg war versucht zu sagen: »Ich noch viel mehr«, aber er schwieg. Vier Militärjets flogen in Formation ganz tief über den Flughafen, bevor sie die Nachbrenner zündeten und fast senkrecht im tiefblauen Himmel über Bogotá verschwanden.
»Ich bin in spätestens einer Stunde da«, sagte er schließlich und trennte rasch das Gespräch. Dann stand er auf und spürte, wie seine Knie nachzugeben drohten. Er schlug voller Zorn mit der Faust auf den Tisch, bevor er die oberste Lade aufzog und einen großen Schlüssel herausnahm. Anschließend schlurfte er mit hängenden Schultern zu dem alten, reich verzierten Safe, der wie ein Relikt aus früheren Tagen in einer Ecke des kleinen Raums kauerte. Das Bild seines Vaters hing direkt darüber, und Georg schaute ihm in die Augen.
»Du hast genau gewusst, dass es eines Tages geschehen würde. Es war nur die Frage, wann, nicht wahr? Der Teufel soll dich holen, alter Mann, und den verdammten Vogel gleich dazu!« Seine Hand mit dem großen Schlüssel zitterte, als er den Safe aufschloss, das geriffelte Rad drehte und die Kombination einstellte. Dann zog er am Handgriff, und die schwere Tür schwang mit einem hellen Quietschen auf. »Du hast gelogen, Vater. Hast du nicht immer wiederholt, dass es wahrscheinlich nie so weit kommen würde? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, hast du gesagt, der Brief ist nur für den Fall der Fälle. Eins zu einer Million, dass du ihn jemals in deinem Leben öffnen musst.« Georg murmelte vor sich hin, während er Akten und Ordner aus dem Safe räumte. »Mein Leben! Ha! Was wusstest du schon von meinem Leben? Dein ganzes Leben war eine Lüge, ein transatlantisches Fiasko. Ich hätte gute Lust, dem Vogel den Hals umzudrehen, den Ring in der Toilette runterzuspülen und deinen Brief zu verbrennen.«
Als er endlich das braune Kuvert an der Rückwand des Safes erreicht hatte, türmten sich Stapel von Akten um ihn herum auf dem Boden. Er setzte sich zwischen die Türme aus Papier auf das abgetretene Linoleum und drehte behutsam den Brief in seinen Händen. So lange er sich erinnern konnte, hatte er im untersten Fach dieses Safes gelegen. Einmal, Georg war noch ganz klein gewesen, kaum älter als fünf oder sechs, hatte der Panzerschrank im alten Büro seines Vaters offen gestanden. Damals war ihm der Safe riesig erschienen, eine Eiger-Nordwand aus Stahl, und er hatte neugierig in die Fächer geschaut. Ganz unten hatten, neben dünnen Bündeln von Pesos und Dollar, der Schmuck seiner Mutter, ein paar Orden und Medaillen, eine alte Pistole und ein Stapel Briefe gelegen. Und dann derBrief, mit der charakteristischen, gestochen scharfen Handschrift seines Vaters, die Georg damals noch nicht lesen konnte.
Jetzt tanzten die Buchstaben vor seinen Augen. Die Tinte war in den langen Jahren verblasst, aber Georg kannte die Anschrift inzwischen auswendig: »An meinen Sohn Georg Gruber, persönlich und verbindlich, irgendwo auf dieser Erde.«
»Der Schlag soll dich treffen, alter Mann«, murmelte Georg. Dann fiel ihm ein, dass genau das bereits eingetreten war, und er kam sich schlecht vor. Der Brief trug auf der Rückseite fünf Siegel, in deren blutroten Lack die Initialen FG seines Vaters gedrückt waren. Kunstvoll verschnörkelte Buchstaben, umringt von seinem Wahlspruch Ad Astra – zu den Sternen.
»Nach ihnen hast du gegriffen, aber du hast sie nie erreicht, Vater«, flüsterte Georg und begann, ein Siegel nach dem anderen zu erbrechen.
FLUGHAFEN FRANZ JOSEF STRAUSS, MÜNCHEN/DEUTSCHLAND
Christopher Webers Schicht war früher zu Ende gegangen als geplant. Nachdem drei Flüge nach Griechenland ausgefallen waren, weil dort die Fluglotsen streikten, hatte man Chris nach Hause geschickt, um dem Flughafen Personalstunden und damit Kosten zu ersparen. So schälte er sich drei Stunden eher als geplant aus dem verschwitzten Overall mit dem blauen M, zog seine geliebten Jeans und einen ausgeleierten Pullover an, der ihn bereits seit einigen Jahren begleitete und dem man langsam die Kilometer ansah, genauso wie dem orangenen Bulli in der Tiefgarage.
Der Himmel über München war dunkel geworden, und der aufgeheizte Beton des Flughafens strahlte nach und nach die Hitze des Tages ab. Von den Alpen her wehte ein kühler Wind herüber. Er trug den Geruch von gemähten Bergwiesen, den Duft des Südens und das Flüstern italienischer Versprechungen mit sich nordwärts.
Christopher stand noch einige Minuten am Rand des Flugfelds, die Hände tief in den Taschen vergraben, den Kopf in den Nacken gelegt, die Nase im Wind. Im Westen war noch ein Hauch von Blau zu sehen, der sich langsam hinter den Horizont zurückzog.
Es gab Tage, an denen vermisste er seine Eltern mehr als alles andere auf der Welt.