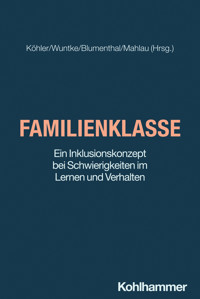
Familienklasse E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die Familienklasse ist ein präventives Inklusionskonzept im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Verhalten und Lernens, das in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dieser Band präsentiert die Grundlagen sowie die praktische Umsetzung des Konzepts und bietet einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand. Enthalten sind Berichte zahlreicher PraktikerInnen, die den Ansatz der Multifamilienarbeit mit großem Engagement und vielfältiger Erfahrung umsetzen. Das Buch beleuchtet die Implementierungsprozesse der Familienklassen im schulischen Kontext und gewährt durch umfassende Interviews Einblicke in die konkrete Durchführung, die Möglichkeiten und die Herausforderungen dieses Konzepts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
1 Einleitung
2 Grundlagen von Multifamiliensettings
2.1 Besondere Schüler*innen
Ursachen herausfordernden Verhaltens
Diagnosen herausfordernden Verhaltens
2.2 Entstehungsgeschichte von Multifamiliensettings und Familienklassen
2.3 Ziele, Prinzipien, Methoden und Strukturen der Familienklasse
Ziele der Familienklasse
Prinzipien der Familienklasse
Methoden der Familienklasse
Strukturen der Familienklasse
3 Die Umsetzung der Familienklasse in Deutschland
3.1 Verbreitung in Deutschland
3.2 Die Umsetzung der Familienklasse in Hamburg
3.3 Familienklassenzimmer – Das Dresdner Modell für Grundschulen
Inhaltliche Arbeit im Familienklassenzimmer – Besonderheiten des Dresdner Modells
Fachliche Qualitätsstandards, Vernetzung und Finanzierung
Herausforderungen und Stolpersteine
Zusammenfassung
3.4 Die Entwicklung der Familienklassen in Hessen seit 2010
Die Grundidee
Die Umsetzung
Die Rahmenbedingungen
Wie sieht ein Schultag in der Familienklasse aus?
Finanzierung
Ergebnisse zur Wirksamkeit
Fazit
3.5 FiSch – Familie in Schule
©
– Multifamiliencoaching in der Schule aus Schleswig-Holstein
Die Ausgangslage: Überforderte Eltern – überforderte Schulen
FiSch – Familie in Schule
Veränderte Expertenrolle: Multifamiliencoaching
Ablauf eines »FiSch-Tages«
Fokus Schule und Transfer
Lehrer*innen und Eltern als Erziehungspartner*innen
Wertschätzende Grundhaltung
Weiterbildung, Finanzierung und Vernetzung in der Region
Hürden und Grenzen
Scham und Beschämung
Fazit
3.6 Familienklassenzimmer in Mecklenburg-Vorpommern
Entstehung der Familienklassenzimmer in Mecklenburg-Vorpommern
Gelingensbedingungen für den Aufbau von Familienklassenzimmern im Regelschulbereich
Episoden aus den Familienklassenzimmern
3.7 Modelle der Familienschule in Deutschland – Freiwilligkeit vs. Zwangskontext im städtischen und ländlichen Raum
Einleitung
Kinder in der Krise – Beginn der Familienschule in Berlin
Sozialraum Cuxhaven
Von der Familienklasse zur Familienschule im Landkreis Cuxhaven
Rahmenbedingungen und Zugang zur Familienschule Berlin
Rahmenbedingungen und Zugang zu den Familienschulen im Landkreis Cuxhaven
Welche besonderen Methoden kann man in der Familienschule nutzen?
Chancen und Risiken in der Arbeit im Zwangskontext – Berlin
Chancen und Risiken der »Freiwilligkeit« – Landkreis Cuxhaven
Fazit
4 Stimmen aus der Praxis
4.1 »Hoffnung auf Akzeptanz systemischer Grundhaltung«
4.2 »Die Herkunft tritt schnell in den Hintergrund«
4.3 »In den Rollen klar bleiben«
4.4 »Eltern erleben das Bemühen ihrer Kinder«
4.5 »Das Gefühl von Stabilität«
5 Wissenschaftliche Untersuchungen
5.1 Multifamilienarbeit im klinischen Bereich
5.2 Multifamilienarbeit im pädagogischen Bereich
5.3 Ausblicke für Wissenschaft und Forschung
6 Resümee
Empfehlungen für die nachhaltige Etablierung von Multifamilienarbeit im Bildungsbereich
Familienklassencoach*innen
Familienklasse
Anbindung an die Schule/Stammklasse
Schuladministration
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Die Herausgebenden
Joachim Köhler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sonderpädagogik und Inklusion an der Universität Greifswald, Trainer für Multifamilienarbeit, vormals Sozialarbeiter, Forschungsschwerpunkt Familienklassenzimmer in Mecklenburg-Vorpommern.
Dr. Lena Varuna Wuntke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sonderpädagogik und Inklusion an der Universität Greifswald, vormals Sekundar- und Grundschullehrerin für Deutsch, Englisch und Deutsch als Fremdsprache, Forschungsschwerpunkt Konzeption und Evaluation inklusiven Unterrichts im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung.
Dr. Yvonne Blumenthal ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Studienfächer Grundschulpädagogik und Sachunterricht am Institut für Grundschulpädagogik der Universität Rostock, vormals sonderpädagogische Lehrkraft, Forschungsschwerpunkte u. a. Soziale Integration in der Schule – Diagnostik, Prävention und Intervention.
Prof. Dr. Kathrin Mahlau ist Professorin am Lehrstuhl Erziehungswissenschaft/Sonderpädagogik und Inklusion in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und sozial-emotionale Entwicklung an der Universität Greifswald, vormals Sonderpädagogin, Forschungsschwerpunkt.
Joachim Köhler,Lena Varuna Wuntke,Yvonne Blumenthal,Kathrin Mahlau (Hrsg.)
Familienklasse
Ein Inklusionskonzept bei Schwierigkeiten im Lernen und Verhalten
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-043642-8
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043643-5epub: ISBN 978-3-17-043644-2
1 Einleitung
Wertschätzung und Anerkennung von Diversität nimmt in der Pädagogik einen immer höheren Stellenwert ein – und man darf sagen: zum Glück! Mit dem Gedanken der Inklusion rückt im Bereich der Schule der Bedarf nach Konzepten in den Vordergrund, die den verschiedenen Voraussetzungen und der Vielfalt von Schüler*innen gerecht werden. Da individuelle Förderung und ganzheitliche Bildung zunehmend an Relevanz gewinnen, präsentiert sich die Familienklasse hierbei als ein herausragendes Modell zu deren Umsetzung. Es gestaltet nicht nur die Lernreise der teilnehmenden Schüler*innen, sondern beeinflusst auch nachhaltig das soziale Gefüge ihrer Familien. Das Konzept, geprägt von einem präventiven Ansatz zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen, eröffnet eine Brücke zu inklusiver Bildung, die über bloße schulische Leistungen hinausgeht.
Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass Bildung und Erziehung nicht nur in den Klassenzimmern entstehen, sondern auch durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Lehrer*innen, Schüler*innen und ihren Familien gestaltet wird. Die Familienklasse repräsentiert nicht nur eine Veränderung im Bildungswesen, sondern eine neue Haltung, die die Grundlagen der Inklusion stärkt und einen neuen Maßstab für eine ganzheitliche und integrative Bildung setzt.
Ausgangspunkt der Familienklasse ist es, »besonderen« Schüler*innen (▸ Kap. 2.1) Unterstützung und Förderung zukommen zu lassen. Dies geschieht durch den Einbezug der Familien in den Prozess, wodurch der Fokus nicht mehr nur klassisch auf den Schüler*innen liegt, sondern das Umfeld in den Mittelpunkt rückt. Dies meint letztendlich nicht nur die Familie, sondern auch die Lehrkräfte und die Schule als Ganzes. In Deutschland wird das Konzept mittlerweile seit über zehn Jahren in verschiedenen Bundesländern angewendet und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Dieser große Erfolg zeigt, dass Pädagog*innen bundesweit nicht nur große Hoffnung in die Familienklasse setzen, sondern darüber hinaus eine Ergänzung und Veränderung im Schulwesen im Sinne der bereits ein- und durchgeführten Inklusion als notwendig erachten und bereit sind, mit viel Energie, Kreativität und vor allem viel Einsatzbereitschaft diese Änderung anzugehen.
Hierbei ist der systemische Gedanke zentral: Es sind nicht nur Lehrer*innen und Schüler*innen, die miteinander interagieren, sondern es muss das jeweilige Umfeld mitgedacht werden. Die Schüler*innen sind als Kinder grundlegend eingebunden in ihren familiären Kontext und gerade in jungen Jahren sind die Eltern ihre vorrangigen Bezugspersonen. Häufig tritt herausforderndes Verhalten nicht nur in der Schule, sondern auch im Elternhaus auf und stellt alle Beteiligten vor die schwierige Aufgabe, damit umzugehen. Mit dem Konzept der Familienklasse wird es ermöglicht, dass Kinder, Eltern und Lehrer*innen gemeinsam eine Lösung für diese Aufgabe finden. Damit dies gelingt, werden Kinder zusammen mit jeweils einem Familienmitglied mit anderen Kindern und deren Familien, die ähnliche Problemlagen aufweisen, in Kontakt gebracht. Häufig können Familien, die Schwierigkeiten in der Erziehung ihrer Kinder erleben, andere Familien beratend unterstützen. Die damit einhergehende Erfahrung der Selbstwirksamkeit, aber auch der Solidarität untereinander schafft ein neues Selbstbewusstsein sowohl auf der Seite der Kinder als auch der der Eltern. Für die Coach*innen innerhalb der Familienklassen, die selbst Pädagog*innen sind, bedeutet dies, die klassischen, oft hierarchisch geprägten Rollen aufzugeben und sich auf Augenhöhe mit allen Beteiligten zu begeben. Für die Erziehung und das Wohlbefinden des Kindes sind nicht sie die Expert*innen, sondern die Eltern. Eine Haltung, die den wechselseitigen Respekt auf Seiten aller Beteiligten fördert.
Im vorliegenden Buch wird ein Überblick über die Umsetzung der Familienklasse in Deutschland gegeben. Die Familienklasse ist ein Konzept, dass nicht nur unter verschiedenen Namen umgesetzt wird, sondern auch unterschiedliche Ausrichtungen erfahren hat. Daher wird der Versuch unternommen, einen umfassenden Überblick über die Konzepte in Deutschland und ihre jeweiligen Realisierungen, aber auch über Stolpersteine und Hürden zu geben, die eine Implementierung an den Schulen mit sich bringen kann. Um eine realistische und lebendige Perspektive zu gewährleisten, kommen maßgeblich Praktiker*innen zu Wort, die die vielen Konzepte, die unter dem großen Namen »Familienklasse« zusammengefasst werden können, umsetzen. Das Buch richtet sich somit an alle Interessierten sowie aktiven Akteur*innen, die sich derzeit schon mit dem Konzept der Familienklasse befassen. Es soll als Inspirationsquelle und Nachschlagewerk dienen und Lust darauf machen, Neues in der Familienklasse auszuprobieren oder das Konzept selbst zur Anwendung zu bringen.
Im Eröffnungskapitel erfolgt eine umfassende Einführung in das Konzept der Familienklasse (▸ Kap. 2). Dabei werden zunächst Schüler*innen betrachtet, für die die Familienklasse in besonderem Maße konzipiert wurde. Anschließend wird ein Überblick über die Entwicklungsphasen dieses Konzepts gegeben. Zum Abschluss werden die zentralen Prinzipien, Strukturen und Methoden beleuchtet, nach denen das Konzept in der Praxis umgesetzt wird.
Das folgende Kapitel führt umfänglich in die einzelnen Konzepte und deren Umsetzung in Deutschland ein (▸ Kap. 3). Nico Ernst, Leiter der Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen und berufliche Teilhabe in Mecklenburg-Vorpommern e. V., befasst sich mit einer Übersicht zur Familienklasse und ihren jeweiligen Konzeptionen in ganz Deutschland. Für den In Via Hamburg e. V. beschreibt Kristina Gauding, wie die Familienklasse in Hamburg Anwendung findet. Maud Rix, Antje Gehrke, Friederike Martin, Lars Junghahn und Lisa Schürmann berichten von der Kinder- und Jugendhilfe Dresden drefugio und dem dort praktizierten Modell des Familienklassenzimmers. Christian Scharfe, Leiter des familienorientierten Bereichs des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes in Wetzlar, beschreibt die Umsetzung der Familienklasse in Hessen. Das Konzept »Familie in Schule – FiSch« wird vorgestellt von Thomas Pletsch und Ulrike Behme-Matthiessen, systemische Ausbilder*innen und Leiter*innen des Instituts für Weiterbildung und Entwicklung in Schleswig (IWES). Selma-Maria Behrndt und Bärbel Brandenburg, die maßgeblich am Aufbau und der Koordination in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt waren und sind, stellen das dortige Familienklassenzimmer vor. Die Familienschule, eine besondere Form der Familienklasse, da sie auch in Zwangskontexten angewandt wird, besprechen Nicole Schui und Sylvia Beuth, beide langjährige Coach*innen in diesem Format.
Erfahrungen und Einschätzungen aus der Praxis kommen im vierten Kapitel zur Geltung (▸ Kap. 4). Hier berichten Praktiker*innen von ihren Erlebnissen innerhalb des Formats, von Herausforderungen und Möglichkeiten zu deren Überwindung sowie von den schönen und erfolgreichen Momenten der Arbeit in der Familienklasse an der Schule. Die zu diesem Zweck geführten Interviews geben die zentralen Eindrücke der Interviewpartner*innen wieder. Zu Beginn berichten Selma-Maria Behrndt und Bärbel Brandenburg über die Entstehung und Implementierung des Familienklassenzimmers in Mecklenburg-Vorpommern. Im Anschluss führt Carina Bründlinger, die Leiterin des Berliner Zentrums für Präsenz und Kompetenz in Beziehungen, ihre Erfahrungen mit »Familie in Schule« im Raum Berlin aus. Ulrike Behme-Matthiessen und Thomas Pletsch vom IWES stellen die Besonderheiten der Ausbildung von FiSch-Coach*innen und der Anwendung des Konzepts in Schleswig-Holstein dar. Miriam Staak, langjährige Lehrerin in Mecklenburg-Vorpommern und Coach für das Familienklassenzimmer, erzählt uns von ihren Erfahrungen mit dem System Schule und wie das Familienklassenzimmer sich darauf auswirkt. Die Multifamilientrainer*innen Manuela Wallenstein und Christian Hahlgans vom Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar berichten abschließend von der Familienklasse in Hessen und den dort zur Anwendung kommenden Methoden und den Zielen, die ihrer Arbeit zugrunde liegen.
Über den aktuellen Forschungsstand wird im fünften Kapitel berichtet (▸ Kap. 5). Es wird darin, nach einem kurzen Abstecher in den klinischen Bereich, eine Auswahl der bisher relevanten Studien zur Familienklasse sowohl in Deutschland als auch international dargeboten. Ein Ausblick auf derzeit geplante Forschungsprojekte beschließt den aktuellen Forschungsstand.
Das abschließende Kapitel bietet ein Resümee (▸ Kap. 6). Hier wird zusammengefasst, welche Hilfestellungen es für die Arbeit mit dem Konzept der Familienklasse gibt und wie diese sinnvoll in der schulischen Praxis umgesetzt werden können.
Die einzelnen Kapitel können unabhängig voneinander gelesen werden. Wir wünschen den Leser*innen viele neue und spannende Einblicke in das Konzept der Familienklasse.
2 Grundlagen von Multifamiliensettings
Das Prinzip der Gruppenarbeit mit Patient*innen, um diese zu therapieren, ist innerhalb des klinischen Kontextes schon länger verbreitet. Die Patient*innen lernen zum einen, dass es noch andere Menschen mit ähnlichen Problemlagen gibt, und treten zum anderen in die Funktion der wechselseitigen Beratung. Dieses klassische Gruppensetting wurde im systemischen Sinne erweitert, indem nicht mehr nur andere Patient*innen, sondern die Familien in den therapeutischen Prozess einbezogen wurden. Der leitende Gedanke war hierbei, die unmittelbaren Bezugspersonen mit einzubinden und somit eine Genesung zu unterstützen. Das Konzept der Familienklasse setzt sich durch seine schulische Ausrichtung vom klinischen Kontext ab, indem es auf eine eigene Zielgruppe ausgerichtet ist und eigene Zielstellungen und Methoden entwickelt. Im Folgenden werden die Grundlagen des Multifamiliensettings und wie diese an teilnehmenden Schulen eingesetzt werden vorgestellt, um einen Überblick über die Ausrichtung auf besondere Schüler*innen zu geben, die Geschichte der Familienklasse einzuordnen und die Prinzipien und Strukturen darzulegen, nach welchen die Familienklassen funktionieren und die in allen Variationen der jeweiligen Konzeptionen wiederzufinden sind.
2.1 Besondere Schüler*innen
Kathrin Mahlau
Schüler*innen, die in eine Familienklasse aufgenommen werden, zeigen im regulären Schulsetting sehr herausfordernde Verhaltensweisen im Lern- und Sozialverhalten. Nicht selten sind es Kinder aus Familien mit problematischen sozioökonomischen Rahmenbedingungen. Symptome und Merkmale, wie aggressives Verhalten, Hyperaktivität, Ängste, Unstrukturiertheit, schlechte Lernleistungen, fehlende Lernmotivation bis hin zu Schulabstinenz, sind kennzeichnend für Schüler*innen einer Familienklasse.
Ursachen herausfordernden Verhaltens
Die Ursachen problematischen Verhaltens sind komplex und multikausal. Die psychologische Forschung unterscheidet individuelle Faktoren, die biologisch oder auch psychisch sein können, und soziale Faktoren. Je nachdem, welche Faktoren auf das Kind und sein Verhalten einwirken, können sich psychische Auffälligkeiten zeigen, aber auch unterdrückt werden.
Herausforderndes Verhalten begünstigende biologische Faktoren sind niedrige Cortisolwerte, eine reduzierte Serotoninaktivität, Belastungen während der Schwangerschaft (z. B. Infektionen, Schockerlebnisse, Suchtmittelmissbrauch), Komplikationen bei der Geburt (z. B. Sauerstoffmangel) und ein geringes Geburtsgewicht. Das Geschlecht kann ebenfalls als biologische Ursache angesehen werden, da Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen. Psychische Faktoren, die die Ausprägung herausfordernden Verhaltens beeinflussen, sind ein schwieriges Temperament bereits im Kleinkindalter, niedrige kognitive Fähigkeiten, eingeschränkte Impulskontrolle und Emotionsregulation, eine überzogene Selbsteinschätzung, eine verzerrte sozial-kognitive Informationsverarbeitung und ein geringes Einfühlungsvermögen (Petermann & Petermann, 2023; Tewes, 2021).
Fachlicher Konsens herrscht darüber, dass insbesondere das soziale und familiäre Umfeld die Ausprägung problematischen Lern- und Sozialverhaltens bedingt oder verhindert. So verweist das Robert Koch Institut (Klipker et al., 2018) darauf, dass ein mangelndes Kommunikations- und Erziehungsverhalten der unmittelbaren Bezugspersonen Verhaltens- und Lernauffälligkeiten der Kinder begünstigt. Eine inkonsequente, zu strenge oder gleichgültige Erziehung, mangelnde elterliche Zuwendung, ein zu geringes Interesse am Kind, seinen Problemen und Bedürfnissen, Trennungserfahrungen, Suchtmittelmissbrauch, aber auch psychische Erkrankungen der Eltern stellen Risikofaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Problemverhalten dar (ebd.). Weitere soziale Risikofaktoren sind familiäre Stressbelastungen (z. B. alleinerziehendes Elternteil, beengte Wohnverhältnisse, geringes Familieneinkommen), aber auch soziale Ablehnung oder negative Einflüsse durch Gleichaltrige (Tewes, 2021). Das Erziehungs- und Zuwendungsverhalten der unmittelbaren Bezugspersonen bzw. des sozialen Umfeldes führt zu entwicklungsstimulierenden Prozessen beim Kind und Jugendlichen. Ein belastetes Interaktionsverhalten erschwert daher die Entwicklung sozial angemessenen Verhaltens und kann zu ausgeprägtem Problemverhalten führen (Petermann & Petermann, 2023).
Ein kausaler Zusammenhang zur Entstehung herausfordernden Verhaltens wird im Zuwendungsverhalten der Bezugspersonen im Baby- und Kleinkindalter und damit im Aufbau von Bindungsverhalten angesehen. Kinder sind von Geburt an mit einem Bindungssystem ausgestattet, das sich in den ersten Lebensjahren abhängig vom Zuwendungsverhalten der Eltern entwickelt. Erfährt ein Kind ausreichend Zuwendung, fühlt es sich sicher und entwickelt in der Folge ein Explorationsverhalten, das es ihm ermöglicht, die Umwelt altersgerecht zu erkunden. Erfährt ein Kind jedoch beim Bedürfnis nach Sicherheit und Zuwendung eher Unsicherheit, indem die Bezugspersonen auf sein Rufen, Weinen oder auch Lächeln nicht adäquat reagieren, bleibt das Bindungsverhalten (Suche nach Nähe) aktiviert und das Explorationsverhalten der betroffenen Kinder eingeschränkt. Das heißt, sie können ihre Umwelt nicht entwicklungsbegünstigend und altersgerecht erkunden, wodurch wichtige Lernerfahrungen und soziale Erfahrungsräume nicht erfolgen können (Ainsworth, 1969; Bolz et al., 2019).
Diagnosen herausfordernden Verhaltens
Die Symptome problematischen Verhaltens sind vielfältig und münden in unterschiedliche Diagnosen. Aus schulrechtlicher Sicht kommt es zur Feststellung eines Unterstützungsbedarfs im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (esE), wenn Schüler*innen »Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der Selbststeuerung« (KMK, 2000, S. 10) aufweisen. Diese müssen so erheblich sein, dass die Schüler*innen »in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der Allgemeinen Schule auch mit Hilfe anderer Dienste nicht hinreichend gefördert werden können« (ebd.). Dies traf im Schuljahr 2021/22 deutschlandweit auf 103.520 und damit auf ca. 1,4 % aller Kinder und Jugendlichen der ersten bis zehnten Klasse allgemeinbildender Schulen zu (KMK, 2022). Deutlich wird, dass diese Definition bzw. Beschreibung der Gruppe der Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt esE sehr allgemein gehalten und davon auszugehen ist, dass es hinsichtlich der Prävalenz eine sehr viel größere Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit problematischen Verhaltensweisen gibt (Hennemann et al., 2020).
Vor dem Hintergrund einer sonderpädagogisch-fachwissenschaftlichen Sichtweise erweist sich die Definition einer Gefühls- und Verhaltensstörung, wie sie u. a. von Opp (2003) verwendet wird, als spezifischer und präziser. Danach liegen Gefühls- und Verhaltensstörungen vor, wenn folgende Kriterien zu beobachten sind:
lange Zeitdauer und hoher Schweregrad der Symptome (s. unten);
Symptome treten in mindestens zwei Settings auf, von denen eines die Schule ist;
eine Intervention üblicher Erziehungsmaßnahmen ist bzw. war nicht erfolgreich.
Nach Lindsay (2007) schätzen Lehrkräfte Kinder und Jugendliche mit einer Verhaltensstörung als besonders herausfordernd ein. Internationale Studien verweisen auf eine hohe Prävalenzrate von 10 bis 20 % aller Kinder und Jugendlichen (Hövel et al., 2015), die bei der Hälfte aller betroffenen Personen persistieren. Dabei weisen externalisierende Störungsformen, wie Hyperaktivität oder aggressives Verhalten, die bereits im frühen Kindesalter beginnen, besonders ungünstige Verläufe auf (Ihle & Esser, 2008).
Schüler*innen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen (Opp, 2003) können somit eine Zielgruppe für die Familienklasse darstellen, die unabhängig vom schulrechtlich anerkannten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf esE oder von der Diagnose einer psychiatrischen Störung (Casale & Hennemann, 2019) zu sehen ist. Zu den häufigsten psychiatrischen Diagnosen zählen die Störung des Sozialverhaltens, ein Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts-)Syndrom (AD[H]S) und ängstliches bzw. sozial unsicheres Verhalten (Tewes, 2021). Daher sollen die Formen nun genauer vorgestellt werden.
Nach einer allgemeinen Definition (Petermann & Petermann, 2023) liegt eine Störung des Sozialverhaltens vor, wenn absichtlich und unter Missachtung altersadäquater Normen und Regeln die Schädigung einer oder mehrerer Personen erfolgt. Nach Linderkamp (2022) gehören dazu das Brechen gesellschaftlicher Normen und Regeln, das wiederholte und anhaltende Verletzen der Rechte anderer, aggressives Verhalten gegenüber Menschen und Tieren, Schule schwänzen sowie bedeutsame Beeinträchtigungen in sozialen oder schulischen Funktionsbereichen. Es ist davon auszugehen, dass unter diesen Voraussetzungen das gezeigte Verhalten generalisiert ist und auf mehrere oder sogar alle Lebensbereiche übertragen wird. Diese Symptome können auch in Form eines oppositionellen Trotzverhaltens aufgrund von Entwicklungsschüben oder familiären Belastungen als zeitlich begrenztes Phänomen auftreten (Petermann, Petermann & Blumenthal, 2016). Insgesamt finden sich je nach Studienmethodik Prävalenzraten von 1,5 bis 7,1 % (Petermann, Döpfner & Görtz-Dorten, 2016).
Liegt eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung vor, sind die Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität häufig beobachtbar. Diese müssen mindestens sechs Monate regelmäßig auftreten, sind nicht mit dem altersnormalen Entwicklungsstand des Kindes vereinbar und verursachen einen deutlichen Leidensdruck bzw. eine manifeste Beeinträchtigung der sozialen und schulischen Funktionsfähigkeit (Linderkamp, 2022).
Vielfältige Begleit- und Folgeprobleme zeigen sich in Erziehungsschwierigkeiten, im problematischen Umgang mit Gleichaltrigen, schlechten Schulleistungen und einem geringen Selbstkonzept. Diese typischen Symptome beeinträchtigen insbesondere schulische oder anderweitige Lernsituationen, wie Unterricht, Hausaufgaben oder andere soziale Situationen, in denen zielgerichtet und strukturiert gearbeitet werden sollte.
Kindern mit ADHS wird schnell langweilig, d. h., dass neue und anregende Inhalte das Verhalten durchaus positiv beeinflussen können. Trotz dieser ungünstigen Voraussetzungen haben Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen viele positive Eigenschaften, die es zur Kompensation der Symptomatik zu fördern gilt. So sind sie begeisterungsfähig, freundlich, hilfsbereit und sehr belastbar (Petermann, Petermann & Blumenthal, 2016).
Die Problematik sozial unsicherer oder ängstlicher Kinder darf von den Pädagog*innen nicht unterschätzt werden. Sozial unsichere oder ängstliche Kinder sind in der Interaktion mit Gleichaltrigen oder Erwachsenen unverhältnismäßig schüchtern, ängstlich und zeigen erhebliches soziales Vermeidungsverhalten bis dahin, dass sie den Schulbesuch oder jegliche soziale Ereignisse verweigern. Sie umgehen alle sozialen Situationen, in denen sie Beschämung oder Verlegenheit ausgesetzt sein könnten, und sind daher oft sozial isoliert und sozial inkompetent (Petermann & Petermann, 2015). Eine soziale Angststörung kann dazu führen, dass die betroffenen Kinder nicht mehr das Haus verlassen, nicht ans Telefon gehen oder erhebliche psychosomatische Beschwerden, wie Kopf- und Bauchschmerzen bis hin zu Erbrechen, aufweisen (Plag & Hoyer, 2022). Um die Diagnose einer sozialen Angststörung zu stellen, müssen die Symptome mindestens sechs Monate andauern und in verschiedenen sozialen Situationen (im Elternhaus, in der Schule, bei Verwandtenbesuchen, in unterschiedlichen Unterrichtsfächern, bei Gleichaltrigen und Erwachsenen) auftreten.
Ursächlich werden neben genetischen (nachgewiesene Zusammenhänge im Auftreten der sozialen Ängstlichkeit und Variationen des Serotonin-Transporter-Gens 5-HTT) und psychischen (z. B. Verhaltenshemmung) auch psychosoziale Risikofaktoren diskutiert, die insbesondere das elterliche Erziehungsverhalten als ursächlich benennen. Der Forschungsstand zeigt, dass sowohl die Verhaltenshemmung als auch das Erziehungsverhalten der Eltern, zum Beispiel ein überbeschützender und -besorgter Erziehungsstil, große Bedeutung bei der Entstehung sozialer Ängstlichkeit haben und beide Faktoren vermutlich miteinander interagieren (Laakmann et al., 2015).
Wie auch bei anderen psychiatrischen Diagnosen liegen bei der sozialen Angststörung im Kindesalter mit 0,5 % (Essau et al., 1999) bis 7 % (Beesdo et al., 2009) sehr heterogene Prävalenzangaben vor, wobei Mädchen häufiger als Jungen betroffen sind.
Ängstliche und expressive ausagierende Verhaltensweisen gehen häufig mit komorbiden Störungen und schwerwiegenden Nachfolgeproblemen einher (Laakmann et al., 2015). Sie zeigen sich in praktisch allen Kombinationen und Ausprägungen. So kann aggressives Verhalten auch mit weiteren Verhaltensauffälligkeiten, wie ADHS, Ängsten oder starken Stimmungsschwankungen, auftreten (Visser, Büttner & Hasselhorn, 2019). Hohe Komorbiditätsraten zwischen Verhaltens- und Lernstörungen werden in bis zu 50 % aller Fälle beobachtet (Hövel et al., 2015). Dies stellt eine Verschärfung der Problematik dar, auf die insbesondere in einem inklusiven Bildungssystem eine frühzeitige und nachhaltige Antwort gefunden werden muss. Präventive Maßnahmen müssen Risikofaktoren verringern und Rahmenbedingungen schaffen, die helfen, die bereits gezeigte Symptomatik abzubauen oder zu vermindern. Dazu gehört auch der adäquate Umgang der Eltern und Lehrkräfte mit dem schulischen Verhalten der Kinder. Ein Konzept einer erfolgreichen präventiven Maßnahme kann die Familienklasse darstellen.
2.2 Entstehungsgeschichte von Multifamiliensettings und Familienklassen
Yvonne Blumenthal
Familienklassen basieren auf dem Ansatz der Multifamilientherapie (MFT), deren Ursprung wiederum im klinischen Kontext liegt. Dort etablierte sich seit den 1940er Jahren die Familientherapie in Kombination mit einer systemischen Sichtweise. Eia Asen, der Gründungsvater der MFT im schulischen Kontext, wurde in den Anfängen der Arbeit mit »Multi-Problem-Familien« von Walter Lorenz, einem deutschen Sozialwissenschaftler, inspiriert. Dieser entwickelte für die Arbeit mit benachteiligten Familien einen interdisziplinären, systemischen Ansatz, in dem er Sozialarbeit und Psychologie miteinander verband (Asen, 2007).
Ausgehend von der Annahme, dass Störungen nicht im Individuum verortet sind, sondern aus dem engen psychosozialen System und der darin praktizierten Interaktion und Kommunikation resultieren, initiierten Laqueur und Kolleg*innen (1964) vor etwa 50 Jahren simultane therapeutische Interventionen mit hospitalisierten schizophrenen Patient*innen und deren Familien in New York. Die Angehörigen wurden eingeladen, um direkt in Gespräche über das häusliche Leben und Behandlungsfragen eingebunden zu werden. Das Ziel war es, die Kommunikation innerhalb der Familie zu verbessern. Da mehrere Familien an einer Sitzung teilnahmen, konnten alle Familienmitglieder Lösungsideen für Probleme entwickeln. Diese Gruppen wurden als »beschützte Workshops zur Familienkommunikation« bezeichnet und fanden alle zwei Wochen für zwei Stunden statt. Die Familien tauschten Erfahrungen und Ideen mit anderen Familien aus und lernten voneinander. Später fand der Multifamilienansatz auch bei der Therapie anderer Störungsbilder, etwa der Anorexie, suizidalen und depressiven Störungen im Erwachsenenalter, Delinquenz sowie Drogen- oder Internetsucht, großen Anklang (u. a. McFarlane, 1983; Lemmens et al., 2009; Liu et al., 2015, Rigter et al., 2013). Es stellte sich heraus, dass die betroffenen Familien es hilfreich fanden, einige ihrer eigenen Interaktions- und Kommunikationsmuster bei anderen Familien zu sehen und zu reflektieren. Dieses Vorgehen bewirkte sowohl Veränderungen während als auch nach den Familiengruppensitzungen im häuslichen Umfeld, wie die Reduzierung familiärer Verstrickungen, die Normalisierung der intra- und interfamiliären Kommunikation, die Bewältigung akuter Krisen, die Resozialisierung sowie die Verringerung von Stigmatisierung (Asen, 2007).
In den 1970er Jahren adaptierte das Team des »Marlborough Family Service« in London die Ideen der Multifamilienarbeit auf sogenannte Multi-Problem-Familien (Cooklin et al., 1983; Asen et al., 1982). Unter Multi-Problem-Familien subsumiert Asen Familien, die mit Gewalt und Missbrauch, Familienzerfall, schweren psychischen Erkrankungen, Drogen- und Alkoholmissbrauch, Bildungsversagen und sozialer Ausgrenzung konfrontiert sind (Asen, 2007). Das Marlborough-Team begleitete für mehrere Monate täglich sechs bis acht dieser Familien, um eine Art »therapeutische Gemeinschaft dysfunktionaler Familien« zu schaffen. Die Familien wurden ermutigt, sich gegenseitig zu helfen und voneinander zu lernen, während die Kliniker*innen und andere Helfer*innen im Hintergrund blieben. Dieses besondere Setting basiert auf der Erkenntnis, dass Menschen in Problemlagen trotz einer eingeengten Sichtweise für die eigene Problematik oftmals eine hohe Sensibilität für ähnliche Konfliktlagen anderer Menschen besitzen (Asen & Scholz, 2017). Die Innovation lag vor allem in dem Paradigmenwechsel der Therapeut*innenrolle, von der traditionellen therapeutischen Helfer*innenposition hin zu der Haltung, Familien nicht zu entmündigen, sondern die Fähigkeit mitzuentwickeln, anderen und sich selbst zu helfen. Den Multifamilientherapeut*innen kommt hierbei vor allem die Aufgabe zu, Kommunikation, Interaktion, Reflexion und Selbsterfahrung bei den Familien anzuregen (Wengler & Asen, 2012), sodass sie selbst sowie andere professionelle Unterstützer*innen langsam in den Hintergrund treten können. Ein stark strukturiertes Tagesprogramm mit explizit eingebauten kontrollierten Krisensituationen – ähnlich derer, die den Familien in ihrem häuslichen Umfeld begegnen könnten – befähigte die Familien dazu, Probleme des täglichen Lebens in einem therapeutischen Kontext anzugehen. Ziel war es, diese Familien in die Lage zu versetzen, neue Formen der Selbsthilfe zur Krisenbewältigung zu erkennen und die Einbeziehung von Fachpersonal zu reduzieren.
In den 1980er Jahren etablierte sich die »Marlborough Family Day Unit« (Cooklin et al., 1983). Seitdem wurden dort über 2000 Kinder und ihre Familien behandelt. Anfänglich war die Arbeit der Marlborough Family Day Unit sehr intensiv und langwierig, da die Familien dieses Unterstützungsangebot acht Stunden pro Tag und fünf Tage pro Woche über einen Zeitraum von vielen Monaten, wenn nicht sogar einem ganzen Jahr besuchten. Nach zahlreichen Weiterentwicklungen wurde die Dauer der therapeutischen Arbeit im Durchschnitt auf zwölf Wochen reduziert und ein Gleichgewicht zwischen klinischer und häuslicher Arbeit realisiert. Während ihrer Anwesenheit im therapeutischen Setting erleben die Familien einen strukturierten Stundenplan, der von ihnen im Laufe des Tages häufige Übergänge und Änderungen abverlangt. In unterschiedlichen Gruppenkonstellationen (z. B. alle teilnehmenden Familien zusammen oder Eltern und Kinder getrennt) findet eine Mischung aus handlungsorientiertem und reflektierendem Arbeiten statt. Ein wesentliches Prinzip dieser Arbeit ist Offenheit und Transparenz, nicht nur zwischen den Familien, sondern auch zwischen den Mitarbeiter*innen und den Familien. Zusätzlich etablierte sich die Videografie, um die Interaktionen in der Familie aufzuzeichnen und damit den Familien die Möglichkeit einer Metaperspektive zu geben. Ziel war es, gemeinsam zu beraten, wie die betroffenen Familien Änderungen vornehmen können. Die Videografie wurde auch im häuslichen Setting eingesetzt, um einen individuellen Film über das tägliche Leben oder bestimmte Themen zu erstellen und im Anschluss mit den anderen Familien zu besprechen. So wurden die einzelnen Mitglieder unterschiedlicher Familien »Berater*innen« für andere Familien. Der methodische Gewinn wird vor allem in der gegenseitigen Unterstützung, in der Selbstreflexion sowie in der Netzwerkbildung zur Unterstützung isolierter Familien außerhalb des Programms gesehen (Asen, 2007).
Neben der Arbeit mit der Familiengruppe trafen sich die Familienhelfer*innen 14-tägig zu »Reflection Meetings«, angelehnt an reflektierende Team-Praktiken nach Andersen (1987). Diese Meetings unterstützen den Aspekt der Transparenz als einen wechselseitigen Prozess, bei dem die Mitarbeiter*innen ihre Ansichten und Beobachtungen offen äußern. Bei diesem ebenfalls videografierten klinischen Treffen tauschen die Familienhelfer*innen Informationen und Ansichten über die Dynamiken jeder Familie aus und fassen Stärken und Schwächen zusammen, die in den vergangenen Wochen beobachtet wurden. Im Anschluss an diese ca. 30-minütigen Treffen wird die Videoaufzeichnung einer*einem anderen Mitarbeiter*in des Marlborough-Teams gegeben, der bzw. die nicht an dem klinischen Treffen teilgenommen hat. Dieser wiederum trifft sich mit allen Eltern (normalerweise zehn bis zwölf Personen), um das Videoband des klinischen Treffens gemeinsam anzusehen und die Ansichten, Meinungen und Überlegungen des Fachpersonals zu reflektieren. Während dieser Sitzung wird einem der Eltern oder anderen Erwachsenen die Fernbedienung für den Videorecorder mit dem Auftrag gegeben, selbständig zu entscheiden, ob der jeweilige Videoabschnitt ganz ablaufen oder pausiert werden soll, damit über bestimmte Aspekte gesprochen werden kann. Nach Asen (2007) entscheiden sich die meisten Eltern dafür, die Aufnahme anzuhalten und neu zu starten, da das Anhalten des Bandes es den Familienmitgliedern ermöglicht, sofort auf die Ansichten des Personals zu reagieren und einen Reflexionsprozess zu beginnen. Die Aufgabe der systemischen Kliniker*innen besteht zuvorderst darin, die Familien neugierig aufeinander zu machen und sie zu ermutigen, sich gegenseitig zu beraten, zu kritisieren und zu unterstützen. Die Mitarbeitenden der Family Day Unit sind während des videobasierten Reflexionstreffens nicht im Raum, sondern beobachten das Treffen durch einen Einwegbildschirm. Dadurch entsteht für die Kliniker*innen eine reine Beobachtungsposition, in der sie den Reflexionen zuhören, die die Familien über deren fachliche Reflexionen machen. Diese Vorgehensweise verhindert längere Diskussionen mit den Familien, um beispielsweise zuvor Gesagtes zu begründen. Stattdessen hören sie sich die Reflexionen der Familienmitglieder an, ohne sofort etwas richtigstellen zu müssen. Die Eltern wiederum werden von der bzw. dem systemischen Berater*in, die bzw. der mit ihnen das Reflexionstreffen führt, ermutigt, darüber zu spekulieren, wie das Personal ihre Reflexionen verarbeiten könnte. Das Reflexionstreffen ist insbesondere bei den Familien eine beliebte Methode, da nicht nur sie selbst, sondern auch die professionellen Mitarbeiter*innen bei der Arbeit beobachtet werden können. Dies trägt erheblich zum Grundprinzip der Offenheit und Transparenz der Family Day Unit bei. Ein anschließendes »Post-Reflection-Meeting«, an dem nur die bzw. der systemische Berater*in und die klinischen Mitarbeiter*innen teilnehmen, schafft eine weitere Kontextebene, indem die Mitarbeiter*innen über die Reflexionen der Familien reflektieren. Dieses zirkuläre Modell begleitet den gesamten Arbeitsprozess fortlaufend (Asen, 2007).
In den letzten 30 Jahren hat die Marlborough Family Day Unit in London Pionierarbeit bei der Einrichtung des ersten dauerhaften Modells für mehrere Familientage geleistet, das speziell für die Arbeit mit scheinbar hoffnungslosen Familien konzipiert und ausschließlich dieser gewidmet ist. Insgesamt hat das systemische Arbeiten im Multifamiliensetting zu einem deutlich verbesserten Engagement mit scheinbar »verlorenen« Familien geführt und dazu beigetragen, chronisch ungünstige Beziehungen zu Fachleuten zu neutralisieren. Während der Schwerpunkt auf der Mehrfamilienarbeit liegt, werden bei Bedarf auch andere therapeutische Interventionen wie die Einfamilienarbeit und Einzelinterventionen, einschließlich psychodynamischer Arbeit, eingesetzt. Auf diesem Modell basierende Projekte wurden in unterschiedlichen europäischen Ländern entwickelt, darunter Skandinavien, Deutschland, Belgien, Italien und Frankreich, und von der Europäischen Kommission gefördert.
Ebenfalls zu Beginn der 1980er Jahre übertrug der Londoner »Marlborough Family Service« den Ansatz der Multifamilienarbeit auf schulische Settings und den Umgang mit Kindern, bei denen die Gefahr bestand, aus Regelschulen ausgeschlossen zu werden, oder die bereits ausgeschlossen worden waren. In diesem »Marlborough Model« steht die Elternpräsenz in Schulen im Mittelpunkt. Die Idee, Eltern in die Auseinandersetzung mit den schulischen Problemen ihrer Kinder einzubeziehen und Familienklassen für den Grundschul- und Sekundärbereich zu entwickeln, geht auf die Regelschullehrkräfte Brenda McHugh und Neil Dawson (1994) zurück. Mit dem Ziel, substanzielle und langanhaltende Veränderungen bei schwierigen Kindern und ihren Familien zu erreichen, wurden in der Folge familienfokussierte Interventionen in zahlreichen Schulen implementiert, dabei weiter adaptiert und in unterschiedlichen europäischen Ländern umgesetzt (Dawson & McHugh, 2017; Asen, 2017a).
Vor dem Hintergrund dieser Entstehungsgeschichte fassen die folgenden Worte Eia Asens die Entwicklung des Marlborough-Modells sehr treffend zusammen:
»So hat sich das ehemalige ›Marlborough-Modell‹ über die Jahrzehnte sehr gewandelt, und es gibt – Gott sei Dank! – die verschiedensten Anwendungen und Variationen: In der Tat so viele, dass es nicht mehr angebracht ist, von einem »Marlborough-Modell« zu sprechen. Man könnte vielleicht treffend ausrufen: »Das ›Marlborough‹ ist tot. Lang lebe die MFT in ihrer Vielfalt!« (Asen, 2017a)
Die Vielfalt in der Umsetzung wird auch in den Implementationen innerhalb des deutschen Schulsystems sichtbar. Detaillierte Informationen zur Verbreitung und über die einzelnen Umsetzungsmodelle finden sich unten (▸ Kap. 3).
2.3 Ziele, Prinzipien, Methoden und Strukturen der Familienklasse
Lena Varuna Wuntke
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Entstehung der Familienklasse sowie besondere Schüler*innen und deren Familien als Zielgruppe beschrieben wurden, soll im Folgenden die konzeptionelle Rahmung der Familienklasse selbst dargelegt werden. Wie in den oberen Textabschnitten deutlich wurde, hat sich die Familienklasse als ein nicht therapeutisches, präventiv ansetzendes und damit niederschwelliges Bildungsangebot aus der klinischen Multifamilientherapie heraus entwickelt. Diese Transformation wurde am Anna Freud, einem Zentrum für Forschung, Ausbildung und Behandlung im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern in London, durch das Malborough-Team um Eia Asen entscheidend vorangetrieben (▸ Kap. 2.2). Die nachfolgenden Darstellungen orientieren sich daher maßgeblich an den Publikationen aus dieser Forschungsgruppe (Asen & Scholz, 2017; Dawson et al., 2020; Fonagy, Gergely & Target, 2015).
Ziele der Familienklasse
Für Schüler*innen hat die Teilnahme an der Familienklasse das übergeordnete Ziel der Bewältigung von Anforderungen des Schulalltags. Dazu gehören das Erlernen neuer Handlungsmuster, Akzeptanz von Regeln und Strukturen, eine positive Veränderung des Lern- und Sozialverhaltens und eine bessere Integration in die inklusive Schulklasse. Durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden zielt die Familienklasse darauf ab, im Schulkontext einen geschützten Raum zu schaffen, in dem gegenseitige Beratung, Unterstützung und Sensibilisierung für Erlebens- und Verhaltensweisen sowie das Erkennen und Üben alternativen Verhaltens möglich werden. Auf diese Weise sollen lösungs- und ressourcenorientierte Sichtweisen bei allen Beteiligten entwickelt werden (Asen & Scholz, 2017). Durch eine gelingende Kooperation zwischen Kindern, Eltern und den Familienklassencoach-Teams, zu denen mindestens eine multisystemisch geschulte Fachkraft gehört, werden die Beziehungen der Beteiligten untereinander gestärkt und die Basis dafür geschaffen, gemeinsame Problemlösestrategien zu entwickeln und umzusetzen (Dawson et al., 2020). Die Familienklasse zielt darauf ab, Lern- und Verhaltenserfolge zu stärken, die Erziehungskompetenz der Eltern weiterzuentwickeln und durch den Transfer auf das häusliche Umfeld die Entwicklung des Kindes kontextübergreifend und systemisch nachhaltig positiv zu beeinflussen. Weiterhin stehen folgende Schlüsselkonzepte bei der Arbeit mit Multifamiliengruppen im Schulkontext im Vordergrund: Entstigmatisierung, Aufhebung von Isolation, Erfahrung von Erfolgen, Lernen sowie Reflexions- und Veränderungsprozesse (ebd., S. 16).





























