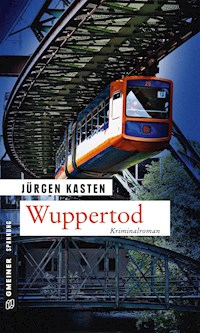Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Tote und Verletzte an verschiedenen Orten Wuppertals. An den Tatorten gefundene Tarotkarten lassen einen Zusammenhang erahnen. Doch welcher ist es, und wer steckt dahinter? Die Ermittler stoßen auf indoktrinierte Schüler, "querdenkene" Polizisten, merkwürdige Psychologen und einer Gruppe esoterischer Studenten. Chef Fasel, von Vorurteilen gebeutelt, legt sich fest. Doch er irrt sich. Praktikant Leon, von den Kollegen als komischer Vogel belächelt, hat die klarsten Gedanken. Er führt auf die richtige Spur. Ein Roman über fehlgeleitete Gedanken, die zu Gewalt führen, über Homophobie und über Wuppertal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Kasten
Fasel irrt sich
Ein Wuppertal-Krimi
Ruhrkrimi-Verlag
Jürgen Kasten, in Berlin geboren, im Ruhrgebiet aufgewachsen, lebt seit den sechziger Jahren in Wuppertal. Im Berufsleben war er u.a. Leiter von Mordkommissionen und Chef des Kommissariats für Tötungsdelikte. Nach der Pensionierung ging er mit seinen Geschichten in die Öffentlichkeit und schrieb Kurzgeschichten für Anthologien und Zeitschriften und mehrere Kriminalromane. Kasten ist Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller und beim SYNDIKAT.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Jürgen Kasten
© 2023 Ruhrkrimi-Verlag
Taschenbuch: ISBN 978-3-947848-79-9
Auch als eBook erhältlich
Originalausgabe /09/2023
Titelfoto: © pixabay
Alle Personen, Namen und Ereignisse sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen, Namen und Ereignissen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten!
Die Verwendung von Text und Grafik ist auch auszugsweise ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.
https://www.ruhrkrimi.de
Kapitel 1
Der Karlsplatz war einer von vielen in der Stadt, ein eher unbedeutender. Ambitioniert geplant mit kleinen Terrassen und Sitzecken, dazwischen etwas Grün, das sich verzweifelt an Drahtgestellen hinauf rankte, und an einem Kiosk. Gelegentlich hielten sich hier Obdachlose auf, denen der Trubel der benachbarten Innenstadt zu viel wurde. An diesem Freitagmittag zeigte sich der Platz fast menschenleer. Nur Kurt Fasel war zu sehen. Seine Kollegin Anna Schmidt stand verdeckt in dem Kiosk. Fasel lehnte lässig an dem kleinen Tresen und schaute gelangweilt umher. Sein Handy klingelte ununterbrochen. Er ignorierte es.
Fasels Name gab nur den Kollegen Anlass zu Witzen, die ihn nicht näher kannten. Der Name entsprach in keiner Weise seinem Naturell. Er war eher wortkarg. Wenn er aber als Leiter des KK 11 seine Bassstimme erhob, konnte sie laut und bestimmend sein. Dieses Timbre holte er aus der Weite seines Brustkorbs. Zwar war seine Gestalt von durchschnittlicher Größe, man sah ihm aber an, dass er mal Kraftsport betrieben hatte. Der Stock, auf den er sich jetzt lässig stützte, schien überflüssig zu sein. Ein schwarzer Gehstock mit silbernem Knauf und ebensolcher Metallspitze. Er trug ihn seit fast drei Jahren bei sich.
Dragovic hatte ihm die rechte Kniescheibe zerschossen. Fasel bekam eine Neue eingesetzt. Danach konnte er wochenlang nur mit Krücken laufen. Sobald sich alles wieder stabilisiert hatte, reichte ein Gehstock, denn er humpelte noch immer. Wie ein alter Mann kam er sich damit vor, dabei hatte er doch kaum die Fünfzig überschritten. Dann sah er in der Zeitung ein Bild des Künstlers Markus Lüpertz. Sich seiner Bedeutung bewusst, blickte Lüpertz in die Kamera, lässig auf einen schwarzen Gehstock mit silbernem Knauf gestützt.
»Das isses«, sagte sich Fasel. Seine orthopädische Gehhilfe verbannte er in den Keller und legte sich umgehend einen Stock zu, wie Lüpertz ihn trug. Wie gesagt, eigentlich brauchte er keinen mehr, aber er gefiel sich in der Pose eines Dandys.
So lehnte er am Kiosk, rechts lässig aufgestützt, in der linken Hand eine Bierflasche haltend. Zuschauer waren nur die Scharfschützen des SEK, die gut versteckt ringsum postiert waren. Sie hielten die Ausgänge der Tiefgarage im Blick und warteten auf Dragovic.
Weiträumig war alles abgesperrt. Die Rollgitter der Garage wurden geschlossen. Wenn Dragovic heraus wollte, blieben ihm nur die beiden Aufgänge zum Platz. Einer führte direkt dort hoch. Nehme er den, stünde er allerdings auf dem Präsentierteller. Der andere Aufgang endete im Innenhof des Gebäudekomplexes auf der anderen Seite der Friedrichstraße gegenüber der Komödie. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich auf diesen.
Ihr Leiter saß im obersten Stock der Rathausgalerie im Büro des Centermanagers und schaute auf Fasel hinunter, der dort nichts zu suchen hatte.
Genervt vom ständigen Handyklingeln, nahm er es endlich ans Ohr. »Was ist?«
»Fasel, hau endlich ab. Das ist eine Geiselnahme. Damit hast du nichts zu tun«, nölte der nicht minder genervte Einsatzleiter.
Fasel hatte keine Lust zu debattieren. Er hielt einen ausgestreckten Mittelfinger in die Luft.
Der Einsatzleiter fluchte.
»Schulte wird nervös. Es geht gleich los.«
»Mach nichts Unüberlegtes«, raunte Anna ihrem Chef zu. »Dragovic ist unberechenbar.«
Ihre Waffe lag griffbereit in der Durchreiche neben ihr.
»Ich kenne das Arschloch«, flüsterte Fasel zurück.
Beide hatten gemeinsam Karriere gemacht. Als Fasel noch junger Kommissar auf der Kriminalwache war, lief der ebenfalls junge Milan Dragovic ihm des Öfteren als Kleinkrimineller über den Weg. Laden- und Taschendiebstähle, hin und wieder ein Einbruch. Mehr konnte Dragovic nicht. Er war ungeschickt, hinterließ Spuren, wurde schnell als Täter identifiziert. Fasel nahm ihn mehrmals fest. Im Knast lernte Dragovic dazu. Jahre später galt er als Intensivtäter, verlegte sich auf bewaffnete Überfälle.
Vor drei Jahren trafen sie dann zufällig wieder aufeinander. Fasel verließ gerade seine Bank, wo er ein Sparkonto zugunsten seiner volljährig gewordenen Tochter aufgelöst hatte. Im Eingangsbereich stand er plötzlich Dragovic gegenüber. Er erkannte ihn trotz dessen übergezogener Maske sofort und was er vorhatte, war offensichtlich. In der Hand hielt er eine Pistole.
Fasel verzichtete auf eine Begrüßung, stattdessen schmetterte er ihm seine rechte Faust voll auf die Zwölf. Dragovic fiel um wie ein nasser Sack. Im Fallen zuckte sein Finger am Abzug der Waffe und Fasels Knie war dahin.
Die nächsten fünf Jahre sollte Dragovic in der JVA Simonshöfchen verbringen. Er spielte den geläuterten Mustergefangenen, meldete sich freiwillig zu Arbeitseinsätzen, suchte das Gespräch mit dem Gefängnispsychologen und schrieb Fasel einen langen Brief, in dem er sich für seinen Knieschuss entschuldigte. Bereits nach drei Jahren wurde er wegen außerordentlich guter Führung auf Bewährung entlassen. Eine fatale Fehleinschätzung der Gutachter. Er hatte alle getäuscht.
Heute Mittag war Fasel mit Anna Schmidt in der Stadt unterwegs gewesen, um einen Zeugen aufzusuchen, als sie über Funk von der Geiselnahme in dem Sportstudio hörten, das sich in dem Gebäudekomplex zwischen Gathe und Friedrichstraße befand. Schon kurz darauf stand fest, dass Dragovic der Geiselnehmer war.
Er wollte die Kasse des Studios ausrauben, wusste nicht, dass sich darin kaum Bares befand und bekam auch nicht mit, dass die junge Frau hinter dem Tresen einen stillen Alarm drückte.
Noch während Dragovic das enttäuschend wenige Geld einsteckte, hielten drei Streifenwagen vor dem Eingang auf der Gathe. Uniformierte mit gezogenen Waffen sprangen heraus und blockierten ihm den Rückzug.
Dragovic fuchtelte mit seiner Pistole herum, setzte einen Warnschuss in die Deckenbeleuchtung und zwang alle Anwesenden auf den Boden. Zwei Frauen mussten sich mit erhobenen Händen vor die Tür stellen. Dann schaute er sich nervös um. Einen Ausweg aus dieser Situation sah er nicht.
Den bot ihm nach einer halben Stunde der Verhandlungsführer der Polizei, der im Studio anrief.
»Geben Sie auf. Sie haben keine Chance, zu entkommen. Legen Sie ihre Waffe auf den Boden und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus.«
Das Angebot wollte Dragovic nicht annehmen.
Er forderte einen Fluchtwagen und hunderttausend Euro. Beides sollte neben dem Aufgang oben im Innenhof bereitgestellt werden. Dragovic wusste, dass es im Studio einen Ausgang zur Tiefgarage gab, von wo aus er hinaus könnte.
Eine Stunde lang dauerten die Verhandlungen, dann teilte der Polizeisprecher mit, dass alles bereitstünde. Dragovic schnappte sich eine der Frauen, hielt ihr seine Pistole gegen den Kopf und marschierte los.
Die Hektik im Funkverkehr amüsierte Fasel. Was sollte die Aufregung? Dragovic war sein Part. Kurzerhand besetzte er mit Kollegin Anna den verwaisten Kiosk und wartete nun auf Dragovic.
Der nahm den richtigen Aufzug, trat oben ins Freie und schaute sich um. Niemand war zu sehen, auch kein Fluchtwagen. Demonstrativ drückte er seiner Geisel die Pistole an den Kopf und schrie: »Macht keinen Scheiß, sonst ist die Frau tot!«
Zwei der Scharfschützen saßen in richtiger Position.
»Zielperson im Visier«, meldeten sie.
»Keine Schussfreigabe. Warten.« Der Einsatzleiter klang angespannt.
Dragovic ging langsam zur Hausecke vor. Er hielt sich dicht hinter der Geisel. Seine Waffenhand zitterte leicht.
An der Bushaltestelle stand ein BMW mit offen stehenden Türen. Daneben eine Tasche. Dragovic wusste nicht, was er tun würde, wenn die Bullen ihn gelinkt hätten und gar kein Geld da drin wäre. Er ging langsam weiter, immer dicht hinter der Geisel. Jetzt hatte er die Schnellreinigung an der anderen Ecke passiert, stand fünf Meter vor dem BMW. Sein Blick irrte umher, blieb am Dach der Rathausgalerie hängen. Ein schwarz vermummter Mann stand dort, winkte ihm zu und legte demonstrativ ein Gewehr auf den Boden.
»Gut so«, murmelte Dragovic. Die Geisel zitterte. »Ruhig, wir haben es gleich geschafft.«
Er musste sie mit seinem freien Arm fest umklammern, damit sie nicht wegsackte. In seinem Rücken stand im zweiten Stock über der Reinigung ein weiterer Vermummter im offenen Fenster. »Optimale Schussposition«, flüsterte er in sein Mikrofon.
»Warten!«, kam die scharfe Erwiderung des Einsatzleiters.
In diesem Augenblick ging Fasel los. Stark humpelnd wankte er auf Dragovic zu, der ihn erst jetzt erblickte.
»Schicken sie jetzt schon Behinderte ins Gefecht?«, rief er höhnend.
Fasel stapfte unbeirrt weiter.
»Bleib stehen«, knurrte Dragovic.
Innerlich schluckte Fasel, trotzdem gelang es ihm, ein breites Grinsen aufzusetzen. Erst kurz vor Dragovic blieb er stehen und keuchte übertrieben angestrengt.
Dragovic durchschaute das Schauspiel nicht. Verunsichert richtete er seine Waffe auf Fasel und lockerte dabei den Griff um die Geisel. Die junge Frau war am Ende ihrer Kräfte. Sie sackte seitlich weg.
Fasel und Dragovic standen sich jetzt unmittelbar gegenüber.
»Drago, gib auf. Die blasen dir sonst deinen Kopf weg.«
Fasel wies zur Rathausgalerie hoch. Dort standen jetzt plötzlich drei Vermummte am Dachrand und alle zielten mit einem Gewehr hinunter.
Nur kurz hatte Dragovic den Blick von Fasel genommen, um dieses Szenario zu sehen.
Anna nutzte diesen kurzen Blick, sprintete aus ihrem Kiosk über die Straße und stand hinter einem Werbebanner in seitlicher Höhe zu Dragovic, dreißig Meter entfernt.
Das Ganze dauerte nur Sekunden. Dragovic bekam es aus den Augenwinkeln mit. Er reagierte blitzschnell. Er riss Fasel eng an sich heran und presste ihm die Pistole gegen den Schädel.
»Haut alle ab!«, schrie er. »Sonst könnt ihr euren Kollegen einsargen.«
»Verdammter Amateur«, zischte eine wütende Stimme durch die Headsets der SEK-Leute. »Zieht euch zurück!«
Dragovic sah erleichtert, dass die Scharfschützen von der Dachkante verschwanden.
»Jetzt langsam zum Wagen«, befahl er Fasel und schob ihn in Richtung BMW. Seinen Griff musste er lockern, damit der vermeintlich behinderte Fasel vorwärts humpeln konnte.
Dragovic schaute sich noch einmal um, ob auch wirklich alle weg waren. In diesem Augenblick rammte Fasel ihm die Eisenspitze seines Stockes mit voller Wucht in den rechten Fuß.
Dragovic schrie auf. Seine Hand mit der Waffe zuckte zur Seite. Ein Schuss löste sich, dröhnte Fasel im Ohr. Den zweiten Schuss hörte er nicht mehr, sah nur, dass die Schusshand von Dragovic leer war. Blut spritzte ihm ins Gesicht. Er wirbelte herum, setzte seinen ersten Schlag in Dragovic Magen und als der zusammen knickte, den zweiten als Uppercut auf die Kinnspitze. Dragovic war k.o.
Anna kniete neben dem Werbebanner auf dem Trotteur. Ihre Waffe hielt sie noch mit beiden Händen, stand jetzt auf, steckte sie weg und lief auf Fasel zu.
»Du bist wirklich ein Hasardeur«, schleuderte sie Fasel entgegen.
Der fasste sich ans Ohr. »Ich hör dich nicht, aber guter Schuss.«
Nach der Standpauke des Einsatzleiters, von der Fasel nicht viel mitbekam, saß er mit Anna in ihrem Dienstwagen. Kopfschüttelnd betrachtete sie ihren Chef, der sich das rechte Ohr hielt.
»Ist nur ein Knalltrauma«, grinste er sie an. »Ich hör dich wie durch Watte.«
»Hättest tot sein können«, schrie sie ihn an, was er mit einem Schulterzucken beantwortete.
Er startete den Wagen, setzte Anna vor ihrer Haustür ab und fuhr dann direkt weiter zu seinem Hals-Nasen-Ohren-Arzt, von dem er wusste, dass der auch am Freitagnachmittag noch in der Praxis war.
Kapitel 2
Seit Paul aufgehört hatte, Süßigkeiten in sich reinzustopfen und auch die Burger-Buden mied, ging es ihm deutlich besser. Dass seine Fresssucht psychisch bedingt war, hatte er inzwischen begriffen. Er hatte immer geglaubt, seine Ängste und den Frust auf diese Weise ersticken zu können. Dass es im Grunde genommen nur eine Fluchtreaktion gewesen war, hatte er kompetent erklärt bekommen. Nicht nur das. Sein ganzes Verhalten müsse er ändern und vor allem seine Gedanken ordnen, wurde ihm gesagt. Er müsse sich klar über sich selber werden, müsse sich annehmen, wie er wirklich sei und zu seinen Gefühlen stehen. Sein tägliches Training werde nicht nur seinen Körper verändern, sondern auch den Geist klären. Die Tarot-Karte Der Gehängte, die er bei der letzten Session gezogen hatte, sagte es genau so: Sein Leben werde auf den Kopf gestellt, große Veränderungen stünden an. »Die Karten lügen nicht«, hatte Halvor gesagt und er hatte recht.
Äußerlich sichtbar war sie bereits, die Veränderung. Einige Kilos weniger brachte er inzwischen auf die Waage, aber das war noch lange nicht genug.
Was er leider nicht wusste, war seine angeborene Herzschwäche. Die hatte bisher niemand festgestellt. Sein hartes Trainingsprogramm war unter diesen Voraussetzungen nicht gerade optimal. Er absolvierte es seit einigen Wochen im Gelpetal, einem ausgedehnten Waldgebiet im Süden Wuppertals. Dort unten auf der Grenze zwischen den Stadtteilen Cronenberg und Ronsdorf drehte er jeden Abend seine Joggingrunden. Nicht nur, weil er nun in die Gesamtschule Ronsdorf umgemeldet wurde, sondern vor allem, weil es weit von seiner Wohnung in Barmen entfernt lag. So konnte er den ganzen Typen aus dem Weg gehen und würde auch seinen Widersacher hoffentlich nie wieder sehen. Dass er sich noch vor Wochen eingebildet hatte, der sei sein Freund, konnte er sich heute nicht mehr erklären.
Der Abend schritt voran. Abendrot schmückte den Himmel im Westen, doch vom Osten her zogen dunkle Wolken auf. Das diffuse Licht im Wald schwankte zwischen Tag und Nacht. Spaziergänger und Gäste des nahen Biergartens hatten sich auf dem Heimweg gemacht. Ein alter Mann mit einem ebenso betagten Hund war ihm vorhin noch auf dem Weg entgegengekommen. Er verschnaufte einen Augenblick und schaute sich um. Unten vom Weg her hörte er jemanden Laufen. Offensichtlich war noch ein Jogger unterwegs. Als er in sein Blickfeld kam, erschrak Paul. Der war der Letzte, den er hier sehen wollte.
Paul war über eine Stunde gelaufen, bergauf und bergab. Schweiß überströmt und ausgelaugt stand er am Hang. Sein Atem pfiff. Was sollte er tun? Der rettende Weg zu seinem Fahrrad unten am Schuppen des alten Minigolfplatzes wurde ihm abgeschnitten.
Paul zögerte nur kurz. Querfeldein hetzte er durch das Unterholz den Berg hinunter. Er bekam kaum noch Luft.
»Bleib stehen, du Arschloch«, schrie es hinter ihm.
Paul konnte nicht mehr. Er wurde langsamer. Was sollte ihm denn passieren? Umbringen wird er ihn ja wohl nicht. Aber zusammenschlagen lassen wollte er sich auch nicht. Er musste versuchen, sein Fahrrad zu erreichen. Noch einmal raffte er alle Kräfte zusammen und rannte weiter, den Verfolger dicht auf den Fersen. Fast hatte er sein Ziel erreicht, als er mit dem Fuß in einer Wurzel hängen blieb. Er fiel. Ein stechender Schmerz durchzuckte sein Herz. Den Aufprall spürte er nicht mehr.
Kapitel 3
Als Fasel am Freitagmittag in der Elberfelder Innenstadt seinen Alleingang ungeplant, aber erfolgreich abschloss, zeigte sich der Himmel azurblau. Für einen Julitag nichts Ungewöhnliches. Aber es war heiß und schwül und das zog sich über den ganzen Tag bis in den Abend hinein.
Das Wetter war bei den Menschen derzeit allerdings kein Gesprächsthema. Die allgegenwärtige Pandemie gab mehr Anlass zur Klage.
Der verhängte Lockdown des Frühlings wurde zwar inzwischen gelockert, aber Abstandsregel und Maskenpflicht bestanden fort. Zumindest in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen. Dafür wurden Gaststätten wieder geöffnet und die nach Geselligkeit und Feiern dürstende Bevölkerung nahm das erleichtert auf. Wenn möglich, mied man noch geschlossene Räume und saß bevorzugt draußen auf Terrassen oder in Biergärten.
Dieser Freitagnachmittag verschaffte auch dem Ausflugslokal Zillertal unten im Naherholungsgebiet Gelpe ein volles Haus, beziehungsweise einen gut gefüllten Gastgarten.
Gegen Abend wurden die Sonnenschirme zusammengeklappt, die Stühle aufgestapelt. Wer den Tag noch nicht beenden wollte, saß jetzt drinnen im Gastraum. Unter ihnen auch die Skatrunde, die sich dort zum Spielen traf. Kurz vor Mitternacht beendeten sie ihr Treffen. Einer aus dem Trio verblieb bis zum Lokalschluss. Er hielt sich an der Theke fest und trank ein bisschen zu viel.
Als man ihn als letzten Gast an die Luft setzte, hatte sich der bisher sternenklare Himmel verdunkelt. Im Siegerland und südöstlichem Nordrhein-Westfalen könnten sich vereinzelt Wärmegewitter entladen, wurde vorhergesagt. Dass sie sich bis ins Bergische Land ausbreiten würden, sahen die Meteorologen nicht voraus.
Der Zillertaler Wirt sah es kommen. Er wollte seinem Stammgast ein Taxi bestellen, doch dazu war der Skatbruder zu geizig. Der Anstieg durch den Wald nach Ronsdorf hinauf würde ihm guttun, wiegelte er lallend den Vorschlag ab. Er machte sich zu Fuß auf den Weg. Kaum hatte er das Lokal verlassen, rollte ein erster Donner über das Tal. Irritiert schaute der Mann auf, zögerte kurz, wankte dann aber weiter. Schon kurz darauf erreichte ihn das Gewitter. Es brachte einen Sommerregen mit, der wuchtig hinunter prasselte. Sich einen Unterstand zu suchen, kam dem Mann nicht in den Sinn. Er grub die Hände in seine Hosentaschen, zog den Kopf zwischen die hochgezogenen Schultern und stapfte beharrlich weiter. Nur die vielen Biere in ihm bremsten ihn ab. Er musste sich erleichtern. Mitten auf dem Weg ließ er es plätschern. Beim nächsten Stopp wankte er immerhin ein paar Schritte zur Seite und pinkelte einen dicken Buchenstamm an.
Ohne Unterlass prasselte der Regen auf das Laubdach, platschte dem Betrunkenen auf den triefenden Haarschopf und lief weiter in den Kragen hinab. Der Mann nahm das hin wie eine warme Dusche. Umständlich zog er sich den Hosenschlitz wieder hoch und kramte in der inzwischen durchnässten Hose nach dem Smartphone. »Bin auf dem Nachhauseweg«, nuschelte er in das Gerät und merkte erst dann, dass es gar nicht eingeschaltet war. Dennoch tönte ständig eine Handymelodie. Schwankend drehte er sich im Kreis. Außer dunklen Baumstämme sah er nichts und niemanden. Er versuchte, ruhig zu stehen und sich zu konzentrieren. Das Geräusch kam aus dem Wald vor ihm. Als er es endlich geortet hatte, baumelte vor ihm eine Leiche.
Kapitel 4
Gemessen am Altersdurchschnitt der Kriminalwache, konnte man Heintze durchaus als Fossil betrachten. Mit seinen 50 Jahren hätte er sich schon lange in einem der Kommissariate ein geregeltes Büroleben einrichten können, wollte er aber nicht. Zu Hause hatte er eine schwerkranke Frau, die dauerhaft gepflegt werden musste. Dazu hatte er einen Pflegedienst beauftragt. Wann immer er konnte, kümmerte er sich selber um seine Frau und das ging nur, wenn er auf der Kriminalwache verblieb. Der Wechseldienst verschaffte ihm viele freie Tage, die das möglich machten. Am liebsten waren ihm aber die Nachtdienste. Sie dienten ihm als Ausgleich zu den stressigen Pflegetagen.
Mal war nachts gar nichts los. Heintze zog dann mit einer Kollegin durch Kneipen und Bars. Auch die Bordelle ließ er nicht aus. Hin und wieder erhielt er dabei Informationen, die für Kollegen aus den Kommissariaten interessant waren.
In anderen Nächten brannte die Luft. Dann hetzte er von Einbruch zu Einbruch, zu Bränden, zu Toten, bei denen ein Arzt keinen natürlichen Tod bescheinigen wollte oder konnte. Besonders dann war Heintze gefragt. Er hatte die meiste Erfahrung. Wenn er sagte »hier sehe ich kein Fremdverschulden«, dann war das so. Die Sachbearbeiter beim KK 11, die am nächsten Morgen den Todesfall weiter bearbeiteten, vertrauten seinem Urteil.
Nach der meist oberflächlichen Besichtigung eines Leichnams durch den Notarzt und Ausstellung der Todesbescheinigung führte Heintze noch eine genauere Leichenschau durch. Er fertigte Fotos, befragte Angehörige, ließ den oder die Verstorbene sodann in die Pathologie des Klinikums bringen oder beließ sie in der Obhut der Angehörigen, je nachdem. Danach schrieb er die Berichte und legte alles ins Fach für das KK 11. Mit Bürobeginn übernahm ein dortiger Kollege den begonnenen Akt, prüfte die von Heintze beschriebenen Fakten, sprach vielleicht noch einmal mit dem Hausarzt der Verstorbenen und schloss sich dann meistens Heintzes Schlussfolgerung an. Die Akte wurde geschlossen, an die Staatsanwaltschaft abgegeben und von dort die Leiche zur Bestattung freigegeben.
Leben und Tod waren aber nicht immer durchschaubar. So manches lief anders ab als gedacht. Schein und Wirklichkeit konnten nicht jeder auseinanderhalten. Auch der hochgelobte Heintze war nicht vor Fehlern gefeit.
Diese Freitagnacht stand er nach einem bisher ereignislosen Dienst um zwei Uhr morgens im strömenden Regen mitten im Wald. Ein kurzes, heftiges Sommergewitter war nieder gegangen, zog nun langsam ab, ließ aber noch immer dicke Tropfen auf den nach Wasser dürstenden Boden platschen.
Den Skatbruder, der die Leiche gefunden hatte, hatte ein Streifenwagen nach Hause gefahren. Der Leichenfund war ab jetzt eine Sache der Kriminalwache.
Nun also stand Heintze vor dem Toten, beschirmt von seiner Kollegin Melanie, die jeder Wettervorhersage misstraute und für alle Fälle immer einen Schirm in Reichweite hielt.
»Das sieht mir ganz nach einem Sportunfall aus«, stellte Heintze fest.
Ein junger Mann hing an den Beinen festgebunden an einem querstehenden Ast. Bei näherem Hinsehen war es aber nur eine lose Schlinge, in der ein Bein festhing. Das andere war vermutlich aus der Schlinge gerutscht. Es lag rechtwinklig geknickt am gestreckten Bein an. Das war irgendeine bescheuerte Kraftübung, in der sich der korpulente Mann verheddert hatte, vermutete Heintze. Dunkelrot leuchtete der Kopf im Schein von Heintzes Taschenlampe. Mit Mühe hob er den schweren Körper aus der Schlinge. Halten konnte er ihn nicht. Er rutschte ihm aus den Armen und platschte ins schlammige Laub.
»Äh, der hat sich noch eingekotet.«
Angeekelt betrachtete Heintze seine mit braunem Schleim überzogenen Jackenärmel.
»Bestell den Leichenwagen«, forderte er Melanie auf. »Die sollen ihn in die Pathologie fahren. Ich schau mir den nachher genauer an.«
Fluchend zog er sich die Jacke vom Leib und stopfte sie in einen Plastiksack.
Den Notarzt, der den Tod bescheinigen sollte, bestellte er in die Pathologie. Der Arzt hatte in dieser Nacht schon genug zu tun gehabt, war schlecht gelaunt und nörgelte, dass er für die wirklichen Notfälle zuständig sei. Die offensichtlich Toten könnten ruhig ein paar Stunden warten. Zeit hätten die ja für die Ewigkeit.
»Ich brauche die Todesbescheinigung aber jetzt«, meckerte Heintze zurück. Auch ihm stank das Ganze. Der Regen hatte ihn, trotz Melanies Schirm, ziemlich durchnässt. Die Leichenschau führte er, entgegen seiner sonstigen Akribie, nur oberflächlich durch.
Der Mann schien jünger zu sein, als er im Wald vermutet hatte. Auf ein Entkleiden der Leiche verzichtete er, schob nur das T-Shirt hoch. Auf dem Bauch klebten nasse Blätter- und Fichtenreste. Rötliche Abschürfungen ließen vermuten, dass der Tote sich bei seinen Übungen irgendwo geschrammt haben musste. Schleimiger Kot verschmierte den Rücken.
Irgendeine äußere Verletzung, die den Tod verursacht haben könnte, war nicht zu erkennen. Deutliche Leichenflecke zeichneten sich am Kopf, Brust- und Schulterbereich ab.
Ob sie durch den nach unten hängenden Kopf verursacht wurden, oder vielleicht von einem Infarkt herrührten, sollten andere entscheiden.
»Tot isser«, nuschelte der Notarzt, »warum, kann ich auch nicht sagen.«
»Kreuzen Sie einfach ungeklärt« an, schlug Heintze vor und damit war für beide die Angelegenheit erledigt.
Kapitel 5
Das weitere Wochenende verlief fast wie immer. Heintze hatte noch seinen Bericht zu dem Toten im Wald geschrieben und begab sich dann nach Hause. Fasel besuchte seine Tochter, die inzwischen in Bochum studierte. In der Pathologie des Klinikums sammelten sich derweil weitere Tote an, die auf die eine oder andere Weise verstorben waren. Ungewöhnlich war das nicht. Am Montag würde sich das KK 11 darum kümmern.
Noch war das Wochenende aber nicht vorbei.
Die Vollmondnacht zum 5. Juli ging in den Sonntag über. Vor langer Zeit nannte man diesen Vollmond auch Heumond oder Bockmond. Den Namen gab man dem Juli-Vollmond entsprechend der jahreszeitlichen Ereignisse: Die Heuernte stand an und den jungen Rehen wuchsen ihre Geweihe.
In manchen Gegenden sprach man auch vom Donnermond, da im Juli häufig Gewitter übers Land zogen.
Am Freitagabend ging ja tatsächlich eines über das Bergische Land nieder. In dieser Sonntagnacht war jedoch von einem Gewitter weit und breit nichts zu sehen und zu hören.
In Wuppertal hatten sich den Tag über Wolken, aus denen es nur hin und wieder tröpfelte, und phasenweise blauer Himmel abgewechselt. Bei klarem Himmel hätte man vielleicht die Venus sehen können. Sie steht als Synonym für die Göttin der sexuellen Liebe, aber auch des Krieges. Um die Venus ranken sich einige Mythen.
So ist man zum Beispiel in der sakralen Mathematik auf die Zahl 72 gestoßen, die sich aus der Anzahl der Tierkreis-Zeichen, der Tag-und-Nacht-Gleiche und der Umlaufbahn des Planeten zusammensetzt. Teilt man das Zusammengesetzte, so erhält man letztendlich die Zahl Fünf. Diese Fünf bezeichnet ein Pentagramm, eines der wichtigsten Symbole des Okkultismusses.
Als erster sichtbarer Planet des Morgens nannte man die Venus in der Mythologie auch Luzifer, den Lichtträger, den Morgenstern.
Luzifer wurde später im christlichen Sprachgebrauch zum Teufel, einem gefallenen Engel, auch Fürst der Finsternis genannt. Er bringt das Licht und öffnet einem damit die Augen.
Diese esoterische Mischung aus Mythen, Legenden, alten Religionen und mathematischen Berechnungen trieb wahrscheinlich die dunkel gekleideten Menschen an, die sich in jeder Vollmondnacht am Teufelsfelsen in Wuppertal-Barmen trafen und irgendeinen Hokuspokus veranstalteten. Hokuspokus, so stand es ironisch gemeint im kurzen Polizeibericht des nächsten Tages.
Üblicherweise verliefen diese Treffen ruhig. Wahrgenommen wurden sie nur von Anwohnern der Bogenstraße, falls jemand gegen Mitternacht aus einer oberen Etage zufällig aus dem Fenster sah und Kerzen-und Fackelschein bemerkte. Das nahm man achselzuckend oder milde lächelnd hin.
Diese Nacht verlief allerdings anders als geplant. Nur wenige Menschen trafen sich gegen Mitternacht am Teufelsfelsen. Vergeblich wurde nach dem Vollmond Ausschau gehalten. Auch die Venus zeigte sich nicht. Der Wind blies die Kerzen immer wieder aus. Die gewünschte Stimmung wollte nicht aufkommen. Das geplante Ritual versandete im Streit.
Es wurde laut. Geschrei war zu hören, drang bis zu den Häusern hinüber und weckte schlafende Anwohner.
Irgendjemand rief schließlich die Polizei. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung amüsierte sich über die kostümierte kleine Gesellschaft. Alle trugen Masken.
»Leute«, lachte die junge Kommissarin, »geht nach Hause. Die Nachbarschaft beschwert sich über euren Lärm.«
Der Wortführer der Gruppe, ein großer schlanker Mann mit langem schwarzen Haar, war in einen schwarzen Umhang gehüllt. Er war der Einzige ohne Maske, hatte dafür sein Gesicht rot angemalt. Er protestierte, doch der Streifenführer stoppte seinen Wortschwall. Seine Gestalt war nicht weniger klein, aber doppelt so breit. Mit tiefen Bass herrschte er ihn an: »Habt ihr nicht verstanden, was meine Kollegin sagte? Verschwindet und veranstaltet euren Mummenschanz zu Hause.«
Die Beamten sahen das Ganze als albernen Hokuspokus, wie sie es auch in ihrem Bericht schrieben. Personalien stellten sie nicht fest, da die Gruppe sich zwar murrend und zögernd, aber letztendlich dann doch entfernte.
Kapitel 6
Am Montag gab sich der Julitag nicht sommerlich. Das Thermometer erreichte kaum 20 Grad und es regnete ab und zu. Chemsky parkte sein Motorrad im Innenhof des Präsidiums. Fröstelnd stieg er ab. Für den heutigen Tag war er zu leicht bekleidet. Über das hintere Treppenhaus ging er direkt zum Chefbüro des KK 11 hinauf. Er brauchte erst einmal einen heißen Kaffee. Fasel war nicht da, aber auf dem Besprechungstisch lagen sortiert die Vorgänge vom Wochenende und auch der Kaffee war schon fertig. Da Chemsky für die Todesermittlungen zuständig war, nahm er sich von dementsprechenden Stapel den obersten weg, goss sich einen Pott Kaffee ein und verzog sich in sein Büro.
Noch im Stehen schlürfte er das heiße Getränk und überflog dabei die mitgenommene dünne Akte.
Eine an den Füßen hängende Leiche war ihm noch nie untergekommen. Eine erneute Leichenschau könnte er sich aber wohl ersparen, denn der akribische Heintze hatte das ja schon erledigt. Überdies musste ein ungeklärter Tod sowieso auf den Obduktionstisch. Er leitete alles telefonisch in die Wege und ging dann erneut zu Fasel ins Büro. Der saß nun an seinem Schreibtisch und schaute hoch.
»Morgen Chef«, begrüßte Chemsky ihn. »Ich bin gleich als Zeuge vor Gericht geladen und kann nicht selber zur Obduktion fahren.«
»Leg hin«, murmelte Fasel. Er blätterte in dem Kölner Express, den ihn jemand auf dem Schreibtisch gelegt hatte. Wohl deshalb, weil auf Seite drei ein langer Artikel über den Kölner CSD stand. Am gestrigen Sonntag, den 5. Juli, hätte er stattfinden sollen. Covid 19 hat ihn, wie alle anderen Großveranstaltungen auch, verhindert.
In dem Artikel wurde auf den letztjährigen CSD Bezug genommen. Zwei Fotos waren eingefügt.
Mit ironischem Unterton stand geschrieben, dass inzwischen selbst bei der Polizei angekommen sei, dass Schwul- und Lesbischsein eine normale, gesellschaftlich akzeptierte Lebensform sei und sich deshalb auch Polizisten ohne Probleme outen könnten.
Das sah Fasel genauso, denn in seinem Kommissariat gab es gleich mehrere und die wurden ohne jeden Vorbehalt angenommen. Niemand verlor ein Wort über ihre sexuelle Orientierung.
Weniger einverstanden war Fasel mit einem der Fotos, das dem Artikel beigefügt war. Er sah darauf seine Kollegin Anna Schmidt in knappen Pants und luftigem T-Shirt auf einen Festwagen stehen. Daneben ihre Freundin im gleichen Outfit. Beide küssten sich in inniger Umarmung. Leuchtend weiß zog sich der Schriftzug Polizei quer über die Rücken ihrer schwarzen Shirts.
Chemsky tat so, als sehe er nicht, was sein Chef da las. Innerlich grinste er. Beim Rausgehen aus Fasels Büro stieß er mit Anna zusammen, die gerade hereinkam. Sie schmunzelte, als sie Fasel über den Artikel gebeugt sah.
»War das nötig?«, brummte er ihr die Lachfältchen aus dem Gesicht.
»Na ja«, Anna zuckte mit den Schultern, »im Karneval laufen auch viele Jecken als Polizisten verkleidet herum.«
»Die sind aber nicht wirklich bei der Polizei, nur kostümiert. Das Foto wird dir Ärger einbringen.«
»Warum?«, konterte Anna. »Ich habe im Zug auch noch andere Kollegen gesehen.«
»Aber sicher nicht mit diesem Polizei-Shirt.«
Bevor Fasel sich richtig aufregen konnte, unterbrach ihn das Telefon. Der Polizeipräsident wünschte, ihn sofort zu sehen.
»Da hast du es. Die Zeitung ist schon beim PP gelandet.«
Wütend stampfte er aus dem Büro.
»Kümmere dich mal darum«, wies er im Rausgehen auf die dünne Akte, die Chemsky ihm hingelegt hatte.
Anna setze sich in den Chefsessel, las Heintzes Bericht und griff dann zum Telefon.
Der Tote war überhaupt noch nicht identifiziert. Er hatte lediglich eine Jogginghose und ein Sweatshirt angehabt. Handy oder Ausweispapiere wurden bei ihm nicht gefunden.
Für unbekannte Tote wäre eigentlich erst einmal die Vermisstendienstelle zuständig. Ein Kapitaldelikt lag ja anscheinend nicht vor.
Beim KK 12 wusste man allerdings nichts von einem Vermissten, auf den die Beschreibung passen könnte. Also bat Anna die Leitstelle darum, alle Dienststellen über den Fund einer unbekannten Leiche zu informieren. Falls irgendwo ein Hinweis einginge, sollte man sich sofort mit ihr in Verbindung setzen.
Kapitel 7