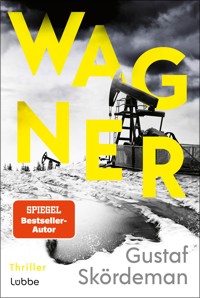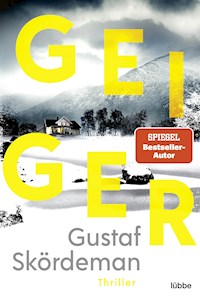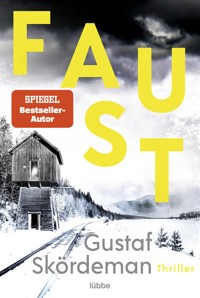
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Geiger-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nachdem Sara Nowak das Netzwerk der Stasi-Mitarbeiter in Schweden auffliegen ließ und einen Bombenanschlag in Deutschland verhindert hat, werden die Ereignisse von den schwedischen Geheimdiensten unter den Teppich gekehrt. Sara willigt ein, darüber zu schweigen, doch dann wird ein Ex-Spion ermordet, der sie wenige Tage zuvor vergeblich um Rückruf gebeten hatte. Obwohl sie an ihrer neuen Stelle in der Kriminalpolizei bereits genug mit einer Mordserie in der Unterwelt zu tun hat, lässt ihr schlechtes Gewissen sie erneut in der Spionagewelt herumstochern. Dabei scheint sie einen Agenten namens FAUST mit einer Vergangenheit in der RAF gegen sich aufzubringen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Nachdem Sara Nowak das Netzwerk der Stasi-Mitarbeiter in Schweden auffliegen ließ und einen Bombenschlag in Deutschland verhindert hat, werden die Ereignisse von den schwedischen Geheimdiensten unter den Teppich gekehrt. Sara will sich an das Schweigegebot halten, doch dann wird ein Ex-Spion ermordet, der sie wenige Tage zuvor vergeblich um Rückruf gebeten hatte. Obwohl sie an ihrer neuen Stelle in der Kriminalpolizei bereits genug mit einer Mordserie in der Unterwelt zu tun hat, lässt ihr schlechtes Gewissen sie erneut in der Spionagewelt herumstochern. Dabei scheint sie einen Agenten namens Faust mit einer Vergangenheit in der RAF gegen sich aufzubringen ...
Über den Autor
Gustaf Skördeman ist 1965 in Nordschweden geboren. Heute lebt er mit Frau und zwei Kindern in Stockholm. Er ist Drehbuchschreiber, Regisseur und Filmproduzent. GEIGER ist sein schriftstellerisches Debüt. Die Idee für diesen Thriller kam ihm bereits vor zehn Jahren. Seitdem hat er an der Handlung für diesen Auftakt einer Trilogie gefeilt. Das Buch wurde gleich ein internationaler Erfolg und erscheint in 20 Ländern.
Gustaf Skördeman
FAUST
Thriller
Übersetzung aus dem Schwedischenvon Thorsten Alms
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der schwedischen Originalausgabe:
»Faust«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2021 by Gustaf Skördeman and Bokförlaget Polaris in agreement with Politiken Literary Agency
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagmotiv: © STILLFX/shutterstock; VISUALSPECTRUM/stocksy; Michael715/shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-1041-1
www.luebbe.de
www.lesejury.de
1
Welch ein schönes Tier.
Vollkommen ahnungslos, dass es durch ein Zielfernrohr beobachtet wurde.
Gunilla hatte eine freie Schussbahn. Die Voraussetzungen dafür, an ihre erste Trophäe zu kommen, waren perfekt. Der Beweis, dass sie sich ihren Platz in der Jagdgesellschaft verdient hatte. Ein stattlicher Bock, schön und majestätisch, und ihr vollkommen ausgeliefert. Oder eher ihrer Waffe. Eine Tikka T3, die der Verkäufer in der Waffenhandlung für sie ausgesucht hatte, während sie Interesse für die Unterschiede zwischen den vielen Gewehren geheuchelt hatte.
Stutzen, Büchsen, Flinten, Drillinge.
Sie hatten alle unterschiedliche Eigenschaften, aber der Zweck war derselbe. Das Töten.
Der Geschmack von Kaffee im Mund, anscheinend ein zentraler Teil des Jagderlebnisses. Wie die gegrillte Wurst. Falukorvscheiben, Kabanossi, Rostbratwurst. Die genussvollen Blicke der Jäger, während sie diese beinahe fleischfreien Schlachtreste verschlangen. Waren sie tatsächlich so lecker? Die halbe Wurst verkohlt und die andere Hälfte kalt. Aber das gehörte eben auch dazu.
Zur Jagd. Jetzt war sie Teil davon.
Ein Leben beenden. Am besten mehrere. Jeder Tod war ein Sieg. Warum? Für die Jagdgemeinschaft? Wegen des Adrenalinkicks? Um den Rehbestand zu regulieren, wie man so schön sagte. Ein ziemlich wackeliges Argument.
Bekamen sie denn nie ein schlechtes Gewissen, diese alten Grünröcke? Sie hatten gegrinst und süffisante Kommentare gemacht, als sie sich zur Jagdausbildung angemeldet hatte, und jedes Mal das Thema gewechselt, wenn Gunilla fragte, ob sie mit auf die Jagd gehen könne. In ihren Häusern waren die Wände bedeckt von Geweihen, die auf Brettchen montiert waren, in ihren Waffenschränken befanden sich Gewehre im Wert von zehntausenden oder gar hunderttausenden schwedischer Kronen. Es waren Männer, die erst auflebten, wenn sie die grüne Kleidung und die orangefarbenen Bänder angelegt hatten. Dann waren sie endlich sie selbst. Oder diejenigen, die sie in ihren Träumen waren. Vielleicht war es so wie bei Dragshow-Künstlern, wenn sie endlich die Paillettenkleider anziehen und sich im Scheinwerferlicht präsentieren konnten? Eine Verwandlungsnummer als Protest gegen das, als das man geboren wurde? Wir sind keine bierbäuchigen Spießbürger, sondern Jäger. Krieger. Todesboten. Das Fortleben des ganzen Stammes hängt allein von uns ab.
Und warum hatte sie selbst es getan? Sie hatte sich durch die ganze Jägerprüfung gequält und war mehrere Jagdsaisons als Treiberin unterwegs gewesen, während sie ununterbrochen gequengelt hatte, endlich in die Jagdgemeinschaft aufgenommen zu werden. Wollte sie so ihren Mann besser kennenlernen? Verstehen, warum er die Jagd so sehr liebte? Ein gemeinsames Interesse finden?
Oder ging es um Gleichberechtigung? Wollte sie eine der äußerst männerdominierten Festungen des Landes zum Wackeln bringen?
Vielleicht.
Aber sie hatte überhaupt nichts zum Wackeln gebracht.
Sie hatte den Kerlen etwas zum Lachen und zur Belustigung gegeben. Und definitiv ihr Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Vielleicht war sie sogar peinlich für ihren Mann, aber in diesem Fall verbarg er es unter einer Maske aus wohlwollendem Humor. Er war jedenfalls darauf eingegangen, ihr seinen Platz zu überlassen und stattdessen als Treiber zu gehen, eine freiwillige Herabstufung, die sicherlich Spuren hinterließ, auch wenn sie nur höchst vorübergehend war.
Eine Ricke und ein Kitz schlossen sich dem Bock an. Sie hatte gelernt, dass dies die richtigen Begriffe waren. Ricke und Kitz, nicht Rehweibchen und Rehjunges. Hier wie überall anders auch waren die richtigen Begriffe entscheidend, kleine Codes, die zeigten, ob man dazugehörte oder nicht. Ein bisschen wie das richtige Etikett an der Jeans auf dem Schulhof.
Man schoss niemals die Ricke zuerst, damit das Kitz nicht mutterlos wurde. Eine absurde Rücksichtnahme bei der Brutalität des Rituals. Wir erschießen zuerst dein Kind, damit es nicht allein ist, ist das nicht nett?
Ganz langsam begann sich ihr Zeigefinger um den Abzug zu krümmen. Der Bock stand genau im Fadenkreuz. Seine letzten Sekunden mit der Familie. Aber so war eben die Natur, redete sie sich ein. Der Mensch war nicht das einzige Tier, das andere Tiere tötete. Allerdings war er das einzige Tier, das es aus der Entfernung und auf diese Weise tun konnte. Distanziert. Unpersönlich. Feige.
Der Schuss löste sich. Und die drei hübschen Tiere liefen davon. Waren wie durch Zauberei verschwunden, von der Evolution darauf trainiert, den Ort der Gefahr blitzschnell zu verlassen.
Die Kugel landete in einem Baumstamm direkt neben der Stelle, an der der Bock gestanden hatte. Eine Handbreit vom Ziel entfernt.
»Guter Versuch«, sagte Håkan aus der Jagdgruppe tröstlich.
»Knapp daneben ist auch vorbei«, grinste sein Bruder Martin.
Gunilla machte sich nichts daraus. Sie wollte bei der Jagd dabei sein, und sie hatte das Urteil über das Leben des Bocks gefällt. Sie nahm die Kommentare der andern hin und verspürte kein Bedürfnis, etwas zu erklären oder sich zu entschuldigen.
»Jetzt sind bestimmt auch alle anderen geflohen, die in der Nähe waren«, sagte Håkan. »Wir sollten uns ein bisschen weiter nach vorne bewegen.«
»Sie hat ihn ja nur ganz knapp verfehlt«, sagte Martin in einem Versuch zu trösten, der wesentlich mehr schmerzte als ein höhnisches Lachen.
»Aber wir wollen die Tiere ja auch nicht waidwund schießen«, sagte Håkan. »Wie auch immer, du solltest vielleicht noch ein bisschen üben, bevor du das nächste Mal auf Wild anlegst.«
»Mhm«, sagte sie. Nickte dazu.
Sie gingen weiter voran, zuerst die Gebrüder Lang und Gunilla ein paar Schritte dahinter. Der elegante Håkan mit seiner Blaser R8 und der grünen Jagdkleidung von Mauritz Widforss, Martin in seinen alten Klamotten, die er sich vor zwanzig Jahren beim Ausverkauf besorgt hatte, umarmte seine Husqvarna 1900, als wäre sie sein erstgeborenes Kind.
Sie folgten dem schmalen Waldweg, der von den tiefen Spuren der Cross-Maschinen zerpflügt war. Gunilla verstand nicht, wie man die Natur so behandeln konnte. Ganz zu schweigen davon, wie sehr man die Tiere damit störte. Elche, Füchse, Rehe mit ihren Kitzen, brütende Vögel. Der Fichtenwald lichtete sich, und sie gelangten auf einen großen, offenen Platz mit Hochspannungsleitungen, Hochsitzen und einem Waldweg. »Kolbotten«, sagte Håkan, als wüsste Gunilla nicht, wie diese Stelle hieß.
Auf einem mit Schotter bedeckten Wendekreis stand ein großer SUV, ein Porsche Cayenne älterer Bauart. Die Türen waren geöffnet, und zwei großgewachsene Männer zerrten etwas aus dem Auto den bewaldeten Hügel hinauf, hinter dem es zum Mälarsee hinunterging.
Die Männer waren vollauf mit ihrer Schlepperei beschäftigt, sodass sie die Jäger nicht bemerkt hatten. Als sich das Trio den arbeitenden Männern näherte, bemerkte Martin, dass sie wie Leute aussahen, mit denen er sich nicht anlegen wollte, und entschied sich daher offenbar instinktiv, sie auf eine eher kumpelhafte Art anzusprechen. Die Autokennzeichen waren nicht schwedisch, und Martin tat sich generell schwer im Umgang mit Ausländern. Sie waren einfach unberechenbar. Schwer zu deuten. Aber er wusste, dass ein Lächeln die meisten kulturellen Missverständnisse überbrücken konnte.
»Hallo!«, rief Martin fröhlich, worauf die Männer zusammenzuckten und zu ihm aufsahen. »Haben Sie vielleicht ein paar Rehe gesehen?«
Die beiden Männer ließen das Bündel fallen, zogen ihre Pistolen und eröffneten sofort das Feuer.
Håkan brach mit einem Schrei zusammen, nachdem er am Bein getroffen worden war, und Martin ließ instinktiv sein Gewehr fallen, drehte sich um und lief.
Einer der beiden Männer schoss Martin hinterher, während der andere ein paar Schritte auf den liegenden Håkan zu machte.
Der Mann türmte sich vor dem blutenden, jammernden Jäger auf und hob die Waffe. Eine Glock, konstatierte der schockierte Håkan. Verdammt gute Pistole.
Doch bevor der Mann abdrücken konnte, knallte es vom Waldrand her, und er brach über Håkan zusammen, während sein Blut aus einem Loch in der Stirn spritzte.
Der andere Mann hörte den Schuss, sah seinen Begleiter fallen und drehte sich mit gezogener Waffe um.
Nur um von einem ähnlich zielsicheren Schuss mitten in die Stirn getroffen zu werden.
Kein Laut kam über seine Lippen, als sein Körper zu Boden fiel.
Håkan, der bereits sicher gewesen war, dass sein letzter Atemzug bevorstand, schob denjenigen zur Seite, der an seiner Stelle gestorben war, und drehte sich zu seinem Retter um.
Er wusste nicht, ob Martin vielleicht zurückgekommen, die Polizei oder irgendwelche finsteren Typen aufgetaucht waren, die hinter den beiden Männern her waren und jetzt möglicherweise die Zeugen aus dem Weg räumen wollten.
Aber er sah nur Gunilla, Kalles Frau, die langsam ihr rauchendes Gewehr sinken ließ, während ihr Blick auf ihre ersten beiden Jagdtrophäen gerichtet war.
2
»Wo ist Karin?«
Das Seil spannte sich fester um seinen Hals und machte es ihm schwer, die Worte auszusprechen. Er schielte zu Rau hinunter. Sie waren beide sehr viel älter geworden. Warum tat er das? Konnten sie nicht einfach in aller Ruhe die Jahre genießen, die sie noch hatten?
»Stimmt«, sagte Rau. »Karin. Gut, dass du mich daran erinnerst.« Und auf Deutsch fügte er hinzu: »Vielen Dank.«
Stiller spürte, dass Rau ihm hinter dem Rücken etwas Hartes in die gefesselten Hände legte, um dann Stillers Fingerspitzen dagegen zu drücken.
»Ich hätte fast vergessen, deine Abdrücke auf dem Messer zu hinterlassen. Wahrscheinlich werde ich langsam alt.«
Rau lächelte. Als wäre der bloße Gedanke, dass er altern könnte, nichts als ein absurder Witz. Stiller sah ihn an, konnte seine Augen nicht von ihm wenden. Graues Haar, tiefe Furchen im Gesicht, genauso alt wie Stiller selbst, aber trotzdem wesentlich attraktiver. Ein echter Mann. Das war Stiller niemals gewesen, nicht in seinen eigenen Augen und wohl kaum in den Augen anderer. Raus Haltung verriet weder sein Alter noch sein entbehrungsreiches Leben. Sein Rücken war gerade, und er strahlte Energie und Kraft aus.
»Das Messer?«, fragte Stiller verwundert, obwohl er die Wahrheit bereits ahnte. Er wollte bis zum Schluss noch hoffen dürfen.
»Ich stelle mir vor, dass du es vor lauter Panik weggeworfen hast«, sagte Rau, hielt ein großes Messer hoch und warf es nachlässig in eine Ecke der Küche. Ein Tranchiermesser mit einer langen, scharfen Klinge, die jetzt voller Blut war. Ein Fiskars, wenn sich Stiller richtig erinnerte. Absurd, dass ausgerechnet jetzt die Marke des Messers in seinem Kopf auftauchte. Dieses Messer war seit über dreißig Jahren in ihrem Besitz, und es hatte ausgezeichnete Dienste geleistet. Sie brauchten eigentlich kein neues. Brot, Steaks, Weißkohlköpfe, alles hatte es ganz leicht bewältigt. Und jetzt …
»Wo ist Karin?«, fragte Stiller erneut, dieses Mal mit Panik in der Stimme.
»Ja, wie nennt ihr es denn? Im oberen Salon? Man gibt den toten Räumen ja gerne feine Namen. Diese Halle, die offensichtlich kaum zu möblieren ist. Irgendwo da oben jedenfalls.«
»Karin!«
»Das ist gut. Schrei nur. Wenn jemand es hört, dann untermauert das nur die offizielle Version.«
»Wovon? Was hast du mit ihr gemacht?«
»Ich?«, sagte Rau mit einem verwunderten Ausdruck. »Ich nehme an, du bist einfach zusammengebrochen, nachdem deine alten Spionagekameraden einer nach dem anderen ermordet worden sind. Vielleicht hattest du Angst, dass du der Nächste bist. Und dabei sind jede Menge Schuldgefühle wieder zum Leben erweckt worden. Du hast lange Zeit unter großem Druck gelebt. Du hast dich für deine Vergangenheit geschämt, die dich jetzt wieder eingeholt hat. Was weiß ich? Die Polizei kann sich da bestimmt noch etwas Besseres zusammenreimen. Du kamst von deinem täglichen Morgenspaziergang, und dann fingt ihr an zu streiten, und, tja …«
Rau hielt inne und betrachtete Stiller, der auf den Zehenspitzen auf dem Küchenstuhl balancierte. Ein Stuhl, der mit Sicherheit zum Pfarrhaus gehörte und schon seit Jahrzehnten hier gestanden haben musste. Helles Kiefernholz, das nicht besonders gut zu dem dunkel gebeizten Klapptisch passte. Dazu gehäkelte Tischläufer und kleine orangefarbene Kerzen in ebenso kleinen Ständern. Ein moosgrüner Lampenschirm aus Samt mit braunen Fransen. Herdabdeckplatten aus Kupfer, jahrzehntealte Gewürzgläser mit Thymian, Zimt und Zitronenpfeffer. An der Wand hing ein Kalender vom ICA-Supermarkt, ein Plakat mit verschiedenen Pilzsorten sowie ein paar Stickereien mit frommen Sprüchen. »Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, zu dir.«
Rau begriff nicht, wie Leute so leben konnten, ohne Atemnot zu bekommen. Obwohl, Atemnot war im Grunde ja das, was Stiller gerade hatte.
»Genau. Die Requisiten.«
Er verließ die Küche, und Stiller starrte an die Decke, als hoffte er, durch sie hindurchsehen und Karin entdecken zu können. Lebte sie noch? Wie schwer hatte Rau sie verletzt? Und was würde er mit Stiller machen? War das hier nur eine Warnung? Er betete, dass es nur das war.
Rau kehrte mit einer Bibel zurück.
»Matthäus, oder? Das ist doch die beste Version.«
Rau schwieg, als würde er wirklich auf eine Antwort warten. Nach ein paar Sekunden fuhr er fort:
»Kapitel siebenundzwanzig, nicht wahr? Vers drei bis fünf? Oder?« Er warf Stiller einen fragenden Blick zu und begann zu lächeln. »Ich habe es gegoogelt. Leider ist die Darstellung dort ein bisschen trocken, aber ich denke, es wird trotzdem funktionieren.«
Er schlug die Bibel an der genannten Stelle auf und legte die Heilige Schrift auf den Küchentisch. Dann wandte er sich Stiller zu.
»Tja, mein Freund. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich. Und die Antworten werden über dein Schicksal entscheiden.«
Stiller starrte verwirrt um sich. Das Seil schnitt ihm in den Hals, und der Nacken schmerzte, nachdem er den Kopf so lange schief gehalten hatte. Jeder Atemzug war ein Kampf.
»Volksgerichtsprozess gegen Jürgen Stiller, der den revolutionären Kampf verraten hat, indem er kleinbürgerlichen Abweichungen und revisionistischen Tendenzen nachgegeben und versucht hat, persönlichen Gewinn aus der reinen sozialistischen Lehre zu ziehen.«
»Ich bekenne mich schuldig«, brachte Stiller mühsam über die Lippen. Seine Beine fühlten sich immer tauber an. Er würde nicht mehr lange das Gleichgewicht halten können. »Ich bekenne mich schuldig …«
Das Lächeln verschwand von Raus Lippen.
»Mit wem hast du gesprochen?«
»Worüber?«
»Über mich.«
»Mit niemandem.«
Rau tippte mit der Schuhspitze gegen den Küchenstuhl. Stiller zuckte zusammen und versuchte die Bewegung auszugleichen, was allerdings nur dazu führte, dass er sich zur anderen Seite neigte. Das Seil drückte auf den Kehlkopf, und ein paar wenige, aber ewig erscheinende Sekunden lang bekam er keine Luft. Rau verfolgte seinen Kampf mit gleichgültigem Blick.
»Mit niemandem!«, schrie Stiller und hoffte, dass draußen vielleicht jemand vorbeiging und ihn hören würde. Vielleicht könnte er ja noch davonkommen. Er wusste, dass Scheinhinrichtungen eine verbreitete Methode waren, um Leute zu brechen. Aber man überlebte sie zumindest. »Mit niemandem, ich schwöre!«
Rau hob den Fuß. Ließ ihn aufreizend hin und her schwingen.
»Warum hätte ich das tun sollen?«, sagte Stiller. »Mit wem sollte ich darüber sprechen?«
»Was weißt du über Wahasha?«
»Worüber?«
»Über die Operation Wahasha.«
»Nichts.«
»Schade.«
»Warum schade?«, quäkte Stiller.
»Wenn du nichts darüber weißt, bist du für mich nichts wert.« Und dann fügte er auf Deutsch hinzu: »Leider.«
Rau setzte den Fuß wieder an den Stuhl.
»Warte! Wahasha, sagtest du? Ich kann es herausbekommen. Ich kenne Leute. Ich kann es herausfinden.«
»Vergiss es.«
»Bitte, ich werde niemandem irgendetwas erzählen. Es tut mir leid, dass ich …«
»Pssst …«, sagte Rau, ging zum Kühlschrank und öffnete ihn. Eingelegter Hering, Anchovis, Kaviar, Dickmilch, Frischhaltedosen mit Resten, eine blaue Teetasse, die anscheinend mit übrig gebliebenem Bratenfett gefüllt war. Keine menschenwürdige Nahrung weit und breit. Mit einer Grimasse drehte sich Rau wieder zu Stiller um.
»Was hast du Sara Nowak erzählt?«
»Wer ist das?«, antwortete Stiller.
»Die Polizistin, die Geiger enttarnt hat. Die Polin. Hast du sie angerufen?«
»Nein, das habe ich nicht.«
»Du hast einfach eine Nummer aufgeschrieben, ohne zu wissen, dass es ihre ist? Rein zufällig?«
Rau hielt das kleine, schwarze Notizbuch hoch, das er in Stillers Arbeitszimmer gefunden hatte.
»Notizen für Gottesdienste, Telefonnummern von Handwerkern, dem Bischof in Linköping und von Sara Nowak.«
Rau sah vom Notizbuch hoch. Jetzt lächelte er nicht mehr. Stiller schluckte, und noch mehr Schweiß trat auf seine Stirn.
»Ich … ich wollte nur hören, wie es mit Geiger gelaufen ist.«
»Du lügst«, sagte Rau auf Deutsch und setzte die Schuhspitze auf den Rand des Küchenstuhls.
»Ich habe sie gar nicht erreicht! Ehrlich! Ich habe mit niemandem gesprochen!«
»Vielleicht«, sagte Rau erneut auf Deutsch und drückte den Stuhl ein paar Zentimeter zur Seite. »Vielleicht auch nicht.«
»Bitte, Otto, ich habe nicht …«
»Pssst …«
Rau sah ihn vorwurfsvoll an und legte einen Finger auf seine Lippen.
»Ich glaube dir.«
Stiller atmete aus, soweit es ihm überhaupt möglich war.
Rau lächelte Stiller an, drehte sich langsam um und stellte seine schwarze Tasche auf die Arbeitsplatte. Ein alter Küchenschrank, dachte er verwundert, als er die Tasche öffnete. Bestimmt aus den Dreißiger- oder Vierzigerjahren. Warum schafft man sich nicht eine moderne Küche an, selbst wenn das Haus alt ist. Menschen ohne jeden Sinn für Ästhetik. Spiritualität war einfach nur ein anderer Name für die totale Abwesenheit von Geschmack.
Durch das Fenster sah er die Kirche, die ein paar hundert Meter entfernt hinter einem Acker lag. Dort hatte der große Bischof Giertz, einer der bekanntesten christlichen Amtsträger in Schweden, am Anfang seiner Karriere gewirkt. Dieses Wissen hatte Rau sich natürlich ergoogelt. Heutzutage war das gesamte Wissen der Welt über das Handy zugänglich. Er hätte sich die Kirche gerne näher angesehen, aber dazu hatte er jetzt keine Zeit. Vielleicht würde er ein anderes Mal wiederkommen.
Er holte alles, was er brauchte, aus der Tasche: Lautsprecher, einen Bang & Olufsen Beolit 17 mit einem für seine Größe sehr guten Klang. Ein LED-Panel, das klein und leicht, aber sehr lichtstark war. Ein ultraleichtes Stativ, auf das er die Lampe schrauben konnte. Und die Videokamera, eine Panasonic HC-VXF990, eine altgediente Gefährtin mit einer hervorragenden Bildqualität. Er konnte natürlich auch das Handy benutzen, aber dann wäre es ihm nicht möglich, gleichzeitig Musik abzuspielen, und schließlich war es etwas Besonderes, wenn man eine richtige Filmkamera verwendete. Er mochte seine kleine Ausrüstung.
Dann richtete er die Lampe auf Stiller und schaltete sie an, wirklich erstaunlich, wie viel Licht der kleine, metallrote Kasten erzeugte. Die tränengefüllten Augen des Pfarrers glänzten in dem unerwartet hellen Schein. Gut. Dann sah er noch ängstlicher aus.
Er nahm sein Handy und suchte Musik aus. Diamanda Galás, The Litanies of Satan. Keine Musik, die er persönlich schätzte, aber er mochte den Titel und die Wirkung, die das Stück auf diejenigen hatte, denen er es vorspielte. Und tatsächlich reagierte auch Stiller mit großem Unbehagen auf die diabolischen Schreie.
Als er alles fertig aufgebaut hatte, schaltete er die Videokamera ein und betrachtete das Tableau für einen Moment voller Bewunderung. Dann trat er den Stuhl unter Stillers Füßen weg.
Der Fall war nicht tief genug, um den Nacken zu brechen. Er wollte, dass Stiller langsam erstickte, an seinem eigenen Gewicht, zusätzlich gequält von den zwanzig Kilo, die er zu viel auf den Rippen hatte.
Er wollte einen langgezogenen Todeskampf einfangen.
Nahaufnahmen von der Angst in den Augen des Todgeweihten, von den verzweifelten Versuchen, um Gnade zu betteln, wenn der Hals immer stärker vom Seil zugeschnürt wurde.
Und die aufsteigende Panik, wenn sich die Einsicht über den unwiderruflichen Tod langsam in das Bewusstsein hineinfraß.
Stiller kämpfte um sein Leben.
Gut.
Die Beine zappelten, um irgendwo Halt zu finden, sich abzustützen. Aber es war sinnlos.
Die gurgelnden Geräusche signalisierten, dass er den Kampf langsam verlor und dennoch etwas mitteilen, einen Hilferuf ausstoßen wollte.
Wo ist dein Gott jetzt, dachte Rau, bevor ihm klarwurde, dass Gott natürlich auf seiner Seite war. Rau verrichtete in diesem Augenblick Gottes Willen. Das war die einzig logische Erkenntnis für einen Gläubigen, zu denen auch diese zuckende und zappelnde Kreatur gehörte.
Gottes Wille war eben nicht der, auf den Stiller gehofft hatte.
3
Er hupte.
Dieses Arschloch hupte tatsächlich.
Sara stand genau vor ihrem Hauseingang am Kornhamnstorg, mitten in Gamla Stan, um dort eine Parklücke für ihren Mann frei zu halten. Als er mit dem gemieteten Transporter von Circle K dort ankam, winkte sie ihn heran. Ebba, ihre Tochter, hätte am liebsten eine Umzugsfirma beauftragt, aber Sara hatte entschieden, dass sie es selbst machen würden. Man musste Kindern schließlich auch Grenzen setzen.
Sie hielt diesen Platz schon über zwanzig Minuten frei, aber jetzt, da Martin endlich hier war, wollte der schwarze Audi direkt vor ihm in die Lücke einparken, in der Sara stand. Obwohl sie abwehrend winkte. Der Audi fuhr Stück für Stück näher an sie heran, bis der Kotflügel gegen Saras Schienbein stieß. Und als sie sich trotzdem nicht bewegte, hupte der Fahrer. Das Arschloch.
Hinter Martin standen mittlerweile ein Taxi und ein Volvo und warteten, begannen ebenfalls zu hupen, weil sich nichts bewegte. Martin stieg aus dem Lieferwagen und winkte Sara zu.
»Lass ihn rein. Wir halten den Verkehr auf. Ich finde einen anderen Platz.«
»Und wo willst du den finden? Zehn Straßen weiter?«
Sara signalisierte dem Audi-Fahrer, dass er weiterfahren sollte, bekam aber nur ein Hupen zur Antwort.
Sie seufzte und zog ihre Brieftasche heraus.
»Nein«, sagte Martin, dem klar war, was seine Frau vorhatte.
»Wieso? Vielleicht lässt er sich bestechen«, sagte Sara mit einem unschuldigen Gesicht. »Wenn das nicht funktioniert, dann gebe ich auf. Steig wieder ein.«
Martin drehte sich um und ging zurück zum Lieferwagen. Sara klappte ihren Polizeiausweis auf und hielt ihn dem Fahrer des Audis vor die Nase. Gleichzeitig behielt sie Martin im Auge, damit sie den Ausweis schnell wieder einstecken konnte, falls er sich zu ihr umdrehte. Sie machte dem Idioten im Audi noch einmal deutlich, dass er sich verziehen sollte. Als er weiterhin versuchte einzuparken, beugte sie sich vor und schlug mit beiden Händen kräftig auf die Motorhaube, während sie ihm gleichzeitig ihre linke Gesichtshälfte zuwandte. Die mit den Narben und den Brandverletzungen. Dann starrte sie dem Anzugträger direkt in die Augen, und ihr Blick ließ keinen Zweifel daran, was als Nächstes passieren würde, wenn er sich nicht sofort aus dem Staub machte. Schließlich gab er auf, dieser kleine, unreife Junge im Körper eines alternden Fünfzigjährigen. Mit quietschenden Reifen als kindischem Protest machte er sich davon.
Martin drehte sich um, als er den Motor aufheulen hörte, und schaute sie verwundert an.
»Ist er abgehauen?«
»Hundert Kronen haben gereicht«, sagte Sara und lächelte.
Sie hatte ihr mittlerweile zweigeteiltes Äußeres schon einige Male auf diese Weise eingesetzt.
Ohne diese Erinnerung in ihrem Gesicht würde sie wahrscheinlich selbst nicht glauben, dass all das wirklich geschehen war: Dass sie in diesem brennenden Geräteschuppen gefangen gewesen war, während die Terroristin Abu Rasil kurz davorstand, die Codes zu verschicken, mit denen Atombomben gezündet werden konnten, die sich aus den Zeiten des Kalten Kriegs noch in Deutschland befanden. Bomben, die große Teile Deutschlands in Schutt und Asche gelegt hätten. Sie hatte mit ansehen müssen, wie Agneta Broman erschossen wurde, in deren Familie sie aufgewachsen war, ohne zu wissen, dass Agneta als Doppelagentin operiert hatte. Und auch ihre Jugendfreundin Lotta, Agnetas Tochter, war eine Spionin, die unter dem Decknamen Geiger aktiv gewesen war. Und als wäre das noch nicht genug, hatte sich außerdem herausgestellt, dass Lottas Vater Stellan, der beliebte Showmaster, ein Monster war, auf dessen Konto unzählige sexuelle Gewalttaten an Minderjährigen gingen. Und dieses Monster hatte sich auch an Saras Mutter vergriffen und war somit ihr biologischer Vater. Eine Erkenntnis, die sie immer noch mit Ekel erfüllte.
Dass die eine Hälfte ihres Gesichts von Brandwunden entstellt war, unterstrich nur, was sie immer schon gewusst hatte, dass sie zwei Gesichter besaß. Eine hübsche und anziehende Seite und eine befremdliche und abstoßende. Ein echtes Janus-Gesicht. Wenn Männer lediglich ihre anziehende Gesichtshälfte sahen, bekam sie immer noch die bekannten Anmachsprüche zu hören, genau wie früher, aber sobald sie die Narben sahen, schraken sie zurück.
Sara hatte ihr zweigeteiltes Gesicht allmählich lieben gelernt, weil es etwas von ihrem Innenleben offenbarte, aber ihr auch vor Augen führte, dass sie nicht auf ihr Gesicht angewiesen war, um schön zu sein. Sie war Sara Nowak, auch wenn ihre Umgebung vor ihr zurückschreckte. Sie war tatsächlich mehr Sara als jemals zuvor.
Sie würde sich noch etlicher plastischer Eingriffe unterziehen, aber die Ärzte wollten ihr nichts versprechen. Die Narben würden vielleicht für immer bleiben.
Aber sie war froh, überlebt zu haben. Es scherte sie nicht, dass die Leute sie manchmal anstarrten. Wenn sie bedachte, welche inneren Wunden sie erlitten hatte, dann konnten diese Narben ruhig auf der Oberfläche erscheinen. Vielleicht war es an der Zeit, mehr Platz für sich zu beanspruchen, dafür einzustehen, wer sie war. Nicht nur im Verhältnis zu anderen, sondern als sie selbst. Nicht als Polizistin, Mutter, Ehefrau oder Tochter, sondern als Sara.
Ihr rotes Haar, das sie immer braun gefärbt hatte, durfte sich jetzt auch wieder zeigen. Sie arbeitete nicht mehr als Fahnderin bei der Sitte, also musste sie es nicht mehr verstecken, um leichter in der Menge untertauchen zu können. Sie hatte bemerkt, dass ihr genau das immer schwerer fiel, das Untertauchen, das reine Beobachten. Am Ende war sie einem verhafteten Freier gegenüber gewalttätig geworden, was beinahe zu ihrem Rauswurf geführt hatte, und sie nahm an, dass ihr Verhalten diesem Mann sowieso völlig gleichgültig gewesen war.
Die Gewalt, der sie ständig ausgesetzt gewesen war, hatte sie immer schon schockiert, aber beinahe noch erschütterter war sie von der Gewalt, die sie selbst bei der Jagd auf Abu Rasil angewendet hatte. Sie hatte einen anderen Menschen erschossen, ohne mit der Wimper zu zucken. Mit dem teuren Jagdgewehr des Nachbarn. Was wäre passiert, wenn sie nicht daran gedacht hätte, dass Carl Magnus, der Freund der Bromans, den alle nur CM nannten, diese Waffe besaß?
Sie träumte immer noch von dieser Nacht. Das Feuer, das Knallen der automatischen Waffen, der Schmerz, als sie von dem Schuss getroffen wurde, das viele Blut, als sie Abu Rasil erschoss, und all das, was daraus folgte.
Obwohl sie vermutlich unendlich viele Menschen vor dem Tod gerettet hatte, sah sich Sara nicht als jemanden, der es leichtfiel, im Kampf gegen den Terror kaltblütig Menschen umzubringen.
Sie war dankbar dafür, diese innere Kraft gefunden zu haben, freute sich über diese Seite von Sara, auch wenn es sie fast das Leben gekostet hätte. Jetzt war es Zeit, sich zu erholen. Es war Zeit, innezuhalten und sich ein Bild davon zu machen, wo sie im Leben stand.
Mittlerweile zeigten sich auch die ersten grauen Haare, die sie bislang noch alle auszupfen konnte. Sie wollte nicht vorzeitig von einer Gesellschaft abgeschrieben werden, die so wenig Respekt vor dem Alter und der Erfahrung hatte. Aber darüber, dass sich ihre Haare bald wie Feuer über ihren Kopf ausbreiten würden, freute sie sich schon jetzt. Sie wollte sich nicht länger verstecken.
Nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, hatte sie einen schönen Sommer verlebt. In völliger Normalität. Keine Spione, keine Sexualverbrecher, keine Toten. Nur sie und ihre Familie. Sie konnte schlafen, baden, lesen und ihre Energie auf völlig unwichtige Dinge verschwenden, wie etwa auf Deppenleerzeichen oder die zu langen Pausen zwischen den Songs auf Depeche Modes Album Ultra.
Und inzwischen ging es ihr gut. Und es würde ihr auch weiterhin gut gehen. Denn das war die wichtigste Lehre, die sie aus den Ereignissen des Frühsommers gezogen hatte: Ihr Wohlergehen und das ihrer Familie waren das Wichtigste.
Martin hatte den Wagen inzwischen geparkt und die Hecktüren geöffnet. Sara starrte in den leeren Laderaum. Wie viele Möbel waren darin schon transportiert worden? In neue Wohnungen, größer als die vorherige, weil jetzt ein Kind zur Familie gehörte, oder in eine kleinere, weil der Partner gestorben war, oder in zwei verschiedene, weil man nicht länger zusammenleben wollte. Oder in die allererste eigene Wohnung. Umzüge, die voller Freude und Erwartung oder in Trauer und Verzweiflung stattfanden.
Saras Gedankengänge wurden von einem irritierenden Geräusch unterbrochen, das von ihrem Handy stammte. Drei schrille Signale mit zunehmender Lautstärke. Sie hörte diesen Klingelton so selten, dass sie beinahe vergessen hatte, was er bedeutete. Ein Videoanruf. In der letzten Zeit hatte sie die meisten Anrufe einfach ignoriert. Hatte keine Lust gehabt, sich mit Telefonverkäufern oder Kollegen zu unterhalten. Es war beinahe zu einem Reflex geworden, jeden Anruf wegzudrücken und auch den Anrufbeantworter zu ignorieren. Ihre Kollegin und beste Freundin Anna hatte sich schon einige Male deswegen beschwert, aber Sara war nicht in der Verfassung, sich ständig mit ihrer Umwelt auseinandersetzen zu können. Noch nicht. Aber das hier war ein anderer Klingelton, und vielleicht reagierte sie gerade deswegen darauf.
»Nadia möchte Facetime starten«, stand auf dem Display.
Die einzige Nadia, deren Nummer Sara im Telefonbuch gespeichert hatte, war eine der Prostituierten auf der Malmskillnadsgatan. Eine von den vielen, die aus ihrem Heimatland hierhergelockt und dann gezwungen wurden, ihren Körper zu verkaufen, um erfundene Schulden abzubezahlen und ihre Familie in der Heimat vor Nachstellungen zu schützen. Manchmal wurde gedroht, die kleine Schwester derselben Behandlung auszusetzen, falls die entführte Frau nicht genau das machte, was die Menschenhändler von ihr verlangten.
Obwohl Sara nicht mehr bei der Sitte arbeitete, fühlte sie sich auf eine gewisse Weise immer noch verantwortlich für die Frauen, die sie dort getroffen hatte. Sie hatte das Gefühl gehabt, dort aufhören zu müssen. Bevor sie etwas richtig Dummes tat. Aber sie konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass sie damit auch diejenigen im Stich gelassen hatte, die sie am meisten brauchten. Jetzt wollte sie also gerne helfen, wenn sie konnte.
Falls Nadia sie nicht einfach versehentlich angerufen hatte, was vielleicht die nächstliegende Erklärung war.
Als Sara den Videoanruf annahm, blickte sie in ein blutüberströmtes Gesicht.
Nadia. Verprügelt und kaum bei Bewusstsein.
Ihr Mund bewegte sich, als wollte sie etwas sagen.
»Wo bist du?«, fragte Sara, nachdem sie den Ernst der Lage erkannt hatte. »Zeig es mir mit deinem Handy. Show around you!«
Nadia drehte die Hand und ließ die Kamera über die Umgebung wandern. Anscheinend lag sie auf dem Boden. Auf einem offenen, asphaltierten Platz neben einer Art Lagerhalle. Jede Menge Container waren aufeinandergestapelt, die Schriftzüge darauf in fremden Sprachen. Weiter entfernt standen Bäume, ein ganzer Wald. Und der Kaknäs-Turm. Und dann ein langes rotes Backsteingebäude mit der Aufschrift »Freihafen«.
»Ich komme!«, rief Sara Nadia zu. Sie drückte das Gespräch weg, als Martin und Olle einen weiß gestrichenen Schreibtisch aus dem Hauseingang trugen.
»Ich muss los.«
»Jetzt? Mitten im Umzug?«
»Ich bin bald wieder zurück!«, rief Sara und lief zu einem der roten Taxis, die in Höhe der Forex-Bank standen. »Zum Freihafen«, sagte sie und setzte sich auf den Beifahrersitz. »So schnell, wie Sie können«, fuhr sie fort und zeigte ihren Dienstausweis.
Mit einer Polizistin an der Seite hatte der Fahrer keine Bedenken, was Geschwindigkeitsüberschreitungen anging. Mit riskanten Überholmanövern und plötzlichen Spurwechseln bei Tempo neunzig hatten sie den Freihafen in wenigen Minuten erreicht.
Sara versuchte Nadias genaue Position zu bestimmen und lotste den Fahrer mit Hilfe der Filmaufnahmen weit hinaus zu einem Gebäude mit der Bezeichnung »Magasin 7«.
Sie kamen an einem riesigen roten Backsteingebäude vorbei, in dem Produktionsfirmen und ein Auktionshaus untergebracht waren. Autos mit den aufgedruckten Logos unterschiedlicher Fernsehsender waren davor geparkt. Sara kannte keines davon. Magasin 7 lag in einem Bereich, in dem Container für internationale Transporte umgeschlagen wurden.
Der Freihafen war unbekanntes Terrain für Sara. Hier sah die Welt ganz anders aus. Der Himmel war hoch und weit, legte sich aber trotzdem wie ein Deckel über die Szene. Dass die Abstände zwischen den riesigen Gebäuden so groß waren, verzerrte die Perspektive. Sie hatte das Gefühl, die alten Lagerhallen und das große Silo berühren zu können, obwohl sie doch mehrere hundert Meter entfernt lagen. Sie fühlte sich riesig und gleichzeitig winzig klein.
Früher war der Freihafen eine Hochburg des Sexhandels gewesen, erinnerte sich Sara. Dank der Seeleute von den Schiffen, die hier einliefen, und der Familienväter, die die Abgeschiedenheit des Ortes zu schätzen wussten. Aber das war, bevor die ganzen Medienbetriebe einzogen. Jetzt arbeiteten die Leute hier rund um die Uhr, und man war selten ganz allein, außer vielleicht draußen auf den Piers. Soweit Sara wusste, gab es jetzt keinen Sexhandel mehr im Freihafen. Was also konnte Nadia passiert sein?
Sie entdeckte sie sofort, nachdem sie in den offenen Wendehammer eingebogen waren. Leblos und blutüberströmt. Hinter ihr stand die hohe Mauer aus Containern unterschiedlicher Logistikfirmen. Kein Mensch war zu sehen. Sara sprang aus dem Taxi und lief zu Nadia.
Blaue Flecken, eine geplatzte Augenbraue, ein paar ausgeschlagene Zähne, zerfetzte Lippen, heftige Blutergüsse an Armen und Beinen. Womöglich hatte sie auch innere Verletzungen. Nadia musste sofort ins Krankenhaus. Also rief sie die 112 an.
»Sara Nowak, Polizei Stockholm. Ich befinde mich im Freihafen bei einer schwer verletzten Frau. Sie braucht sofort einen Rettungswagen.«
»Geben Sie mir Ihre Adresse?«
»Ich weiß es nicht. Im Freihafen. Draußen bei den Containern.«
»Wir brauchen eine genaue Adresse.«
»Ich habe keine Adresse! Im Freihafen! Im hinteren Teil!«
»Beruhigen Sie sich, bitte.«
»Hören Sie nicht, was ich Ihnen sage?! Sie ist schwer verletzt! Machen Sie Ihren verdammten Job und schicken Sie einen Rettungswagen!«
Die Frau in der Leitstelle beendete das Gespräch.
»Verdammte Idiotin!«, schrie Sara ins Handy.
In Gedanken sah sie sich, wie sie die Räumlichkeiten der Leitstelle stürmte, um diese blöde Kuh zu finden. Aber dann wandte sie sich an den Taxifahrer.
»Sie muss ins Krankenhaus«, sagte sie.
»Kein Blut in meinem Auto«, sagte der Fahrer. »Erst müssen Sie bezahlen. Dann rufen Sie Rettungswagen.«
»Das habe ich doch gerade versucht. Sie haben es ja gehört. Sie muss wirklich ins Krankenhaus.«
»Kein Blut in meinem Auto. Das hier ist mein Job, wissen Sie. Wenn Blut im Wagen ist, keiner will fahren.«
»Ich lege meine Jacke unter sie.«
»Nein.«
»Sie kriegen tausend Kronen extra.«
»Hören Sie, wenn Blut im Auto, ich kann zwei Tage lang nicht fahren. Muss das Auto waschen.«
»Zweitausend.«
»Okay. Steigen Sie ein. Aber Jacke drunter.«
Sara sah Nadia an.
»Hörst du mich, Nadia?«
Ihre Augenlider schienen zu flackern, aber Sara wusste nicht, ob Nadia bei Bewusstsein war.
»Wir müssen ins Krankenhaus.«
Ein kaum wahrnehmbares Nicken. Dann öffneten sich die Augen einen kleinen Spalt. Nadia legte eine zitternde Hand auf Saras verbrannte Wange.
»Was ist passiert?«
Sara legte ihre Hand auf Nadias. Spürte die raue Oberfläche der Brandwunde unter den Fingerspitzen.
»Ein Unfall«, sagte sie sanft, und Nadia schloss die Augen, beruhigt. »Aber was ist passiert?«
Nadia setzte ein paar Mal an, bevor es ihr gelang zu antworten.
»Peepshow.«
»Was für eine Peepshow?«
Aber Nadia schaute sich nur um.
»Meine Tasche …«
Sara sah die Panik in Nadias blutunterlaufenen Augen. Sie hob die Tasche auf, die direkt neben Nadia lag.
»Diese hier?«
»Da drin …? Inside?«
Sara öffnete die Handtasche und fand ein dickes Bündel Tausend-Kronen-Scheine. Sie zeigte Nadia das Geld, die sich daraufhin spürbar beruhigte. Sie nahm die Handtasche und drückte sie an die Brust.
»Was ist das für Geld?«, fragte Sara. »Where is the money from?«
»Warn Jenna«, sagte Nadia, ohne die Augen zu öffnen. »Please. No good.«
»Warnen? Wovor denn? For what? Nadia?«
Keine Antwort.
Sara stand auf, um die Sachen einzusammeln, die aus der Handtasche gefallen waren, möglicherweise, als Nadia nach dem Handy gesucht hatte, damit sie Hilfe rufen konnte. Schminkutensilien, Schlüssel, Brieftasche, Halstabletten, Kondome, ein paar Pillen-danach, Reizgas, ein Stilett, Kopfhörer und ein kleines, zotteliges Kuscheltier. Und direkt neben Nadia lag ihr Handy.
Sara überlegte nur kurz, bevor sie Nadias Daumen auf den Fingerabdruck-Sensor drückte. Ohne Erfolg. Mit dem Zeigefinger klappte es besser. Im Telefonbuch fand sie die Nummer einer »Jenna«, bekam aber keine Antwort. Sie versuchte, die Nummer mit ihrem eigenen Telefon zu erreichen. Dasselbe Ergebnis. Vielleicht war es schon zu spät?
Da sie ohnehin Zugang zu Nadias Handy hatte, rief Sara auch die Anruflisten und Textnachrichten der letzten Tage auf und fotografierte sie mit ihrem eigenen Handy ab. Die letzten Gespräche stammten vom Abend zuvor, in der Nacht und am Morgen waren die Anrufe unbeantwortet geblieben, bis am Ende der Liste Nadias FaceTime-Anruf mit Sara auftauchte.
Sara betrachtete Nadias Handy. Sie hatte dasselbe Modell wie ihre Tochter Ebba. Und sie waren ungefähr im selben Alter. Und dennoch lebten sie in völlig unterschiedlichen Welten.
4
Sara hatte das Personal der Notaufnahme im St-Göran-Krankenhaus gebeten, auf Nadias Handtasche aufzupassen und sie zu benachrichtigen, sobald sie in der Lage wäre, ein Gespräch zu führen. Während sie sich auf dem Weg zum Ausgang befand, meldete sich ihr schlechtes Gewissen immer deutlicher. Wieder war ihr die Arbeit wichtiger als ihre Familie gewesen. Eine Arbeit, die sie nicht einmal mehr hatte. Ihre alte Einheit war aufgelöst worden, und sie hatte es vorgezogen, sich auf eine andere Stelle zu bewerben, statt sich der neuen Ermittlungsgruppe »Menschenhandel« anzuschließen. Sie hatte eingesehen, dass die Arbeit sie aufgefressen hatte. Sie war nicht mehr zuständig für die Frauen auf der Straße und in den Wohnungsbordellen. Aber dennoch spürte sie eine Verantwortung. Auf eine Weise, wie sie alle Menschen spüren sollten. Sie war einfach verpflichtet gewesen, Nadia zu helfen. Als Mitmensch. Aber jetzt musste David übernehmen. Sara hatte geschworen, sich mehr um ihre Familie zu kümmern und ihr berufliches Engagement auf ein normales Niveau zu senken. Also rief sie auf dem Weg in die Stadt ihren alten Kollegen an.
»Wie geht es dir?«, fragte David direkt.
Inzwischen nahmen alle besondere Rücksicht auf sie. Schlichen auf Zehenspitzen um sie herum. Vielleicht weil die Brandverletzungen eine so konkrete Erinnerung an das waren, was sie durchgemacht hatte? Wie auch immer, mittlerweile war Sara am liebsten allein, wollte den besorgten Blicken entgehen. Gleichzeitig wollte sie bei ihrer Familie sein, sie im Auge behalten, dafür sorgen, dass alle sicher waren. Sie war da einfach zwiegespalten.
»Alles ist gut«, sagte sie nur, ohne weiter darauf einzugehen. Dann erzählte sie ihm von Nadia und was ihr gerade zugestoßen war. Von einer Peepshow wusste auch David nichts, aber er würde sich mal umhören. Er war ebenfalls überrascht, dass nach all den Jahren wieder Prostituierte im Freihafen auftauchten. Vielleicht hatte ein ausländisches Schiff angelegt, das sie angelockt hatte. Aber warum sollte es eine Peepshow an Bord haben? David bekam Jennas Nummer und versprach, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Er fügte noch hinzu, dass er sich melden würde, sobald er mehr wusste, dann beendeten sie das Gespräch.
Sara kürzte quer über den Fridhemsplan ab und ging die Hantverkargatan hinunter.
Im Augenblick fühlte sich alles gut an, stellte sie erstaunt fest.
Eigentlich war dies der vielleicht schwierigste Tag in ihrem ganzen Leben, aber sie war so froh, dass sie überhaupt dabei sein konnte, dass sie schließlich auch die damit verbundene Tatsache akzeptiert hatte.
Ihre Tochter Ebba zog von zuhause aus.
Ebba, die ihre Vertraute werden sollte, ihre beste Freundin, der sie in ihrer Eigenschaft als Mutter mit all ihrer teuer erkauften Erfahrung durchs Leben helfen sollte. Aber Ebba wollte ihre Hilfe nicht. Es war ihr nicht klar, ob es daran lag, dass Sara so oft nicht da gewesen war, ob es einfach zu ihrer Persönlichkeit gehörte oder ob letztendlich alle Töchter gegen ihre Mütter aufbegehrten, indem sie sich weigerten, ihre Hilfe anzunehmen. Sara selbst hatte ihre Mutter Jane ebenfalls viele Jahre lang nicht an sich herangelassen, weil sie geglaubt hatte, dass sie ihr Leben zerstört hatte, als sie mit ihr vom hübschen Ufergrundstück der Bromans in die triste Zweizimmerwohnung in Vällingby gezogen war. Erst sehr viel später war ihr klar geworden, dass Jane sie damit vor dem Zugriff ihres widerwärtigen Vaters gerettet hatte.
Was Ebba wohl von Saras Fürsorge hielt? Fühlte sie sich zu sehr kontrolliert? Glaubte sie, dass Sara dabei nur an sich selbst dachte?
Wenn man neunzehn war, hatte man keine Ahnung, was man alles noch nicht wusste, dachte Sara, als sie die Hökens gata zum Mosebacke hinaufstieg. Sie schielte zu dem großen Terrassenrestaurant auf der anderen Seite des Södra Teaterns hinüber und dachte daran, an wie vielen Sommerabenden sie dort als junger Mensch gesessen hatte. Alles sah noch fast genauso aus wie damals, obwohl es schon mehr als zwei Jahrzehnte her war. Die ganze Stadt war wie ein Fotoalbum. So viele Häuser und Orte waren mit Erinnerungen aufgeladen, mit Spuren der Vergangenheit. Es fühlte sich beinahe so an, als könnte sie in der Zeit zurückreisen zu jenen Tagen, jenen Abenden, sich zu den Freunden gesellen, die sich vor so vielen Jahren an diesen Tischen versammelt hatten. Als bräuchte sie sich nur umzudrehen, und schon wären alle wieder da.
Oben auf dem Platz hatte sich allerdings etwas verändert, nicht nur, dass die Telefonzelle inzwischen nur noch als Dekor diente, sondern dort gab es jetzt auch ein kleines Außencafé, das »Woodstockholm«. Genialer Name, dachte Sara voller Ironie. Auf dem Bürgersteig gegenüber dem Café sah sie ihre Mutter vor Ebbas neuer Wohnung stehen. Sie wartete dort neben ein paar großen Kartons. In gebügelter und farblich abgestimmter Arbeitskleidung. Lila, Rosa und Weiß. Sara konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Sie selbst trug einfach nur eine Jeans und ein T-Shirt. Martins altes Joy-Division-T-Shirt. So wie Sara das sah, hatte er die Musik sowieso nie wirklich gemocht, also hatte sie ihm auch das Recht abgesprochen, das T-Shirt zu tragen. Am Bordstein parkte Ebbas VW-Beetle, ein mokkabraunes Cabriolet, das sie von ihrem Großvater Eric zum Abitur geschenkt bekommen hatte. Es hatte drei Knöllchen unter dem Scheibenwischer. Sara beschloss, sich auf einen harten Streit mit ihrer Tochter, ihrem Mann und ihrem Schwiegervater einzulassen, sobald es um die Frage ging, wer das Bußgeld bezahlen sollte.
»Hatten wir nicht neun Uhr gesagt?«, fragte Jane, statt sie zu begrüßen.
»Sind die anderen noch nicht da?«
Sara sah sich um.
»Martin ist erst vor zwei Stunden mit dem Umzugswagen zu ihrer alten Wohnung gekommen. Stehst du hier schon eine ganze Stunde?«
»Zwei. Ich wollte pünktlich sein.«
»Aber Mama, du kennst uns doch!«
»Die Hoffnung stirbt zuletzt.«
»Was ist denn das hier?«
Sara betrachtete die großen Kartons von Hästens und Montana mit Stirnrunzeln. Teures Bett. Teure Möbel. Empfängerin: Ebba Titus. Rechnungsadresse: Martin Titus und Eric Titus.
»Hast du die angenommen?«
»Ja.«
Was für ein Glück für Ebba, dass Jane vor Ort war. Bedanken würde sie sich dafür bestimmt nicht.
»Kannst du dir das vorstellen«, sagte Jane. »Diese Idioten meinten, sie könnten es nur Ebba geben. ›Das ist mein Enkelkind‹, sagte ich. Und sie: ›Wir können solch teuren Sachen nicht einfach hierlassen.‹ Ich darauf: ›Dann rufe ich eben Ihren Chef an.‹«
»Und dann haben sie nachgegeben?«
»Ja? Was denkst du? Hätte ich nachgeben sollen?«
Jane folgte Saras Blick, der sich auf die Möbel richtete.
»So etwas konnte ich dir nicht geben, als du ausgezogen bist.«
»Nein. Dafür habe ich gelernt, für mich selbst zu sorgen.«
»Für dich selbst zu sorgen«, schnaubte Jane verächtlich. »Warum musstest du für dich selbst sorgen? Ich musste für mich selbst sorgen, als ich jung war, und es war schrecklich. Ich hätte dir gerne geholfen. Mit allem, was mir zur Verfügung stand.«
»Du hast mir beim Wichtigsten von allem geholfen. Ich wusste nur nichts davon.«
»Hast du es erzählt?«, fragte Jane und sah sie scharf an.
»Über Stellan? Nein. Das werde ich niemals tun.«
Jane hatte ständig auf Sara eingeredet, dass sie ihrer Familie erzählen sollte, wer ihr Vater war. Als Kind wäre sie unendlich stolz darauf gewesen, aber inzwischen war das unmöglich. Absolut ausgeschlossen.
»Dieses Haus gehört auch dir.«
Sara zuckte zusammen und sah ihre Mutter an.
»Stellans Haus? Warum sollte ich es haben wollen?«
»Weil es deins ist.«
»Ich will es nicht haben. Es ekelt mich an.« Sara schwieg, angewidert von allem, was sie über ihren Vater erfahren hatte, aber dann sah sie ihre Mutter wieder an. Die so entschlossen aussah, wie nur Jane aussehen konnte.
»Mama, sag den anderen nichts.«
»Was soll ich nicht sagen?«
»Das von Stellan.«
»Das ist nicht nur deine Entscheidung. Er ist ihr Großvater.«
»Ja, ja. Aber …«
Endlich kam Martin mit dem gemieteten Lieferwagen von der Östgötagatan um die Ecke gefahren. Während er um den Platz herumfuhr, legte Sara ihre Hand auf Janes Arm und wiederholte ihre Bitte.
»Versprich es mir!«
»Ja, ja«, sagte Jane müde. »Ich kann es dir versprechen. Kein Problem. Wenn du mir versprichst, es selbst zu tun.«
»Nicht jetzt.«
Martin parkte den Wagen ein und sprang aus dem Führerhaus, immer noch mit einer gewissen jungenhaften Art, fand Sara. Allerdings war sie sich nicht sicher, ob sie natürlich oder aufgesetzt war. Ihr war nicht verborgen geblieben, dass ihr geliebter Mann große Probleme mit seinem nahenden fünfzigsten Geburtstag hatte. Nur noch ein paar Jahre, dann war es vorbei. Währenddessen hatte er die Haare wachsen lassen, die Jacketts gegen Lederjacken, Kapuzenpullis und Stiefel getauscht und immer intensiver mit seiner Band geübt, einer Combo aus älter werdenden Herren mit dem selbstironischen Namen C. E.O. Speedwagon – sämtliche Mitglieder waren Männer in Führungspositionen. Allerdings konnte Sara feststellen, dass Martin immer noch die Blicke der Frauen auf sich zog, wenn sie durch die Stadt gingen, selbst von bedeutend jüngeren, also sollte sie wohl stolz auf ihren Fang sein. Gleichzeitig war sie sich bewusst, dass auch die besonders hübsch verpackten Geschenke leer sein konnten. Wie verhielt es sich da mit ihrem Mann?
Ebba stieg aus dem Lieferwagen, mitten in einem erregten Telefongespräch.
»Was heißt denn ›bereits geliefert‹?! Wohin denn? An wen? ›Weiß nicht‹?!?« Sie hielt ihr Handy ans Ohr gedrückt und merkte nicht, dass ihre Mutter ihr diskret zuwinkte. »Wenn Sie meine Sachen verschlampt haben, müssen Sie sie ersetzen! Schicken Sie neue, heute noch! Am Abend habe ich meine Einweihungsparty!«
»Ebba!«, brüllte Sara, und als ihre Tochter sie endlich wahrnahm, zeigte sie auf die Kartons, die vor der Haustür standen. Ebba drückte das Gespräch weg.
»Aha, schön«, war alles, was sie dazu sagte. Dann umarmte sie ihre Großmutter. Aber ihre Mutter nicht, dachte Sara resigniert.
Martin gab Sara einen Kuss, ging um den Wagen herum und öffnete die Heckklappe, um einen Karton mit Kleidung herauszuholen. Sara ging zu ihm, um mit dem Rest zu helfen, aber das Auto war vollkommen leer.
»Wo sind die Möbel? Und alle anderen Klamotten?«
»Ich habe sie bei euch gelassen«, sagte Ebba. »Ich muss mir ohnehin neue kaufen.«
»Neue kaufen? Du hast doch mindestens zehn Kartons mit Kleidung! Und deine Möbel! Du musst doch eine ganze Wohnung einrichten.«
»Komm schon, das waren doch Kindersachen.«
»Wir hatten alles nach unten getragen und den Wagen vollgeladen, als sie sich plötzlich anders entschied.« Martin zeigte sein jugendlich charmantes Wolfsgrinsen, das er immer dann aufsetzte, wenn er die Wogen glätten wollte. »Dann mussten wir eben alles wieder nach oben tragen.«
»Und was machst du jetzt?«, fragte Jane, ohne auf diesen Wortwechsel einzugehen. »Wie willst du die Miete bezahlen?«
»Ich arbeite«, sagte Ebba. »Und ich werde in Zusatzkursen meine Abschlussnoten aufbessern, damit ich mich nächstes Jahr an der Handelshochschule bewerben kann.«
»Sie hat einen Job bei Eric bekommen«, sagte Sara. »Am Empfang.«
»Es ist eine Traineeausbildung«, sagte Ebba. »Ich werde das ganze Unternehmen kennenlernen. Und dabei fange ich von ganz unten an.«
»Nur ein kleiner Tipp«, sagte Sara. »Sag den anderen am Empfang nicht, dass sie für dich ganz unten sind.«
Ebba zuckte mit den Schultern.
»Whatever.«
»Wo ist Olle?«, fragte Sara mit einem Seufzen und redete sich ein, dass sie nicht jeden Streit bis zum Ende ausfechten musste. »Du hast ihn doch wohl nicht zu Hause gelassen?«
»Nein, natürlich nicht. Er …« Martin sah sich um. »Er ist wohl noch im Auto?«
Sara warf einen Blick in die Fahrerkabine, in der tatsächlich ihr vierzehnjähriger Sohn saß. Mit ein paar großen Beats-Kopfhörern, die an sein Handy angeschlossen waren, schmetterte er ohne jedes Taktgefühl:
»You don’t know where I’ve been, you only see the color of my skin.«
Sara betrachtete Olles Hautfarbe, die ziemlich blass dafür war, dass ein ganzer Sommer hinter ihnen lag. Aber er machte einen engagierten Eindruck, das war wohl ein gutes Zeichen.
»But I’m your brother, I’m your next of kin!«
Anschließend nickte er im Takt der Musik. Das war Martins Art, Kontakt mit seinem Sohn zu halten: Er ließ ihn machen, was er wollte, und bestärkte ihn in allem. Eher ein Kumpel als ein Vater. Aber so waren heutzutage wohl die meisten Väter, dachte Sara. Olle bemerkte die Anwesenheit seiner Mutter, hielt die Musik an und nahm die Kopfhörer ab.
»Hallo«, sagte er.
»Guter Song?«
»Verdammt gut. Uncle Scam.«
»Was sagst du. Mama Scan?«
»Uncle Scam!«
»Okay.«
Immerhin ein Künstler, dessen Namen Sara schon gehört hatte. Uncle Scam würde diese Woche in Stockholm auftreten, und laut Martin war das ein Riesending. Der im Augenblick meistverkaufte Künstler der Welt. Die Friends Arena war zweimal bis auf den letzten Platz gefüllt. Ihn nach Schweden zu bekommen war das Größte was Go Live jemals zustande gebracht hatte, obwohl der Künstler kaum geboren war, als Martin seine Konzertagentur vor mehr als zwanzig Jahren gegründet hatte. Aber Sara wusste, wie wichtig der Deal war, eine große Feder, die Martin sich an den Hut stecken konnte. Und sie wusste auch, dass der Rapper seinen Künstlernamen Un¢le $cam schrieb, mit dem Dollar- und dem Cent-Zeichen. Das hatte Olle für absolut genial gehalten. Eine unerbittliche Kritik an der westlichen Konsumgesellschaft. Und das von einem Dreiundzwanzigjährigen, der sich Autogramme bezahlen ließ und jedes Jahr T-Shirts für Hunderte von Millionen verkaufte.
»Komm raus und hilf mit«, sagte Sara.
»Aber da ist doch nichts. Ein Karton oder so.«
»Und ein paar schweineteure Sachen, die dein Vater und dein Großvater für Ebba gekauft haben. Komm schon, du musst dich bewegen. Du kannst mit deinem Vater zusammen das Bett tragen.«
»Ich kann nicht. Ich muss los«, sagte Martin im gleichen Augenblick und sprang hinter das Steuer.
»Wo musst du denn hin?«, fragte Olle, sodass Sara die Frage nicht zu stellen brauchte, was insofern positiv war, als sie wesentlich verärgerter geklungen hätte.
»Das Fest vorbereiten.«
Olle schien die Antwort anscheinend zufrieden zu stellen, er setzte sich die Kopfhörer auf, schaltete die Musik wieder an und stieg aus dem Wagen, johlte schräg:
»Don’t you know every yang needs a yin, don’t you know I’m the original sin, my own evil twin, so let it begin!«
Aber statt zu helfen, setzte er sich auf einen der großen Kartons vor der Haustür und sang weiter. Ebba schrie auf:
»Mein Regal!«
Sie rannte zu Olle und zog ihn von dem Montana-Karton hoch. Er ließ sich ohne Widerstand zur Seite schieben, war es gewohnt, dass die große Schwester die Entscheidungen traf.
Sara wandte sich an Martin.
»Du musst das Fest vorbereiten? Ihr habt doch Leute angeheuert?«
»Klar, aber die machen nicht alles. Die Programmplanung, kontrollieren, dass alles am richtigen Platz ist, die Probe mit der Band.«
Da klemmte also der Schuh. Die Band. Martins Band.
»Die können doch noch ein bisschen warten, oder?«
»Hallo? Es ist das zwanzigste Firmenjubiläum. Es kommen die Chefs aus den USA.«
Bei dem Gedanken, dass Martin vor ein paar steinharten Executives von der anderen Seite des großen Teichs den Rockstar spielen wollte, musste Sara lachen. Martin sah sie verständnislos an, schien dann aber der Erklärung zuzuneigen, dass sie sich darüber freute.
»Wann kommst du? Es fängt um sieben an, aber es ist früh genug, wenn du um neun da bist. Wir treten erst auf, wenn die Leute ein bisschen auf Touren gekommen sind.«
Bevor Sara antworten konnte, hielt ein schwarzer Maserati Quattroporte Trofeo neben dem Lieferwagen. Die Beifahrertür öffnete sich, und Martins Mutter Marie stieg aus. Sie trug ein sportliches Outfit in Pastellfarben mit einer Masse Polospieler darauf. Und einen Sonnenschild wie die Croupiers an Roulette-Tischen oder die Dealer beim Poker in einem Lucky-Luke-Band trugen, dachte Sara. Aber ihr war klar, dass es bei Marie nur ein schickes Accessoire war. Eric trug seine Golfkluft und hatte die Tasche im Kofferraum. Er war wahrscheinlich mit den Hühnern aufgestanden, damit er vor dem Umzug noch achtzehn Löcher spielen konnte.
»Opa!«, flötete Ebba, lief zum Auto, öffnete die Tür auf der gegenüberliegenden Seite und fiel Eric um den Hals.
»Ein Einzugsgeschenk«, sagte Eric und gab Ebba einen kleinen Karton.
Als ob die Möbel für zehntausende von Kronen noch nicht reichten. Und eine Wohnung für mehrere Millionen.
»Ein neues Handy!«, schrie Ebba. »Danke!«
Damit schwand Saras letzte Möglichkeit, ihre Tochter kontrollieren zu können. Sie hatte sich Ebbas aktuelles Handy ausgeliehen und ihren eigenen Fingerabdruck eingegeben, sodass sie Ebbas Bekanntenkreis und die Webseiten, die sie besuchte, im Auge behalten konnte. Dieses neue Handymodell hatte eine Gesichtserkennung, was es für Sara sehr schwermachen würde, sich einzuloggen, ohne dass Ebba es bemerkte. Außerdem würde ihre Tochter ab jetzt in der eigenen Wohnung schlafen, also musste sie wohl einfach akzeptieren, dass es vorbei war. Die Leinen waren losgemacht, das Schiff Ebba segelte davon. Und ließ Sara an Land zurück.
»Und dann noch eine Kleinigkeit.«
Eric gab Ebba einen Aufkleber in L-Form, den sie hinten auf sein Auto heftete.
»Willst du jetzt eine Übungsfahrt machen?«, fragte Sara.
»Ja.«
»Und der Umzug?«
»Ich springe für sie ein«, zwitscherte Marie mit ihrer muntersten Stimme und winkte fröhlich mit der Hand.
»Aber du hast doch dein eigenes Auto, warum nimmst du nicht das?«, fragte Sara. »Und parkst es so, dass du keine Strafzettel bekommst.«
»Das ist doch so klein. Das von Opa ist besser.«
»Sag nicht Opa«, warf Eric ein. »Das klingt, als wäre ich hundert Jahre alt. Sag Eric.«
Sara wusste jetzt zumindest, wo Martin seine Angst vor dem Älterwerden herhatte. Dann fiel ihr Blick auf Marie, die gerade ihr Make-up kontrollierte, und sie begriff, dass Martin auf diesem Feld doppelt vorbelastet war.
»Kommt ihr heute Abend?«
Martin beugte sich aus dem Seitenfenster und sah seinen Vater erwartungsvoll an. Mit dem unstillbaren Wunsch des Sohnes nach Bestätigung, dachte Sara und fühlte sich sofort schlecht. Natürlich wollte man die Wertschätzung seiner Eltern, auch wenn man schon fünfzig war und eine große Firma leitete.
»Natürlich«, antwortete Marie. »Das ist doch dein großer Tag. Und auf Ebbas Einweihungsparty dürfen wir ja nicht kommen.« Die Großmutter lächelte ihr Enkelkind freundlich an. Sara fragte sich, wie sie die ganze Zeit so fröhlich sein konnte. Auf welchem Trip war sie? Sherry? Lebenslügen? Oder einfach nur eine perfekte Kinderstube? Irgendetwas an ihrer Schwiegermutter erinnerte sie an ein Vollblutpferd. Sorgsam gezüchtet, dressiert und pedantisch gepflegt, damit sie stets ihre Höchstleistung brachte. Niemals auch nur der kleinste Durchhänger.
»Die ist nur für meine Freunde«, sagte Ebba und lächelte süß. »Ihr dürft das nächste Mal kommen.«
Sara konnte einfach nicht herausfinden, ob Ebba ihre Großeltern väterlicherseits wirklich liebte oder ob sie nur darum bemüht war, dass die Geschenkeflut nicht abriss. Sie wusste allerdings genau, wie sauer Ebba wäre, wenn sie ihr diese Frage direkt stellen würde.
Sara schaute dem großen schwarzen Auto nach, als Ebba und Eric losfuhren. Nicht ein einziges Mal hatte ihre Tochter darum gebeten, eine Übungsfahrt mit Sara machen zu dürfen. Sie war wohl davon ausgegangen, dass ihre Mutter ungeduldig sein und sich über sie ärgern würde, aber im Grunde war es Ebba, die sich ständig über Sara ärgerte. Sie war einfach in dem Alter, in dem man seine gesamte Wut auf die Umgebung projizierte. Sara war sich nicht ganz sicher, ob sie selbst aus diesem Alter jemals herausgewachsen war, sie hoffte es zumindest.
Der Maserati bog nach rechts in die Östgötagatan ab, deren Name von den Stockholmern anders als im Rest des Landes ausgesprochen wurde. Sprach man ihn richtig aus, war sofort klar, dass man ein Landei war.
Jetzt war der Wagen verschwunden.
Wenn sie Ebba das nächste Mal sah, würde ihre Tochter nicht mehr zu Hause wohnen.
Sie hätte eine eigene Wohnung und einen richtigen Job. Bei ihrem Großvater.
Sara wurde bewusst, dass sie ein bisschen eifersüchtig war. Es war verdammt einfach, ständig mit Geschenken zu kommen, wenn einem danach war, und die ewigen Streitigkeiten zu Hause zu ignorieren. Eric hatte sich Martin gegenüber bestimmt genauso verhalten, hatte die ganze Zeit gearbeitet, als Martin aufwuchs, hatte nie den Stress gehabt, ihn morgens aufwecken und zur Schule schicken zu müssen oder ihn ständig an die Hausaufgaben zu erinnern. Und jetzt surfte er mit den Taschen voller Geld bequem durchs Leben. Es war so leicht, sich Liebe zu kaufen.
Musste sie mit ihrem Schwiegervater um ihre Familie kämpfen? Ebba schien schon verloren zu sein, aber Sara gehörte nicht zu den Leuten, die so leicht aufgaben.
Kurz danach fuhr auch Martin los, und Olle war vollkommen in einen Youtube-Clip versunken, bestimmt einer mit Uncle Scam. Die Männer waren also ein Totalausfall, und der Umzug musste vom alten, ehrwürdigen Matriarchat bewältigt werden. Allerdings von zwei sehr unterschiedlichen Matriarchinnen.
»Nun ja«, sagte Sara. »Dann werden wohl die Mutter und die Großmütter alles erledigen müssen.«
»Martin und Eric haben die Möbel ja gekauft«, verteidigte Marie die Männer.
Die Möbel, ja. Sara hatte etliche hübsche Möbel im Second-Hand-Shop gefunden, aber Ebba wollte nur Markenartikel. Als Neunzehnjährige. In ihrer ersten Wohnung, die sie von ihrem Vater geschenkt bekommen hatte. Für fünf Millionen Kronen. Du lieber Himmel. Sara hatte das alles eigentlich verhindern wollen, damit Ebba ihr Wohnproblem selber lösen musste, aber nach der Tragödie bei den Bromans wollte sie diesen Konflikt mit der Familie nicht mehr eingehen. Sie wollte ihnen nur noch ihre Liebe zeigen. Sie war kurz davor gewesen, sie niemals wiedersehen zu können, und jetzt war ihr einziger Wunsch, so lange wie möglich mit ihnen zusammen zu sein. Was unter anderem bedeutete, Martins und Erics haltlose Geldverschwendung hinnehmen zu müssen. Zumindest fürs Erste.
»Ja, ja«, sagte Sara und gab auf. Dass Sara alles neu kaufte, hatte immerhin den Vorteil, dass sie jetzt nicht so viel hineintragen mussten. »Dann packen wir es an. Könnt ihr den Schrank nehmen, dann tragen Olle und ich das Bett?«
»Sollten wir nicht besser eine Umzugsfirma rufen?«, fragte Marie und sah sich um.
»Nein, das machen jetzt wir. Und dann kaufen wir uns hier draußen einen Kaffee und weihen Ebbas Wohnung ohne sie ein.«
Jane nickte zustimmend, und Marie konnte sich gegen diese vereinte Front nicht mehr durchsetzen.
5
Eigentlich begann Saras Dienst um neun, aber heute durfte sie bis zum Mittag ein paar Überstunden abbummeln, um Ebba beim Umzug helfen zu können. Dann hatte allerdings ihre Kollegin Anna angerufen, und Sara hatte das Gespräch entgegen ihrer Gewohnheit angenommen, wofür sie ein ironisches Lob einheimste. Anna bat sie, so schnell wie möglich zur Arbeit zu kommen, denn es hatte eine Schießerei gegeben. Drei Tote und ein Verletzter auf Ekerö. Anna schickte einen Kartenausschnitt, auf dem der Ort markiert war, und Sara holte das Auto aus der Garage am Slottsbacken. Martin hatte seinen großen, knallgelben Lamborghini Urus, aber Sara weigerte sich, ihn ebenfalls zu benutzen. Sie hätte sich zu Tode geschämt, wenn sie mit einem Minderwertigkeitskomplex auf Rädern vorfahren würde. Stattdessen setzte sie sich an das Steuer ihres flinken, kleinen Golf GTI und folgte den Anweisungen des Navis, die sie aus der Stadt hinaus zum Tatort führten.
Als sie auf dem Weg war, spürte sie einen gewissen Unwillen, jetzt doch zur Arbeit zu fahren. Lieber wäre sie bei der Familie gewesen oder hätte die Einsamkeit gesucht. Andererseits wollte sie einen guten Eindruck hinterlassen, wollte auf keinen Fall, dass ihr Chef bereute, ihrer Versetzung zugestimmt zu haben. Sie durfte jetzt mit ihrer besten Freundin zusammenarbeiten, und wenn sie ganz ehrlich war, hätte sie es anders wohl nicht zurück in den Beruf geschafft. Die Familie, Anna und die Einsamkeit, das waren die drei Faktoren, die sie aufrecht hielten.