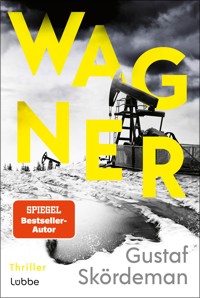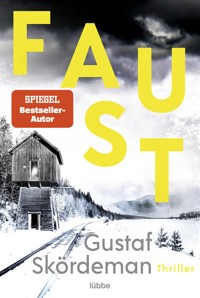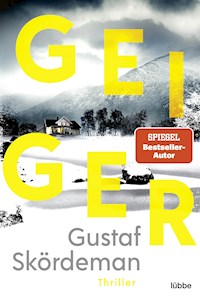
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Geiger-Reihe
- Sprache: Deutsch
Das Festnetz-Telefon klingelt, als sie am Fenster steht und ihren Enkelkindern zum Abschied winkt. Agneta hebt den Hörer ab. "Geiger", sagt jemand und legt auf. Agneta weiß, was das bedeutet. Sie geht zu dem Versteck, entnimmt eine Waffe mit Schalldämpfer und tritt an ihren Mann heran, der im Wohnzimmer sitzt und Musik hört. Sie setzt den Lauf an seine Schläfe - und drückt ab.
Als Kommissarin Sara Nowak von diesem kaltblütigen Mord hört, ist sie alarmiert. Sie kennt die Familie seit ihrer Kindheit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Das Festnetz-Telefon klingelt, als sie am Fenster steht und ihren Enkelkindern zum Abschied winkt. Agneta hebt den Hörer ab. "Geiger", sagt jemand und legt auf. Agneta weiß, was das bedeutet. Sie geht zu dem Versteck, entnimmt eine Waffe mit Schalldämpfer und tritt an ihren Mann heran, der im Wohnzimmer sitzt und Musik hört. Sie setzt den Lauf an seine Schläfe – und drückt ab.
Als Kommissarin Sara Nowak von diesem kaltblütigen Mord hört, ist sie alarmiert. Sie kennt die Familie seit ihrer Kindheit …
Über den Autor
Gustaf Skördeman ist 1965 in Nordschweden geboren. Heute lebt er mit Frau und zwei Kindern in Stockholm. Er ist Drehbuchschreiber, Regisseur und Filmproduzent. GEIGER ist sein schriftstellerisches Debüt. Die Idee für diesen Thriller kam ihm bereits vor zehn Jahren. Seitdem hat er an der Handlung für diesen Auftakt einer Trilogie gefeilt. Das Buch wurde gleich ein internationaler Erfolg und erscheint in 20 Ländern.
Gustaf Skördeman
GEIGER
Thriller
Übersetzung aus dem Schwedischenvon Thorsten Alms
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der schwedischen Originalausgabe:
»Geiger«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020 by Gustaf Skördeman and Bokförlaget Polaris 2020 in agreement with Politiken Literary Agency
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Julie Hübner, Berlin
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagmotiv: © Nils Leithold / EyeEm / GettyImages; © Craig Easton / GettyImages; © happykanppy/shutterstock; SiljeAO/shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0393-2
luebbe.de
lesejury.de
1
Das Kaffeeservice von Royal Copenhagen stand noch auf dem Tisch, in den Tassen schwammen nur noch dunkle Pfützen, die Kuchenplatten waren leer und die Saftgläser ausgetrunken. Blau gepunktete Servietten lagen unbenutzt oder bekleckert herum. Das Tischtuch war voller Kaffeeflecken und Krümel, und hier und da hatte ein Glas einen hellroten Ring hinterlassen. Die Kleinen waren aufgestanden und die Stühle daher vom Tisch weggeschoben.
Die eine Hälfte der Kinder lümmelte mittlerweile auf dem Josef-Frank-Sofa. Die andere Hälfte rannte, aufgepeitscht von dem vielen Zucker, herum und schrie. Von irgendwoher kam ein Tennisball geflogen, der glücklicherweise zwischen den Schmucktellern einschlug, die als Souvenirs aus etlichen europäischen Städten an der Wand hingen: Berlin, Prag, Budapest, Paris, Rostock, Leipzig, Rom.
In der letzten Schulwoche vor den Ferien hatten die Enkelkinder bei den Großeltern gewohnt, damit ihre Eltern allein in der Bretagne Urlaub machen konnten. Die Schwestern Malin und Lotta wollten die Gelegenheit nutzen, bevor die Sommerferien begannen und halb Schweden nach Frankreich reiste.
In der vergangenen Woche hatte Großvater Stellan also die Flucht ins Arbeitszimmer ergriffen, während Großmutter Agneta das Frühstück zubereitet, das Mittagessen gekocht und die Kinder zur Schule und zu den unterschiedlichen Freizeitaktivitäten chauffiert hatte. Und sie hatte an den außergewöhnlich warmen Frühsommerabenden das Baden am Steg überwacht. Die Großmutter übernahm es auch, anschließend die Schnorchel, Schwimmflossen, Badeanzüge, Taucherbrillen, Kubb-Steine und Sonnenölflaschen wieder einzusammeln und wegzupacken. Und später noch die Kleidung, Tablets, Ladekabel und Schulbücher.
Inzwischen waren beide Schwestern mit ihren Männern wieder da, um die Kinder abzuholen. Das Haus schien gleichsam einen Seufzer der Erleichterung darüber auszustoßen, dass bald die gewohnte Ruhe zurückkehren würde.
Die Tür zum Garten stand offen, und draußen spazierte Lotta an der Seite ihres alternden Vaters, der ihr zeigte, was er in den Beeten und Rabatten gepflanzt hatte. Die meisten Setzlinge kannte sie schon, aber einige waren neu. Ihr Vater Stellan hatte bestimmte Favoriten, während er bei der übrigen Bepflanzung variierte.
Am schönsten fand sie die Blumen, kurz bevor sie sich öffneten. Wenn die Knospen aufsprangen. In diesem Punkt unterschieden sich Vater und Tochter.
Lotta hörte aufmerksam zu, als ihr Vater voller Begeisterung die Blütenpracht präsentierte. Rudbeckien, Stockrosen, blauer Feldrittersporn, Bittersüßer Nachtschatten, der von selbst gekommen war, Oregano, Pfefferminze, Schafgarbe und Hornklee. Er liebte seine Blumen, und Lotta erinnerte sich daran, wie viel Zeit er im Garten verbracht hatte, als sie noch ein Kind gewesen war. Hier draußen durfte man Papa nicht stören, aber man wusste immer, wo er war.
Während Stellan eine kurze Verschnaufpause einlegte, drehte sich Lotta unauffällig um, als wollte sie das Haus in Augenschein nehmen – das funktionalistisch entworfene Gebäude, das sie in- und auswendig kannte und eigentlich gar nicht mehr eingehend in Augenschein nehmen musste. Die großen Fensterflächen und die zwei Terrassen mit der großartigen Aussicht auf den Mälaren und die Insel Kärsön.
Schließlich landete ihr Blick auf dem Gartenweg, den zwölf schweren Steinplatten, über die sie und ihre Schwester so oft gelaufen waren und die ihr Vater scherzhaft das ›Zwölf-Schritte-Programm zu einem besseren Leben‹ nannte, weil sie zum Geräteschuppen führten. Darin konnte er sich ungestört dem widmen, was er in seinem Leben am meisten liebte.
Es war ein solcher Aufwand gewesen, die Platten zu verlegen, dass Stellan gesagt hatte, dass sie wahrscheinlich ewig dort liegen bleiben würden. Mittlerweile waren es immerhin vierzig Jahre, also könnte er mit seiner Prophezeiung recht behalten.
Sie betrachtete ihren Vater. Er war fünfundachtzig Jahre alt, im Kopf immer noch so klar wie früher, doch der Körper war müde und gealtert. So sehr, dass er beim Rasieren bestimmte Teile des Halses nicht mehr erreichte. Er war sehr lang, ging aber mittlerweile gebeugt. Die Brille, deren Größe schon immer sein Markenzeichen gewesen war, saß ein bisschen schief, und der Blick hinter den Gläsern wirkte trübe.
Lotta war beinahe genauso groß wie Stellan, ansonsten waren sie einander aber nicht besonders ähnlich. Der Vater hatte aschblondes Haar, die Tochter schwarzes. Laut Stellan hatte sie es von seiner willensstarken Mutter geerbt. Sein Blick war stets freundlich und warm, während Lottas skeptisch und abwartend wirkte.
»Können wir uns vielleicht einen Augenblick setzen?«, sagte Lotta, die bemerkt hatte, dass ihr Vater erschöpft war, aber genau wusste, dass er das niemals zugeben würde.
Sie ließen sich auf der grünen Bank vor dem Geräteschuppen nieder, von der die Farbe abblätterte. Stellan fächelte sich mit einem Pappteller, auf dem Blumenzwiebeln gelegen hatten, frische Luft ins Gesicht, und Lotta wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Hitze kam ihr beinahe übernatürlich vor. Schon seit Mai hatte sie das ganze Land fest im Griff und schien auch jetzt im Juni nicht abklingen zu wollen.
Wie oft hatten sie hier nebeneinandergesessen. Eine Bank zum Verschnaufen, alle Werkzeuge in Reichweite: Hier erholte man sich, während man gleichzeitig einsatzbereit blieb.
Zumindest konnte man sich das einreden.
Im Geräteschuppen standen aufgestapelte Gartenmöbel und Werkzeuge, die seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden waren. Unkrautharken, Rasensprenger, Gießkannen aus Kupfer, die mittlerweile verschimmelte gestreifte Hängematte und die alten, knarrenden Liegestühle, mit denen die Schwestern so gerne gespielt hatten, als sie noch klein gewesen waren. Darauf hatten sie sich in den ersten Frühlingstagen noch zwischen Schneehaufen gesonnt, wolkige Sommertage durchdämmert, ganze Sommer lang gespielt, dass sie auf Booten, Autos, Flugzeugen, Raketen oder Stegen unterwegs waren, von denen sie in das eingebildete Wasser sprangen.
Als die Schwestern zu groß für solche Spiele geworden waren, verschwanden die Liegestühle im Geräteschuppen, wo sie seitdem gestanden hatten. Nur Stellan nutzte sie noch und erholte sich heimlich auf ihnen von der Gartenarbeit, wobei ihn allerdings das leise Knirschen der alten Stühle verriet, das durch die Wände drang.
Der Schuppen war zu einer Art Denkmal einer verschwundenen Zeit geworden. Nur der Gartentisch wurde jedes Jahr wieder herausgeholt, vom Gärtner Jocke, der immer noch regelmäßig wie ein Uhrwerk auftauchte, obwohl er längst im Ruhestand war. Er wollte sich auch nicht bezahlen lassen. Er war einmal pro Woche gekommen, seit Stellan und Agneta kurz nach ihrer Hochzeit Anfang der Siebzigerjahre hier eingezogen waren. Und auch als Rentner war er einfach weiter gekommen, ohne dass ihn jemand darum gebeten hätte. Vielleicht brauchte er solche festen Gewohnheiten, um nicht den Halt zu verlieren.
Lotta schob die Tür zum Geräteschuppen ein Stückchen auf, und die Wärme schlug ihr entgegen. Die Sommerhitze hatte ihn zu einem Backofen gemacht.
»Wollt ihr dieses Fenster nicht wieder öffnen?«, fragte sie und zeigte auf die Sperrholzplatte, die an die rückseitige Wand genagelt war. »Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr, die herumspionieren.«
»Nein, aber jetzt gibt es neue kleine Spione«, sagte Stellan und lächelte.
»Die hängen doch nur an ihren Bildschirmen.«
»Ich werde Jocke bitten, die Platte abzubauen. Vor dem Fenster steht so eine hübsche Kolkwitzie, aber ich bin ja nicht mehr so oft im Schuppen.«
»Überhaupt nicht mehr, würde ich sagen«, erwiderte Lotta und betrachtete die verrosteten Liegestühle.
»Die hier ist für dich«, sagte Stellan und reichte seiner Tochter eine Blume. Jedes Mal, wenn sie zu Besuch kam, gab er ihr eine seiner Pflanzen oder Blumenzwiebeln für ihren kleinen Nutzgarten, und sie nahm sie dankbar entgegen.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Ich weiß nicht. Eine Sommerazalee, glaube ich. Jocke hat sie gepflanzt.«
»Das behauptest du immer.«
Lotta lächelte ihren Vater an.
Joachim, den alle Jocke nannten, war schon immer ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens gewesen, und ihr Vater und er hatten sich schon immer darum gekabbelt, wer von beiden mehr Ahnung von Blumen hatte. Wenn sie ehrlich war, hatte sie von Jocke wohl mehr über Pflanzen und Gartenbau gelernt als von Stellan. Sie erinnerte sich gerne an die schon immer vorhandene Gartenleidenschaft ihres Vaters, denn sie bedeutete, dass er da gewesen war. Nicht immer nur auf der Arbeit und auch nicht immer nur mit Kollegen und Freunden im Haus. Es gab nicht nur die großartigen Feste und die Arbeit, sondern manchmal auch nur ein leises Hacken in den Beeten.
Wie ruhig sein Leben in den letzten dreißig Jahren gewesen sein musste. Vermisste er die Zeit davor, als er im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden hatte?
Zumindest hatten Malin und sie eine besondere Kindheit gehabt, ein Zuhause, um das sie alle anderen Kinder beneideten. Was hätte es eigentlich für einen Unterschied gemacht, wenn ihr Vater damals öfter bei ihnen gewesen wäre, wenn er sich nicht im Partykeller eingeschlossen hätte oder in den Garten geflohen wäre, sobald er zur Tür hereingekommen war? Sie hatten ja immer noch ihre Mutter gehabt.
Es war ohne Zweifel spannend gewesen mit all den bekannten Gesichtern, die im Haus auftauchten, mit allen Festen und Veranstaltungen, bei denen die Erwachsenen merkwürdige Dinge taten.
Vielleicht war es das intensive gesellschaftliche Leben ihrer Eltern, das sie selbst zu einer Eigenbrötlerin gemacht hatte? Ihre Arbeitssucht hatte sie definitiv von ihrem Vater geerbt, aber wenn sie nicht arbeitete, wollte sie sich auch nicht mit Leuten umgeben, sondern lieber ein Buch lesen oder möglicherweise eine Freundin treffen und reden. Eine Freundin.
Der schrille Schrei eines Kindes signalisierte, dass es an der Zeit war, wieder zu den anderen hineinzugehen.
Malin war wie gewohnt mit ihrer Mutter Agneta im Haus geblieben. Sie hatte den Garten nie gemocht. »Bäh, Würmer und Asseln«, meinte sie schon als Sechsjährige, und an diesem Urteil hatte sich nichts geändert.
Die dunkelhaarige Lotta und die blonde Malin. Die tüchtige große Schwester und die verwöhnte kleine Prinzessin.
Lotta fand es geradezu grotesk, wie die kleine Schwester auch dieses Mal ihrer Mutter weder beim Putzen noch beim Packen oder Spülen geholfen hatte. Stattdessen hatte sie eine Kiste mit alten Kleidern vom Dachboden geholt und nach Vintage-Stücken für ihre Kinder gesucht.
»Wollen sie diese alten Klamotten wirklich tragen?«
»Die sind doch super«, sagte Malin und hielt einen hellblauen Plüschanzug hoch, den sie selbst als Kind getragen hatte.
Malin war eine Kopie ihrer Mutter. Agneta war ganz offensichtlich eine strahlende Schönheit gewesen, und selbst mit ihren beinahe siebzig Jahren zog sie in der Öffentlichkeit noch Blicke auf sich. Sie selbst bemerkte es gar nicht. Sowohl die Mutter als auch die Tochter strahlten eine Schönheit aus, die dafür sorgte, dass ihnen die Menschen instinktiv mit Wohlwollen begegneten. Als käme die Schönheit von innen, und man würde sie deshalb nicht um sie beneiden.
Während Malin und Lotta sich mit ihren Eltern unterhielten und die Kinder herumtobten, hatten sich die Ehemänner der Schwestern zurückgezogen. Sie hatten irgendein Thema wie Arbeit oder Autos oder die Badezimmerrenovierung gefunden, worüber sie diskutieren konnten. Christian mit seinem exakt gebügelten Hemd und den glänzenden Schuhen, Peter in Shorts und Sandalen. Sie waren nie so richtig warm miteinander geworden – der Banker und der Kulturbürokrat –, aber noch weniger kamen beide mit dem berühmten Schwiegervater zurecht, der Fernseh- und Entertainerlegende, also fanden sie doch immer wieder zueinander. Keiner von ihnen war besonders begeistert von den Themen, die Stellan interessierten: Fernsehen in den Siebzigerjahren, Reisen durch Europa oder wie sehr klassische Kultur, Unterhaltung und Volksbildung zusammengehörten. Keiner von ihnen konnte Schiller rezitieren.
Nachdem ihr aufgefallen war, dass die Schwager dem gewohnten Muster folgten, stellte sie fest, dass die Kinder es ebenso machten. Ihre eigenen Söhne saßen über ihre Handys gebeugt, und Malins Sprösslinge stritten sich. Molly schrie, weil Hugo ihr einen Tennisball an die Stirn geworfen und gesagt hatte, dass sie nicken solle. Der Ball war an die Wand gesprungen und schließlich auf die Tischplatte direkt zwischen zwei Kaffeetassen.
Höchste Zeit, die Söhne zum Training zu fahren und Malins verzogenen Blagen zu entkommen. Sie hatte jede Menge Meetings, die auf sie warteten. In ihrem Job war eine Woche Abwesenheit eine lange Zeit. Zum Glück konnte sich Peter seine Arbeit selbst einteilen, und für die Kinder waren den ganzen Sommer über Aktivitäten geplant.
»Wir müssen los. Bedankt euch bei eurer Großmutter und zieht eure Sachen an.«
Leo strich sich den Pony aus der Stirn und ging zu seiner Großmutter, gab ihr die Hand und bedankte sich.
Malin durchstöberte hastig alles, was sie sich noch nicht angeschaut hatte, warf ein paar Kleidungsstücke in eine Tüte und stellte den Karton zur Seite. Sie brachte ihn nicht zurück auf den Dachboden, konstatierte Lotta. Und sie war davon überzeugt, dass diese Tüte mit alten Kleidern aus ihrer Kindheit, die die Schwester eingepackt hatte, noch jahrelang ungeöffnet bei ihr herumstehen würde.
Lotta öffnete die Haustür und ließ ihre Söhne nach draußen. Peter verstand den Wink sofort, kam herein und bedankte sich bei seinen Schwiegereltern und verabschiedete sich, bevor er wieder hinausging und sich ins Auto setzte. Währenddessen half Lotta den Kindern ihrer Schwester beim Anziehen. Malin musste erst nach Christian suchen, damit er sich bei seinen Schwiegereltern bedankte. Schließlich schob Lotta alle zu den zwei Autos in der Auffahrt hinaus, während Malin noch ihre Mutter umarmte.
Stellan zog sich in den geliebten Lesesessel im Wohnzimmer zurück, die Matthäuspassion als Klangkulisse und Schutz um sich herum. John Eliot Gardiners klassische Einspielung von 1988 mit Barbara Bonney.
Agneta trat auf die Haustreppe, um den abziehenden Horden nachzuwinken. Ein Klingeln drang aus dem Haus, und sie erklärte den Töchtern, dass sie den Anruf entgegennehmen müsse. Malin konnte sich den amüsierten Kommentar nicht verkneifen, dass sie außer ihren Eltern niemanden mehr kannte, der noch einen Festnetzanschluss hatte, und fügte hinzu, dass sie ihren Kindern gar nicht mehr erklären könne, was ein Festnetztelefon sei.
»Das liegt an deinem Vater«, sagte Agneta entschuldigend. »Er wollte es unbedingt behalten.«
Sie kehrte ins Haus zurück, während sich ihre jüngste Tochter der wartenden Familie anschloss.
Agneta ging ins Arbeitszimmer und hob den großen Hörer mit Spiralkabel von der Gabel eines alten Apparats mit Wählscheibe. Sie meldete sich mit ihrem Nachnamen, wie sie es immer getan hatte.
»Broman.«
Am anderen Ende sagte eine Stimme in gebrochenem Deutsch:
»Geiger?«
Wie sie befürchtet hatte.
Großer Gott.
Die Enkelkinder.
Aber sie hörte, wie die Autos draußen angelassen wurden, und sah ein, dass sie keine Wahl hatte.
Sie überlegte kurz, dann antwortete sie mit einem knappen »Ja« und legte auf.
Anschließend ging sie die Treppe hinauf und ins Schlafzimmer, zog die Nachttischschublade heraus, hob die Gebrauchsanweisungen des Radioweckers und der Badezimmerwaage an und holte eine große, schwarze Pistole der Marke Makarow sowie einen Schalldämpfer heraus, den sie auf den Lauf schraubte.
Auf dem Weg zurück ins Wohnzimmer lud sie die Waffe durch und hatte den Eindruck, dass sie funktionstüchtig war, obwohl sie so lange niemand benutzt hatte. Immerhin war sie regelmäßig gereinigt und geölt worden.
Sie näherte sich ihrem Ehemann von schräg hinten und setzte die Mündung an die Seite seines Kopfs.
Dann drückte sie ab.
Blut spritzte auf das Buch, das aus Stellans Hand fiel. Goethes Faust im deutschen Original.
Es hatte nicht laut geknallt, aber lauter, als sie es in Erinnerung hatte. Sicherheitshalber ging sie mit gesenkter Waffe zum Wohnzimmerfenster.
Draußen schienen die Schwestern in eine Diskussion geraten zu sein, denn sie waren immer noch nicht losgefahren, doch jetzt ging Lotta von Malins Auto zu ihrem eigenen und stieg ein.
Lotta schaute noch einmal zum Haus, während sie in den Sitz sank, entdeckte ihre Mutter, die aus dem Fenster sah, und winkte fröhlich. Malin folgte Lottas Blick und tat es ihr nach.
Agneta versteckte die Waffe hinter ihrem Rücken und winkte mit der anderen Hand zurück. Ihre Töchter klopften gegen die hinteren Seitenscheiben der Autos, damit auch die Kinder ein letztes Mal ihrer Großmutter zuwinken sollten. Sie taten es, und ihre Großmutter lächelte und dachte, dass sie ja irgendetwas richtig gemacht haben musste, wenn sie so großartige Enkelkinder hatte.
2
»Sie haben angerufen.«
Karla Breuer sah von ihrem Buch auf und blickte Jakob Strauss an. Die kleine Kanonenkugel, wie sie ihn nannte. Kurz, kugelrund und von tödlicher Effektivität.
Sie wusste, dass er sie das Weiße Gespenst nannte. Wegen ihrer langen, weißen Haare, ihrer eisblauen Augen und ihrer weißen Kleidung. Und weil er sie als ein Relikt aus der Vergangenheit betrachtete, eine Wiedergängerin aus einer vergessenen Zeit.
»Wer?«, fragte Breuer. »Und wo?«
»Beirut. In Stockholm«, sagte Strauss und sah dem Gespenst an, dass es überrascht war.
Es war eine von vielen Nummern, die sie überwachten, und niemand hatte geglaubt, dass sie jemals wieder benutzt werden würde. Wahrscheinlich gehörte ihre Abteilung deshalb zu den letzten, die umziehen sollten, da niemand glaubte, dass ihr Projekt noch aktuell war. Der Umzug von Pullach nach Berlin schien auch zu bedeuten, dass man die alte Welt hinter sich lassen wollte. Aber Breuer behauptete hartnäckig, dass die Vergangenheit niemals vorbei war.
Breuer war die Einzige in der Abteilung, die schon beim Geheimdienst gewesen war, als diese Nummer in Stockholm noch als aktiv betrachtet wurde. Seitdem waren viele Jahre vergangen. Aber jetzt war sie plötzlich wieder aktiv, entgegen aller Wahrscheinlichkeit.
»Dann müssen wir los.«
Breuer stand auf und ging direkt an Strauss vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Während der vier Jahre, die sie zusammengearbeitet hatten, waren sie keine Freunde geworden, aber in dieser Situation trugen sie beide die Verantwortung.
Die Entscheidung musste allerdings von Schönberg kommen.
Strauss warf einen kurzen Blick in Breuers Büro, als sie an ihm vorbeirauschte. Kein einziger der Bildschirme war eingeschaltet, keiner der Computer lief. Stattdessen sah er stapelweise Bücher und Berichte. Warum eine so durch und durch analoge Mitarbeiterin bleiben durfte, war ihm ein Rätsel. Sie musste gegen irgendjemanden etwas in der Hand haben. Während ihrer vier Jahrzehnte beim Geheimdienst hatte sie bestimmt einiges an sensiblen Daten gesammelt. Schließlich drehte er sich um und eilte ihr nach.
Es befinden sich nicht mehr viele Leute im Gebäude, dachte er und sah sich im Flur um. Die meisten waren bereits in den neuen Komplex in Berlin gezogen. Das größte Verwaltungsgebäude des Landes, das anderthalb Milliarden Euro gekostet hatte.
Die Größe und die Lage mitten in Berlin hätten die Architekten und die Auftraggeber eigentlich an das alte Stasi-Hauptquartier erinnern müssen, aber daran hatten sie offensichtlich keinen Gedanken verschwendet, oder es war ihnen einfach egal gewesen.
In einer offenen Gesellschaft waren die verdeckten Tätigkeiten nicht im gleichen Maße erschreckend.
Sechs Büros weiter unten im Flur klopfte Breuer an Schönbergs Tür und trat ein, noch bevor Strauss sie erreicht hatte.
Schönberg hatte einen Stapel mit Akten vor sich liegen, drei Ordner lagen nebeneinander, die Deckel waren zugeschlagen. Er musste sie zugeklappt haben, als es an der Tür klopfte. Auch hier im Inneren hatte man Geheimnisse voreinander.
»Geiger ist aktiviert«, sagte Breuer.
Schönberg erwiderte nichts, aber sein Blick hieß so viel wie: Na, und?
»Das heißt, dass auch Abu Rasil aktiviert wird«, sagte Breuer. »Jetzt können wir ihn schnappen.«
»Sie glauben, dass er immer noch lebt?«, fragte Schönberg. »Nachdem es dreißig Jahre lang still um ihn war?«
»Er lebt. Er hat sich zurückgezogen, aber jetzt wird er wieder aktiv. Sie hätten nicht in Stockholm angerufen, wenn Abu Rasil nicht am Leben wäre.«
»Und welche Gefahr soll heute noch von ihm ausgehen?«
»Wenn er nach drei Jahrzehnten aktiviert wird, dann muss es etwas Außergewöhnliches sein. Wir müssen los.«
Schönberg schwieg.
»Was soll unsere Abteilung denn für einen Sinn haben, wenn wir unsere Warnsysteme nicht ernst nehmen?«
Schönberg sah sie nur an.
»Genau damit rechnen sie nämlich«, fuhr Breuer fort. »Dass niemand mehr glaubt, dass Rasil noch am Leben ist. Dass niemand etwas unternimmt.«
»Wie sicher sind Sie sich?«, fragte Schönberg schließlich.
Breuer sah zu Strauss hinüber.
»Absolut sicher«, sagte Strauss, denn ihm war klar, dass Breuer genau das von ihm hören wollte. Die gängige Praxis war, dass der scheidende Abteilungschef einen Nachfolger empfehlen konnte, und Strauss wollte gerne ihr Amt übernehmen.
»Sie haben noch vier Monate bis zu Ihrer Pensionierung, Breuer. Schicken Sie Strauss.«
Diesen Vorschlag würdigte Breuer keines einzigen Kommentars.
Schönberg seufzte.
»Wie lange jagen Sie Abu Rasil schon? Vierzig Jahre?«
»Ich habe ihn zehn Jahre lang gejagt. Dann ist er verschwunden. Und ich war mehrere Male kurz davor, ihn zu schnappen.«
»Das glauben Sie jedenfalls.«
»Sollen wir den schlimmsten Terroristen, dem wir jemals auf der Spur waren, einfach entkommen lassen?«
Schönberg setzte die Lesebrille ab und massierte sich die Nasenwurzel. Dann betrachtete er seine Untergebenen.
»Abu Rasil ist ein Mythos«, sagte er. »Eine Legende, die die Palästinenser in den Siebzigerjahren in die Welt gesetzt haben, um den Westen in Angst und Schrecken zu versetzen.«
»Genau das möchte Abu Rasil uns glauben lassen.«
»Der übermenschliche Terrorist. Dass ein und dasselbe Gehirn hinter so gut wie allen Terroranschlägen gesteckt hat, die damals in Europa verübt wurden, ist einfach eine zu gute Geschichte, um tatsächlich wahr zu sein.«
»Dann vielleicht als Abschiedsgeschenk?«, sagte Breuer und sah ihrem Chef tief in die Augen. Schönberg und Strauss sahen beide ein, dass sie nicht nachgeben würde.
»Fahren Sie«, sagte Schönberg. »Nehmen Sie Strauss und Windmüller mit. Aber ich gebe Ihnen nur eine Woche.«
»Wir brechen sofort auf.«
»Sofort?«, fragte Strauss.
»Sofort. Rasil ist schon längst aufgebrochen.«
Breuer drehte sich um und ging. Strauss lief in sein eigenes Büro, um seine Jacke und die Dienstwaffe zu holen. Alles andere konnte er auf dem Weg besorgen. Nur keine Glock 17 und auch keinen maßgeschneiderten Zegna in Größe sechzig.
In seinem Büro gab es keine Bücherstapel, stattdessen jede Menge Computerbildschirme wie bei allen anderen, die im Gegensatz zu Breuers auch eingeschaltet waren. Dazu Nick-Cave-Poster und seine geliebte Devialet Phantom Gold, die beste drahtlose Lautsprecheranlage, wenn es um die Wiedergabe von Musik ging. Je mehr Kollegen nach Berlin zogen, desto lauter konnte er sie drehen.
Auf der Schwelle zögerte er eine Sekunde, aber dann konnte er sich nicht zurückhalten. Er schaltete seine Phantom mit der Fernbedienung ein und spielte ›The Good Son‹ von seinem Handy.
»One more man gone. One more man gone. One more man …«
Göttlich.
Dann lief er schnell wieder hinaus und den Korridor hinunter, um dem Kollegen mitzuteilen, dass er mit ihnen nach Schweden musste. Windmüller war einer dieser durchtrainierten Mitarbeiter, deren Aufgabe darin bestand, ihre Sicherheit zu gewährleisten und ihr Leben zu beschützen.
Breuers Fixierung auf Abu Rasil war im ganzen BND bekannt und umstritten. Dies war ihre letzte Chance zu beweisen, dass er keine Legende war und sie die ganze Zeit recht gehabt hatte.
Strauss wusste nicht, was er davon halten sollte, aber er würde dem Weißen Gespenst niemals widersprechen. Jedenfalls nicht offen und solange sie noch im Dienst war. Breuer kannte sehr viele sehr hochrangige Leute.
Keiner der drei hatte eine Familie, die informiert werden musste, also konnten sie direkt losfahren. Windmüller stieg in das Einsatzfahrzeug, während Strauss die Tür des BMW für Breuer aufhielt. Er konnte nicht beurteilen, wie seriös der Auftrag war. Aber falls Abu Rasil existierte und falls er jetzt aktiviert war, war etwas Großes im Gange.
Etwas wirklich Großes.
3
Sobald ihre Töchter gefahren waren, drängte die Zeit.
Sie holte den Rucksack aus dem Flur und eilte die Treppe zum Obergeschoss hinauf. Das dortige Badezimmer war ihr damals als der sicherste Ort vorgekommen. Aus drei Gründen: Man konnte die Tür hinter sich abschließen, es war von außen nicht einsehbar, und niemand würde irgendwelche Fragen stellen, was man dort drinnen tat. Die vielen Gäste, die sie im Haus hatten, benutzten stets nur die Toiletten im Erdgeschoss.
Dinge im Garten zu vergraben oder in irgendeinen Wald zu bringen klang vielleicht auf den ersten Blick verlockend, aber wenn sie die Ausrüstung brauchte, hätte sie sie nicht sofort zur Hand gehabt. So weit hatte sie auch damals schon gedacht.
Jetzt war die Zeit knapp. Es waren natürlich schon Leute auf dem Weg.
Die Frage war nur, wie weit sie noch entfernt waren.
Und um wen es sich handelte.
Die Halterung für das Toilettenpapier reichte nicht aus, so kräftig sie auch damit zuschlug, also musste sie in den Keller laufen und den Hammer holen. Wie sie die Kacheln wieder abbekommen sollte und wie laut es werden würde, darüber hatte sie sich keine Gedanken gemacht, als sie damals das Paket in die Badezimmerwand steckte und diese neu kachelte.
Jetzt konnte sie allerdings niemand hören.
Sie schwang den Hammer so schnell und hart, wie sie konnte, und zerschlug die Kacheln beim ersten Versuch. Sie schlug weiter, um alle Reste der Kacheln zu beseitigen, riss die darunterliegende Feuchtigkeitssperre weiter auf, bis sie zwei Finger hineinstecken und das in Wachstuch gewickelte Notfallpaket herausziehen konnte.
Ein dickes Bündel Tausendkronenscheine, die allerdings nicht mehr gültig waren. Also musste sie auf das Bargeld zurückgreifen, das sie im Haus hatte. Zum Glück bewahrten sie immer ein bisschen in einer Blechdose in der Küche auf.
Drei Pässe mit unterschiedlichen Namen, alle natürlich schon längst abgelaufen.
Die Codewörter für das Funkgerät.
Autoschlüssel – gab es das Auto noch? Wann hatte sie zum letzten Mal danach geschaut?
Das Instruktionsbuch für das Überleben außerhalb der Zivilisation.
Zyanidkapseln, du lieber Gott.
Die Pistole hatte nie hier gelegen, weil sie sie in Reichweite haben wollte und sich deshalb für den Nachttisch entschieden hatte. Sie hätte ihre Existenz mit einer idiotischen Geschichte als Erbstück ihres Vaters verkauft, falls jemand sie entdeckt hätte. Aber das war nie passiert.
Sie hielt inne. Kam gerade ein Auto?
Sie eilte zum Fenster im oberen Flur, schob vorsichtig den Rand der Gardine zur Seite und warf einen verstohlenen Blick auf die Straße.
Niemand dort.
Aber würden sie wirklich direkt vor dem Haus parken? Würden sie nicht eher in einiger Entfernung halten und sich dann anschleichen? Aber was würden die Leute sagen, wenn sich in diesem wohlhabenden Viertel verdächtige Gestalten durch ihre Gärten schleichen würden?
Nein, am einfachsten war es natürlich, direkt vors Haus zu fahren und auf der Straße zu parken, am besten so, als hätte man einen ganz legitimen Grund dazu. Vielleicht hatten sie sich sogar das Fahrzeug eines Paketzustellers besorgt oder einen Pick-up, auf dem ›Sanitär Notdienst‹ stand. Irgendetwas, bei dem sich niemand etwas denken würde.
Aber noch waren sie nicht hier. Sie hatte keine Ahnung, ob sie Stunden, Minuten oder nur noch Sekunden zur Verfügung hatte.
Sie musste wieder zurück und weitermachen.
»Meine Bananenpuppe!«, rief Molly.
»Wir nehmen sie das nächste Mal mit, wenn wir wieder bei Oma sind«, sagte Malin.
»NEIN!«, schrie Molly.
Malin seufzte.
»Ich glaube, wir müssen umkehren«, sagte sie zu Christian.
Sie wusste, wie sehr Molly auf diese lange, gelbe Stofffigur mit dem breiten Lächeln fixiert war. Die Bananenpuppe diente als Spielkamerad und Kuscheltier, und wenn sie nicht sofort umdrehten, würde ihre Tochter anfangen zu schreien und erst wieder damit aufhören, wenn sie sie wiederbekommen hatte.
Christian warf einen kurzen Blick auf seine Rolex GMT-Master II. Die Pepsi-Version, auf die er nicht wenig stolz war.
Scheiße.
Der ganze Tag war hinüber.
Aber da war nichts zu machen.
Sie waren gerade am Brommaplan vorbeigefahren, auf dem er hätte wenden können, aber er reagierte zu spät und musste bis zum nächsten Kreisverkehr weiterfahren und dort eine Runde drehen, bis sie wieder auf dem Rückweg waren.
Scheißpuppe.
Die Uhr tickte, und sie ging noch einmal ins Badezimmer, nahm die Packung mit dem Schnellzement und rührte ihn im Zahnputzbecher mit ein bisschen Wasser an. Sie schmierte die Mischung auf die Rückseite einer Reservekachel, die die ganze Zeit zusammen mit dem Zementbeutel am Boden ihrer Schublade im Badezimmerschrank gelegen hatte, und drückte sie auf das Loch, bevor sie den Korb mit den Handtüchern davor platzierte. Bei einer genauen Untersuchung würde das niemanden täuschen können, aber vielleicht konnte sie damit ein paar Tage gewinnen, was vielleicht reichen würde. Es ging vor allem darum, Zeit zu gewinnen.
Sie stopfte den Zahnputzbecher und die Kachelreste in den Rucksack, zusammen mit dem Geld und den Pässen. Dann ging sie nach unten in die Küche und packte sich ein kleines Fresspaket. Eine plötzliche Eingebung ließ sie in die Garage laufen und das Ladegerät für die Autobatterie holen.
Gut. Und jetzt?
Für ein bisschen Verwirrung sorgen.
Wie?
Das Schmuckkästchen. Stellans Brieftasche. Noch irgendwas …?
Das kleine Munch-Gemälde, das in der Gästetoilette hing.
Alles in den Rucksack.
Ein paar Schubladen herausziehen und durcheinanderwühlen.
Was noch?
Genau. Der Grund für das alles. Sie brauchte eine Minute, um ihn zu holen.
Sie sah auf die Uhr.
Es war schon viel zu viel Zeit vergangen.
Sie musste aufbrechen.
Das eigene Auto konnte sie nicht nehmen, so viel war ihr klar, also ging sie in den Geräteschuppen und holte das alte Fahrrad heraus, das seit Jahrzehnten dort abgestellt war. Rosa mit weißen Handgriffen. Es musste einer der Töchter gehört haben, sie erinnerte sich allerdings nicht daran, jemals eine von ihnen auf einem Fahrrad gesehen zu haben.
Im Laufe der Jahre war das Fahrrad allmählich hinter Harken, Spaten, Rasentrimmern, Schubkarren, Liegestühlen und diversen Brettern verschwunden, die irgendwann noch einmal verwendet werden sollten. Ein aussortierter Gartenschlauch war in den Rahmen, den Lenker und das Vorderrad verwickelt. Die Kette war nicht gefettet, und die Reifen waren so gut wie platt, aber man konnte darauf fahren.
Kein Nachbar, der zuschaute? Sie würden schließlich befragt werden, und sie wollte nicht, dass einer der Akteure, die jetzt in Bewegung gesetzt worden waren, von dem zweirädrigen Fluchtfahrzeug erfuhr. Wenn sie bedachte, wie selten die Töchter von sich hören ließen, könnte es bis zu eine Woche dauern, bevor sich eine von ihnen Sorgen machte. So lange dürfte sie zumindest von der Polizei verschont bleiben.
Mit den anderen war es schlimmer.
Die angerufen hatten.
Und denjenigen, die vielleicht gelauscht hatten.
Sie hatte keine Ahnung, wie viel Zeit ihr noch blieb.
Stunden oder Tage?
Oder würden sie sich mit dem Anruf begnügen und nur das Ergebnis abwarten?
Wohl kaum, und mittlerweile hatte sie es wirklich eilig.
Sie ging ein letztes Mal ins Haus, um alles zu überprüfen. Dann sah sie durch das Fenster in der Haustür. Nichts Seltsames da draußen. Sie knöpfte die Outdoorjacke zu und setzte eine Mütze auf. Es würde warm werden, aber sie musste sich irgendwie verkleiden.
Schließlich ging sie zu ihrem toten Ehemann und küsste ihn auf die Stirn.
»Danke für all die Jahre. Drück mir die Daumen.«
Sie tätschelte ihm die Wange, ging nach draußen zum Fahrrad und trampelte los.
In derselben Sekunde, in der Agneta Broman hinter der Kurve des Grönviksvägen verschwand, rollte Malin Broman-Dahls schwarzer BMW M550d xDrive Touring über den Nockebyvägen heran und bog in den Grönviksvägen ab, nur wenige Hundert Meter von ihrem Elternhaus mit der Nummer 63 entfernt.
4
Der Lärm war ohrenbetäubend. Hupende Autos, Abiturientenumzüge mit Lautsprechern im Summerburst-Format. Alte Schlager im Wechsel mit donnernder House-Musik. Jeder Wagen dröhnte so laut, dass die Fensterscheiben in den stattlichen Großbürgerhäusern schepperten.
Ballons, Champagnerflaschen, blaugelbe Flaggen. Gedränge.
Junge Menschen voller Erwartungen und Hoffnungen.
Eltern, Großeltern und Erbtanten auf dem Weg zur Abschlussfeier, die immer die vornehmste der Hauptstadt sein würde. Schilder mit Vornamen, Babybildern und Klassenzugehörigkeit. Was die Schulklasse betraf, natürlich. Die andere Klassenzugehörigkeit war an Uhren, Kleidern und Taschen ablesbar. Und an den Marken der Autos, die mit schadenfroher Respektlosigkeit an allen Straßen rund um das Gymnasium Östra Real im Parkverbot standen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamts spazierten um sie herum, bis die vorgeschriebenen fünf Minuten vergangen waren und sie anfangen konnten, Strafzettel zu schreiben. Wie Hyänen, die darauf warteten, dass sich die Löwen an den toten Zebras satt gegessen und sie freie Bahn hatten.
Sogar der ansonsten relativ leere obere Abschnitt der Artillerigatan war verstopft mit Leuten, die auf dem Weg zu dem noblen Schulhof waren. Gealterte Direktoren in vergilbten Studentenmützen, hart geschminkte Luxusgattinnen, die unglücklich darüber waren, wegen der Hitze auf ihre Pelze verzichten zu müssen, und junge Männer mit zurückgekämmten Haaren, die bereits im ersten Jahr nach ihrem Schulabschluss zwei oder drei eigene Firmen gegründet hatten. Grüne und rote Hosen waren bei den alten Herren immer noch populär, stellte Sara fest.
Und der ganze Zirkus nur, weil ein paar Teenager die Schule verließen. Und ins Nichts gingen.
Genießt diesen Tag, dachte sie, während sie im saunaheißen Auto saß. Denn morgen seid ihr nur noch Statistik. Arbeitslos und obdachlos. Ein Problem für die Gesellschaft. Genießt es, solange ihr es noch könnt.
Als eine dreijährige ›Ebba‹ auf einem Schild in der stolzen Hand ihres Vaters vorbeischwebte, fiel Sara ein, dass sie für ihre eigene Ebba gar keines bestellt hatte.
Sie notierte es in ihrem Handy. Sobald die Schicht vorbei war: ein Schild für die Tochter besorgen.
Der Schweiß rann ihr von der Stirn und die Wangen hinunter. Ihr Rücken war nass.
Sara und David waren früh dran gewesen und hatten einen vollkommen legalen Parkplatz an der langen Mauer des Östra Reals gefunden, direkt gegenüber der Artillerigatan 65, die sie überwachen sollten. Jetzt saßen sie zwischen leeren PET-Flaschen und fettigen Imbissverpackungen und mussten immer dringender auf die Toilette.
David Carlsson. Und Sara Nowak.
Sara hatte ihr Haar zu einem Knoten gebunden und eine Baseballkappe von Ralph Lauren aufgesetzt, um sich dem Stadtteil anzupassen. Als sie die Kappe hob, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, sah sie im Rückspiegel, dass sie ihr Haar bald neu färben musste. Es war braun, aber darunter wuchs es knallrot nach. Es sah aus, als würde auf ihrem Kopf ein Feuer ausbrechen.
Als Kind hatte man ihr wegen ihrer roten Haare den Spitznamen ›Indianerin‹ gegeben. Nicht ganz logisch, und auf Dauer ziemlich nervtötend. Sie wurde auch ›Giraffe‹ genannt, weil sie größer war als die meisten Jungs in der Klasse. 1,77 Meter, genau wie Naomi Campbell und Linda Evangelista. Ihre Größe und die markanten Wangenknochen waren in ihrer Teenagerzeit Anlass für Hunderte von idiotischen Anmachsprüchen gewesen, dass sie wie ein Model aussehe. Es geschah so oft, dass Sara sich tatsächlich an einer solchen Karriere versucht hatte, obwohl sie ihr eigenes Aussehen eher als seltsam empfand.
Der Job als Model war relativ gut gelaufen, doch sie erinnerte sich nur mit Unbehagen daran, wie sie ständig um Aufträge werben musste. Angeboten wie eine Ware in einem Katalog, aus dem die Kunden die Auswahl zwischen unzähligen unsicheren Mädchen hatten. Ein Kleiderbügel mit der richtigen Beinlänge.
Von der Anerkennung und Meinung anderer Leute abhängig zu sein hatte ihr überhaupt nicht gefallen. Sie kündigte ihren Vertrag mit der Agentur und begann stattdessen Kampfsport zu trainieren, um die Wut zu kanalisieren, die sich bei all den Auswahlprozessen und den grabschenden Fotografen angesammelt hatte.
Mittlerweile war sie stolz auf ihre Körpergröße und ihre Haarfarbe, färbte sich die Haare aber trotzdem braun, um bei Fahndungseinsätzen nicht so auffällig zu sein. Sie mochte es generell nicht, die Blicke der Leute auf sich zu ziehen. Besonders nicht die der Männer, weil ihr Job bei der Sitte dafür gesorgt hatte, dass sie lüsterne Blicke mit sehr unbehaglichen Menschen in Verbindung brachte.
»Diese verdammte Hitze«, stöhnte Sara und drehte ihr Gesicht zu dem kleinen Ventilator, den sie bei Clas Ohlson gekauft hatten, um ihre Autobatterie nicht durch den ständigen Gebrauch der Klimaanlage zu belasten.
»Mal sehen, wann die Leute anfangen, sich über die Hitze zu beschweren«, sagte David. »Über den ersten warmen Sommer seit Jahrzehnten.«
Er sah vom Hauseingang auf seine Uhr und wieder zurück.
»Wie lange ist er jetzt schon drinnen?«
»Keine Ahnung. Zu lange. Er ist bestimmt fertig. Wir schnappen uns den Nächsten.«
»Okay.«
»Aber vielleicht können wir ihn ein bisschen erschrecken, wenn er rauskommt? Ihm die Lust auf ein nächstes Mal nehmen, wenn wir ihn schon nicht überführen können.«
David warf Sara einen skeptischen Blick zu.
»Ihn schikanieren, meinst du?«
»Nein, wir können ihm einfach nur zeigen, dass wir ihn im Blick haben. Den Ausweis kontrollieren, andeuten, dass seine Frau davon erfahren könnte. Die glauben ja alle, dass sie das einfach machen können, ohne dass es Konsequenzen für sie hat.«
»Entweder wir erwischen sie auf frischer Tat oder wir lassen sie in Ruhe.«
»Jetzt sieh uns doch an. Wir können einen Typen schnappen, aber diese Frau hat noch zehn andere am Tag. Und im Rest der Stadt haben Hunderte anderer Frauen Tausende weiterer Freier. Nur heute. Und wir schnappen uns ein paar Einzelne davon. Die zahlen dann eine Geldstrafe und machen anschließend weiter wie gewohnt. Das ist doch vollkommen idiotisch.«
»So ist es eben.«
»Und es ist scheiße!«
»Was ist denn mit dir los? Warum bist du so wütend?«
»Findest du das echt seltsam? Ich finde es eher seltsam, dass du nicht wütend bist.«
»Ich glaube nicht, dass man gute Arbeit leisten kann, wenn man wütend ist.«
»Es ist doch super, wütend zu sein. Das gibt einem die Energie zum Weitermachen. Was soll ich denn sonst sein? Froh? Glücklich, dass es so viele eklige Typen gibt?«
»Ich halte das für unvernünftig. Man arbeitet schlechter, wenn man dabei ausbrennt. Man hält diese Arbeit nicht lange durch, wenn man sich über alles aufregt, was man sieht.«
»Es wird allmählich Zeit, dass irgendjemand sich wegen dieser Scheiße mal aufregt. Dass wir nicht nur immer versuchen zu verstehen und zu überlegen, sondern auch mal jemand durchdreht. Einen heiligen Zorn entwickelt.«
»Wir müssen langfristig agieren.«
»Ich will nicht langfristig agieren, ich will verdammt kurzfristig agieren: Aufhören! Sofort!«
David schüttelte den Kopf.
»Wir müssen ihnen klarmachen, dass es falsch ist, was sie tun. Wut ist nicht die richtige Methode, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie schafft Abstand, Konflikte. Sie hören doch gar nicht zu, wenn du sie nur anschreist, sondern gehen in Abwehrhaltung.«
»Spielt es denn überhaupt eine Rolle, was wir tun? Alles geht trotzdem genauso weiter.«
»Was hättest du lieber?«, fragte David. »Die Frauen retten oder die Freier hochnehmen?«
»Beides.«
»Aber was davon ist wichtiger?«
Sara zuckte mit den Schultern.
»Wenn du eines aussuchen müsstest.«
Sie dachte nach. Obwohl sie die Antwort schon wusste.
»Die Freier schnappen«, sagte sie. »Ohne Verbrecher keine Opfer.«
»Ich würde lieber die Frauen retten.«
»Aber die wollen doch keine Hilfe. Sie weigern sich auszusagen. Wollen nicht in geschützte Wohnungen ziehen. Sie wollen nicht einmal mit uns sprechen.«
»Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen«, wandte David ein. »Aber das braucht Zeit.«
»Vertrauen!? Sollte es nicht verdammt einfach sein, sich zwischen uns und einer Horde brutaler Zuhälter zu entscheiden? Zwischen uns und zehn Vergewaltigungen am Tag durch eklige Freier? Bei denen man jederzeit umgebracht werden kann?«
»Du klingst ganz anders als sonst, Sara. Ist irgendwas passiert?«
»Nein, es ist einfach gar nichts passiert. Und genau das ist das Problem. Egal, wie viele Sexkäufer wir erwischen, es stehen immer noch Tausende mit dem Schwanz in der Hand in der Schlange. Jedes Alter, jede Sorte, alle. Es hilft einfach nichts. Also, wo ist der Sinn? Und die Frauen wollen nicht einmal aussagen, weder gegen die Zuhälter noch gegen die Freier.«
»Sie haben Angst vor dem, was danach kommt, wenn die Täter in der Zelle sitzen und wir uns mit anderen Dingen beschäftigen. Sie haben Angst vor Rache, dass irgendwas mit ihren Familien passiert.«
»Ich weiß. Und deswegen können wir ihnen nicht helfen. Die Schuldigen nicht einsperren. Warum scheißen wir nicht einfach drauf, wenn wir ohnehin keine Chance haben? Vielleicht sollten wir uns einfach raushalten?«
»Und wenn wir uns nicht darum kümmern, wer soll es dann tun?«
»Warum tut der liebe Gott denn nichts?«
David seufzte.
»Nicht schon wieder …«
»Doch, schon wieder. Es provoziert mich wirklich, wenn du am selben Tag über Gott sprichst, an dem du dich um ein junges Mädchen kümmern musstest, das nach einer Gruppenvergewaltigung halb tot ist. Wie kannst du das nur?«
David blieb ihr eine Antwort schuldig. Es war nicht das erste Mal, dass Sara seinen Glauben kritisierte. Eher das siebzigste Mal. Das sieben mal siebzigste Mal. Sie versuchte erst gar nicht, seinen Glauben zu verstehen. Ihm war klar, dass das Ganze bei dem Job, den sie hatten, nicht so leicht war, aber ohne seinen Glauben hätte er das alles auf gar keinen Fall ertragen.
»Ein Gottesglaube, der dir nicht einmal ein Coming-out in deiner Familie erlaubt!«, sagte Sara. »Was ist das denn für ein Gott?«
»Es geht hier nicht um meine Familie, das habe ich doch schon gesagt! Denen kann ich alles erzählen. Es geht um die anderen.«
»Das meine ich doch. Freikirchliche Gemeinden in irgendeinem Nest, die eine Familie mobben, weil sie einen homosexuellen Sohn hat. Und das heute, in Schweden! Von anderen Ländern will ich gar nicht reden. Die Südstaaten der USA, Saudi-Arabien, Polen, Russland. Da geht es nicht um Religion, sondern darum, seinen Hass zu legitimieren, seine Mitmenschen zu kontrollieren. Straflos Schwule und Frauen angreifen zu können und …«
Sara zuckte zusammen und verstummte. David hob den Kopf und sah sie auf die Haustür starren.
»Kümmere dich um das Mädchen!«, schrie sie und stürmte aus dem Wagen.
David sah, wie Sara die Artillerigatan in Richtung Karlavägen hinunterrannte. Dann lief er in den Hauseingang, den sie beobachtet hatten. Er wusste, dass die Wohnung im ersten Stock lag, zum Innenhof. Sie waren nicht das erste Mal hier.
Er kontrollierte die Tür. Abgeschlossen.
»Aufmachen! Polizei!«
Er konnte nur hoffen, dass es in der Wohnung noch jemanden gab, der in der Lage war, die Tür zu öffnen. Er hämmerte laut dagegen und rief erneut, und nach einer guten Minute hörte er Schritte auf der anderen Seite.
Die Tür schwang langsam auf.
David wusste, dass die junge Frau, die hier lebte und arbeitete, Becky hieß, und nahm an, dass sie es war, die die Tür öffnete. Es war allerdings nicht leicht zu erkennen, denn sie hielt sich die Hand vors Gesicht. Das bisschen, was er von Beckys Gesicht noch sah, war voller Blut.
»Sind Sie verletzt?«, fragte David. »Ich meine, schwer verletzt?«, fügte er hinzu, als er die Augen der Frau aufblitzen sah. Es war schließlich offensichtlich, dass sie verletzt war. »Kommen Sie zurecht? Darf ich mal sehen?«
David griff vorsichtig nach Beckys Hand, und sie ließ zu, dass er sie von ihrem Gesicht zog. Die Nase schien gebrochen zu sein. Eine Augenbraue aufgeplatzt. Und zwei Zähne waren ausgeschlagen. Weitere vermutlich lose.
»Ich rufe einen Rettungswagen.«
Becky winkte abwehrend.
»Haxi«, murmelte sie und nahm die Handtasche von der Garderobe. Sie holte das Handy heraus, tippte den Code ein und hielt es David hin.
»Was? Wollen Sie, dass ich anrufe?«
»Mhm.«
»Ein Taxi zur Artillerigatan 63 bitte. Für Becky. Zum Krankenhaus Danderyd.« David warf Becky einen fragenden Blick zu, um sich zu vergewissern, dass die Wahl des Krankenhauses richtig war. Die Frau nickte zur Antwort. »Notaufnahme.«
Dann lief er wieder auf die Straße.
Woher hatte Sara das gewusst?
Schon an der Tyskbagargatan hatte der Freier bemerkt, dass Sara hinter ihm her war, also begann er in Richtung Karlavägen zu sprinten. Er stieß alle Familien mit Schülerschildern zur Seite, hielt Autos an, die in dem Gedränge ohnehin nicht mehr als im Schneckentempo fahren konnten.
Im Karlavägen folgte ihm Sara auf dem Spazierstreifen in der Mitte der breiten Allee. Es waren immer noch Festwagen auf dem Weg zum Östra Real. Jede Menge Freunde und Familienangehörige.
Der Mann lief im Slalom durch die Menge der Festteilnehmer, schleuste sich hindurch, indem er die Leute zur Seite riss.
Sara lief und sprang und kämpfte sich vorwärts.
»Platz da! Idioten!«
Einige protestierten lautstark, andere setzten verärgerte Mienen auf. Hier war man es nicht gewohnt, angerempelt zu werden.
Vor dem Kiosk in der Sibyllegatan stand ein geschmückter Chevrolet Bel Air Cabriolet ’56, dessen Fahrer ungeduldig darauf wartete, in den Karlavägen einbiegen zu können, und die Chance ergriff, als sich eine viel zu kleine Lücke offenbarte. Der junge Mann gab Gas, wurde aber gebremst, als Sara auf seiner Motorhaube landete.
»Idiot!«, schrie Sara, lief aber weiter, ohne sich groß Gedanken zu machen.
Als sie etwas später am Supermarkt ICA Esplanad vorbeilief, stellte sie allerdings fest, dass ihr Knöchel und ihre Schulter etwas abbekommen hatten. Der Freier konnte den Abstand vergrößern.
Scheiße, so würde es nie klappen.
Sara riss einem kleinen, älteren Herrn mit Spitzbart eine Champagnerflasche aus den Händen und schleuderte sie mit voller Kraft dem Flüchtigen hinterher.
Und traf.
Mitten in den Rücken.
Heftig genug, um ihn zum Stolpern zu bringen. Was dazu führte, dass er in eine Gruppe von jungen Männern hineinlief und zu Boden stürzte.
Während er noch versuchte, wieder aufzustehen, holte Sara ihn ein.
Sie warf sich auf ihn, schlang ihre Beine um seinen Bauch und drückte sie zusammen. Eine Beinschere, die sie ziemlich oft angewandt hatte, als sie den russischen Kampfsport Sambo trainierte. Sie hatte gelernt, dass ihre starken Beine in dieser Position besonders effektiv waren, und viele sie deutlich überragende Männer hatten sich ergeben müssen, nachdem sie im Training in diesem Schraubstock gelandet waren.
»Ich gebe auf!«, schrie der Freier, und Sara lockerte ihren Griff ein wenig. Sie hatte Schmerzen im Bein und sah, dass der Freier etwas Blankes in der Hand hielt. Ein kleines Jagdmesser, mit dem er sie erwischt hatte. Der Schnitt war zum Glück nicht tief, es war nur eine Schramme, aber trotzdem.
Sara beugte sich vor, umfasste den kleinen Finger seiner anderen Hand und bog ihn nach hinten. Er schrie auf vor Schmerz, und in dem Augenblick schlug sie von hinten auf seine Messerhand, sodass die Waffe davonflog.
Sie presste die Beine noch fester zusammen.
»Loslassen!«, schrie der Freier. »Loslassen. Sie zerquetschen mich!«
»Und Sie haben mich mit dem Messer verletzt«, sagte Sara und holte ihre Handschellen heraus. »Her mit der Hand!«
»Verdammte Nutte!«
Sara drückte noch fester zu.
»Loslassen!«, schrie der Idiot. »Das ist Polizeigewalt!«
Dann wandte er sich an die Zuschauer und forderte sie auf:
»Filmt das doch, filmt das doch!«
Gleichzeitig verbarg er geschickt sein Gesicht.
»Her mit der Hand«, sagte Sara.
Schließlich gehorchte er.
»Und jetzt die andere.«
Als Sara die Handschellen geschlossen hatte, lockerte sie die Beinschere, und der Freier schnappte nach Luft, als wäre er unter Wasser gewesen und bräuchte dringend Sauerstoff.
»Haben Sie etwa gedacht, dass Sie mir weglaufen können?«
Er war zu erschöpft, um antworten zu können, und sie beugte sich vor und schrie in sein Ohr:
»Idiot!«
Dann suchte sie nach seiner Brieftasche, holte den Führerschein heraus und fotografierte ihn.
Pål Vestlund.
Was für ein blöder Name für einen Sexkäufer. Einen Ring hatte er auch am Finger.
»Du gibst echt niemals auf.«
Die Worte kamen von David, der durch einen Wald aus Feiernden herbeilief.
Er hat recht, dachte Sara. Sie gab niemals auf.
»Wie geht es dem Mädchen?«, fragte sie und starrte auf den überwältigten Freier.
»Zwei Zähne, Nase, Augenbraue.«
»Verdammtes Arschloch«, sagte Sara, packte Vestlund am Haar und zog seinen Schädel nach hinten.
»Ich werde Sie anzeigen«, presste er heraus.
»Wofür?«, fragte Sara. »Für das hier?«
Sie trat ihm in die Rippen.
»Oder für das hier?«
Sie versetzte ihm einen Tritt in den Schritt. Vestlund schrie auf und rollte sich in Embryonalstellung zusammen.
»Sara!«, sagte David und ging dazwischen. Er sah sich um, ob jemand sie gefilmt hatte, aber alle schienen sich auf die Feierlichkeiten an der traditionsreichen Schule zu konzentrieren.
»Ich bin nur gestolpert«, sagte Sara. Und fügte hinzu: »Warum sollte er besser davonkommen als Becky?«
»Hör auf damit.«
»Er hat mich geschnitten«, sagte Sara und zeigte ihm die blutende Wunde am Oberschenkel.
»Okay, aber wir wollen nicht so werden wie sie«, sagte David. »Woher wusstest du, dass er sie geschlagen hat?«
»Er hatte Blut an den Händen.«
»Sonst nichts?«
»Ist das nicht genug?«
»Nein, ich meinte, das hat dir gereicht? Als Beweis? Erstaunlich, dass du das aus der Entfernung überhaupt gesehen hast.«
»Sieh es dir doch selbst an.«
»Ja, jetzt kann ich es auch erkennen. Aber von der anderen Straßenseite aus hätte ich es nicht gesehen.«
»Okay, wir nehmen ihn fest. Sexkauf, schwere Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich habe ihm das Messer aus der Hand geschlagen. Es müsste dahinten irgendwo liegen.«
David fand die Waffe und steckte sie ein, bevor sie Pål Vestlund auf die Beine halfen.
Sara spürte das Adrenalin immer noch durch ihren Körper pumpen. Für die sogenannte Katharsis-Theorie hatte sie nicht viel übrig. Sie glaubte nicht, dass die Anwendung von Gewalt ein Ventil sein konnte, um den inneren Druck abzubauen, wie es viele Kampfsportlehrer als Argument dafür anbrachten, junge Kriminelle in ihren Clubs trainieren zu lassen. Stattdessen war Sara davon überzeugt, dass es die Situation sogar verschärfte. Je mehr sie trainierte, je mehr sie die Wut herausließ, desto aggressiver wurde sie. Sogar Martin und den Kindern war ihr immer kürzerer Geduldsfaden aufgefallen. Und wenn man sich die Fußballhooligans anschaute, wurden auch die nicht weniger gewaltbereit, je öfter sie sich miteinander prügelten. Nein, manchmal bedauerte sie, dass der Einsatz von Gewalt für sie so naheliegend war, andererseits war es gut, dass man sie bei Gelegenheiten wie dieser nutzen konnte. Zwiespältig.
Sie kehrten zum Einsatzfahrzeug zurück, und Vestlund senkte seinen Kopf, um sein Gesicht zu verbergen, falls ihnen ein Bekannter entgegenkam.
Als sie am Café Foam vorbeigingen, klingelte Saras Handy. Der Klingelton sagte ihr, dass es Anna war, eine alte Freundin von der Polizeihochschule, die jetzt beim Dezernat für Gewaltverbrechen für die westlichen Stadtteile Stockholms zuständig war. Anna hatte ›Somebody that I used to know‹ von Gotye als persönlichen Klingelton erhalten, was eher als Scherz gemeint war. In Wirklichkeit war Sara immer noch eng mit ihr befreundet. Anna war nicht ihre einzige Freundin, aber eine der wenigen, die sie hatte.
»Keine schlechten Nachrichten, hoffe ich«, meldete sich Sara.
»Doch, ich fürchte schon«, antwortete Anna.
»Die Einladung auf ein Bier oder so was wäre mir lieber.«
»Stattdessen bekommst du einen Mord in Bromma.«
»Okay. An einer Prostituierten?«
»Das wäre in dem Fall schon etwas für sehr spezielle Kunden«, sagte Anna. »Ein fünfundachtzigjähriger Mann mit einer Kugel im Kopf.«
»Okay … ein Freier also?«
»Es hat im Grunde gar nichts mit deiner Arbeit zu tun, es geht um was Privates. Ich glaube, du kennst den Mann. Oder hast ihn gekannt.«
Familie, Nachbarn, Freunde, alte Kollegen: Namen und Gesichter rauschten durch Saras Kopf. Ein alter Mann, der ermordet worden war. Ein Bekannter von ihr.
»Wer …?«, war alles, was sie herausbekam.
»Onkel Stellan.«
»Onkel Stellan?«, wiederholte Sara und versuchte die Information zu verarbeiten. Versuchte, sie an der richtigen Stelle im Gehirn zu platzieren. Aber Onkel Stellan ließ sich nicht einordnen. Nirgendwo.
»Der Fernsehmoderator von früher«, sagte Anna. »Kanntest du ihn nicht?«
»Doch. Oder eher seine Töchter. Ja, und ihn natürlich auch. Ich war als Kind ständig dort.«
»Na also. Dann kannst du uns bestimmt helfen.«
»Warte. Ist Onkel Stellan ermordet worden?«
»Mit einem Schuss in den Kopf.«
»Du machst Witze.«
»Nein.«
»Von wem?«
»Keine Ahnung. Ein unzufriedener Zuschauer aus alten Zeiten? Ich dachte, du wüsstest vielleicht etwas. Eine alte Drohung. Streit in der Familie. Ein irrer Nachbar. Ein verrückter Fan. Was weiß ich …«
»Ich komme.«
Als Anna »Nein« sagte, hatte Sara bereits aufgelegt.
5
Die Einfahrt zu der protzigen weißen Villa war von Streifenwagen belagert, die Straße mit blauweißen Bändern abgesperrt, Polizisten kamen und gingen. Nachbarn und Schaulustige standen hinter ihren Zäunen oder auf den Gehwegen und glotzten. Sie versuchten vorbeikommende Polizisten nach Informationen auszuquetschen, ohne sensationslüstern wirken zu wollen. Noch waren keine Journalisten eingetroffen, aber das würde nicht lange dauern.
Sara stellte ihren Wagen in einiger Entfernung vom Haus ab. Schon von Weitem fühlte es sich an, als wäre sie in der Zeit zurückgereist, und beinahe hätte sie sich einen Spiegel gesucht, um sich davon zu überzeugen, dass sie kein Kind mehr war.
Sie zeigte ihren Polizeiausweis und stieg über die Absperrung.
»Sara!«, rief jemand hinter ihr, und sie drehte sich um. Ein weißhaariger Mann im Blaumann und mit Arbeitshandschuhen sah sie an.
»Ich bin es, Joachim.«
Großer Gott. Jocke. Der Gärtner.
»Was ist denn passiert?«, fragte er mit besorgter Stimme. Sara sah, wie er vor Neugier geradezu die Ohren spitzte. Vergeblich.
»Ich kann nichts darüber sagen.«
»Aber ich gehöre doch zur Familie.«
»Ich weiß. Ich darf es trotzdem nicht, tut mir leid.«
Sara ging weiter zum Haus. Jocke war wie ein Gespenst aus der Vergangenheit aufgetaucht. Sehr viel älter sah er aus, aber ansonsten fast unverändert. Dass er immer noch bei Bromans arbeitete …
Auf dem Weg zur Haustür warf sie einen kurzen Blick in den Garten und entschied sich, dorthin zu gehen. Vielleicht war es die Konfrontation mit der Vergangenheit, die sie lockte.
Nach der Verhaftung war sie immer noch vollgepumpt mit Adrenalin. Sie sollte wohl erst mal etwas runterkommen, bevor sie mit den Kindheitsfreundinnen Malin und Lotta über den Tod ihres Vaters sprach. Aber das war eher ein Vorwand. Der Garten der Bromans würde in ihrer Erinnerung immer als das Sinnbild des verlorenen Paradieses weiterleben, als Symbol für die unschuldigen Spiele ihrer Kindheit. Vielleicht sollte sie dort zuerst eine Runde drehen und versuchen, ein bisschen Ruhe zu finden nach all dem Mist, den sie sich ständig auf ihrer Arbeit ansehen musste. Vielleicht war dieser Garten ja genau das, was sie jetzt brauchte. Natürlich nur, wenn man von dem schrecklichen Grund ihres Besuchs absah.
Das Ufergrundstück war genauso prächtig wie in ihrer Erinnerung. Sie ging an der kleinen Gästehütte vorbei und trat auf den Steg. Hier hatte sie nicht mehr gestanden, seit sie ein Kind gewesen war. Sie sah drei kleine Mädchen vor sich, die auf der Kante saßen und lachten und Käsebutterbrote ins Wasser warfen. Fröhlich und unbekümmert. Die dunkelhaarige Lotta, die blonde Malin und die rothaarige Sara.
Sie vervollständigten einander. Wurden zu einer Einheit.
Vielleicht hatten sie die Bezeichnung ›Butterbrote werfen‹ zum ersten Mal als Ausdruck dafür gehört, Steine über das Wasser hüpfen zu lassen, und fanden es besonders lustig, wenn man statt der Steine echte Brote nahm. Es war an einem sonnigen Tag wie diesem hier. Aber vor so unendlich langer Zeit. In einer anderen Welt.
Was war daraus geworden, dachte Sara. Warum hatte es nicht einfach genauso weitergehen können?
Sie betrachtete den Steg, auf dem sie in den warmen Sommermonaten ganze Tage verbracht hatten.
Hatten sie jemals gebadet?
Sara erinnerte sich nicht genau, aber das mussten sie eigentlich getan haben. Doch, sie erinnerte sich zumindest an Badeanzüge und den Geruch von Sonnenmilch. Sie hatte diesen Geruch noch nie gemocht. Warum eigentlich? Vielleicht hatten sie den ganzen Tag komplett eingecremt dort gesessen, ohne ein einziges Mal ins Wasser zu gehen?
Plötzlich war sie sich nicht mehr sicher, vielleicht weil sie sich an den Grund ihres Besuchs erinnerte. Jedenfalls drehte sie um und ging zum Haus hinauf.
Groß, weiß und stilecht. War es schon teuer gewesen, als Bromans es gekauft hatten, so war es heutzutage bestimmt ein Vermögen wert.
Es fühlte sich komisch an, nicht zu klingeln und darauf zu warten, dass Tante Agneta ihr öffnete oder die Schwestern heranstürmten und an der Schwelle hängen blieben, während sie ihre eingeladene Spielkameradin musterten. Die Außentreppe war ihr immer wie eine Einlassprüfung vorgekommen. Danach war dann alles wie immer.
Aber Sara klingelte nicht. Sie öffnete die Tür und betrat das Haus. Sah sich um.
Nichts hatte sich verändert.
Es kam ihr tatsächlich so vor, als würde sie in die Vergangenheit treten. Der Flur sah genauso aus wie früher. Dieselbe Hutablage, derselbe Hocker und dasselbe Telefontischchen. An den Wänden dieselben Fotos von Stellan zusammen mit Prominenten und Politikern. Alles, was sie von hier aus sah, war seit dreißig Jahren unverändert. Alles stand am selben Ort, sogar der Geruch war derselbe.
Konnte die Zeit wirklich so stillstehen?
Sara erinnerte sich noch genau daran, wie es war, über die Schwelle dieses Hauses zu treten, wie Agneta jedes Mal kam, um sie in Empfang zu nehmen, selbst wenn eine ihrer Töchter schon geöffnet hatte. Sie bemühte sich sehr viel mehr um das Wohlergehen ihrer Gäste als der Rest der Familie.
Im Wohnzimmer waren die Kriminaltechniker mit dem Opfer beschäftigt. Der Sessel stand mit dem Rücken zu ihr, aber Sara bemerkte einen Arm, der leblos an der Seite herunterhing. Mehr wollte sie nicht sehen. Nicht jetzt. Stattdessen fragte sie einen der Techniker, wo sich Anna befand, und erhielt eine Armbewegung in Richtung Küche zur Antwort.
Als Sara sich der Küche näherte, hörte sie Malins durchdringende Stimme:
»Sie müssen sie finden!«
»Wir suchen sie schon«, antwortete ihre Kollegin Anna mit einem leicht resignierten Tonfall.
Malin war sichtlich aufgeregt und reagierte verwirrt, als Sara in die Küche kam. Sobald sie ihre Jugendfreundin erblickte, ging sie mit abwehrenden Händen auf sie zu.
»Sara, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Besuch«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Es ist etwas Schreckliches passiert.«
»Beruhige dich. Ich bin Polizistin«, sagte sie und zeigte ihren Ausweis.
Malin hielt inne.
»Ach, stimmt ja. Entschuldige, es ist alles so … Bist du beruflich hier?«
Sie sah ängstlich aus, als würde der Umstand, dass Sara als Polizistin und nicht als alte Freundin vor Ort war, die albtraumhafte Situation noch schlimmer machen.
»Du hättest nicht kommen müssen«, sagte Anna.
Sara sah sie an. Klein, durchtrainiert und beweglich. Respekteinflößend trotz ihrer geringen Größe. Kräftiges schwarzes Haar, braune Augen und ein dunkler Teint. Sie strahlte Entschlossenheit aus. Sie waren oft unterschiedlicher Meinung gewesen, aber bis jetzt hatte sich noch nie eine in die Arbeit der anderen eingemischt.
»Doch«, sagte Sara. »Das musste ich. Es geht um Stellan.«
Malin schluchzte kurz auf, als sie den Namen ihres Vaters hörte. Sara wandte sich wieder Malin zu. Wer war ihre Kindheitsfreundin heute?
Als Erstes bemerkte sie, dass Malin nicht mehr natürlich blond war. An den Wurzeln waren die Haare grau, während der Rest platinblond gefärbt war. Wie erwartet trug sie teure Kleidung. Sara vermutete, dass sie oft in der Birger Jarlsgatan einkaufen ging. Schuterman, Gucci, Prada, vielleicht sogar Chanel. Die Handtasche war jedenfalls von Louis Vuitton. Ein bisschen fantasielos, fand Sara. Sie erinnerte sich, dass die Schwestern ausgeprägte Markensnobs und sehr strenge Geschmacksrichter waren und dass sie die wenigen Male, die sie mit ihrem Outfit vor ihren Augen Gnade gefunden hatte, besonders stolz darauf gewesen war.
»Sara, ihr müsst Mama finden«, sagte Malin bedrückt.
»Ist Agneta verschwunden?«
»Ja. Und Papa ist …«
»Ich weiß. Es ist vollkommen absurd. Stellan, erschossen.«
»Wo könnte Mama denn sein?«, fragte Malin und schaute sie an.
»Ich weiß es nicht. Aber sie werden sie finden.«
»Wie denn?« Malins Angst schlug in Aufregung um. »Vielleicht ist sie auch erschossen worden. Oder entführt. Oder sie liegt irgendwo verletzt herum und verblutet, wenn sie niemand findet.«
Anna fiel ihr ins Wort, vielleicht eher um Sara zu helfen als Malin zu beruhigen.
»Wie gesagt, überall in der Umgebung sind Polizeipatrouillen unterwegs«, sagte sie. »Sie befragen die Leute und suchen Spuren. Unten im Wasser kreuzt ein Boot, und wir haben einen Hubschrauber angefordert. Wenn wir sie trotzdem nicht finden, werden wir Hunde einsetzen.«
»Sie ist meine Mutter!«, sagte Malin.
»Ich weiß. Aber wir können so etwas. Verlassen Sie sich darauf.«
Malin sah zu Sara hinüber, die beruhigend nickte. Als sie klein waren, hatten immer die Schwestern das Kommando geführt, aber jetzt musste Malin sich geduldig darauf verlassen, dass sie und ihre Kollegin wussten, was das Beste war.
»Ist sie tot?«, fragte Malin und sah Sara in die Augen.
»Kannst du dir nicht vorstellen, dass sie sich irgendwo versteckt hat, nachdem sie gesehen hat, was mit deinem Vater passiert ist?«
»Doch. Aber dann könnte sie ja jetzt wieder herauskommen.«
»Vielleicht weiß sie nicht, dass wir hier sind. Was glaubst du, wohin würde sie gehen, wenn sie sich in Sicherheit bringen müsste?«
»Keine Ahnung. Zu mir nach Hause?«
»Könnte sie dort sein?«