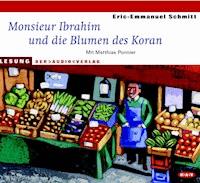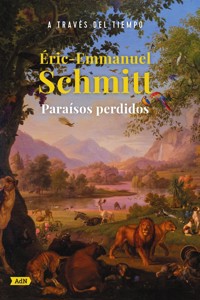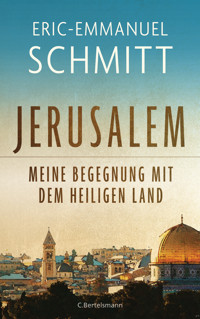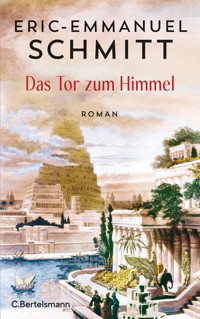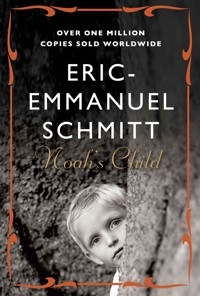3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein origineller und tiefsinniger Roman über die Kraft von Herkunft und Familie
Der zwölfjährige Felix ist verzweifelt. Seine lebenslustige Mutter Fatou, die in Paris ein kleines Café betreibt, ist in eine Depression geraten. Fatou, einst der Dreh- und Angelpunkt der liebenswerten und schrulligen Gemeinschaft ihrer Stammkunden, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Um sie zu retten, unternimmt Felix mit ihr eine abenteuerliche Reise nach Afrika, die sie zu ihren Wurzeln und zur Versöhnung mit der Vergangenheit führen wird.
Wie in seinen Welterfolgen »Oscar und die Dame in Rosa« und »Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran« bringt uns Eric-Emmanuel Schmitt in einem humorvollen und lebensklugen Roman philosophische und spirituelle Themen näher, indem er sie mit den Augen eines Kindes betrachtet. Darüber hinaus ist das Buch die wunderbare Liebeserklärung eines Jungen an seine Mutter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
Der zwölfjährige Felix ist verzweifelt. Seine Mutter Fatou, die im Pariser Stadtteil Belleville ein gemütliches Café betreibt, ist in eine Depression geraten, und alle Therapieversuche scheinen vergeblich. Die wunderbare Fatou war der Dreh- und Angelpunkt der bunten, liebenswerten und schrulligen Gemeinschaft ihrer Stammkunden. Nun ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Um sie zu retten, unternimmt Felix mit ihr eine abenteuerliche Reise nach Afrika, die sie zu ihren Wurzeln und zu den unsichtbaren Quellen des Lebens führen wird.
»In diesem Roman ist alles, was Schmitts Leser lieben: Tragik und Komik, Warmherzigkeit und liebevoll gezeichnete Figuren, Philosophie und Spiritualität.« Le Point
Zum Autor
Eric-Emmanuel Schmitt, französischer Schriftsteller, Bühnenautor und Filmregisseur wurde 1960 in St.-Foy-les-Lyon geboren. Nach der Promotion in Philosophie unterrichtete er einige Jahre an der Universität, bevor er ein erfolgreicher Dramatiker und Romancier wurde. Sein Buch Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran, für das er 2004 den Deutschen Bücherpreis erhielt und das mit Omar Sharif in der Hauptrolle verfilmt wurde, machte ihn weltberühmt. Auf Deutsch sind von ihm bisher 20 Werke mit einer Gesamtauflage von 2 Mio. Exemplaren erschienen. Schmitt lebt in Brüssel.
Eric-Emmanuel Schmitt
Felix und die Quelle des Lebens
Aus dem Französischen von Michael v. Killisch-Horn
Roman
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Félix et la source invisible bei Éditions Albin Michel, Paris.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
© der deutschsprachigen Ausgabe 2020 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
© der Originalausgabe 2019 bei Éditions Albin Michel
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-25608-1V001
www.cbertelsmann.de
Derjenige, der gut hinschaut, wird schließlich sehen.
Afrikanisches Sprichwort
1
»Merkst du denn nicht, dass deine Mutter tot ist?«
Mein Onkel deutete auf meine Mama, die groß, aufrecht und zu blass vor der Spüle stand und das Abtrocknen des Geschirrs beendete, indem sie den letzten Teller auf den Stapel stellte.
»Tot?«, murmelte ich.
»Tot!«
Der Onkel hatte das Wort mit seiner tiefen Stimme so heftig wiederholt, dass es die Küche erfüllte, an die Möbel stieß, von den Wänden abprallte, gegen die Decke schlug und schließlich durch das Fenster floh, um die Nachbarn anzugreifen; guttural, gellend, krächzend zersplitterte der Klang im Hof in tausend Echos.
Unter der schwankenden Glühbirne kehrte wieder Stille ein.
Das Krächzen hatte Mama nicht tangiert. Sie hatte währenddessen abwesend angefangen, die Untertassen zu zählen. Ich biss mir auf die Unterlippe bei dem Gedanken, sie könnte einen neuerlichen Anfall von Zähleritis haben – wenn sie in letzter Zeit eine Bestandsaufnahme machte, begann sie stundenlang immer wieder von vorn.
»Tot, mein Junge, eindeutig tot. Deine Mutter reagiert auf nichts.«
»Sie bewegt sich!«
»Du lässt dich von einem Detail täuschen. Ich kenne mich mit Leichen aus, ich habe bei uns Dutzende gesehen.«
»Bei uns?«
»Im Dorf.«
»Bei dir, meinst du! Für Mama und mich ist hier bei uns!«
»In diesem schrecklichen Mocheville?«
»Belleville! Wir wohnen im wunderschönen Belleville, Onkel!«
Ich hatte geschrien. Ich ertrug es nicht, dass mein Onkel verachtete, was mich mit Stolz erfüllte, Paris, die Krake, deren Tentakel ich war, die Hauptstadt Frankreichs, Paris mit seinen Prachtstraßen, seiner Périphérique, seinem Kohlendioxid, seinen Staus, seinen Demonstrationen, seinen Polizisten, seinen Streiks, seinem Élysée-Palast, seinen Grundschulen, seinen Gymnasien, seinen Autofahrern, die herumbellen, seinen Hunden, denen man das Bellen abgewöhnt hat, seinen heimtückischen Fahrrädern, seinen breiten Boulevards, seinen aschfarbenen Dächern, auf denen sich die grauen Tauben verstecken, seinen glänzenden Pflastersteinen, seinem stumpfen Asphalt, seinen lärmenden Geschäften, seinen Lebensmittelläden mit Abendöffnung, seinen Metroeingängen, seinen heftigen Kanalisationsgerüchen, seiner quecksilbern schillernden Luft nach dem Regen, seinen von der Luftverschmutzung rosa gefärbten Dämmerungen, seinen Straßenlaternen, seinen Nachtschwärmern, seinen Vielfraßen, seinen Pennern, seinen Betrunkenen. Was den Eiffelturm betrifft, unseren friedlichen Riesen, den stählernen Aufpasser, der über uns wachte, so hatte jeder, der ihn nicht verehrte, meiner Meinung nach einen Tadel verdient.
Der Onkel zuckte die Achseln und fuhr fort: »Deine Mutter wurde nicht hier geboren, sie hat das Licht der Welt im Busch erblickt. Oh, ich liebe diesen Ausdruck, ›das Licht der Welt erblicken‹, wie gemacht für Fatou, die an einem brütend heißen Tag aus dem Bauch ihrer Mutter geglitten ist. Ich erinnere mich gut, ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Und du, um welche Zeit bist du geboren worden?«
»Eine halbe Stunde nach Mitternacht.«
»Genau, wie ich mir gedacht habe: Du hast nicht das Licht erblickt, du hast die Nacht erblickt.«
Er kratzte sich am Kinn.
»Und wo?«
»Im Krankenhaus.«
»Im Krankenhaus! Im Krankenhaus, als hätte deine Mutter im Sterben gelegen … Im Krankenhaus, als wäre schwanger sein eine Krankheit … Krankenschwestern und Ärzte, das ist es, was du als Erstes gesehen hast, was für ein Jammer! Mein armer Felix, ich frage mich, inwiefern du deine Mutter verstehen kannst.«
Tränen traten mir, ohne dass ich es ihnen erlaubt hätte, in die Augen. Das ärgerte mich. Genug! Keine Schwäche mehr! Es machte mir schon genug zu schaffen, ein zwölfjähriger Junge zu sein, da musste ich die Situation nicht noch schlimmer machen, indem ich zu einem heulenden Rotzlöffel mutierte … Die Wut hielt meine Tränen zurück und erlaubte mir, spontan zu rufen: »Ich liebe meine Mama.«
Der Onkel legte mir eine Hand auf den Schädel; ich glaubte, er wollte mir das Gehirn zerquetschen, bis sich aus seiner Handfläche und seinen knotigen Gelenken ein Gefühl der Ruhe übertrug.
»Daran zweifle ich nicht, mein Junge. Aber lieben bedeutet nicht verstehen. Ist dir bewusst, dass deine Mutter in Schwierigkeiten steckt?«
»Natürlich! Deswegen habe ich dir ja geschrieben, Onkel, und dich angefleht, aus dem Senegal zurückzukommen.«
»Sehr gut. Sprechen wir von Mann zu Mann.«
Er setzte sich rittlings mir gegenüber auf den Stuhl und blickte mich ernst an.
»Was sagt der Arzt?«
»Dass sie unter einer Depression leidet.«
Onkel Bamba riss die Augen auf und rief: »Was ist das, eine Depression? So was haben wir in Afrika nicht.«
»Das ist eine Krankheit, bei der man niedergedrückt ist. Die Ärzte benutzen den Ausdruck ›Depression‹, wenn jemand plötzlich trübseliger ist als am Tag zuvor, ohne dass sich irgendetwas verändert hätte; die Lustlosigkeit belastet, überschwemmt und blockiert alles.«
»Welche Behandlung schlagen sie vor?«
»Antidepressiva.«
»Funktioniert das?«
»Das siehst du ja.«
Wir betrachteten Mama, die sich auf den Schemel gesetzt hatte – oder, besser, sich auf ihn hatte plumpsen lassen –, wie eine Puppe, die der Puppenspieler zurückgelassen hat, schlaffer Rumpf, gesenkte Schultern, nach hinten gekippte Hüften, verdrehte Beine, eingeknickter Nacken. Keinerlei Kraft hielt die Teile von Mama noch zusammen.
Onkel Bamba fuhr leise fort: »Falsche Diagnose. Ich garantiere dir, dass Fatou tot ist. Du wohnst mit dem Zombie deiner Mutter zusammen.«
»Hör auf!«
»Und ich beweise es dir. Was zeichnet einen Toten aus? Erstens, er hört nicht mehr.«
Der Onkel schlug mit der Faust auf den Tisch. Mama verzog keine Miene.
»Deine Mutter ist stocktaub.«
»Sie hat vielleicht Probleme mit den Ohren …«
»Zweitens, der Tote sieht nichts mehr, selbst mit geöffneten Augen nicht. Drittens, sein Blick wird leer.«
Ich musste zugeben, dass Mamas Augen, ebenso glasig wie die eines Fischs in der Auslage, nicht mehr Ausdruck hatten als eine Makrele auf einem Eisbett.
»Viertens, die Haut des Toten verändert ihre Farbe.«
Mit einer Handbewegung zu seiner jüngeren Schwester wies der Onkel mich auf ihren gräulich-grünlichen Teint hin, der früher karamellfarben gewesen war. Er seufzte.
»Fünftens, der Tote nimmt von den anderen keine Notiz. Es gibt niemanden, der egoistischer ist als die Toten, echte Arschgesichter. Kümmert sie sich um dich?«
Ich wurde blass und protestierte: »Sie bereitet die Mahlzeiten zu, putzt die Wohnung …«
»Reflexhaft, aus Gewohnheit, wie ein Huhn, das weiterläuft, nachdem man ihm den Hals durchgeschnitten hat.«
Gesenkten Haupts gab ich ihm recht. Er setzte seine Aufzählung fort, indem er den Daumen seiner linken Hand hob: »Sechstens, der Tote spricht nicht. Wann hast du dich zuletzt mit deiner Mutter unterhalten?«
Erneut drangen die Tränen an den Rand meiner Wimpern. Obwohl er seine Liste gern weiter abgespult hätte, verzichtete der Onkel angesichts meiner Verzweiflung darauf. Er umklammerte meine Knie.
»Deine Mutter erweckt den Anschein, als würde sie leben, aber sie ist tot, Felix.«
Das Schluchzen wurde schlimmer; und diesmal ließ ich mich gehen. Ade, Ehre! Sei’s drum … Nachgeben bestürzte und erleichterte mich; endlich teilte jemand die Sorge, die mich seit Monaten bedrückte, jemand fühlte sich betroffen, ich würde mich nicht mehr allein ängstigen müssen! Mamas Bruder benutzte zwar erschreckende Worte, sie quälten mich aber nicht so sehr, während er sie aussprach, sondern erst, als sie sich in meinen Gedanken festsetzten. Ja, der Onkel hatte recht: Ich hatte Mama verloren, sie hatte mich verlassen, ich wohnte bei einer Fremden. Wo wohnte diejenige, die mich im Stich gelassen hatte? Sie fehlte mir … Gab es sie noch irgendwo?
Zwischen zwei Schluchzern stammelte ich: »Kann man sie behandeln?«
»Man heilt die Lebenden, nicht die Verstorbenen.«
»Und?«
»Was?«
»Was machen wir?«
»Hm …«
»Nichts?«
»Wir erwecken sie wieder zum Leben!«
Der Onkel erhob sich, schlank, zu stolzer Größe, asphaltfarbene Haut, kohlrabenschwarzes Haar. Er streckte sich geschmeidig, ging zum Fenster, spuckte den Kautabak aus, auf dem er seit dem Dessert herumkaute – hoffentlich reinigte die Concierge nicht gerade die Mülleimer im Hof –, atmete tief die Nacht ein und rieb sich den Nacken. Ich erinnerte mich, dass man laut Mama diesen großen und dürren Athleten in seinem Dorf für einen unbezwingbaren, furchtlosen, erbitterten Krieger hielt, die letzte Rettung, wenn eine Tragödie aufflammte. Vertrauen! Auf keinen Fall seinem augenblicklichen Aussehen trauen, seinem Gebaren als großspuriger Afrikaner, seinem überkandidelten Stil, besonders an diesem Abend, an dem er über spitz zulaufenden karminroten Krokodillederschuhen einen kanariengelben dreiteiligen Anzug trug.
Er drehte sich ruhig zu mir um.
»Kennst du jemanden, der die Toten wieder zum Leben erweckt?«
»Nein.«
»Okay«, entgegnete er gelassen, »ich werde jemanden suchen. Wo hast du das Telefonbuch?«
»Das Telefon… was?«
»Das Telefonbuch. Das dicke Buch, in dem die Telefonnummern stehen. Das gelbe, dasjenige, das die Leute nach Berufen ordnet.«
»Aber … aber … das gibt es nicht mehr!«
»Ah?«
»Man benutzt das Internet.«
»Okay, kein Problem, dann gib mir deinen Computer.«
Seine Lässigkeit brachte mich auf die Palme. Ich schrie: »Verdammter Mist, Onkel! Wonach willst du denn suchen? Nach ›Wiedererwecker‹?«
Als Antwort lächelte er.
*
Jahrelang hatte Mama das genaue Gegenteil der Schwermut verkörpert, die sie heute abstumpfte. Lebhaft, sprühend, neugierig, strahlend, gesprächig, zwitscherte sie mit seidenweicher, fülliger, frischer Stimme, der ihr tropischer Akzent eine gewisse Weichheit verlieh, staunte, empörte sich, interessierte sich für alles, lachte über die meisten Dinge, küsste mich ab von morgens – wenn sie mich weckte und mir den Rücken massierte – bis abends – wenn sie mir genüsslich die Anekdoten des Tages erzählte, denn, so pflegte sie zu sagen, »man muss die Geschichten immer erzählen, bevor sie kalt werden«.
Mama betrieb das Café in der Rue Ramponneau in Belleville, ein schmaler Raum mit safrangelben Wänden, in dem sich die Anwohner der Nachbarschaft drängten. Sie war so umsichtig gewesen, ihr Café Büro zu nennen; auf diese Weise konnte ein Stammgast, der an der Bar mit seiner Ehefrau, seinem Ehemann, seinem Mitarbeiter, seinem Chef telefonierte, auf dessen Frage, wo er sich befinde, ganz offen antworten: »Im Büro.«
»So bleiben sie länger und konsumieren bei mir. Niemand traut sich, sie zu nerven oder etwas von ihnen zu verlangen, weil sie ›im Büro‹ sind.«
Mama verstand es, die Gegenstände, die Tiere und die Leute einzuschätzen. Dank dieser Gabe vermied sie die Fallen des Lebens. Nachdem sie das Bistro eröffnet hatte, hatte sie sofort das Schild WC von der betreffenden Tür gerissen und den Hinweis In Ruhe allein angeklebt. Der Katze des benachbarten Kramerladens, ein rotbrauner Kater mit dichtem Fell, der eingerollt an der Kasse lag und die Kunden belästigte, indem er sie viermal in der Minute annieste, hatte sie den Namen Hatschi gegeben, ein Spitzname, der sofort von den Käufern angenommen wurde. Während sie sich vor Lachen bogen, apostrophierten sie den Kater von nun an so, anstatt sich wie vorher über ihn zu ärgern, und freuten sich, dass Hatschi gemäß seiner namengebenden Neigung nieste.
Auf die gleiche Weise hatte Mama die Lesben von der Rue Bisson gerettet, zwei mürrische Dreißigjährige von stattlicher Figur, deren offen ausgelebte Beziehung die Flegel, von denen es selbst in unserem Viertel jede Menge gab, zu abfälligen Kommentaren veranlasste. Mama hatte die Lesben ohne ihr Wissen Schneeweißchen und Rosenrot getauft, eine Bezeichnung, die sich rasch verbreitete und ein spontanes Lächeln auf die Gesichter derer zauberte, die den beiden Frauen begegneten – ein Lächeln, das sie im Lauf der Zeit schließlich erwiderten. Wer konnte sich die Rue Ramponneau jetzt noch ohne Schneeweißchen und Rosenrot vorstellen? Man hätte sich über ihr Verschwinden im Rathaus beschwert! Durch die Kraft des Namens hatte Mama ihre Beziehung zu einer ebenso legitimen wie amüsanten gemacht.
Wie eine gute Fee machte sie das Leben im Viertel schöner. Ihre Begabung für die Macht der Worte hatte sogar einen Stammgast unserer Bar aus seiner Isolation geholt: die zerbrechliche Mademoiselle Tran, eine bezaubernde Eurasierin mit mahagonifarbener Iris, viel zu zurückhaltend, um auf irgendjemanden zuzugehen, die täglich kam, um einen Fingerhut Sake zu genießen. Eines Samstags, als Mademoiselle Tran sich mit dem ausgelassenen Welpen, den sie gerade erworben hatte, an die Bar geschlichen hatte, hatte Mama ihr vorgeschlagen, ihn Monsieur zu nennen.
»Monsieur?«
»Ja, Monsieur! Folge meinem Rat, du wirst sehen.«
Mademoiselle Tran hatte gehorcht, ohne zu verstehen, und seitdem war sie umringt von Männern. In den Straßen, in denen sie mit ihrem Pudel Gassi ging, ohne ihn an der Leine zu führen, rief sie den Kläffer mit hoher Stimme: »Monsieur, Monsieur!« Und das Ergebnis? In dem Glauben, von der verführerischen jungen Frau gerufen zu werden, eilten die Männer der Umgebung augenblicklich zu ihr, entdeckten ihren Irrtum, lachten lauthals, erröteten, streichelten das Tier, da sie ja nicht einfach Mademoiselle Tran streicheln konnten, und begannen ein Gespräch. Sie erfreute sich jetzt eines eindrucksvollen Hofs von Verehrern, aus dem sie sich eines Tages, das lag auf der Hand, einen Mann wählen würde.
»Aber mein Meisterwerk bist du, mein Felix«, wurde Mama nicht müde zu wiederholen.
Sie hatte mich Felix genannt, überzeugt, dass mein Vorname – felix bedeutet glücklich auf Lateinisch – mir ein glänzendes Schicksal bescheren würde.
Sie hatte ohne Frage recht … Wir beide waren glücklich in unserer Mansardenwohnung im sechsten Stock des Hauses, in dem sich das Bistro befand.
Mama zog mich allein auf, denn sie hatte mich mit dem Heiligen Geist gezeugt.
Dass sie mich mit dem Heiligen Geist gezeugt hatte, kam mir sehr gelegen. Es brauchte keinen Vater zwischen ihr und mir. Sie verschwand zwar gelegentlich zwei oder drei Stunden zu einem Liebhaber, aber zu Hause zwang sie mir kein männliches Wesen auf. So weit ich mich zurückerinnern kann, habe ich immer gewusst, dass ich ihr Ein und Alles war; bereits als Säugling habe ich diese Herausforderung angenommen: Ich schenkte ihr meine vorbehaltlose Liebe.
In Belleville wusste jeder, dass sie mich mit dem Heiligen Geist gezeugt hatte, da sie nicht müde wurde, es den Nachbarn, den Gästen, den Lehrerinnen, den Schülereltern und meinen Kameraden immer und immer wieder zu erzählen. Nachdem die Verblüffung abgeklungen war, beneideten sie mich um diese Abstammung; manche nannten mich manchmal aus Spaß Jesus, was ich gutmütig zuließ, ich war ja kein Spielverderber und fand es verständlich, angesichts eines so außergewöhnlichen Falls die wenigen Vorgänger zu erwähnen.
Es bestand kein Zweifel daran, dass Mama mich mit dem Heiligen Geist gezeugt hatte, da es einen offiziellen Beweis gab: Der Heilige Geist hatte mich in meiner Geburtsurkunde anerkannt. Ja! Er hatte sich persönlich im Rathaus eingefunden. Danach haben wir ihn allerdings nie wiedergesehen.
Félicien Saint-Esprit, mein Erzeuger, von den Antillen, Kapitän eines Handelsschiffs, hatte vor dreizehn Jahren eine Woche in Paris verbracht und mich mit Mama gemacht. Neun Monate später war er zurückgekommen, um mich auf dem Standesamt anzuerkennen. Danach hatte meine Mutter ihm unsere neue Adresse verschwiegen. »Schluss! Kein weiterer Bedarf mehr für einen Besamer. Nicht, dass er noch Zuneigung entwickelt …«
Sie betrachtete die Männer mit dem Blick eines Fußballtrainers, der seine Spieler nach ihrer Eignung für die ihnen zugedachte Aufgabe auswählt. Was in diesem engen Rahmen echte Begeisterung nicht ausschloss. »Einem Schöneren als dem Heiligen Geist bin ich nie begegnet«, rief meine Mutter oft, »überall schön. Du wirst es ja bald bemerken, wenn du genauso schön wie er geworden bist.«
Mein Erzeuger fehlte mir nicht, weil ich mich als Erwachsener in meinem Spiegelbild an ihm ergötzen würde und vor allem weil Mama für mich der Nordpol, der Südpol, der Äquator, die Tropen in einem war …
Die Familie? Mamas Gäste, die nicht einen Tag vergehen ließen, ohne sich die Kehle anzufeuchten im Bistro, die mich, wenn ich aus der Schule kam, wie eine Großmutter, ein Bruder, eine Tante zu Hause empfingen; sie plauderten mit mir, manche nur kurz, andere länger, erkundigten sich nach meiner Gesundheit, nach der Schule. Dank Mamas Beruf hatte ich eine große Familie.
Den ersten Platz dieser Stammgäste nahm Madame Simone ein. Madame Simone zu beschreiben ist leicht: Sie wirkte verbraucht. Ihre Haut, durchscheinend, bräunlich, welk, war von Falten zerfurcht, während die Jahre ihre Zähne und ihre Hornhaut gelb gefärbt hatten. Wie alt sie war? »Gar nicht so alt!«, pflegte Mama denen zu antworten, die sie danach fragten. Madame Simone wirkte auch durch einen unbarmherzigen Feind verbraucht, die Schwerkraft; das Fleisch ihres Körpers drückte ihre gebeugte Gestalt nieder, ihr Haar hing schlaff herunter, ihre Lider wurden schwer, ihre Mundwinkel hingen nach unten, ihr Kinn purzelte in Kaskaden abwärts, ihre Wangen hingen. Und schließlich wirkte sie verbraucht durch die Sorgen, denn Scherereien waren fürwahr kübelweise über ihr ausgekippt worden.
Man muss wissen, dass Madame Simone eine Hure und ein Mann war. Oder besser, wenn man die Reihenfolge der Ereignisse respektiert, ein Mann und eine Hure.
Das muss ich erklären. In ihrer Kindheit hatte Madame Simone Jules geheißen. Dieser Jules hatte sich als Opfer eines grundlegenden Fehlers empfunden: Er hatte den Körper eines Jungen geerbt, obwohl er sich innerlich als Mädchen fühlte. Trotz seiner weiblichen Vorlieben und weiblichen Körpersprache hatte man Jules das Gegenteil eingeredet und ihm verboten, Röcke zu tragen. Man hatte ihm die Haare geschnitten, die er als Zöpfe tragen wollte. Man hatte ihn gezwungen, mit tiefer Stimme zu reden, und von ihm als Jungen gesprochen. Und da er sich gewehrt hatte, hatte man ihn bestraft, verspottet, beschimpft, kurz, man hatte seine innersten Überzeugungen mit Füßen getreten. Obwohl er sich danach gesehnt hatte, ein Mädchen zu sein, hatte Jules immer nur kämpfen müssen, außer bei seiner Tante Simona, einer von der Familie geschmähten Exzentrikerin, die seine Launen zuließ, wenn er bei ihr war. Nach zwanzig Jahren des Kampfs gegen seine Eltern, seine Brüder, seine Schwestern, seine Kameraden, seine Nachbarn, seine Lehrer hatte Jules die Stadt Luchon verlassen. In Paris hatte er Jules gegen Simone getauscht, hatte sich nach seinen Träumen gekleidet, frisiert, geschminkt und niemanden aus seiner Vergangenheit je wiedergesehen.
Man hätte hoffen können, dass das Drama mit diesem glücklichen Ausgang sein Ende finden würde. Weit gefehlt. Die Tragödie fing erst an … Madame Simone hatte das Aussehen einer Frau angenommen, aber nicht das einer hübschen Frau. Männlich oder weiblich, sie blieb hässlich. Ihren plumpen Gesichtszügen fehlte es an Symmetrie, ihr schütteres Haar baumelte schlaff an ihrem Kopf, während starker Bartwuchs ihre Wangen ab mittags bläulich schimmern ließ und zu zwei Rasuren am Tag zwang. Was ihren Körper betraf, so erinnerte er an einen geschlossenen Koffer. Nur ihre Knöchel waren schmal und anmutig; doch zu Mamas Bedauern besaß sie davon nur zwei.