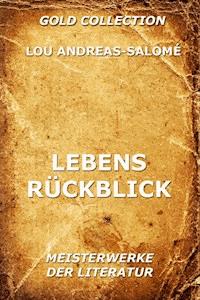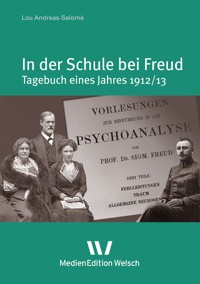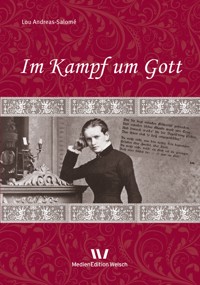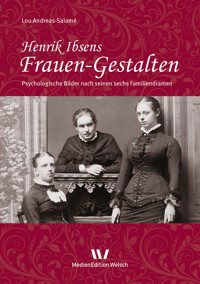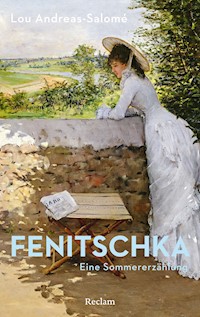
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Im spätsommerlichen Paris lernt Max eine ungewöhnliche, sehr eigenständig denkende und lebende Studentin kennen. Der Psychologe ist fasziniert von der jungen Russin. Die beiden kommen sich nahe, doch ihre Beziehung schwankt auf für ihn rätselhafte Weise zwischen vertrauensvoller Freundschaft und Verliebtheit. Max und Fenitschka verlieren sich aus den Augen, um sich später noch einmal zu treffen … Die Emanzipationsversuche einer jungen Frau um 1900, psychologisch einfühlsam erzählt von der russisch-deutschen Schriftstellerin und Rilke-Freundin Lou Andreas-Salomé (1861–1937).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Ähnliche
Lou Andreas-Salomé
Fenitschka
Eine Sommererzählung
Reclam
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: Jean Béraud (1849–1935), Un Figaro de rêve – Bridgeman Images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962134-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014374-2
www.reclam.de
Inhalt
Fenitschka
Anhang
Fenitschka
Es war im September, der stillsten Zeit des Pariser Lebens. Die vornehme Welt steckte in den Seebädern, die Fremden wurden scharenweise von der drückenden Hitze vertrieben. Trotzdem drängte sich an den schwülen Abenden auf den Boulevards eine so vielköpfige Menge, dass sie der Hochsaison jeder andern Stadt immer noch genügt hätte.
Max Werner flanierte nach Mitternacht über den Boulevard St. Michel, als er in eine kleine Gesellschaft ihm bekannter Familien hineingeriet. Sie hatten mit durchreisenden Freunden ein Theater besucht und wollten nun diesen Herren und Damen ein wenig »Paris bei Nacht« zeigen, – nämlich erst in einem charakteristischen Nachtcafé des Quartier Latin einkehren und dann, im Morgengrauen, um die Stunde, wo die Stadt schläft, den interessanten Trubel bei den Hallen betrachten, wenn der verödete Platz sich mit den Marktleuten belebt, die ihre Waren vom Lande einfahren und sie ausbreiten.
Nach einigem Zögern und Schwanken von Seiten der Damen entschied man sich für das Café Darcourt, das um diese Stunde schon überfüllt war mit den Grisetten und Studenten des Quartier, und besetzte ein paar der kleinen Marmortische draußen, die auf dem Trottoir, mitten unter den Passanten, an den weit geöffneten, hellerleuchteten Fenstern entlang standen.
Max Werner kam neben eine junge Russin zu sitzen, die er zum ersten Mal sah – ihren lang klingenden Namen überhörte er bei der Vorstellung, doch wurde sie von den anderen einfach als »Fenia« oder »Fénitschka« angeredet. In ihrem schwarzen nonnenhaften Kleidchen, das fast drollig unpariserisch ihre mittelgroße ganz unauffällige Gestalt umschloss und eine beliebte Tracht vieler Züricher Studentinnen sein sollte, machte sie zunächst auf ihn keinerlei besonderen Eindruck. Er musterte sie nur näher, weil ihn im Grunde alle Frauen ein wenig interessierten, wenn nicht den Mann, dann mindestens den Menschen in ihm, der seit einem Jahre doktoriert hatte und nun ein brennendes Verlangen besaß, in der Welt der Wirklichkeit praktisch Psychologie zu lernen, ehe er von einem Katheder herab welche las: was ihm einstweilen noch keine begehrenswerte Zukunft schien.
An Fenia fielen ihm nur die intelligenten braunen Augen auf, die jeden Gegenstand eigentümlich seelenoffen und klar – und jeden Menschen wie einen Gegenstand – anschauten, sowie der slawische Schnitt des Gesichtes mit der kurzen Nase: einer von Max Werners Lieblingsnasen, die da vernünftigen Platz zum Kusse lassen – was eine Nase doch gewiss tun soll.
Aber dieses gradezu blass gearbeitete, von Geistesanstrengungen zeugende Gesicht forderte so gar nicht zum Küssen auf.
Anfangs sprachen sie kaum miteinander, denn im Innern des Lokals, neben demselben Fenster, an dessen Außenseite sie saßen, spielte sich eine erregte Szene ab, die aller Aufmerksamkeit auf sich zog. Dort befanden sich zwei Pärchen am Tisch, die ihre Unterhaltung mit Scherzreden und Neckereien begannen und damit endeten, sich fürchterlich zu zanken.
Das eine der beiden Mädchen – wenig schön und am Verblühen, aber trotzdem ein unverwüstlich graziöses Pariser Köpfchen – wurde schließlich vom Gegenpaar mit einer Flut hässlicher Schmähreden überschüttet, ohne dass ihr eigener Begleiter ihr auch nur im mindesten beigestanden hätte. Vielmehr stimmte er bei jedem erneuten Angriff johlend in das brutale Gelächter der beiden andern ein, das sich bald auch auf die benachbarten Tische fortpflanzte, wo neben den erhitzten halbbezechten Männern die geputzten Genossinnen des misshandelten Geschöpfs mit lärmender Schadenfreude ihre Konkurrentin niederjubelten.
Durch die schwere, dumpfe, vom Tabakrauch und vom Dunst der Menschen, Gasflammen und Getränke erfüllte Luft des Lokals schallten die rohen Stimmen laut bis zu dem Tisch draußen hinüber, an dem es ganz still geworden war. Auf den Gesichtern der Damen prägten sich deutlich Mitleid, Ekel, Entrüstung und eine gewisse Verlegenheit darüber aus, einer solchen Situation beizuwohnen; eine von ihnen knüpfte furchtsam ihren Schleier fester. Niemand aber war so benommen von dem, was er sah, wie Fenia.
Sie hatte von allem Anfang an mit sachlichem Interesse um sich geblickt, jede Einzelheit, die ihr auffiel, mit großer Unbefangenheit beobachtet. Jetzt aber wurde sie ganz sichtlich von einer so intensiven Anteilnahme erfüllt, dass sie zuletzt – offenbar ganz unwillkürlich, wie außerstande länger passiv zu verharren – sich langsam erhob und die eine Hand gegen die Lärmenden ausstreckte, als müsse sie eingreifen oder Halt gebieten. Im selben Augenblick ward sie sich ihrer spontanen Bewegung bewusst, hielt sich zurück und errötete stark, wodurch sie plötzlich ganz lieb und kindlich und ein wenig hilflos aussah.
Während sie aber so dastand, traf ihr Blick den der Grisette, die in ihrer Ratlosigkeit und Verlassenheit angefangen hatte zu weinen, so dass große Tränen ihr über die heißen geschminkten Wangen rollten und ihre Lippen sich konvulsivisch verzogen. Unter dem langen, eigentümlichen Blick, den sie mit Fenia austauschte, veränderte sich der Ausdruck des weinenden Gesichts; von Fenias Augen schien eine Hilfe, eine Liebkosung, eine Aufrichtung auszugehn, etwas, was die Einsamkeit dieses getretenen Geschöpfes aufhob. Man konnte vom Tisch aus deutlich den Stimmungswechsel auf ihren Zügen verfolgen, denn sie saß fast grade gegenüber am Fenster. Ein Danken, Staunen, Nachsinnen – ein momentanes Taubwerden für ihre lärmende Umgebung und deren Schmähreden ließ ihre Tränen versiegen, und sie achtete kaum noch darauf, dass das Paar neben ihr sich erhob, um fortzugehn, und auch ihr Begleiter seinen schäbigen Zylinder vom Wandhaken abhob.
Da stieß er sie brutal mit dem Ellenbogen an und forderte sie auf, sich zu beeilen.
Sie schüttelte den Kopf und erwiderte einige Worte im Pariser Argot, die man draußen nicht deutlich vernehmen konnte, die aber eine äußerst deutliche Gebärde der Geringschätzung und Ablehnung begleitete. Er machte eine verdutzte Miene und rief dadurch neues Gelächter hervor. Diesmal jedoch galt es ihm, dem Geprellten, der mit wütendem Gesicht das Lokal verließ.
Das Mädchen nahm ihr fadenscheiniges Seidenmäntelchen von der Stuhllehne, hing es um und schaute dabei mit einem stolzen und leuchtenden Blick zu Fenia hinüber, die unbeweglich stehn geblieben war – eine ganz wunderlich ernste, ergriffene Gestalt inmitten der verschleierten Damen und der buntgekleideten, lachenden Dämchen umher.
Gleich darauf sah man ihren Schützling aus der Tür treten und am Tisch vorüberkommen. Aber da geschah etwas allen ganz Unerwartetes: denn neben Fenia blieb das Mädel stehn, öffnete die Lippen, wie um sie anzusprechen, und plötzlich, mit einer impulsiven Bewegung, deren Natürlichkeit eine mit sich fortreißende Anmut besaß, streckte sie Fenia beide Hände entgegen.
Diese ergriff die dargebotenen Hände und schüttelte sie mit herzhaftem Druck. Einige Augenblicke lang standen sie da und lächelten einander an wie Schwestern, während alle verblüfft, interessiert, amüsiert um die beiden herumsaßen. Dann entfernte sich das Mädchen mit einer Kopfneigung gegen die andern und verschwand im vorüberhastenden Menschenstrom.
Man lachte über das kleine Drama, man scherzte über Fenias »Erfolg« und neckte sie nicht wenig. Sie selbst war sehr einsilbig geworden.
Eine der Damen missverstand ihren ernsthaften Gesichtsausdruck und bemerkte:
»Ja, chérie, eine ziemlich unerbetene und unbequeme Freundschaft! Sie könnte Ihnen eines schönen Tages recht peinlich werden, wenn dies Wesen Sie irgendwo auf der Straße wiedertrifft und Sie auf das Intimste begrüßt – zur Überraschung derer, die vielleicht mit Ihnen gehen.«
»Das brauchen Sie nicht zu befürchten«, widersprach Max Werner rasch, »ich wette darauf, dass dieses Mädchen ohne merkbaren Gruß an Ihnen vorübergehen wird, falls es Ihnen je begegnet. Anderswo würden Sie vielleicht von ihrer Dankbarkeit verfolgt werden – die Französin würde es für eine schlechte Dankbarkeit halten, Sie eventuell dadurch zu kompromittieren. Das ist der französische Takt – der Takt einer alten Kultur, die allmählich bis in alle Schichten eines Volkes durchdringt und ihm seine fast instinktive Intelligenz gibt.«
»Ich würde sie aber gern wiedersehen!«, sagte Fenia leise.
»Um was zu tun?«
»Ich weiß es nicht. Aber was mich vorhin so entsetzte, das war das Gefühl, als ob diese Mädchen gleichmäßig sowohl von den Männern wie von den Genossinnen preisgegeben würden – als ob sie gradezu wie in Feindesland lebten. – Ich habe noch nie so viel höhnische Verachtung gesehen wie in den Mienen der Männer – so viel höhnische Schadenfreude wie in den Blicken der andern Mädchen. – Und das ist hier im Lokal, wo sie sozusagen bei sich ist, unter den Ihrigen. – Außerhalb nun erst! – O ich denke mir, ein solches armes Ding muss nach einer freundlichen, einfach menschlichen Berührung lechzen.«
»Das ist richtig. Manchmal sind sie sehr dankbar dafür. Ich hab es mitunter auch schon bestätigt gefunden.«
»Sie?« Fenia heftete voll Interesse ihre hellbraunen Augen auf ihn. Sie war ganz und gar bei der Sache.
»Warum nicht ich?«
»Weil ich mir vorstelle, dass solche Mädchen einem jeden Mann mit Misstrauen begegnen – müssen sie nicht annehmen, er wolle von ihnen etwas ganz andres als ihr Vertrauen?«
»Donnerwetter!«, dachte er und sah sich Fenia genauer an. Dieser Grad von Unbefangenheit, womit sie über so heikle Dinge mit einem ihr ganz fremden Manne sprach, hier, in Paris, in der Nacht, in diesem Café – und dabei ein Ausdruck in ihren Mienen, als unterhielten sie sich über fremdländische Käfer.
Waren Grisetten, junge Männer, Nachtcafés und Liebesabenteuer ihr wirklich dermaßen fremdländische Käfer?
»Diese Annahme würde ihr Vertrauen dem Manne gegenüber vermutlich gar nicht beeinträchtigen«, entgegnete er inzwischen Fenia auf ihre Frage, »denn dass er neben seiner menschlichen Anteilnahme vielleicht auch von ihnen als – als Frauen etwas empfangen will, das halten sie für ganz natürlich. Das Gegenteil würde wohl gar ihre Eitelkeit kränken und keinesfalls ihr Selbstbewusstsein heben.«
Er blickte bei seinen Worten um sich, ob der kleinen Gesellschaft, die längst zu andern Gesprächsstoffen übergegangen war, die Unterhaltung vernehmbar sei, und beugte sich näher zu Fenia, um mit gedämpfterer Stimme fortfahren zu können.
»Es ist auch gar nicht so verwunderlich, wie es Ihnen vielleicht scheint«, bemerkte er, »denn Sie dürfen nicht vergessen, dass es sich dabei nur um eine diesen Wesen ganz geläufige Verkehrsform handelt, – um eine so gewohnte und geläufige, dass sie in ihr unwillkürlich alles und jedes zum Ausdruck bringen, auch Seelenregungen der Freundschaft, Dankbarkeit oder Sympathie, die in die sinnliche Äußerungsform nicht genau hineinpassen. Es ist eben ihre Art von Sprache geworden.«
Auch die vertrauliche Nähe, in der er das zu Fenia sagte und sie gleichsam mit sich isolierte, störte sie augenscheinlich nicht; sie senkte den Kopf und schien nachzudenken.
Nach einer kurzen Pause fragte sie lebhaft:
»Sie meinen also, auch diese Mädchen hegen oft rein kameradschaftliche Gesinnungen Männern gegenüber und äußern sie nur – nur – sozusagen nur falsch? Das kann ich mir schwer vorstellen. Denn wenn es auch die ihnen gewohnteste Sprache ist, worin sie alles und jedes ausdrücken, – alle Menschen haben doch verschiedene Bezeichnungen für total verschiedene Dinge.«
»Glauben Sie? Ich meinerseits glaube viel eher, dass auch in unsern Ständen sich eine ganz ähnliche Beobachtung machen lässt. Unsre Mädchen und Frauen werden so daran gewöhnt, mit den Männern ihrer Umgebung eine rein konventionelle, ganz unsinnliche Verkehrsform zu üben, dass sie in dieser Sprache auch das noch ausdrücken, was ganz und gar nicht so abstrakt gemeint ist. Wie manches Mädchen meint, mit einem Mann nichts als Geistesinteressen und Seelenfreundschaft zu teilen, während sie, – oft unbewusst, – nichts andres begehrt als seine Liebe, seinen Besitz. – Für eine kleine Grisette ist die menschliche Anteilnahme eines Mannes das bei weitem seltenere, gewissermaßen ausgeschlossene, – für die Dame unsrer Gesellschaft ist es das rücksichtslose Sich-Ausleben des Weibes.«
Kaum hatte er diese Tirade vorgebracht, als unglücklicherweise die Gesellschaft aufbrach. Mitten im Stühlerücken und Durcheinanderreden fasste eine von den Damen Fenia unter den Arm und schnitt ihm ihre Antwort ab. Es ging nicht mehr über ein höchst uninteressantes Geschwätz aller mit allen hinaus.
Dennoch flanierte er neben ihnen her durch die nächtlichen Straßen, machte im »Chien qui fume« das unvermeidliche Nachtessen von Zwiebelsuppe und Austern mit und beschaute sich mit den andern in der Frühdämmerung durch die breiten Spiegelfenster des Restaurants das großartig malerische Bild der Wareneinfuhr in die Hallen. Dabei erfuhr er von einem russischen Journalisten, der Fenias Eltern gekannt hatte, wenigstens etwas vom äußern Umriss ihres Lebens. Von Geburt war sie Moskowitin, begleitete aber schon früh ihren erkrankten Vater, einen ehemaligen Militärarzt, nach Süddeutschland und der Schweiz, wo sie ihre Universitätsstudien begann – und nach seinem Tode mit Hilfe von mühsamem Nebenerwerb, Stundengeben und Übersetzungen aller Art hartnäckig fortsetzte. In Zürich schien sie mit lauter ihr befreundeten Männern zusammen zu studieren, – einer von ihnen hatte sie in den Herbstferien auch hierher, nach Paris, begleitet, war dann aber nach Russland abgereist.
Kam daher dieser merkwürdig schwesterliche, geschlechtslose Anstrich, den sie sich gab, als gäbe es für sie auf der Welt nur lauter Brüder? Oder war es nicht viel wahrscheinlicher, dass dies unendlich unbefangene Betragen nur den äußeren Deckmantel abgab für ein ganz freies Leben? Sie musste doch schon recht viel von der Welt und den Menschen kennen – mehr als eines der wohlbehüteten jungen Mädchen unsrer Kreise.
Immer wieder schweiften seine Augen und seine Gedanken zu ihr hinüber, von der er argwöhnte, sie halte sich eine höchst kluge und gelungene Maske vor. Steckte nicht hinter diesem Nonnenkleidchen, das unter den andern Toiletten fast auffiel, etwas recht Leichtgeschürztes, – hinter diesem offenen, durchgeistigten Gesicht nicht etwas Sinnenheißes, worüber sich nur ein Tölpel täuschen ließ? – Spielte nur seine eigene Phantasie ihm einen Streich, oder erinnerte Fenia nicht an die Magerkeit, Geistigkeit und stilisierte Einfachheit einer modern präraffaelitischen Gestalt