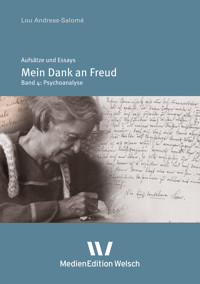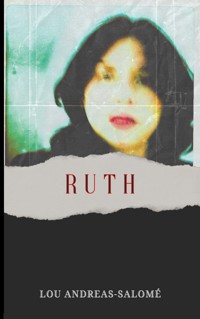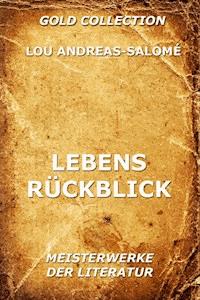
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Autobiografie der russisch-deutschen Schriftstellerin, Erzählerin, Essayistin und Psychoanalytikerin.
Das E-Book Lebensrückblick wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lebensrückblick
Lou Andreas-Salomé
Inhalt:
Lou Andreas-Salomé – Biografie und Bibliografie
Lebensrückblick
Das Erlebnis Gott
Liebeserleben
Erleben an der Familie
Das Erlebnis Rußland
Freundeserleben
Unter Menschen
Mit Rainer
Das Erlebnis Freud
Erinnertes an Freud
Vor dem Weltkrieg und seither
F. C. Andreas
Was am "Grundriß" fehlt
Lebensrückblick, Lou Andreas-Salomé
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849604240
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Lou Andreas-Salomé – Biografie und Bibliografie
Schriftstellerin, Erzählerin, Essayistin und Psychoanalytikerin aus russisch-deutscher Familie. Eigentlich Louise von Salomé; gelegentliches Pseudonym „Henry Lou“, geboren am 12. Februar 1861 in St. Petersburg, verstorben am 5. Februar 1937 in Göttingen. Die Art ihrer persönlichen Beziehungen zu prominenten Vertretern des deutschen Geisteslebens – in erster Linie zu Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke und Sigmund Freud – war und ist bis heute Gegenstand unterschiedlicher Interpretationen. Ihr Vater Gustav Salomé stammte von südfranzösischen Hugenotten ab und kam 1810 als Kind mit seiner Familie nach St. Petersburg. Eine militärische Karriere führte ihn bis in den Generalstab der russischen Armee. 1831 wurde er durch Zar Nikolaus I. in den Adelsstand erhoben. Die Mutter, Louise, geb. Wilm war norddeutsch-dänischer Herkunft. Die beiden heirateten 1844, ihre Tochter Louise von Salomé kam als jüngstes von sechs Kindern und einziges Mädchen am 12. Februar 1861 in St. Petersburg zur Welt. Sie wuchs als Liebling des Vaters in einer wohlhabenden, kulturell vielseitig interessierten Familie auf, in der drei Sprachen gesprochen wurden: Deutsch, Französisch und Russisch. In der glücklichen und anregenden Kindheit sehen Biographen die Grundlage für ihre gleichbleibend starke intellektuelle Neugier, für ihre innere Sicherheit und Unabhängigkeit, auch für ihre Souveränität im Umgang mit mehr oder weniger bedeutenden Männern. Kurz vor ihrem Tod beschrieb sie ihr Lebensgefühl: „Es mag mir geschehen, was will – ich verliere nie die Gewissheit, dass hinter mir Arme geöffnet sind, um mich aufzunehmen“.
Einige Aufregung und Spannungen innerhalb ihrer streng protestantischen Familie verursachte Louise, als sie die Konfirmation durch den dogmatischen Pastor der zuständigen reformierten Gemeinde verweigerte und mit 16 Jahren aus der Kirche austrat. Als Achtzehnjährige war sie fasziniert von den Predigten eines anderen protestantischen Pastors in St. Petersburg, des Holländers Hendrik Gillot, der sie als Schülerin annahm und mit ihr philosophische, literarische und religiöse Themen besprach. Umfang und Intensität dieser Studien sind aus ihren Notizbüchern ablesbar. Es gehörten dazu: Vergleichende Religionsgeschichte; Grundvorstellungen der Religionsphänomenologie. Dogmatismus, messianische Vorstellungen im Alten Testament und der Glaubenssatz von der Dreifaltigkeit; Philosophie, Logik, Metaphysik und Erkenntnistheorie; das französische Theater vor Corneille, die klassische französische Literatur, Descartes und Pascal; Schiller, Kant und Kierkegaard, Rousseau, Voltaire, Leibniz, Fichte und Schopenhauer. Hier werden die Grundzüge jener umfassenden Bildung sichtbar, die, ebenso wie ihre rasche Auffassungsgabe, spätere Gesprächspartner immer wieder beeindruckte.
Gillot war 25 Jahre älter als sie und hatte zwei nahezu erwachsene Töchter. Nun kündigte er an, dass er sich von seiner Frau trennen wolle und machte seiner Schülerin einen Heiratsantrag. Von Salomé lehnte ab. An einer Ehe und einem sexuellen Verhältnis war sie nicht interessiert; sie war regelrecht enttäuscht und schockiert durch diese Entwicklung, blieb aber mit Gillot befreundet. Dieses Muster wiederholte sich häufig in ihrem Leben: Männer machten ihr weitgehende Angebote (körperliche Intimität meist eingeschlossen), sie nahm davon, was sie wünschte; sie bestimmte die Bedingungen. Mit Gillot unternahm sie noch eine Reise nach Holland. Dort ließ sie sich von ihm konfirmieren – sie hätte sonst keinen eigenen Pass bekommen – und wurde von ihm auf den Namen „Lou“ getauft.
Nach dem Tod des Vaters (1879) zog Lou von Salomé zusammen mit ihrer Mutter im Herbst 1880 nach Zürich und begann ein Studium an der dortigen Universität, die als eine von wenigen Hochschulen jener Zeit auch Frauen zum Studium annahm. Zuvor hatte sie einen Eignungstest zu bestehen, weil ihr der verlangte Schulabschluss fehlte. Sie hörte unter anderem Religionswissenschaften, Logik, Metaphysik, Archäologie und Geschichte. Ein Lungenleiden zwang sie zur Unterbrechung des Studiums, man empfahl ihr zur Heilung ein wärmeres Klima. Im Februar 1882 trafen Mutter und Tochter in Rom ein.
Ein Empfehlungsschreiben verschaffte Lou von Salomé Zugang zum Bekanntenkreis der Schriftstellerin, Pazifistin und Frauenrechtlerin Malwida von Meysenbug, die einst wegen ihrer offenen Sympathien für die Revolutionäre von 1848 aus Berlin ausgewiesen worden war und inzwischen in Rom einen Zirkel von Künstlern und Intellektuellen in der Tradition der Berliner Salons etabliert hatte. In diesem Kreis verkehrten der Philosoph Paul Rée, ein Freund Friedrich Nietzsches, und auch Nietzsche selbst. Rée verliebte sich umgehend in Lou von Salomé, hielt um ihre Hand an und wurde abgewiesen; zwischen beiden entwickelte sich aber eine enge Freundschaft. Als Nietzsche im April 1882 Rom erreichte, war er durch enthusiastische Briefe von Rée auf die Begegnung mit von Salomé vorbereitet. Auch er war von der „jungen Russin“ entzückt und machte ihr einen Heiratsantrag, ausgerechnet durch Rée als Vermittler. Auch er wurde zurückgewiesen, war aber als Freund, Lehrer und Gesprächspartner hochwillkommen.
Denn sie hatte inzwischen, ohne ihn persönlich zu kennen, das Wunschbild einer intensiven Arbeitsgemeinschaft (der von ihr so genannten „Dreieinigkeit“) mit Nietzsche, Rée und sich selbst entworfen. Man würde in Wien oder Paris freundschaftlich zusammenleben, studieren, schreiben und diskutieren. Diese ihre Idealvorstellung, die zu dritt eifrig besprochen wurde, ließ sich nicht verwirklichen. Sie scheiterte letztlich an der Eifersucht der beiden Männer – sie wollten sich nicht auf die ihnen zugedachten Rollen festlegen lassen (andererseits hatte Nietzsche mehrfach die Befürchtung geäußert, dass jede wirklich enge, dauerhafte Bindung ihn an der Vollendung seines Lebenswerkes hindern könnte). Die Freundschaft zwischen von Salomé und Paul Rée war relativ unkompliziert, dabei enger und vertrauter als die zu Nietzsche – man duzte sich, schickte sich Tagebuchblätter zu und beriet sich über den jeweiligen Stand der Dinge im Verhältnis zu Nietzsche, der von alledem nichts wusste.
Dessen Situation wurde zunehmend unbefriedigender. Anfang Mai 1882 hatte er allein mit von Salomé einen langen Ausflug am Sacro Monte di Orta in Oberitalien gemacht – seither Anlass für Mutmaßungen darüber, wie nahe sich die beiden dabei gekommen waren. Mitte Mai dann in Luzern ein neuer Heiratsantrag, der wieder abgewiesen wurde. Hier entstand das bekannte Foto, von Nietzsche selbst in allen Einzelheiten arrangiert, auf dem Von Salomé ihn und Rée vor ihren Karren spannt. Wenig später begann Nietzsches Schwester Elisabeth, sich in die Angelegenheiten ihres Bruders einzumischen. Sie berichtete ihm von dem angeblich „leichtfertigen“ und „skandalösen“ Verhalten seiner Freundin während der Festspiele in Bayreuth und unterrichtete auch ihre Mutter über die aus ihrer Sicht moralisch bedenkliche Affäre. Nietzsche war empört über die Einmischung seiner Familie, litt aber auch unter den Details, die ihm zugetragen worden waren.
Seine Beziehung zu Lou von Salomé endete nach einer letzten Begegnung mit ihr und Rée im Herbst 1882 in Leipzig, von wo von Salomé abreiste, ohne sich von ihm zu verabschieden. Danach änderten sich Nietzsches Einstellung und Verhalten beiden gegenüber. In einem Briefentwurf vom Dezember 1882 äußerte er Verzweiflung und Selbstmitleid: „An jedem Morgen verzweifle ich, wie ich den Tag überdaure … Heute Abend werde ich so viel Opium nehmen, dass ich die Vernunft verliere: Wo ist noch ein M(ensch) den man verehren könnte! Aber ich kenne Euch alle durch und durch“. In unbeherrschter Eifersucht machte er Rée und Lou schwere Vorwürfe und verstieg sich zu wilden Beschimpfungen und Beleidigungen auch gegenüber Dritten. Danach sah man sich nie wieder.
Später bedauerte Nietzsche in einem Brief an seine Schwester sein Verhalten – und zwar sowohl in Hinblick auf die verlorene Freundschaft, als auch aus grundsätzlichen Erwägungen: „Nein, ich bin nicht gemacht zu Feindschaft und Hass: und seit diese Sache so weit fortgeschritten ist, dass eine Versöhnung mit jenen beiden nicht mehr möglich ist, weiß ich nicht mehr, wie leben; ich denke fortwährend dran. Es ist unverträglich mit meiner ganzen Philosophie und Denkweise …“ Im Januar 1883 schrieb er in Rapallo den ersten Teil des Zarathustra, überwand so seine akute Krise und hatte sich, wie er anmerkte, „einen schweren Stein von der Seele gewälzt“. Aus den Kapiteln, die sich auf das Wesen der Frauen beziehen, kann man Spuren seiner Erfahrungen mit von Salomé herauslesen, zugleich aber auch Abschluss und Bewältigung dieser Episode seines Lebens. Er blieb bis zu seinem Lebensende allein; nach seinem völligen geistigen Zusammenbruch im Januar 1889 wurde er von Mutter und Schwester gepflegt, bis er am 25. August 1900 starb. In ihrem Buch „Nietzsche in seinen Werken“ von 1894 versuchte von Salomé, auf der Grundlage ihrer genauen Textkenntnis und ihrer persönlichen Erfahrungen mit dem schwierigen Freund, den „Denker durch den Menschen zu erläutern“. Anna Freud sprach später davon, Lou Andreas-Salomé habe mit diesem Buch über Nietzsche die Psychoanalyse vorweggenommen.
Lou von Salomé und Paul Rée lebten drei Jahre lang freundschaftlich zusammen in Berlin und trennten sich 1885. Reé kam 1901 bei einer Bergwanderung ums Leben; ungeklärt blieb, ob durch einen Unfall oder durch Suizid.
Im August 1886 lernte Lou von Salomé in Berlin den Orientalisten Friedrich Carl Andreas kennen. Er war fünfzehn Jahre älter als sie, dunkelhaarig, temperamentvoll und bald fest entschlossen, sie zu heiraten. Seine entschiedene Absicht unterstrich er durch einen Selbstmordversuch vor ihren Augen. Nach längeren inneren Kämpfen willigte sie 1887 in die Eheschließung ein, stellte aber Bedingungen. Die Hauptsache: sie werde sich niemals bereit finden, die Ehe sexuell zu vollziehen. Aus welchen Gründen Andreas dies akzeptierte, ist nicht bekannt. Falls er hoffte – wie meist vermutet wird –, dass sie es damit nicht dauerhaft ernst meinen werde, sah er sich enttäuscht. In den ersten Ehejahren gab es immer wieder Eifersuchtsszenen wegen ihrer Beziehungen zu anderen Männern. Dennoch lehnte Andreas es mehrmals ab, sich scheiden zu lassen. In Berlin bewohnte das Paar nacheinander verschiedene Wohnungen, zeitweilig hatte Andreas berufliche Schwierigkeiten und nur sehr geringe Einnahmen, so dass die ebenfalls recht begrenzten Einkünfte, die seine Frau als Schriftstellerin erzielte, dringend gebraucht wurden.
Lou Andreas-Salomés Leben bestand aus einer konventionellen, bürgerlichen Hälfte mit Ehemann, hausfraulicher Pflichterfüllung und geistiger Arbeit – und einem anderen Bereich, in dem sie weder Pflichten noch engere Bindungen akzeptierte und mit gelegentlichen, inoffiziellen Liebhabern unterwegs war. Gleichzeitig warf sie ihrem Mann anfangs dessen Beziehung zu ihrer Haushälterin Marie vor. Doch kümmerte auch sie sich um das Kind aus dieser Verbindung, nachdem die Mutter früh gestorben war, und setzte es später als Haupterbin ein. Auf lange Sicht erwies sich die schwierige, widersprüchliche Ehe als unerwartet haltbar. Seit Friedrich Carl Andreas im Frühjahr 1903 auf den Lehrstuhl für Westasiatische Sprachen an der Universität Göttingen berufen worden war, lebte das Paar dort im eigenen Haus (von ihr „Loufried“ genannt, wie schon ein früherer Aufenthaltsort) – er mit der Haushälterin im Erdgeschoss, sie im Stockwerk darüber. Sie betreute, wenn sie in Göttingen war, den Garten am Haus, sie baute Gemüse an und hielt Hühner, führte aber im Wesentlichen weiterhin ein unabhängiges, reisefreudiges Leben. In ihren Tagebuchnotizen erscheint dieser Lebensabschnitt, insbesondere das Verhältnis zu ihrem Mann, wesentlich entspannter als die Zeit zuvor.
Als Lou von Salomé in Berlin mit Paul Rée zusammenwohnte, also von 1882 bis 1885, bestand ihr gemeinsamer Bekanntenkreis hauptsächlich aus Wissenschaftlern—den Freunden und Fachkollegen Rées. Von Salomé war die einzige Frau in diesem Kreis, sie genoss die Verehrung der Männer und die Teilnahme an den philosophischen und naturwissenschaftlichen Diskussionen. 1885 erschien unter dem Pseudonym Henry Lou ihr erstes Buch, der Roman Im Kampf um Gott, Thema: „Was geschieht, wenn der Mensch seinen Glauben verliert?“ Mit dem Problem musste sie sich in ihrer eigenen Jugend schon beschäftigen. Die Kritiken waren gut, das Pseudonym schnell durchschaut, der Erfolg machte sie in weiteren Kreisen der Berliner Gesellschaft bekannt.
Nach ihrer Heirat mit Friedrich Carl Andreas ergaben sich neue Kontakte, insbesondere zum sogenannten „Friedrichshagener Dichterkreis“ und zum „Freundeskreis der Freien Volksbühne“ – beide personell zu großen Teilen identisch. Um 1890 hatte sich in dem idyllischen Berliner Vorort Friedrichshagen eine lose Vereinigung von Schriftstellern und Naturliebhabern zusammengefunden, mit dem Ziel, ein zwangloses Leben zu führen sowie Dichtung und Theater im Sinne des Naturalismus zu erneuern. Bruno Wille, einer der Initiatoren, gehörte 1890 zu den Gründern der „Freien Volksbühne“, die Arbeitern den Zugang zur dramatischen Kunst ermöglichen sollte. Zu den Mitgliedern oder Sympathisanten dieser Initiativen gehörten unter anderen Otto Brahm, Richard Dehmel, Max Halbe, Knut Hamsun, Maximilian Harden, Gerhart Hauptmann, Hugo Höppener (genannt Fidus), Erich Mühsam und Frank Wedekind, vorübergehend auch August Strindberg. Bald war Lou Andreas-Salomé mit einer Anzahl von ihnen befreundet oder gut bekannt, besonders Hauptmann und Harden waren von ihr beeindruckt. In der Zeitschrift „Freie Bühne“, die das Projekt Volksbühne begleitete, veröffentlichte auch sie Artikel und Rezensionen. In diesem Zusammenhang wuchs ihr Interesse an den Dramen von Henrik Ibsen, mit denen die Volksbühne eröffnet worden war. Sie untersuchte seine Darstellung von Eheproblemen mit der für sie selbst bedeutsamen Fragestellung: Wie muss eine Ehe beschaffen sein, um auch der Selbstverwirklichung, besonders der Frauen, Raum zu lassen? Ihr Buch „Henrik Ibsens Frauengestalten“ von 1892 zu diesem Thema erhielt ungeteilten Beifall und festigte ihren Ruf als beachtenswerte Autorin.
Rainer Maria Rilke hatte sich seit 1896 in München aufgehalten und war mit literarisch noch recht anspruchslosen Gedichten und Erzählungen einigermaßen erfolgreich. Als Lou Andreas-Salomé im Frühjahr 1897 von Berlin aus ihre Freundin Frieda von Bülow in München besuchte, wurde ihr Rilke bei Jakob Wassermann vorgestellt. Was sie zu jenem Zeitpunkt nicht wusste: Schon vorher hatte er ihr eine Reihe von anonymen Briefen mit beigefügten Gedichten zukommen lassen. Nun versicherte er ihr, wie überaus beeindruckt er von ihrem religionsphilosophischen Essay „Jesus der Jude“ gewesen sei, in dem sie „mit der gigantischen Wucht einer heiligen Überzeugung so meisterhaft klar ausgesprochen“ habe, was er selbst in einem Gedichtzyklus ausdrücken wollte; er lief „mit ein paar Rosen in der Stadt und dem Anfang des Englischen Gartens herum …, um Ihnen die Rosen zu schenken“, las ihr aus seinen Arbeiten vor, widmete ihr ein eigenes Gedicht – wenig später hatte er mit seiner intensiven Werbung Erfolg.
Es folgten einige gemeinsame Sommermonate in der Marktgemeinde Wolfratshausen im Isartal nahe München. Sie bewohnten drei Kammern in einem Bauernhaus und nannten die Unterkunft „Loufried“. Als Lou Andreas-Salomé zurück nach Berlin ging, folgte Rilke ihr dorthin. Er war 21 Jahre alt. Andreas-Salomé, die er als mütterliche Geliebte überschwänglich verehrte, war 36. Auch sie war heftig verliebt, behielt aber, ihrem Wesen entsprechend, gleichzeitig die Kontrolle über sich und die Situation. Sie veranlasste ihn, an seinem sprachlichen Ausdruck zu arbeiten, den sie als übertrieben pathetisch empfand. Ihrem Vorschlag entsprechend änderte er seinen eigentlichen Vornamen René zu Rainer. Sie machte ihn mit dem Denken Nietzsches bekannt und lenkte sein Interesse auf ihre Heimat Russland; er lernte Russisch und begann, Turgenjew und Tolstoi im Original zu lesen. Dies alles geschah vorwiegend in der engen Berliner Wohnung des Ehepaares Andreas-Salomé. Rilke hatte sich ganz in der Nähe eingemietet, hielt sich aber meist bei Lou Andreas-Salomé auf, die in der Küche ihren Wohn- und Arbeitsraum hatte, während ihr Mann im Wohnzimmer arbeitete. Andreas-Salomé stellte bald fest, dass die innere Abhängigkeit des jungen, psychisch labilen Dichters ihr gegenüber ständig zunahm – eine unerwünschte Entwicklung. So drängte sie ihn im Frühjahr 1898 zu einer Italienreise, auf der sie ihn nicht begleitete.
In den Jahren 1899 und 1900 unternahmen sie dann gemeinsam zwei Reisen nach Russland, die erste, kürzere (25. April bis 18. Juni 1899) noch in Begleitung von Andreas. Die zweite Reise dauerte vom 7. Mai bis zum 24. August 1900 und gilt als Wendepunkt in der Beziehung zwischen Andreas-Salomé und Rilke (Eine dritte Reise wurde für 1901 geplant, kam aber nicht zustande). Die Pfingstwoche verbrachten beide in Kiew. Die starken Eindrücke und Empfindungen dieser Zeit sollen ihren Niederschlag in seinem berühmten Stundenbuch gefunden haben (geschrieben 1899 bis 1903). Sie gaben ihm aber auch Anlass zu Weinkrämpfen, zu „Angstverfassungen und körperlichen Anfällen“, wie Andreas-Salomé sich in ihrem Lebensrückblick erinnerte. Sie war erschrocken und besorgt, vermutete als Hintergrund eine ernsthafte psychische Erkrankung. Während eines Abstechers im August 1900 zum Urlaubsort ihrer Familie in Finnland beschloss sie, sich von Rilke zu trennen. Tatsächlich beendete sie die Liebesbeziehung dann erst mit einem Abschiedsbrief vom 26. Februar 1901. In der Zwischenzeit bekräftigte sie ihren Vorsatz in Tagebuchnotizen: „‚Was ich will vom kommenden Jahr, was ich brauche, ist fast nur Stille, – mehr Alleinsein, so wie es bis vor vier Jahren war. Das wird, muss wiederkommen.‘ – „Mich vor R. mit Lügen verleugnet‘. – ‚Damit R. fortginge, ganz fort, wäre ich einer Brutalität fähig (Er muss fort!)‘“.
Die leidenschaftliche Beziehung ging über in eine enge Freundschaft, die bis zu Rilkes Tod im Jahre 1926 anhielt. 1937, in seinem Nachruf auf Lou Andreas Salomé erinnerte Sigmund Freud daran, „dass sie dem großen, im Leben ziemlich hilflosen Dichter Rainer Maria Rilke zugleich Muse und sorgsame Mutter gewesen war.“
Bei einem Aufenthalt in Schweden begann Lou Andreas-Salomé ein intensives Verhältnis mit einem 15 Jahre jüngeren Mann, dem Nervenarzt und Freudianer Poul Bjerre. Als er 1911 zum Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung nach Weimar fuhr, begleitete sie ihn und traf dort erstmals mit Sigmund Freud zusammen. Er wurde zur entscheidenden Bezugsperson ihrer letzten 25 Lebensjahre. Sie ahnte und hoffte, dass die neue Denkschule der Psychoanalyse – mit Freud als Vaterfigur – ihr Zugang verschaffen könnte zum Verständnis der eigenen seelischen Verfassung. Von Oktober 1912 bis April 1913 hielt sie sich in Wien auf, später folgten viele weitere Besuche. Sie hörte im Wintersemester 1912/1913 Freuds Vorlesung in der Psychiatrischen Klinik über „Einzelne Kapitel aus der Lehre von der Psychoanalyse“ und nahm an seinen „Mittwochssitzungen“ und „Samstags-Kollegs“ teil. Mit ausdrücklicher Zustimmung Freuds beteiligte sie sich aber auch an den Diskussionsabenden Alfred Adlers, der sich 1911 von der orthodoxen psychoanalytischen Schule Freuds distanziert und mit seinem Verein für Individualpsychologie eine eigene tiefenpsychologische Schule begründet hatte.
Sigmund Freud hielt sehr viel von seiner Schülerin. In einer engen, rein platonischen Beziehung wurde sie für ihn durch ihren Wissensdurst, ihre Neugier auf menschliche Verhaltensweisen und die intensive Suche nach deren Verständnis eine hochgeschätzte Diskussionspartnerin. Sogar ihre eigenwillige Ausdeutung psychoanalytischer Konzepte, denen sie eine vorwiegend poetische und literarische Form gab, akzeptierte er ohne Widerspruch. Er fand, sie sei die „Dichterin der Psychoanalyse“, während er selbst Prosa schreibe. In der „Schule bei Freud“ (so der Titel ihres postum veröffentlichten Tagebuches der Jahre 1912/1913) lernte Lou Andreas-Salomé, ihr eigenes Leben besser zu verstehen und zu beherrschen, darauf legte sie in Hinblick auf ihr fortgeschrittenes Alter besonderen Wert.
Freud riet ihr zum Beruf der Psychoanalytikerin. Sie schrieb Aufsätze für die psychoanalytische Zeitschrift „Imago“ und war schon 1913 Gastrednerin beim Psychoanalytischen Kongress in Berlin. 1915 eröffnete sie in ihrem Göttinger Wohnhaus die erste psychoanalytische Praxis der Stadt. 1921 wurde sie Mitglied der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung. Im selben Jahr begann ihre Freundschaft mit Anna, einer der drei Töchter Freuds. 1923 ging sie auf Bitten Sigmund Freuds für ein halbes Jahr als Lehranalytikerin nach Königsberg, fünf Ärzte absolvierten bei ihr eine Lehranalyse (die sie selbst nie durchlaufen hatte). Zum 75. Geburtstag ihres Freundes und Lehrers am 6. Mai 1931 schrieb sie den offenen Brief „Mein Dank an Freud“. Der Adressat antwortete ihr: „Es ist gewiss nicht oft vorgekommen, dass ich eine psa. [psychoanalytische] Arbeit bewundert habe, anstatt sie zu kritisieren. Das muss ich diesmal tun. Es ist das Schönste, was ich von Ihnen gelesen habe, ein unfreiwilliger Beweis Ihrer Überlegenheit über uns alle.
Erst im Alter von 74 Jahren beendete Lou Andreas-Salomé ihre Arbeit als Psychoanalytikerin. Sie war schon zuvor schwächlich und herzkrank, musste deswegen mehrmals im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Ehemann besuchte sie täglich, eine beschwerliche Situation für den alten, ebenfalls kranken Mann. Nach einer vierzigjährigen Ehe mit gegenseitigen Kränkungen und lang andauernder Sprachlosigkeit waren die beiden sich nähergekommen. Sigmund Freud begrüßte das aus der Ferne: „So dauerhaft beweist sich doch nur das Echte“. Friedrich Carl Andreas starb 1930 an einem Krebsleiden. Lou Andreas-Salomé musste sich 1935 einer schweren Krebsoperation unterziehen. Am Abend des 5. Februar 1937 starb sie im Schlaf. Ihre Urne wurde im Grab ihres Mannes auf dem Stadtfriedhof in Göttingen beigesetzt.
Wenige Tage vor ihrem Tod konfiszierte die Gestapo ihre Bibliothek (nach anderer Quelle war es ein SA-Trupp, der die Bibliothek verwüstete, und zwar kurz nach ihrem Tode). Der Vorwurf: Sie sei Mitarbeiterin des Juden Sigmund Freud gewesen, habe eine „jüdische Wissenschaft“ betrieben und unter ihren Büchern fänden sich zahlreiche Werke jüdischer Autoren.
Ein Gedenkstein am neubebauten Grundstück ihres einstigen Wohnhauses, ein „Lou-Andreas-Salomé-Weg“ und der Name des „Lou-Andreas-Salomé Instituts“ für Psychoanalyse und Psychotherapie erinnern in Göttingen an die ehemalige Mitbürgerin.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Im Gesamten ist dieser Text zu finden unter http://de.wikipedia.org/wiki/Lou_Andreas-Salom%C3%A9.
Lebensrückblick
Grundriß einiger Lebenserinnerungen
"Menschenleben – ach! Leben überhaupt – ist Dichtung. Uns selber unbewußt leben wir es, Tag um Tag wie Stück um Stück, – in seiner unantastbaren Ganzheit aber lebt es, dichtet es uns. Weit, weitab von der alten Phrase vom ›Sich-das-Leben-zum-Kunstwerk-machen‹; wir sind nicht unser Kunstwerk."
Lou Andreas-Salomé
Das Erlebnis Gott
Unser erstes Erlebnis ist, bemerkenswerter Weise, ein Entschwund. Eben noch waren wir alles, unabgeteilt, war unabteilbar von uns irgendwelches Sein – da wurden wir ins Geborenwerden gedrängt, wurden zu einem Restteilchen davon, das fortan bestrebt sein muß, nicht in immer weitergehende Verkürzungen zu geraten, sich zu behaupten an der sich immer breiter vor ihm aufrichtenden Gegenwelt, in die es aus seiner Allfülle fiel wie in – zunächst beraubende – Leere.
So erlebt man zuerst gleichsam etwas schon Vergangenes, eine Abwehr des Gegenwärtigen; die erste "Erinnerung" – so würden wir es ein wenig später heißen – ist gleichzeitig ein Choc, eine Enttäuschung durch Verlust dessen, was nicht mehr ist, und ein Etwas von nachwirkendem Wissen, Gewißsein, daß es noch zu sein hätte.
Dies ist das Problem der Urkindheit. Es ist auch das aller Urmenschheit, daß sich in ihr eine All-eingeborenheit weiterbekundet neben den Erfahrungen des zunehmenden Bewußtwerdens: wie eine gewaltige Mär von unverlierbarer Teilhaberschaft an Allmacht. Und die frühe Menschheit wußte sich den Glauben daran dermaßen zuversichtlich zu erhalten, daß die gesamte Welt des Augenscheins menschlich zugänglicher Magie unterstellt erschien. Dauernd bewahrt das Menschentum etwas von diesem Unglauben an die Allgemeingültigkeit der Außenwelt, die einmal mit ihm ungeschieden Ein-und-dasselbige schien; dauernd überbrückt es den für sein Bewußtsein entstandenen Riß mit Hilfe der Phantasie, wenngleich diese das Modell ihrer göttlichen Korrekturen auch eben dieser mehr und mehr wahrgenommenen Außenwelt angleichen muß. Dies Darüber und Daneben, dies phantasierte Duplikat – berufen zu vertuschen, was sich mit dem Menschentum Fragwürdiges zugetragen hat – nannte der Mensch seine Religion.
Deshalb kann es auch einem heutigen oder gestrigen Kinde geschehen – falls es noch irgendwo ganz selbstverständlich umstellt ist von elterlicher Gläubigkeit, von "Für-wahrhaltungen" –, daß es das religiös Geglaubte ähnlich unwillkürlich einheimst wie die sachlichen Wahrnehmungen. Denn gerade seinen kleinsten Jahren, der kleinsten Unterscheidungsfähigkeit, eignet noch die Urfähigkeit, nichts für unmöglich und das Extremste für das Wahrscheinlichste zu halten; alle Superlative geben sich noch ein magisches Stelldichein im Menschen als natürlichste Voraussetzungen, bevor er sich an den Mittelmäßigkeiten und Unterschiedenheiten des Tatsächlichen gründlich genug gerieben hat.
Man denke nicht, einem religiös unbeeinflußten Kinde werde solche Vorzeit ganz erspart: die kindlichste Reaktion geschieht – infolge noch ungenügender Unterscheidungskraft und um so fragloserer Wunschkraft – immer zunächst aus dem Superlativischen heraus. Denn zu Beginn entschwindet unsere "All-eingeborenheit" unserm Urteil nicht ohne diese Hinterlassenschaft, die sich über die Gegenstände unserer ersten Anhänglichkeiten oder ersten Empörungen legt wie Verklärung oder wie Verzerrung ins Überdimensionale – wie ein noch restloses Allumfangen selber. Ja, man darf sagen: wo etwa zeitliche Umstände – beispielsweise die heutigen oder die von morgen – einem Kinde allzuviel davon und von den sich ganz unvermeidlich daran anschliessenden Enttäuschungen ersparen möchten, wo seine Nüchternheit allzufrüh kritisch einsetzen muß: da wäre eher zu fürchten, ob der natürliche Phantasietrieb, der unserer Verstandeswachheit so sehr lange vorangeht, sich nicht unnatürlich aufstauen könnte, um sich dermaleinst am nüchtern Realen in gespenstischen Übertreibungen zu rächen, und ob er nicht eben damit, unter solchem nachträglichen Drang, gerade die sachlichen Maßstäbe ausließe.
Wohl aber muß man hinzufügen: beim normalen Kinde weicht ein allzu "religiöses" Erzogensein von selbst vor zunehmender Kritik am Wahrgenommenen – ähnlich wie die ausschließliche Bevorzugung des Märchenglaubens vor dem brennenden Interesse an der Realität. Geschieht dies nicht, so wird meistens eine Entwicklungshemmung vorliegen, eine Unstimmigkeit zwischen dem, was dem Leben entgegentreibt, und dem, was zögert, sich mit dessen Bedingtheiten zu befreunden. –
Daß mit unserm Geborenwerden ein Riß – zwischen Welt und Welt – zwei Existenzarten fortan trennt, das läßt das Vorhandensein einer vermittelnden Instanz sehr begehrenswert werden. In meinem Fall mögen die überall einsetzenden Kleinkindkonflikte einen gewissen Zurückrutsch gezeitigt haben – aus bereits angepaßterer Urteilsweise in eine rein phantasierende, wobei sozusagen die Eltern und die elterlichen Standpunkte verlassen (fast verraten) wurden für ein totaleres Umfangen- und Aufgenommensein, für eins, worin man sowohl hingegeben war an noch größere Übermacht als auch in ihr teilhaftig jeder Selbstherrlichkeit, ja Allmächtigkeit.
Man stelle sich das etwa im Bilde vor: als habe man sich vom Elternschoß, von dem man auch manchmal niedergleiten muß, mitten auf den Gottesschoß gesetzt, wie auf den eines noch viel verwöhnendem, alles billigenden Großvaters, der so schenkfroh ist, als habe er alle Taschen voll und als würde man dadurch fast ebenso allmächtig wie er, wenn auch wohl nicht so "gut"; er bedeutet eigentlich: beide Eltern ineinandergestülpt: mütterliche Schoßwärme und väterliche Machtvollkommenheit. (Sie beide scheiden und unterscheiden, als Macht- und als Liebessphäre, ist schon ein gewaltiger Bruch im sozusagen wunschlos-vorweltlichen Wohlsein.)
Was aber bewirkt im Menschen überhaupt eine solche Fähigkeit, ein Phantasiertes für schlechthin Wirkliches zu nehmen? Doch nur die weiterwirkende Unfähigkeit, sich auf die Außenwelt, auf dieses Außerhalb Unser (groß geschrieben!), das wir gar nicht voraussetzen konnten, zu beschränken – als real voll anzuerkennen, was uns nicht mit-in-sich enthält.
Sicherlich wird dies ein Hauptgrund gewesen sein, warum mich die gänzliche Unsichtbarkeit dieser dritten Macht, der Übermacht auch noch über den Eltern, die letztlich ja doch auch nur durch diese alles empfingen, erstaunlich wenig störte. Es ergeht ja allen für-wahr-haltenden wachechten Gläubigen so. In meinem Fall kam noch ein Nebengrund hinzu: das war eine sonderbare Angelegenheit mit unsern Spiegeln. Wenn ich da hineinzuschauen hatte, dann verdutzte mich gewissermaßen, so deutlich zu erschauen, daß ich nur das war, was ich da sah: so abgegrenzt, eingeklaftert: so gezwungen, beim Übrigen, sogar Nächstliegenden einfach aufzuhören. Blickte ich nicht hinein, drängte sich mir dies nicht ganz so auf, doch irgendwie leugnete mein eignes Empfinden den Umstand, nicht in und mit Jeglichem vorhanden zu sein, sondern ohne Aufnahme darein, gleichsam daran obdachlos geworden. Es erscheint reichlich anormal, denn mir kommt vor, als wenn ich mich auch später noch zeitweise daran gestoßen hätte, wo längst das Spiegelbild eine interessierte Bezugnahme zum eignen Bilde ausdrückt. Jedenfalls aber haben solch frühe Vorstellungen dazu beigetragen, mir sowohl Allgegenwart wie Unsichtbarkeit des Lieben Gottes zu etwas absolut nicht Anstößigem werden zu lassen.
Freilich ist klar, inwiefern ein Gottesgebilde, aus so frühen Sensationen zusammengebastelt, nicht sehr lange vorhalten kann; weniger lange als verständiger, verständlicher bewerkstelligte – wie uns ja auch Großväter vor den lebensfähigem Eltern zu sterben pflegen.
An einer kleinen Erinnerung wird mir die Methode, womit ich Zweifel abgehalten haben mag, plausibel: In einem prachtvollen Knallbonbon, mir von meinem Vater anläßlich eines Hoffestes mitgebracht, mutmaßte ich goldene Kleider; als man mich jedoch belehrte, es enthielte nur Kleider aus dünnem Seidenpapier mit goldenen Rändchen – da ließ ich es ungeknallt. So blieben darin gewissermaßen dennoch goldene Kleider.
Auch die gottgroßväterlichen Geschenke bedurften keiner Sichtbarkeit für mich, gerade weil sie maßlos an Wert und Fülle und mir so absolut sicher waren und insbesondere bedingungslos sicher: nicht etwa, wie sonstige Geschenke, an Bravheit gebunden. Prangten doch sogar die auf Geburtstagstischen eigentlich nur da, weil man brav gewesen war oder es hoffentlich sein würde. Nun war ich häufig ein "schlimmes" Kind, mußte deshalb sogar peinliche Bekanntschaft mit einem Birkenreisig machen – was ich auch nie verfehlte, dem Lieben Gott ostentativ zu klagen. Er erwies sich hierin völlig meiner Meinung, ja er schien mir so zu ergrimmen, daß ich manchesmal, wenn ich just in edelmütiger Stimmung mich befand (was keineswegs oft der Fall war), ihm gut zuredete, die Anwendung dieses Birkenreisigs durch meine Eltern auf sich beruhen zu lassen.
Natürlich wird dieses Phantasietreiben es auch meiner täglichen Umgebung gegenüber nicht selten zu allerhand phantastischen Beigaben zu den Wirklichkeitsvorgängen gebracht haben, die man meistens wohl lächelnd überging. Bis eines Sommertages, als eine um ein wenig ältere kleine Verwandte und ich von unserm Spaziergang heimkamen und gefragt wurden: "Nun ihr Ausflügler, was habt ihr denn alles erlebt ?" – ich ungekürzt ein ganzes Drama von mir gab. Meine kleine Begleiterin, in ihrer kindlichen Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit aufgestört, starrte mich fassungslos an und warf lauten und schrecklichen Tones dazwischen: "Aber du lügst ja!"
Mir scheint, es wird wohl seitdem gewesen sein, daß ich mich bemühte, meine Aussagen genau zu machen – das hieß für mich aber: auch nicht das kleinste Stückchen hinzuzuschenken, obschon dieser erzwungene Geiz mich arg betrübte.
Dem Lieben Gott berichtete ich übrigens, nachts im Dunklen, nicht nur von mir: ihm erzählte ich – freigebig und unaufgefordert – ganze Geschichten. Mit diesen Geschichten hatte es eine eigene Bewandtnis. Sie erscheinen mir herausgeboren aus der Notwendigkeit, zum Gott auch noch die ganze Welt hinzuzufügen, die in aller Breite ja vorhanden war neben unserer insgeheimen, und von deren Wirklichkeit mich dieses Extraverhältnis sonst eher ablenkte, als daß es mich in ihr voll beheimatet hätte. Nicht zufällig also entnahm ich den Stoff der Geschichten wirklichen Begebenheiten oder Begegnungen mit Menschen, Tieren oder Gegenständen; fürs Märchenartige war ja durch den Gott-Zuhörer schon genügend gesorgt, es brauchte nicht betont zu werden; im Gegenteil handelte es sich einzig darum, sich von der Wirklichkeit, sozusagen exakt, zu überzeugen. Freilich konnte nichts erzählt werden, was der ebenso allwissende wie allmächtige Gott nicht bereits gewußt hätte; doch gerade dies verbürgte mir ja die unbezweifelbare Tatsächlichkeit des Erzählten, weshalb ich auch, nicht ohne Genugtuung, jedem Beginn das Wörtchen hinzufügte:
"wie Du weißt".
Des jähen Endes, welches dies etwas bedenkliche Phantasieverhältnis fand, hab' ich mich erst ganz spät, bereits gegen 's Alter, in seinen Einzelheiten wiedererinnert; es findet sich aufgezeichnet in einer kleinen Erzählung "Die Stunde ohne Gott", die indessen entwertet ist durch den Umstand, daß das Kind darin in fremdes Milieu, in abweichende Verhältnisse hineingesetzt ist – vielleicht, weil ich zur Gestaltung des Intimsten daran noch immer einer geringen äußerlichen Distanz bedurfte. Das Tatsächliche war folgendes:
Ein Knecht, der winters aus unserm Landhaus in unsere Stadtwohnung frische Eier brachte, tat mir kund, daß vor dem Miniaturhäuschen, welches ich inmitten des Gartens ganz allein zu eigen besaß, einlaßbegehrend "ein Paar" gestanden habe, das von ihm jedoch abgewiesen worden sei. Als er das nächste Mal wiederkam, fragte ich sofort nach dem Paar, wohl weil es mich beunruhigte, daß es inzwischen gefroren und gehungert haben mußte; wohin mochte es sich gewendet haben? – Ja, entfernt habe es sich gar nicht, meldete er. – Also dann stehe es immer noch vor dem Häuschen ? – Nun, das doch auch nicht: es habe sich nämlich allmählich ganz verändert, immer dünner und kleiner sei es geworden: dermaßen heruntergekommen sei es, und endlich vollends zusammengesunken; denn als er eines Morgens vor dem Häuschen gefegt, da habe er nur noch die schwarzen Knöpfe vom weißen Mantel der Frau vorgefunden und vom ganzen Mann nur noch einen zerbeulten Hut, den Platz aber, wo das gelegen, noch bedeckt von beider vereisten Tränen.
Das Unbegreifliche an dieser Schauermär enthielt für mich nun seinen schärfsten Stachel nicht mehr im Mitleid mit den Beiden, sondern am Rätsel der Vergänglichkeit, Zerschmelzbarkeit von so fraglos Vorhandenem: als hielte irgend etwas die naheliegende Lösung als eine allzu harmlose von mir fern, während doch alles in mir in steigender Leidenschaft Antwort heischte. Wahrscheinlich noch in derselben Nacht focht ich dieses Antwortheischen mit dem Lieben Gott aus. Für gewöhnlich hatte er sich ja nicht damit zu befassen, er hatte bei mir sozusagen nur Ohr zu sein für das, was er selber bereits wußte. Auch diesmal mutete ich ihm nicht viel zu: seinem stummen Munde brauchten ja nur ein paar kurze Worte über die unsichtbaren Lippen zu gehen: "Herr und Frau Schnee." Daß er sich dazu nicht verstand, bedeutete jedoch eine Katastrophe. Und es war nicht nur eine persönliche Katastrophe: sie riß den Vorhang auseinander vor einer unaussprechlichen Unheimlichkeit, die dahinter gelauert hatte. Denn nicht nur von mir hinweg entschwand ja der Gott, der auf den Vorhang draufgemalt gewesen war, sondern überhaupt – dem ganzen Universum entschwand er damit.
Wo uns Analoges an einem lebenden Menschenkinde zustößt, an dem wir uns etwa enttäuschten und umlernen mußten, von dem wir uns verlassen und preisgegeben fühlten, da bleibt die Möglichkeit, uns innerhalb der gleichen Realität irgendwann zurechtzufinden, den Augenfehler, womit wir sie ansahen, zu korrigieren. Etwas dergleichen geschieht jedem Menschen, jedem Kinde, später oder früher, ein Bruch geschieht zwischen Erwartetem und Vorgefundenem – ob ärger oder heilbarer, das erscheint in der Erfahrung als Gradesunterschied. Aber im Fall Gottes erscheint es als Wesensunterschied, zum Beispiel auch in der Tatsache, daß mit dem Schwinden der Gläubigkeit an Gott keineswegs die von ihm herrührende Glaubensfähigkeit als solche – die an irreale Mächte überhaupt – hinfällig wird. So entsinne ich mich eines Augenblicks während der bei uns üblichen Hausandachten, wo der Name des Teufels oder teuflischer Gewalten vorgelesen wurde und mich dies förmlich aus meiner Lethargie weckte: gab es den noch?!, war am Ende er es, der mich vom Gottesschoß hatte fallen lassen, auf dem ich es mir so hold-bequem gemacht ?! Und wenn er es gewesen, warum hatte ich mich gar nicht gewehrt? Hatte ich ihm dadurch nicht geradezu Vorschub geleistet?
Wenn ich mit solchen Worten versuche, mir den vorüberfliegenden und dennoch sich mir so gedächtnisfest eingegrabenen Augenblick anzudeuten, so will ich damit insbesondere einen Ton darin zum Nachklingen bringen: nicht etwa den eines Mitschuldigseins am Gottesverlust – aber den einer Art von Mitwisserschaft: einer schon vorhergehenden Witterung davon. Denn die erstaunliche Belanglosigkeit des Anlasses, bei dem ich meinen Herrgott auf die Probe gestellt, machte es dermaßen unglaubhaft, daß ich nicht selber auf die Lösung gekommen war – nicht selber Herrn und Frau Schnee entlarvt hatte, denen gerade Kinderhände doch so gern zu Existenz verhelfen.
Die Vorstellung vom Unheimlichen, das sich mir aufgetan, spielte keine weitere Rolle in meiner Kindheit: es tat nur auch mit bei der Schwierigkeit, im Realen – im "Gottlosen" heimisch zu werden. Wunderlich genug ergab sich aus dem Gottverlust zunächst jedoch eine unerwartete Wirkung: innerhalb des Moralischen – ich wurde nämlich davon um ein ganzes Stück braver, artiger (das Gottlose verteufelte mich also nicht): vermutlich, weil Niedergeschlagenheit dämpfend auf alle Ungebärdigkeiten wirken mochte. Aber auch aus einem positivern Grunde: aus einer Art unabweislichen Mitgefühls mit meinen Eltern, denen nun nicht auch ich zum Ärgernis werden durfte, nachdem sie doch geschlagen worden waren gleich mir – denn auch ihnen war ja Gott verlorengegangen, – sie wußten es nur nicht –.