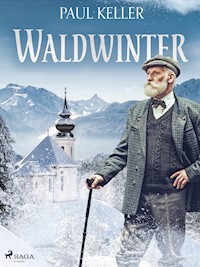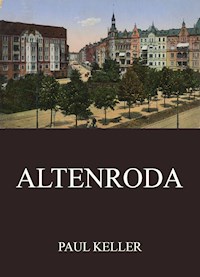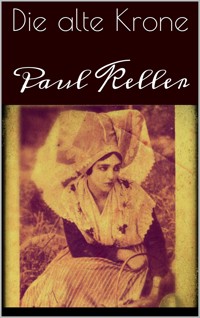Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In seinem Werk 'FERIEN VOM ICH' entführt uns Paul Keller in die mysteriöse Welt der Psyche. Das Buch ist eine rätselhafte Sammlung von Erzählungen, die sich um das Thema Identität, Selbstfindung und Verlust drehen. Keller's literarischer Stil ist von einer tiefen Emotionalität geprägt, die den Leser dazu bringt, über seine eigenen Gedanken und Gefühle nachzudenken. Mit surrealen Elementen und unerwarteten Wendungen schafft er eine einzigartige literarische Erfahrung. Das Buch kann als Teil der postmodernen Literatur betrachtet werden, die die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischt und den Leser dazu zwingt, die verschiedenen Ebenen der Geschichte zu erkunden. Paul Keller, ein bekannter Psychologe und Schriftsteller, schöpft aus seinem Fachwissen und seiner Erfahrung, um komplexe Charaktere und Situationen zu gestalten. Sein Interesse an der menschlichen Psyche und der Suche nach Identität reflektiert sich in seinen Werken, darunter 'FERIEN VOM ICH'. Das Buch ist eine intellektuelle Herausforderung für den Leser und bietet eine tiefe und fesselnde Lektüre. Es ist ein Muss für jeden, der sich für psychologische Literatur und komplexe Erzählungen interessiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FERIEN VOM ICH von Paul Keller
Inhaltsverzeichnis
Nach meiner Heimkehr
Der alte Johannisbrunnen rauscht wieder vor meinem Fenster. Hoch ragt das Bild des Täufers; aus der ehernen Schale, die seine erhobene Hand hält, plätschert das Wasser hinab ins steinerne Becken. In alter Zeit soll ein heidnisches Heer an diesem Brunnen vorübergezogen sein; die Recken haben den rauhen Nacken gebeugt und sind hier getauft worden. Am nächsten Tage fielen alle in der Schlacht. Ihre Leichname blieben liegen unter den dunklen Bäumen der Waldschlucht, da die Krieger heimtückisch erschlagen wurden; aber am Abend, als die Sonne rot am Himmel brannte, kamen weiße Schemen zum Stadttore herein, die hatten Kränze um die Stirnen und lächelten wie Kinder. Als sie am Brunnen vorbeizogen, ließ der heilige Baptista die eherne Taufschale fallen und faltete die Hände; denn diese reinen Seelen brauchten kein Wasser der Gnade mehr. Die Gekränzten zogen langsam zum Stadttore hinaus, den Weihnachtsberg hinauf, und als sie auf der goldglänzenden Höhe standen, winkten sie noch einmal herab ins Tal und zogen dann fort, weit über die rote Sonne hinaus, und der Heilige am Brunnenplatz schaute ihnen nach. Erst als es Nacht war, bückte er sich nach der verlorenen Taufschale, und nun hält er sie wieder in erhobener Hand seit vielen Jahrhunderten.
Das ist eine der vielen Sagen und Legenden von Waltersburg. Die Waltersburger haben ganz eigene Geschichten. Sie borgen nicht von fremden Gauen und Städten; ihr romantisches Tal war immer so reich, daß sie Fremdes nicht nötig hatten.
Der Johannisbrunnen! In seinem Becken ließ ich als Kind meine Schifflein schwimmen. Sie schwammen nach Amerika, nach Jerusalem oder gar bis ins Riesengebirge. Mein Bruder Joachim, der mit auf dem Brunnenrande saß, lächelte oft verächtlich über diese Reiserouten. Er war drei Jahre älter als ich und schon Gymnasiast. Da verachtete er meine Abcschützen-Geographie. Mit Schifflein spielte er nicht mehr; er liebte nur wissenschaftliche Unterhaltung. So warf er Fische aus Blech, die ein eisernes Maul hatten, ins Wasser und angelte mit einem Magneten nach ihnen. Er hatte ein Senkblei, und wenn seine Fische nicht bissen, sagte er: es läge am Wetter oder ich stände mit meinem infam weißen Spitzenkragen zu nahe am Wasser und verscheuchte die Fische.
Unterdes fuhren meine Schiffe nach Jerusalem oder ins Riesengebirge, und oben auf dem grünen Balkon am Brunnenplatz saß unsere Mutter bei ihrer Handarbeit und schaute manchmal zu uns herunter.
Wie kommt es doch, daß Menschen von einem solchen Brunnenrand fortziehen können, daß er ihnen nicht lieber und größer ist als alle Küsten des Ozeans?
Mein Bruder und ich sind fortgezogen, und die gute Frau auf dem grünen Balkon ist allein geblieben. Als Studenten kamen wir noch regelmäßig zu den Ferien. Joachim aber war kaum mit seinen Studien fertig, als er seine Ehe schloß mit jenem unselig schönen Mädchen, dem die Schönheit zum Fluche gegeben war. Nach einem Jahre wurde das Kind geboren, und nach nur wieder einem halben Jahre war ich dabei, als die Frau vor Gericht die Aussage machte, sie habe sich selbst mit einem Revolver in die Brust geschossen, weil ihr Mann sie nach einem furchtbaren Streit verlassen habe.
Nur meine Mutter und ich wußten, daß sie log. Der Flüchtige aber kam nicht heim, auch dann nicht, als es uns endlich gelang, ihm mitzuteilen, daß er außer gerichtlicher Verfolgung sei.
Er floh nicht vor dem Gefängnis; er floh vor dem Grauen, das ihm sein junges Weib bereitet hatte und das auch die Rettung, die ihm ihre Aussage brachte, nicht tilgen konnte.
Der Bruder verscholl in weiter Fremde, und die Mutter lehnte am Balkonfenster und hörte auf das Plätschern des Johannisbrunnens. Sie träumte von fernen Ufern, an denen ihr Herzenssohn weilen würde, von Gestaden, zu denen es keine andere Verbindung gab als die sehnsüchtig hin und her gehenden Gedanken.
Als nun auch ich mein medizinisches Staatsexamen beendet hatte, sagte ich zur Mutter, ich wolle bei ihr in der Heimat bleiben und ihr Trost sein. Sie sah mich still an und schwieg, und es zuckte ein wenig um ihren Mund. Da bat ich sie, zu reden und mir ihren tiefsten Wunsch zu sagen, und sie sprach mit Worten, die sie sich aus dem Herzen riß:
„Geh fort ... in die Welt ... suche Joachim ... bringe ihn wieder!“
So bin ich fortgezogen, um meinen Bruder zu suchen. Und weil ich nicht Geld genug hatte, jahrelang um die Erde zu reisen, wurde ich Schiffsarzt, jetzt bei dieser, dann bei jener Gesellschaft, und kam fast in alle großen Häfen der Welt.
Ich fand ihn erst im fünften Jahre meiner Wanderfahrt und wäre bei flüchtiger Begegnung wohl an dem veränderten harten Mann mit dem fremden Namen vorbeigegangen; aber ich traf ihn an Bord zwischen Rio und Montevideo, da das Schiff tagelang nicht anhält, und wurde meiner Sache gewiß, als der Fremdling sich plötzlich scheu verbarg und weder an Bord noch bei den Mahlzeiten mehr sichtbar wurde. Da suchte ich ihn in seiner Kajüte auf. Er öffnete auf mein Klopfen und bebte zusammen, als er mich sah. Ich drängte ihn ohne weiteres in die Kajüte und schloß die Tür.
„Ich will nur ein wenig mit dir reden, Joachim“, sagte ich und wunderte mich über meine ruhige Stimme; „du wirst es mir nicht abschlagen können, da ich an die fünf Jahre hinter dir her bin. Und daß ich auf dein Leben und deine Entschlüsse keinen Einfluß habe, weiß ich von vornherein. Also versteck dich nicht!“
„Was willst du?“ fragte er mühsam heraus.
„Ich will nicht viel. Ich will dich nur bitten, du möchtest von Zeit zu Zeit, so alle Jahre einmal um Weihnachten, an die Mutter schreiben.“
Da fiel er auf sein Bett und weinte rasend. Ich trat an das kleine runde Kajütenfenster, an das die Wellen klatschten, und schaute hinaus auf die rollende See.
* * *
Vorgestern bin ich nun heimgekommen nach Waltersburg zu meinem und seinem silbernen Mütterchen. Ich muß schon „silbernes Mütterchen“ sagen; denn nicht nur die Haare sind silbern, auch das Gesichtchen, auch die schmalen Hände. Alles ist kostbar, edel und weiß an ihr.
Sie fragte mich nur das eine: „Ist er gesund?“
Ich sagte ihr, was ich wußte, auch daß er ein braver Mensch geblieben sei, woran wir beide niemals gezweifelt hatten. Dann, daß er in einer geachteten Stellung und wohl ein reicher Mann sei oder es doch werde. Darauf hörte sie kaum, sondern schlug die Händchen zusammen und jammerte:
„Warum? Warum?“
Das war die schwere Frage, über deren richtige Beantwortung ich mir auf der Heimreise den Kopf zerbrochen hatte. Ganze Abhandlungen hatte ich in meinem Hirn ausgearbeitet, schlagende psychologische Begründungen für eine Mutter, die fragt: Warum gibt mein Sohn keine Nachricht? Warum kommt er nicht zurück? Warum läßt er mich in dieser furchtbaren Einsamkeit und Qual?
Da sagte ich ihr nur die wichtigsten Sätze, die Joachim gesprochen:
„Ich hab wohl hundertmal geschrieben und tausendmal schreiben wollen. Aber ich hab keinen Brief abgeschickt. Ich hatte eine schreckliche Angst, dann schreibt ihr wieder, und dann halte ich’s nicht aus in der Fremde, dann muß ich zurück in diese verfluchte Heimat.“
Sie war ein wenig betäubt über diese Worte; aber dann glomm eine Hoffnung auf in ihren Augen, und sie sagte:
„Aber jetzt wird er schreiben?“
„Ja, jetzt wird er schreiben; das ist das einzige, was ich nach meinem langen Suchen erreicht habe.“
„Ich danke dir, lieber Fritz“, sagte sie und drückte mir schüchtern die Hand.
* * *
Nun bin ich beinahe eine Woche zu Hause und fange an, mich glücklich zu fühlen und zu freuen. Ich glaube, zu den Freuden, die schwer zu tragen sind, gehört die Heimkehr aus fremden Landen. Und nicht bloß mir in meinem besonderen Falle wird es so gehen, nein, allen, die lange draußen waren und wieder nach Hause kommen. Es ist viel Scheu, viel Bangigkeit in der Seele, die Quellen der Lust und des Schmerzes fließen zusammen wie in einen tiefen Bronnen, aus dem erst langsam, wenn sich der zitternde Spiegel beruhigt hat, das Himmelsgesicht des Glücks auftauchen kann. Es gibt wohl keinen Heimkehrenden, der laut lachte, tanzte oder spränge. Ich habe in fremden Ländern viele robuste Burschen gesehen, die in ihre Heimat zurückkamen, und es war ganz gleich, welcher Farbe oder Rasse sie waren – sie waren schüchtern und verlegen, gingen alle ein wenig mit zusammengezogenen Schultern, sprachen seltsam leise und traten nicht fest auf, als ob sie der Heimaterde nicht weh tun wollten. Sie mußten sich alle in der Heimat erst wieder heimfinden. Es ist auch ganz natürlich: der Star, der aus dem Süden an den heimischen Kasten kommt, pfeift auch nicht am ersten Tage. Er schüttelt in der entwöhnten Luft erst sein Gefieder zurecht.
* * *
Die Mutter steht immer am Fenster und schaut nach dem Briefträger aus. Aber der Brief, auf den sie wartet, kommt nicht. Er könnte längst da sein. Ich telegraphierte schon zweimal heimlich nach Rio. Es kam aber keine Antwort.
Und die Mutter steht und wartet. Ich versuchte es mit der alten Ausrede, ein Brief könne verlorengehen, zumal auf so langem Wege. Aber die Mutter schüttelte den Kopf und sagte:
„Einen solchen Brief würde Gott behüten.“
Die feindlichen Städte
Ich muß versuchen, wieder lustiger zu sein. Herrgott, ich bin doch ein junger Mensch, ich habe meine Aufgaben, und meine Kraft darf nicht in sehnsüchtigem Suchen, am Trotz des Bruders zerschellen. Also will ich heute gar nichts von ihm aufschreiben, sondern einmal die närrische Geschichte von der Feindschaft der Waltersburger und der Neustädter zu erzählen beginnen.
Waltersburg ist eine in einem wunderschönen Talkessel gelegene Stadt von 2967 Einwohnern. Solches besagte die letzte Zählung. Der Personenstand wies im letzten Jahrhundert immer ziemlich dieselbe Höhe auf; auf runde 3000 kam er nie hinauf. Da machte unser Bürgermeister, Herr Wilhelm Bunkert, eine bedeutsame Stiftung: der dreitausendste Einwohner, der Waltersburg Anno 1904 geschenkt würde, solle eine goldene Uhr bekommen, Herrenuhr oder Damenuhr, je nachdem es ein männliches oder ein weibliches Wesen beträfe, und diese Ehrengabe wolle er, der Bürgermeister, aus eigenen Mitteln bestreiten. Die Sache stand im Stadtblatt und wurde viel bewundert. Im nächsten Jahre kamen viele Kinder zur Welt; die Zählung wurde nicht bloß vom Magistrat, sondern auch von der Bürgerschaft sehr eifrig betrieben, und da die Einwohnerschaft auf 2998 stieg, entstand in der zweiten Hälfte des Dezember zwischen der Frau Schneidermeister Lembke und der Frau Schuhmachermeister Abelt eine bittere Feindschaft, da beide hofften, noch vor Ablauf des Jahres eines Kindleins zu genesen. Am 30. Dezember gebar Frau Lembke eine Tochter. Ihr Mann, anstatt sich des blühenden Töchterchens zu freuen, ging in die Schenke und betrank sich vor Ärger, wie er sein Lebtag sich nicht betrunken hatte. Dem Ehepaar Abelt aber klopfte das Herz. Am Silvesternachmittag gebar die Frau einen Sohn, und der entzückte Vater stürzte nach dem Rathause und schrie: „Der dreitausendste Einwohner! Der dreitausendste Einwohner!“ Im Vorzimmer des Bürgermeisters aber begegnete dem Siegestrunkenen eine schwarze Gestalt. Es war die Frau des Webers Michalke, die soeben den Tod ihres Mannes angemeldet hatte. Da waren es wieder nur 2999. Der arme Schuster torkelte gegen die Wand, und dumpf hallten die Silvesterglocken in die Nacht über diese so wenig vom Glück begünstigte Stadt.
Der Bürgermeister hielt sein Angebot auch für das kommende Jahr aufrecht, und einige werdende Mütter wiegten sich in goldenen Hoffnungen. Aber der Tod hielt reichere Ernte als sonst, auch zog der Barbier mit seiner siebenköpfigen Familie nach Neustadt, und nun hielt der geizige erste Ratsmann, Bäckermeister Schiebulke, es für den richtigen Zeitpunkt, sich als einen Gönner der Stadt zu bezeigen und auch seinerseits für den dreitausendsten Einwohner eine Prämie auszusetzen, und zwar ein neues Fahrrad, je nachdem ein Herren- oder Damenrad. Die Sache kam ins Stadtblatt, und die Bürger lachten. Ob Schiebulke vielleicht meine, ein neugeborenes Kind könne radeln, wurde der Stifter befragt. Ob die andern vielleicht meinten, ein neugeborenes Kind könne von einer Uhr die Zeit ablesen, gab Schiebulke giftig zurück. Da setzte der Wirt vom „Goldenen Löwen“, der ein reicher Mann und ein wenig ruhmsüchtig ist, einen erschrecklich hohen Trumpf auf:
„Goldene Uhr und Fahrrad“, sagte er, „sind gute Dinge. Nur leider die Kinder wachsen langsam, und solche Dinge veralten schnell. Was allein nicht veraltet, ist das Geld. Ich will meiner Vaterstadt meine Liebe beweisen und lege 5000 Mark in die städtische Sparkasse für den dreitausendsten Bürger, den Waltersburg in diesem Jahre erhält.“ So lautete die Stiftung, die im Stadtblatt publiziert wurde und ungeheure Aufregung hervorrief.
Und da kam das Unerwartete, wie in solchen Fällen überhaupt meist etwas Unerwartetes geschieht.
Die Einwohnerschaft von Waltersburg hatte die Höhe von 2993 erreicht, als der vor kurzem nach Neustadt übersiedelte Barbier Arthur Heilmann mit seiner Frau und seinen fünf Kindern sich wieder in Waltersburg ansiedelte und glückstrahlend die goldene Uhr, das Fahrrad und die fünftausend Mark für sich in Anspruch nahm, da mit seinem Zuzug die Zahl dreitausend erreicht war. In Waltersburg brach eine Revolte aus. Man wollte den frechen Barbier samt Weib und Kindern lynchen. Man schrie, das sei Betrug, das gälte nicht, das sei ja ganz anders gemeint gewesen. Der Barbier, der zuvor bei einem Rechtsanwalt in Neustadt gewesen war, bewahrte seine Ruhe, und Amtsrichter Knopf, der angesehenste Jurist in Waltersburg, erklärte im Magistratskollegium, am Stammtisch und wo immer man es hören wollte, unter Hinweis auf verschiedene Gesetzesparagraphen: es handle sich hier um eine öffentliche Auslobung, deren Inhalt durch den Barbier Heilmann erfüllt sei und dem daher unzweifelhaft die drei ausgesetzten Prämien zufielen.
Aller Ingrimm der Welt hätte an der Tatsache nichts geändert: Heilmann bekam die Preise.
O unglückliches Waltersburg! In der Stadt war dumpfe Trauer, Zorn und Haß, und alle Männer gelobten, bei diesem Barbier sich nie den Bart schaben oder die Haare schneiden zu lassen.
Darauf rechnete aber der abgefeimte Schaumschläger gar nicht, sondern er zog schon nach Ablauf eines Vierteljahres wieder nach Neustadt zurück und nahm die Preise mit.
Waltersburg zählte nach diesem Abzug 2993 Bewohner. Die Auslobungen wurden nicht erneuert. Das ist nun einer der Fälle, aus denen das feindselige Verhältnis zwischen Waltersburg und dem benachbarten Neustadt schon einigermaßen erhellt.
* * *
Die Zeit meiner Abwesenheit hat an dem feindlichen Verhalten der beiden Städte Waltersburg und Neustadt nichts geändert. Und doch ist Neustadt eine Tochterstadt von Waltersburg, die beiden Orte sind in der Luftlinie kaum drei Kilometer voneinander entfernt und nur durch den mäßig hohen Weihnachtsberg getrennt. Nicht nur, daß die beiderseitigen Gemeindekollegien miteinander in Hader liegen und sich die zwei Stadtblättchen ständig befehden, der Haß gegen die Nachbarstadt bringt auch noch heute die Köpfe der Waltersburger Stammtischphilister in Gluthitze und überträgt sich sogar auf die Frauen und Kinder.
Bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hat sich Waltersburg eines geradezu paradiesischen Friedens erfreut. Die Hussiten sind an ihm vorbeigezogen, die Horden des Dreißigjährigen Krieges haben vergessen, die Stadt auszuplündern, so daß Waltersburg mit seinen damals 2000 Bewohnern nach dem Westfälischen Frieden eine der volkreichsten Städte Deutschlands war, ein Umstand, über den in der Stadtchronik des weiten und breiten geredet wird; von den Fritzeschen Regimentern hat nur eines einmal drei Tage lang in Waltersburg Station gemacht, was den Stoff für ein weiteres Viertel der Chronik bildet, und auch die Siegerscharen Napoleons haben keine besondere „gloire“ darin erblickt, die Stadtmauern von Waltersburg zu berennen. So war das weiße Lamm in grünem Felde ein sehr angebrachtes Wappentier für die friedfertige Stadt, und es gehörte schon die ganze boshafte Niedertracht der Neustädter dazu, zu behaupten, weiland der geistvolle Hohenstaufe Friedrich II. hätte den Waltersburgern das Lamm für ihr Stadtwappen nur darum verliehen, weil er ihre ureigentümliche und unausrottbare Schafköpfigkeit wohl erkannt habe.
Solch grobe Beleidigung strafen die Waltersburger mit eiskalter Verachtung; dagegen erhitzen sie sich noch heute sofort, wenn die Rede einmal auf den Bahnbau kommt.
Als nach dem siebziger Kriege sich in Deutschland die Eisenbahnen mehrten wie nach einem fruchtbaren Regen im Garten die Würmer, hatte die Regierung dem Rat angeboten, eine neue Hauptstrecke über Waltersburg zu führen, ja die Stadt zu einem Eisenbahnknotenpunkt zu machen. Dieses Anerbieten hatte die Bürgerschaft in die allerschwerste Sorge gestürzt. Sie sandten zum Kaiser nach Berlin eine Deputation mit der Bitte, der Landesvater möge das schwere Unheil, das den Frieden und die Ruhe der treuen Stadt Waltersburg bedrohe, allergnädigst abwenden. Die Deputation wurde zwar nicht empfangen, brachte aber in aller Stille ein kräftiges Wort mit heim, das ein Geheimer Rat im Eisenbahnministerium gesprochen hatte, und das nicht viel schmeichelhafter klang als die Neustädter Auslegung des Waltersburger Wappentieres.
Die Hauptsache war: die Bahn kam nicht nach Waltersburg. Sie wurde jenseits des Weihnachtsberges, etwa sechs Kilometer von der Stadt entfernt, vorbeigeführt. Daselbst wurde auch ein großer Bahnhof angelegt, da sich in der Tat die Notwendigkeit herausgestellt hatte, an diesem Orte einen Kreuzungspunkt zu errichten, und die Station führte, da sie doch benannt werden mußte, den Namen „Waltersburg-Neustadt“.
Die Waltersburger lachten. Sie hatten jetzt eine Eisenbahnstation, aber diese Station konnte ihnen nichts anhaben. Später hat ein Dichter in der „Neustädter Umschau“ ein Poem veröffentlicht, in dem es hieß:
Für dieses Gedicht hat sein Verfasser von den Neustädtern viel Lob und von den Waltersburgern gelegentlich recht ordentliche Prügel geerntet.
Neustadt verdankte seine Gründung einem trutzigen Bürger von Waltersburg, dem Baumeister August Bunkert, der als einziger in der ganzen Stadt Waltersburg Tag und Nacht geredet hatte, die so günstige Gelegenheit, einen großen Bahnhof an die Stadt zu bekommen, nicht zu verpassen. Als er mit seinen Ideen nicht durchdrang, im Gegenteil viel Anfeindung erfuhr, die bis zu persönlichen Feindschaften ausartete, und sich insonderheit mit seinem einzigen Bruder, Wilhelm Bunkert, der jetzt Bürgermeister von Waltersburg ist und damals zu der Berliner Deputation gehörte, in bitterem Hader entzweite, zog der Baurat aus dem Hause seiner Väter aus und baute jenseits des Berges dicht neben den neuen Bahnhof ein großes Hotel, dem er den Namen „Zur guten Hoffnung“ gab. Die „gute Hoffnung“ erwies sich zunächst als schlecht; denn da das Hotel auf bloßem Felde stand, alle Eisenbahnpassagiere aber fanden, daß sie in der menschenleeren Wald- und Wiesengegend nichts zu suchen hätten und darum immer schleunigst weiterfuhren, stand das Hotel Jahr und Tag leer, die wenigen Bahnbeamten abgerechnet, die am Abend ihr Schöpplein tranken, und an August Bunkert kroch langsam die Pleite heran. Die Waltersburger meinten, daß der neuerungssüchtige Trotzkopf dieses Schicksal wohl verdient habe, aber zu ihrer Ehre muß gesagt werden, daß Bunkert vielen leid tat und daß man dem verlorenen Sohne gern verziehen und ihm auf die eine oder andere Art wieder auf die Beine geholfen hätte, wenn es dem Ausreißer nur eingefallen wäre, zurückzukommen, seinen Irrtum einzugestehen und die vorsichtige Art der Waltersburger zu loben, die er ehedem so heftig angegriffen hatte. August Bunkert aber dachte nicht daran, den Reuigen zu spielen, und auf einen Brief seines bürgermeisterlichen Bruders, worin dieser fragte, ob er denn auch den Rest seines schönen väterlichen Erbes noch vollends verschleudern wolle, gab er keine Antwort. Da wurde er seinem Schicksal überlassen. Dieses Schicksal gestaltete sich günstig. Die große Bahnhofswirtschaft, die August Bunkert übertragen wurde, hielt ihn zunächst über Wasser, und endlich gelang ihm der große Schlag. Er brachte eine Gesellschaft von bedeutenden Geldleuten der Großstadt zusammen und kaufte als deren Funktionär oder Generaldirektor, wie er sich lieber nannte, alles Waltersburger Gelände auf, das jenseits des Weihnachtsberges gelegen war. Die Waltersburger schlugen die Hände über den Köpfen zusammen. Hundert Taler über den ortsüblichen Preis hinaus gab Bunkert für jeden Morgen Feld-, Wald- oder Wiesenland, und die Besitzer beeilten sich, ihre entlegenen Ländereien unter so glänzenden Bedingungen loszuwerden. Innerhalb von eineinhalb Jahren besaß kein Waltersburger mehr jenseits des Berges auch nur einen Halm.
Die ganz Gewissenhaften aber schüttelten die Köpfe und sagten: Dieser Bunkert lockt seinen Auftraggebern das Geld aus der Tasche; er ist ein Hochstapler, und man sollte doch sehr überlegen, ob man den unangebrachten Preis annehmen dürfe, den die neuen Besitzer aus dem Wald- und Wiesenland nie und nimmer herauswirtschaften könnten. Doch auch diese ganz Gewissenhaften beruhigten sich und nahmen das Geld.
O du großmächtige Verwundernis! In dem prachtvollen Hochwald, den August Bunkert erworben, an den grünen Wiesen, am Flußufer, den Weihnachtsberg hinauf, entstand ein schmuckes Landhaus nach dem anderen, Einfamilienhäuser, Sommerwohnungen, Baderäume, ein Kurhaus, eine „Wandelhalle“ bauten sich auf, ein Basar für Lebensmittel, ein anderer für „Bekleidungs- und Gebrauchsgegenstände“ wurde errichtet, Hunderte und aber Hunderte von Arbeitern waren das ganze Jahr beschäftigt. Und alle Häuser baute der Baumeister August Bunkert und wurde ein schwerreicher Mann.
Noch staunten die Waltersburger, noch lachten einige spöttisch und verächtlich, aber manch einer schwieg schon nachdenklich und dachte bei sich: Was tut sich? Da erschien in den großen hauptstädtischen Blättern ein Inserat: „Waltersburg-Neustadt, entzückend am Südabhange des 450 Meter hohen Weihnachtsberges gelegen, mitten in prachtvollem Hochwald, in grünes Wiesen- und Flußland gebettet, ein Paradies der Gesundheit und des Naturgenusses, bei vorläufig nur fünf Mark pro Quadratmeter Bauland (Anzahlung von 3000 Mark an) für alle, die sich ein Eigenheim gründen wollen, eine nie wiederkehrende Gelegenheit. Nur fünfviertel Stunden von der Hauptstadt entfernt. Großer Eisenbahnknotenpunkt. Haltestelle aller Schnellzüge. Täglich zwölfmal Verbindung mit der Hauptstadt. Anfragen an Generaldirektor Baumeister August Bunkert in Neustadt erbeten.“
Die Proklamation des Deutschen Reiches kann seinerzeit in Berlin keinen so großen Eindruck gemacht haben wie dieses Inserat in Waltersburg. Die Leute lachten, wimmerten, fuchtelten mit den Armen und waren voll neidischer Beklommenheit. Am Abend saß ein ganzer Stammtisch im „Goldenen Löwen“ mit der Kreide vor der Schiefertafel und wollte ausrechnen, wieviel ein Morgen Land koste, wenn das Quadratmeter auf fünf Mark komme. Niemand kriegte es heraus, und alle schimpften auf die neumodische Rechnungsart. Selbst den Amtsrichter Knopf verließ seine akademische Bildung; er knurrte, er habe ja nicht Mathematik studiert, und solche Aufgaben könne überhaupt immer nur ein Volksschullehrer herauskriegen. Also schickte man nach dem Lehrer Herder, und der erklärte:
„Ein Morgen altes Maß ist ungefähr ein Viertel Hektar. Ein Hektar hat 10 000 Quadratmeter; ein Viertel Hektar ist also 2500 Quadratmeter groß. Kostet ein Quadratmeter fünf Mark, so kostet ein Morgen 2500 mal soviel, also 12 500 Mark.“
Als der Lehrer Herder dieses Resultat nannte, schlugen die zehn Männer, die noch mit am Tische saßen, heftig mit den Fäusten auf den Tisch, und zwar alle wie auf Kommando mit einem Hieb. Man schrie den Lehrer an, er müsse sich täuschen. Der aber saß mit der Würde eines Mannes, der von der Unverletzlichkeit und Beweiskraft der Zahl überzeugt ist. Sein ganzes Wesen sagte: meine Rechnung stimmt.
Da wurde zunächst eine große Stille. Dann sagte einer: „Wenn das wahr ist, sind die Kerle große Gauner; 1000 Mark haben sie für den Morgen gegeben, 12 000 Mark verlangen sie.“
Schweigen. Nach fünf Minuten griff Amtsrichter Knopf die letztgenannten Ziffern auf und sagte:
„Sie arbeiten mit elf Prozent.“
„Elf Prozent gibt ja das Gesetz nicht zu“, bemerkte der Erbscholtiseibesitzer Hirsemann mit einem Blick auf den Amtsrichter.
Der schüttelte den Kopf, was in diesem Falle „ja“ und „nein“ heißen konnte. Da ergriff der Lehrer Herder wieder das Wort und sagte:
„Entschuldigen die Herren, wenn man mit 1000 Mark kauft und mit 12 000 Mark verkauft, so sind das nicht elf Prozent, sondern elfhundert Prozent Gewinn.“
Sie starrten ihn alle an wie leblos. Nur Bäckermeister Schiebulke, der gerade trank, verschluckte sich. Der Amtsrichter geriet ins Grübeln. Seine Seele wanderte zurück bis etwa in die Tertianerzeit, und dann sagte er:
„Ja, natürlich, es sind nicht elf, sondern 1100 Prozent.“
Da hoben sich die Fäuste, um auf den Tisch zu donnern, aber diese Überraschung war zu groß und schwer; die Hände sanken still herab ...
Was die allergrößte Hauptsache war: Neustadt, das den Namen Waltersburg zum großen Ingrimm der Mutterstadt nach und nach ganz abgestreift hatte, war auf dem besten Wege, ein aufblühender Badeort zu werden. Zwei „Quellen“ waren entdeckt worden, von denen die eine „Kaisersprudel“, die andere „Felsensprudel“ hieß, und die beide nach dem Gutachten eines sachverständigen Professors aus der Hauptstadt „hervorragend radioaktiv“ waren. Die Neustädter feierten Siegesfeste, während die Waltersburger vier Wochen lang brauchten, ehe sie das Wort „radioaktiv“ richtig aussprechen konnten, und natürlich auch dann noch nicht wußten, was das sei.
Humbug sei es, meinte der Amtsgerichtsrat, und wenn man dieser Auslegung auch viel Beifall zollte, so verschafften sich doch einige Waltersburger heimlich je drei Flaschen von den neuen Sprudeln, und abends wurde im „Löwen“ statt der sonst so beliebten Weinprobe eine Wasserprobe abgehalten. Der Pfropfen der ersten Flasche flog mit einem Knall gegen die Decke.
„Wie – wie bei Champagner“, stammelte Herr Hirsemann.
„Blödsinn“, knurrte der Amtsgerichtsrat; „das is Kohlensäure; die is dem Wasser eingepumpt; alles künstlich, nichts natürlich; ich kenn doch die Wasserpfützen drüben – Betrug is es, glatter Betrug!“ So wartete man, bis sich die Kohlensäure verflüchtet hatte, dann trank der Bäcker und sagte:
„’s schmeckt ’n bissel salzig.“
„Weil Sie heut abend wieder Salzhering gegessen haben“, grollte der Richter.
„Salzig kann man nicht sagen“, meinte der Getreidekaufmann Schneider, „sondern so mehr säuerlich!“
„Ja, weil Sie von gestern noch ’ne saure Schnauze haben“, zürnte Herr Knopf.
Unter solchen Umständen hätte der Löwenwirt, der auch mit probierte, mit seiner Äußerung, das Wasser scheine ihm aber stark nach Schwefel zu schmecken, zurückhalten sollen; denn der schlecht gelaunte Richter fuhr ihn an: „Mensch, wenn Sie tagaus, tagein nischt anderes rauchen als Ihre eigenen Zigarren, muß Ihnen natürlich alles nach Schwefel schmecken.“ Darauf einigte man sich endlich: dieses Wasser schmecke wie jedes andere gewöhnliche Brunnenwasser und sei keinen Pfifferling wert.
Ganz kurze Zeit darauf gab es in Waltersburg eine neue Aufregung. Die Neustädter hatten sich für ihr Bad einen Propagandachef engagiert.
„Propagandachef!“ – Dieses Wort war in Waltersburg seit Erschaffung der Welt noch nicht einmal ausgesprochen worden. Die Neustädter aber wußten nicht bloß, daß es so etwas gäbe, sie engagierten es sogar. Und der Propagandachef war ein Jude. Als das bekannt wurde, sagte der Bäcker abends im „Löwen“:
„Die Kerle in Neustadt verlieren den letzten Rest von Schamgefühl.“
Aber da widersprach der Amtsgerichtsrat, hauptsächlich deswegen, weil er immer widersprach:
„Jude hin, Jude her! Es is ’n alter Witz, daß in den ganzen Antisemitismus nich eher ’n richtiger Schwung kommen wird, ehe ihn nicht die Juden selbst machen. Wenn die Neustädter ihre faule Sache deichseln wollen, mußten sie ’n Juden nehmen, ’n Christ ist viel zu dämlich dazu.“
Der Bäcker stand auf und ging. Wenn freigeistige Reden gehalten wurden, verließ er das Lokal.
Nach etwa sechs Wochen erschien der erste Prospekt von dem Bade Neustadt. Es war ein entzückend ausgestattetes Heftchen von Kunstdruckpapier, mit reizenden bunten und Lichtdruckbildern ausgestattet, und das Werkchen pries Neustadt in so berückender Form, daß eigentlich jeder Mensch zu bemitleiden war, der nicht augenblicklich seine Koffer packte und nach Neustadt abreiste ...
* * *
Die feindlichen Städte! Vielleicht, daß mir der lustige Hader die Zeit verkürzt. Von Zeit zu Zeit will ich etwas von ihm im Tagebuch vermerken ... Joachim hat an die Mutter ein Telegramm gerichtet. „Ich kann nicht mehr schweigen; ich grüße dich und Fritz. Aber schreibt mir keine Briefe, telegraphiert nur, ob ihr gesund seid.“
Mit diesem Telegramm saß die Mutter am Tisch, als ich heute abend nach Hause kam. Sie sprach nicht, sondern übergab mir nur wortlos die Depesche; aber sie sah mich stolz und verklärt an, als wollte sie sagen: „Sieh, solch einen guten Sohn habe ich!“ „Ich freue mich über Joachim“, sagte ich und ließ sie allein. Von meinem Zimmer sah ich nach dem Johannisbrunnen hinunter, dessen Wasser einförmig rann.
Die Seele des fernen Bruders war immer noch krank. Er vertrug keine Nachricht aus der Heimat. Heimat war ihm in Hölle gewandeltes Paradies. Es gab einmal ein Weib, das er mehr liebte als alles, die Mutter mit einbegriffen; es war einmal ein Freund, der ihm näher stand als der Bruder, und es war eine schöne Stadt, die ihm lieber war als der Geburtsort; das war Heidelberg.
In Heidelberg hat ihn die Frau mit dem Freunde betrogen.
Darüber kommt nun der Mann, der zwischen Rio und Montevideo hin und her fährt, nicht mehr hinweg.
Das Modebad
Dieser 5. April war ein sehr merkwürdiger Tag. Ich war drüben in Neustadt und besah mir den neuen Badeort; denn ich war mir immer noch nicht ganz im klaren, ob ich Badearzt in Neustadt werden oder lieber die Praxis des alten Sanitätsrats in Waltersburg übernehmen solle. Der Alte will sich zur Ruhe setzen. Um die Wahrheit zu sagen, er sitzt eigentlich schon sein ganzes Leben lang zur Ruhe. Den Waltersburgern fällt es niemals ein, krank zu werden. Der alte Pfarrer hier, der etwas derber Art ist, sagt: „Wenn einer nicht gerade unverschuldet verunglückt, ist es eine Schweinerei, krank zu werden. Denn wenn einer vernünftig lebt, wird er eben nicht krank, ebenso wie keiner ins Zuchthaus kommt, der nicht was ausfrißt.“ So erschien dem Pfarrer der Sanitätsrat immer höchst überflüssig, wie andererseits dem Sanitätsrat, der ein Freigeist ist, der Pfarrer überflüssig erscheint. Persönlich aber vertragen sie sich recht gut, spielen auch manchmal Karten miteinander, was ihrer lebenslangen gegenseitigen Abneigung keinen Eintrag tut. Der Dritte im Bunde ist der Amtsrichter, den Pfarrer und Sanitätsrat beide für überflüssig halten; denn außer dem Schneider Hampel wird in Waltersburg niemals jemand eingesperrt, und bei Hampel kommen in mageren Jahren auch höchstens drei Wochen heraus. Der Amtsrichter und der Schneider Hampel stehen auf dem „Grüßfuß“, und der Sanitätsrat behauptet, daß der Richter seinem einzigen „Kunden“ immer zu Neujahr gratuliere. Es ist also für einen, der keine Sinekure sucht, nicht verlockend, Arzt oder Richter in Waltersburg zu werden. Im Herzen wäre es mir aber immer noch lieber, mich in Waltersburg niederzulassen, als nach Neustadt zu gehen, dessen Wunderquellen ich nicht traue, und mich also dort gewissermaßen mitschuldig zu machen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Heute war ich drüben in Neustadt. Während der fünf Jahre meiner Abwesenheit ist der Ort um das Doppelte gewachsen. Er ist mit amerikanischer Rapidität emporgeschossen. Ich sah die Marmortempel über den „Sprudeln“, die „Promenade“ mit ihren unendlich gepflegten, unendlich bunten und unendlich langweiligen Blumenanlagen, die Kapelle, die das „Polnische Lied“, den „Einzug der Gäste in die Wartburg“, das „Frühlingslied“ von Mendelssohn, den neuesten Wiener Walzer und ein unendlich albernes Potpourri spielte, das von allen Darbietungen dem Publikum am besten zu gefallen schien, sah auch, wie der erste Geiger und der Flötist an der Rampe des „Musikpavillons“ wie überall mit den vorbeiflanierenden Mägdelein liebäugelten; ich sah auf den Estraden leerer Restaurants Kellner lauern, die wie Bräutigame gekleidet waren oder wie Leichenbitter, fünfunddreißig Gerichte auf ihrer Speisekarte, von denen sicherlich nicht eines halb so gut schmeckte wie das, was Mutters alte Köchin bereitet; ich sah eine „Wandelhalle“ mit Schauläden, in denen die schönen und ach so „preiswerten“ Broschen prangen, die man den Dienstmädchen als „Mitbringe“ schenkt und deren Goldglanz mindestens anhält, bis das Mädchen am nächsten Quartal abzieht, sah schreiend bunte Gläser mit der Aufschrift „Zum Andenken“ oder „Souvenir de Neustadt“, Holzarbeiten, vom geschnitzten Hirsch bis zu dem Kinderspielzeug, wo zwei Bären auf einem Amboß pinken oder ein Affe am Reck turnt, und noch viele Kunstgegenstände, bis ich zum Theater gelangte, wo ein Zettel verkündete, daß ein vielversprechender Dichter (alle vielversprechenden Dichter debütieren in Badetheatern) sein Erstlingswerk „Geheimnisse von Neustadt“ zur Aufführung bringe und Herr Georgio Calzolaio (zu deutsch: Georg Schuster), der vielbeliebte erste Liebhaber der Bühne, die Hauptrolle kreieren werde, auch an diesem Abend sein Benefiz habe. Darauf ging ich in ein Café und trank zwei Kognaks. Ein Zeitungsjunge erschien und schrie mir das neueste Berliner Mittagsblatt ins Ohr; ein Herr am Nebentisch, der schon immerfort nervös hin und her zappelte, knurrte den Kellner an, wie lange er zum Donnerwetter noch auf die telephonische Verbindung mit Breslau warten solle; ein Herr an einem anderen Tisch erzählte mit unerträglicher Weitschweifigkeit seinem Nachbar alle Erscheinungen seiner Krankheit, wofür sich dieser so interessierte, daß er während der Zeit des Zuhörens das ganze Mittagsblatt durchschmökerte; drüben an der Wand stritten zwei rote Köpfe laut über Nietzsche; eine vorübergehende Mutter machte ihrer bleichsüchtigen Tochter Vorwürfe, daß sie ihren Brunnen statt um fünf erst um fünfeinhalb Uhr getrunken habe, was natürlich furchtbar schaden könne; Gents und noch viel mehr Pseudogents tänzelten vorüber, und in der Kapelle drüben blies der Waldhornist zum Herz- und Steinerweichen: „Das Meer erglänzte weit hinaus im lichten Abendscheine“.
„Auch Sie, Fräulein Trude“, hörte ich einen vorbeiwandelnden Primaner zu seiner sechzehnjährigen Begleiterin sagen, „haben mein Herz vergiftet, zwar nicht durch Ihre Tränen, wohl aber durch Ihr Lachen.“
„Aber Herr Lempert“, sagte sie, und sie waren vorbei ... Ich bekam Heimweh nach Waltersburg und ging. Draußen auf den Promenadengängen das gewohnte Publikum; die galizische Jüdin mit etwas schmierigen Spitzen am Halsausschnitt und den großen Brillanten in den Ohren; der Herr in dem hocheleganten weißen Flanellanzug, der 23 Mark gekostet hat; der „Künstler“, dessen Kraft wie bei Samson in der Fülle der Locken sitzt und der sich vor dem Spiegel die wirkungsvollen Gerhart Hauptmannschen Mundwinkel eingeübt hat; das knurrende Eheoberhaupt, das wo anders hinstrebt, weil man auf dem Kurplatz nicht rauchen darf (warum, weiß weder er noch sonst jemand; denn der Platz ist weit, und der Himmel ist hoch); die flirtende Strohwitwe; der melancholisch und langsam schreitende Einsame, der keinen Anschluß findet; das laute Mädchen, das immer zehn Verehrer um sich hat und nie einen Mann kriegt; die Geschäftsfreunde, die auch hier über ihre Alltagssorgen nicht hinauskommen; fachsimpelnde Oberlehrer und lebenslustige Backfische, dazwischen die „Patienten“, die gewissenhaft aus geschliffenen Gläsern das Neustädter Wunderwasser schlürfen, als könnte es in vier Wochen gutmachen, was in vielen, vielen Jahren krank ward.
Ich war im klaren: Ich wollte nicht Badearzt werden. So wollte ich nach Hause und wählte als Heimweg den Pfad über den Weihnachtsberg, der als Grenzscheide zwischen Waltersburg und Neustadt liegt.
Auf dem Weihnachtsberg
Auf dem Weihnachtsberg steht ein altehrwürdiges Gasthaus. Es sieht aus wie eine Burg, hat auch einen grauen verwitterten Turm, eine Zugbrücke, Butzenscheiben und was so dazu gehört. Das echteste von dem ganzen romantischen Nest war der Wirt, der Eberhard hieß, weil er einen langen Bart hatte, oder der sich einen langen Bart hatte wachsen lassen, weil er Eberhard hieß. Die Waltersburger besuchten ihn an allen regenfreien Sonntagnachmittagen, und er lebte auf seiner luftigen Höhe so gute Tage, daß ihm der Humor niemals ausging. Dieser Eberhard war für die Waltersburger Kinder der Knecht Ruprecht. Jeden Weihnachtsabend lugten sie ängstlich, sehnsüchtig und neugierig nach dem Gipfel des Weihnachtsberges hinauf, und wenn endlich die blaue Winternacht ihren Duftschleier um den Gipfel hüllte, flammte da oben ein mächtiges Bergfeuer zum Himmel, und eine Trompete blies langsam und feierlich herab ins Tal: „Vom Himmel hoch, da komm ich her.“
„Er kommt, er kommt!“ stießen da die Kinder heraus, und die kleinsten zitterten in seliger Angst. Vom Berge herab aber kam mit silbernem Geläut der Knecht Ruprecht gefahren. Er thronte auf einem mit Tannenreis prachtvoll verzierten Schlitten, und andere Schlitten folgten ihm, die wurden von seinen Knechten gelenkt und waren mit Hunderten von Paketen und Paketchen beladen. Vom Stadttor an bildeten alle Kinder Spalier, die reichen wie die armen, die großen wie die kleinen. Die Eltern, Tanten und Großmütter standen hinter ihnen, und wenn der Knecht Ruprecht ankam, winkten die Kinder mit den Händen, die Väter nahmen die Mützen ab, und die Tanten und Großmütter machten tiefe, ehrfürchtige Knickse. Der Knecht Ruprecht aber saß da auf seinem tannenbekränzten Thron wie ein König und nickte nach rechts und nickte nach links, winkte mit der rechten Hand und winkte mit der linken Hand, verteilte seine Gaben an die Armen und Reichen, an die Gerechten und Ungerechten.
Nach der Feier bestieg der Knecht Ruprecht seinen Schlitten. Die Fackelträger, die Ehrenjungfrauen und alles Volk begleitete ihn bis ans Tor. Mit lustigem Klingeling fuhren die Schlitten den Weihnachtsberg hinauf, und die Leute kehrten heim, alle im Herzen froh und reich.
Das war der Weihnachtsberg bis vor acht Jahren. Da kamen die Neustädter und kauften Herrn Eberhard, der damals gerade ein wenig in Sorgen war, sein Gasthaus für einen guten Preis ab. Die Neustädter machten aus der alten edlen Burgherberge ein „Etablissement mit Burgruine, Aussichtsturm und im übrigem allem Komfort“. Es wurden hölzerne Veranden mit großen Fenstern an das alte Mauerwerk geklebt, der ganze schablonenhafte öde Hotelbetrieb eingerichtet, und die Badezeitung faselte vom Fortschritt der modernen Zeit.
Daß schweres, reines Altgold in dünnes Flitterblech gewalzt wurde, empfanden am meisten die Waltersburger Kinder, die am Weihnachtsabend vergebens ausspähten nach dem leuchtenden Höhenfeuer und der süßen, verheißungsvollen Melodie: „Vom Himmel hoch, da komm ich her.“
In Gedanken an alte, schöne Zeit stieg ich den Weihnachtsberg hinauf. So sentimental war ich aber nicht, um dem neuen „Etablissement“ auszuweichen; dazu war ich denn doch zu weit in der Welt herumgekommen und hatte zu viel Schifflein scheitern sehen, um so eine Unglücksstelle feig zu umsegeln. Ich kehrte in dem „Etablissement“ ein. In der großen Glasveranda waren drei Kellner und ein Gast anwesend.
Dieser einzige Gast saß am Fenster und guckte nicht auf, als ich zur Tür hereintrat. Daraus erkannte ich, daß er kein Deutscher war. Im übrigen genügte mir ein Blick zu meiner Orientierung. Ich erkenne den Nordamerikaner so leicht unter allen Nationen heraus wie den Star unter den bunten Finken.
Soll ich hier das Bild wiederholen, das deutsche Karikaturisten malen, wenn es gilt, einen „Uncle Sam“ zu zeichnen? Das kurzgeschorene Haar, den glattrasierten, rasiermesserdünnen Mund, die etwas schlottrige Figur mit den langen Beinen und fuchtelnden mageren Armen, die Stummelpfeife, den karierten Anzug und diesen anderen Kram? Nein! Ich ging zweimal durch die Stube, stellte fest, daß achtzehn Tische unbesetzt und einer besetzt war, und setzte mich dann an den besetzten, dem Gaste gegenüber, ohne ihn zu grüßen. Der andere blickte auch jetzt nicht auf. Er sah gelangweilt ins Tal. Ich beachtete ihn auch nicht.
Der Kellner kam, und ich machte meine Bestellung. Darauf war es ganz still.
Endlich blickte der Mann mir gegenüber auf und sagte, indem er nach Neustadt hinunterwies:
„Das ist ein sehr albernes Nest da unten!“
Er sprach englisch; aber ich entgegnete deutsch:
„So kann man schon sagen. Es gefällt mir auch nicht.“
„Aber bei uns in Amerika werden Sie auch dumme Badeorte gefunden haben.“
„Woraus schließen Sie, daß ich in Amerika war?“
„Ich denke es mir.“
„So, so!“
Darauf schwiegen wir. Erst nach einem Weilchen nahm „Uncle Sam“ das Gespräch wieder auf:
„Sie halten nichts von unseren modernen Kurorten?“
„‚Nichts‘ kann ich nicht sagen. Es gibt zehn gute Kurorte und neunzig unnütze. Das sage ich.“
„Und wie denken Sie sich einen ganz guten Kurort?“
Ich zuckte die Achseln.
„Ich habe mir manchmal ein Bild ausgemalt, wenn ich als Schiffsarzt die nötige Muße zu solchen Träumen hatte.“
„Sie sind Schiffsarzt?“
„Ich war es.“
Ich fand es nun angemessen, mich vorzustellen. Darauf wippte auch er ein wenig vom Stuhle auf und sagte:
„Mister Stefenson. Öl und Naphtha. Neuyork, Milwaukee, St. Louis und Trinidad. Nun, wie ist das mit Ihrem Kurort?“
„Es ist gar nichts. Es ist ein Traum, eine verrückte Idee!“
„Verrückte Idee ist schön. Deutschland ist ein gutes Land, aber es leidet einen sehr großen Mangel an verrückten Ideen. Es ist zu brav, es macht zuviel nach. Den deutschen Unternehmungen fehlt die überraschende Pointe. Der Amerikanismus ist besser.“
„Das sagen Sie so!“
„Es ist so.“
Ich war verstimmt und schwieg.
„Nun?“ fragte er ungeduldig.
„Mister Stefenson, wenn ich Ihnen meine Idee entwickeln wollte, würden wir viel Zeit brauchen; am Schluß würden Sie mich doch nicht verstehen. So was liegt Ihnen nicht.“
„Wir haben Zeit, ich werde Sie verstehen, und es liegt mir“, gab er zur Antwort.
Da kam ich in Laune und sagte:
„Ich will es Ihnen in ganz kurzen Linien umreißen. Ich will mal annehmen, meine Heilanstalt bestände schon und Mister Stefenson käme zu mir als Kurgast.“
„Das ist gut! Das ist instruktiv!“ rief er. „Wie heißt Ihr Sanatorium?“
„Ferien vom Ich.“
„Wie?“
„Ferien vom Ich.“
„Das ist kein guter Name. Dabei kann man sich nichts denken. Das zieht nicht.“
„Mister Stefenson, wenn Sie mir schon von vornherein widersprechen, werde ich Ihnen kein Wort über meine Heilanstalt sagen. Daß Sie den Namen nicht ohne weiteres begreifen, ist doch eben das Neue und Gute.“
„Well; ich sage nichts mehr. Ich höre.“
„Also: Irgendwo auf der Welt, sagen wir auf dem Ostabhang dieses Weihnachtsberges bei Waltersburg, liegt die Heilanstalt ‚Ferien vom Ich‘. Auch Mister Stefenson, der schon in vielen Kuranstalten und nie ganz zufrieden gewesen war, hat von der Anstalt gehört und hauptsächlich darum, weil es etwas Neues war, beschlossen, sie aufzusuchen. Er reist nach Waltersburg. Mister Stefenson kommt mit sieben Koffern und zwei Dienern an.“
Mein Gegenüber nickt.
„Stimmt. Sie sind ein Gedankenleser.“
„Der Ankömmling findet in der Nähe von Waltersburg ein Gelände von Wald, Hügeln, Gärten, ganz von einer hohen Mauer umschlossen, über die kein Mensch hinwegsehen kann. Er merkt gleich: ah, an dieser Mauer ist die Welt alle, hier ist eine Welt für sich. Die Mauer hat nur ein einziges Tor. ‚Ferien vom Ich‘ steht darüber. Mister Stefenson, der mit drei Wagen ankommt, zieht die Schelle an der Pforte. Eine tiefe Glocke schlägt einmal an. Da kommt von drinnen her ein Diener, der öffnet das Tor. Er ist nicht in der weltüblichen Tracht, er trägt Pluderhosen, Sandalen an den Füßen, eine weite, am Hals ausgeschnittene Bluse und ist barhäuptig. Vor Stefenson macht er keine Verneigung, sondern sagt: ‚Lieber Freund, Sie sind wohl wenig unterrichtet, sonst kämen Sie nicht mit solch unnötigem Kram hier an. Seien Sie so gut, lassen Sie Ihre Diener und Ihr Gepäck unten in Waltersburg oder sonstwo auf der Welt Unterkunft suchen und kommen Sie ganz allein, wie Sie hier stehen, mit mir.‘
Mister Stefenson ärgert sich nicht wenig über diese Ansprache des dienstbaren Geistes, aber er will hinter den ‚Trick‘ kommen, deshalb winkt er seinem Gefolge ab und geht in das große Ferienheim des Lebens. Die Pforte fällt hinter ihm zu. Sein Begleiter führt ihn eine Lindenallee bergan. Rechts und links sind Wiesen und einige bebaute Ackerstücke. Am Ende der Allee steht ein von Efeu umsponnenes Haus, so klein wie eine Einsiedlerhütte. Das Häuschen hat nur ein einziges Zimmer, aber das ist bequem hergerichtet, hat ein gutes Bett, einen Schreibtisch, schlichte, aber geschmackvolle Möbel und gute Bilder an den Wänden. In dieses Zimmer führt der Torwart den Mister Stefenson und sagt: ‚Hier bleiben Sie, lieber Freund, zwei Tage und zwei Nächte. Lesen Sie die wenigen Blätter, die auf dem Schreibtisch liegen, gut durch und schreiben Sie Ihre eigene Lebens- und Leidensgeschichte auf, schreiben Sie auf, was Ihnen an sich selbst nicht gefällt und warum Sie hierhergekommen sind. Nach zwei Tagen wird der Arzt zu Ihnen kommen, wird lesen, was Sie geschrieben haben, und wird den ganzen guten Mannes- und Freundeswillen haben, Ihnen zu dienen und zu helfen. Das Essen wird Ihnen inzwischen durch mich gebracht werden. Finden Sie sich mit den Blättern, die auf dem Schreibtisch liegen, nicht ab, können Sie nicht den Willen aufbringen, Ferien vom Leben zu machen, so hängt hier am Nagel an der Tür ein Schlüssel, der die Pforte unten an der Allee aufsperrt. Lassen Sie den Schlüssel von innen stecken und schlagen Sie die Pforte von außen zu. Zu bezahlen haben Sie für das, was Sie inzwischen genossen, nichts; wir freuen uns, daß Sie einmal dagewesen sind.‘
So sagt der Torwart, und dann läßt er den verwunderten Herrn Stefenson allein.
Der setzt sich, noch im Reisemantel, an den Tisch und beginnt zu lesen. Ich kann hier nicht den ganzen Inhalt dieser Blätter aufsagen, sondern nur einige wenige Sätze hervorheben. ‚Betrachte dein Leben mit allem, was es gebracht hat: Arbeiten, Erholungen, Genüssen, Sünden, als eine Anstrengung, die dich müde gemacht hat und deine Kräfte zermürben wird. Mache dich los von diesen Anstrengungen, spanne aus, mache Ferien. Löse dich zunächst los von dem Götzen, dem du alle Tage opferst, von deinem von dir so zärtlich geliebten Ich. Entkleide diesen Götzen allen Tandes, den du ihm mit großen Entbehrungen verschafft hast, seines wohlklingenden Namens, seiner Genußsucht, seiner Herrschsucht über Geld und andere Machtmittel.‘“
Hier unterbrach mich mein Zuhörer.
„Bitte, sagen Sie das nicht mit so phrasenhaften, abstrakten Worten; sagen Sie es einfacher und instruktiver!“
„Schön! Nehmen wir also an, daß jener Herr Stefenson die zwei Tage und zwei Nächte in dem Einsiedlerhäuslein ausgehalten hat, ohne fortzulaufen. Nach zwei Tagen kommt der Arzt. Herr Stefenson wird ihm entgegenrennen und ohne jede Einleitung sagen: ‚Ich habe Ihre Blätter gelesen und muß Ihnen sagen, Herr Doktor, daß mir die Sache zum Teil sehr abenteuerlich, zum Teil sehr langweilig vorkommt. Warum soll ich zum Beispiel hier in dem Ferienheim nicht mehr Stefenson heißen, sondern einen anderen Namen haben?‘
‚Setzen Sie sich‘, wird der Arzt antworten und Herrn Stefenson auf die Bank neben der Haustür drücken.
‚Holen Sie Ihre Lebensbeschreibung.‘
Herr Stefenson gehorcht, und der Doktor beginnt zu lesen, was Herr Stefenson in den Tagen einsamer Einkehr in sich selbst über sein Leben niedergeschrieben hat. ‚Ich werde die Blätter mitnehmen‘, sagt der Doktor, ‚und sie zu Haus noch einmal lesen, dann bekommen Sie Ihr Manuskript zurück und können es selbst vernichten.‘ ‚Das ist so ähnlich wie bei Lahmann‘, sagt Stefenson. ‚Ja‘, nickte der Doktor, ‚ich habe vieles von Lahmann, der wieder vieles von Prießnitz und anderen hat. Wenn einer hochkommen will, muß er immer auf die Schultern anderer steigen.‘