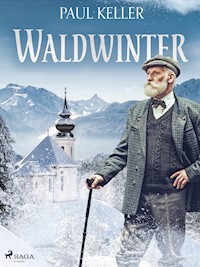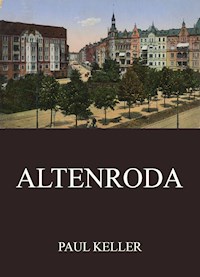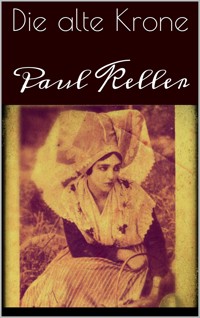1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hubertus hat die Zeit seiner Jugend, seiner Irrungen und Verwirrungen hinter sich und zieht als Mitdreissiger in ein Dorf, wo er sich häuslich niederlässt und sich in die junge Lehrerin verliebt. Das Dorf liegt mitten im schönsten Wald, und der Wald ist es, der das Dorf bestimmt. - Das Leben geht seinen beschaulichen Gang, bis auf einmal alles durcheinander gerät: Eine junge Frau wird ermordet, ein Haus angezündet, ... Hubertus ist ein halber Krimi und ein Roman des Waldes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Hubertus
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorrede
Die Legende erzählt von Sankt Hubertus, daß er im rauhen Wald auf der Jagd zwischen dem Geweih eines halb zu Tode gehetzten Hirsches ein weißes Kreuz blitzen sah und daß er ob dieses Wunders auf die nackten Jägerknie sank und die Armbrust fallen ließ. Nach diesem Erlebnis wurde der bisher sehr leichtlebige Prinz von Aquitanien ein stiller Heiliger. –
Der »Hubertus«, von dem dieses Buch erzählt, war kein Prinz, nicht einmal ein Jäger, noch viel weniger ein Heiliger. Aber er heißt mit Recht »Hubertus«. Er hat wie ein loser Prinz viele Freuden des Lebens sorglos, ja gewissenlos genossen; er hat gejagt nach Gold, Macht, Ansehen, Weiberlust, Weinlaunen, Spielgewinn und hat eines Tages ein weißes Kreuz leuchten sehen, worauf ihm alle Jägerlust erlahmte und er ein stiller Mann wurde.
Lange vor Abend ward er müde. Da sah er auf irgend einer Pürsche das Kreuz des großen Leides. Ob es in den Augen eines geputzten, verlorenen, plötzlich in Tränen ausbrechenden Weibes blitzte? Ob es auf die Stirn eines Hungergesichtes gezeichnet stand, das durch die Fensterscheiben eines Saales schaute, in dem er praßte? Ob es in einer Sakristanlaterne leuchtete, die zu einem Sterbenden führte und der er auf nächtlichem Heimgang übersatt und halbberauscht begegnete? Oder ob er es schweben sah über dem weißen Totenkissen, auf das sein lebenstollster Freund frühzeitig das Haupt zur Ruhe betten mußte?
Irgendwo sah Hubertus das Kreuz des großen Leides.
Vielleicht hat er einmal in stiller Abendstunde, schon von der Dämmerung umfangen, allein in seiner Stube gesessen und sinnverloren in einen großen Spiegel geschaut. Darin hat er das Bild eines müden Toren erblickt, über dem das weiße Kreuz eines Lebens ohne Sinn und eines Endes ohne Gnade war.
Und da ist er in den Wald gezogen.
Hubertus wird die Geschichte seines ersten Waldjahres hier nun selber erzählen. Ich bin nicht Hubertus – und bin es doch! – Du, Leser, bist nicht Hubertus – und bist es doch! Fragen wir ihn nicht, wer er ist. Er ist schlechthin Hubertus, und wir lernen ihn nicht auf seinen Pürschgängen kennen, sondern in seiner ersten stillen Zeit der Einkehr.
Hubertus ging in den Wald, weil er meinte, daß der Wald der Ort des Friedens, eine Stätte abseits des Lebens sei. Das war freilich ein Irrtum. Der Wald liegt nicht abseits der Welt, er ist selbst ein Stück Welt mit allem Hasten und Treiben, Lieben und Verfolgen, mit Großartigkeiten und lächerlichem Kleinkram, mit blitzschnellem Geschehen und breiten Ödnissen, mit Leben und Sterben. Der Wald hat weite Ausblicke und schwere Düsternisse, lachende Wiesen und dumpfe Sümpfe, freundliche Einkehrhäuser und tückische Fallen. Im Walde werden täglich Millionen Brautfeste gefeiert und geschehen täglich Millionen Morde. Es sind dort Schlachten, Niederlagen, Triumphzüge. Es ist Häuserbau, Familienglück, feindselige Nachbarschaft, Liebe und Vernichtung. In einem Tropfen, der am Schilfrohr hängt, geschehen die abenteuerlichsten Dinge.
Der Wald ist ein Stück der Welt und also nichts anderes als die Welt selbst. Die Menschen aber suchen etwas Besonderes in ihm, wie sie mit andächtigen Schauern vor einer Burgruine stehen, in der sich vordem vielleicht nichts abgespielt hat als Kälberabschlachten, Garnspinnen und Steuereintreibung.
Auch die Waldleute sind wie die anderen. Aber doch – es ist etwas Einsames, Schattenhaftes um sie. Sie wohnen alle zusammen wie unter einem gemeinsamen Zelt, das der Wald um sie und über sie geschlagen hat. Der Wald ist in Wahrheit ihr Hausherr, ihr Beherrscher, viel mehr als die Stadt die Beherrscherin der Stadtleute ist. Die Stadt ist eine liberale Tante, der Wald ist ein autokratischer Vater.
So wird der Wald in diesem Buche der eigentliche »Held« sein. Hubertus ist nicht einmal die wichtigste Person; er ist der Berichterstatter, er gibt nur die Firma.
Ein Stück Leben, wie es im Bereich des Waldes sich abspielt – und in das Hubertus hineingeriet – ist der Inhalt dieses Buches.
Von altem und neuem Heimweh, dann von allerhand Hausgenossen
Ich bin erst seit drei Tagen in diesem Hause. Rundum ist mir noch alles neu. Alle Wege muß ich erst finden lernen. Kaum vier Menschen, die mir begegnen, kenne ich mit Namen. Ich weiß nichts von diesen Waldhütten und Waldhöfen, nichts von ihren Schicksalen und ihren Bewohnern.
Es ist alles noch von mir zu erforschen. Da hätten also Geist und Herz Arbeit genug. Aber in den drei Tagen hat mich doch mehr als einmal die Langeweile angegrinst. Es beschlich mich erst gestern abend tiefe Furcht, ich würde es hier nicht aushalten, und als der Mond schon hoch am Himmel stand, trat ich ans Fenster und hatte das Heimweh.
Als ich noch jünger war, habe ich mich einmal weit über ein Jahr lang nach einem fernen Mädel gesehnt, mit dem wehen Verlangen, dessen nur die weiche Jugend fähig ist, mit sterbensbanger Traurigkeit im Herzen, mit müdem, leerem Glanz in den Augen, ja, oft mit bitterem Geschmack auf der Zunge und einem Würgen in der Kehle. So schlimm war diese Sehnsucht! Mit der Zeit wurde ich krank, und ich wußte, daß es nur ein Heilmittel geben könne – die Nähe der Geliebten. So reiste ich zu ihr, sobald es möglich war, und mit jeder Bahnstation, die ich ihr näher kam, verringerte sich das Heimweh, bis es erstarb in einer großen, aber seltsam unruhigen Freude.
Als ich bei dem Mädchen war und als die Beklommenheit des Wiedersehens überwunden, das Glück der ersten Tage ausgekostet war und wir abends allein durch die Dämmerung gingen, kam jenes Verlangen, jenes tiefe Heimweh wieder. Das Mädchen, das neben mir ging, erschien mir auf einmal fremd, und meine Sehnsucht suchte die andere, die sie immer gesucht hatte und die – meine Nachbarin nicht war.
Und jene andere kannte ich nicht!
Was habe ich mich nach der Waldeinsamkeit gesehnt in der letzten Zeit meines Großstadtlebens. Wie der Hirsch nach der Wasserquelle, wie der Verfolgte nach dem Freihafen, wie ein müdes Kind nach dem Schoß der Mutter.
Aber gestern Abend, als der Mond über den Wipfeln der Tannen, die mich und mein schmuckes Waldhaus umhegen, so silbern und schön schwamm, wie nur je ein romantischer Maler ihn malte, und ich den ruhigen Atem der schlummernden Bäume hörte, so mitten im Dämmerlichte erfüllter Liebesnähe – kam das Heimweh wieder, und ich befürchte, daß es wohl auch dieser Wald nicht sein wird, was mir zum Frieden dient.
Ich als Mensch aus der großen Welt lache doch über den Weltschmerz; aber es ist schlimm, daß ich nicht weiß, wonach ich mich sehne.
Nach dem alten Leben? Gewiß nicht. Ich habe seine Freuden bezahlen müssen mit dumm verschleudertem Geld, mit elenden Gewissensskrupeln, mit dem Verlust der Gesundheit. Schlimmer als der gemeinste Wucherer hat das Leben mich betrogen, hat auf den Wert seines Tandes Millionen Prozente aufgeschlagen, und ich Tropf habe es nicht gemerkt oder nicht merken wollen, wie frech ich hintergangen wurde, sondern alles, alles gezahlt.
Oder sehne ich mich nach den Freunden? Irgend ein neuerer Dichter hat gesagt: »Es ist ein trauriges Lied, das von den guten Freunden.« Ich habe eine ganze Anzahl »Freunde« gehabt. Die meisten waren Amüsierkumpane, famose Gesellen beim Spiel, Wein und Tanz; aber wenn einer ging, hinterließ er keine Lücke; es kam leicht ein Ersatzmann. Dann waren ein paar Gesellen, die mich ausnutzten; es waren arme Schlucker, denen es verziehen sein soll. Dann war einer darunter – ein Betbruder – der mir immerfort Moral predigte. Das war der widerwärtigste von allen. Dem habe ich auf die Beine geholfen, daß er davonging und sich jetzt mit mir nur in der Weise beschäftigt, daß er mir Schande gibt. Vier Freunde habe ich gehabt: einen, dem ich alles beichten konnte und der immer ein heilendes Wort hatte – der ist gestorben – und einen zweiten, der meinte, das Wesen der Freundschaft bestehe darin, daß man sich immer die unverfälschte Wahrheit sage, und der mir deshalb täglich und stündlich widersprach und grob kam. Mit dem unterhalte ich mich jetzt lieber brieflich. Den dritten guten Freund hat das Leben in weite Ferne verschlagen, und den vierten drückt der Kampf ums Dasein in immerwährende Fron.
Geschwister habe ich nie gehabt. Die Eltern sind lange tot, schon gestorben, als ich noch ein Kind war. Der Herr Vormund, der mich aufzog, hat das reiche Erbteil an Geld, das mir meine Eltern hinterließen, gewissenhaft verwaltet; aber was sonst ein Kind für Reichtümer hat: Frohsinn, Tollerei, strahlende Laune oder gar Liebe – das hat mir der Mann alles unterschlagen. Er ist ein ärgerer Defraudant, als wenn er sich an meinen Wertpapieren vergriffen hätte.
In meine Großstadtwohnung ist einmal ein Einbrecher eingedrungen, hat eine goldene Uhr und einen Ring von ungefähr fünfhundert Mark Wert gestohlen und hat dafür zwei Jahre Zuchthaus bekommen.
Mein Vormund, der in das Paradies meiner Kindheit einbrach und mir zwar kein gemünztes Geld, aber dafür alle Schmuckstücke junger Jahre stahl, ist nicht mit einem Tag Gefängnis bestraft worden. An meinem einundzwanzigsten Geburtstage, da ich großjährig wurde, habe ich an meinen Vormund geschrieben, ich hätte von einem vereidigten Sachverständigen, Vermögensverwalter usw. mir ausrechnen lassen, daß die von ihm für mich aufgewandte Mühe etwa 2000 Mark wert gewesen sei; diese Summe hätte ich heute dem »Verein für Kinderpflege«, dessen Vorstand seine Gattin sei, überwiesen, damit ich meinerseits mit ihm quitt sei. Meine Gegenrechnung wolle ich nicht ihm, sondern dem alles genau bezahlenden Herrgott einschicken.
Es gibt viele Orden im deutschen Land. Einen Vormundsorden sollte es geben für solche Vormünder, die ihre Aufgabe, toten Vaters Stelle zu vertreten, wirklich erfüllen. Aber die Vormundsschaftsgerichte dürften diesen Orden nicht vorschlagen, die sind mit zu geringer Leistung zufrieden; auch nicht die Gemeinden und Waisenräte, denn sie empfinden ja doch mehr oder weniger die ganze Vormundschaft nur als eine Last; auch nicht die Mündelkinder selbst wären ganz kompetent, sie sind, ach, zu so großer Bescheidenheit, zu oft so unbegründeter Dankbarkeit erzogen, daß auch sie schäbige, liebearme Faulpelze dankbar dekorieren würden, weil sie es nicht besser wissen. Wenn der Herrgott selbst den Vormundsorden verleihen könnte, er, der allein alles weiß und Herz und Nieren kennt, dann wäre dieser Orden viel seltener als das Eiserne Kreuz erster Klasse für einen gemeinen Mann, aber auch dann – wie jenes – ehrlich und schwer verdient.
Februar. Es ist noch tiefer Winter in den Waldbergen. An dem Felsenblock, der neben meinem Hause ist, stehen und hängen meterlange Eiszapfen. Er sieht aus wie eine kristallene Orgel, die in den Silberdom des Waldes eingebaut ist. Den Bachweg herauf klimmen alte dicke Weiden, schwerfällig wie Bauern, die in weißen Schafspelzen zur Kirche kommen, und neben der Orgel stehen einige Birken wie zierliche Jungfrauen, die ein frommes Lied singen wollen.
Manchmal, wenn der Wind geht, singen sie wirklich, und die silberne Orgel klingt dazu mit einer zarten vox coelestis. Dann steht der ganze Wald andächtig da. Am stillsten sind die Tannenkinder, die knien an der Erde in ihren grünen Kapuzenmänteln mit dem Hermelinbesatz und regen sich nicht. Hinter ihnen steht eine große Fichte wie eine strenge Institutsvorsteherin, die aufpaßt, daß die Kinder ganz artig sind in der Kirche. Manchmal denke ich, wenn man die große Fichte umhackte, würden die kleinen Tannen Unfug treiben.
Weit hinten im Dom ragt das Kreuz mit der Ewigen Lampe auf. Ich kann es von meinem Fenster aus gut sehen. Eines reichen Herrn einziger Sohn ist vor vielen Jahren an jener Stelle erschossen aufgefunden worden. »Aus Versehen« – hat es geheißen. Da hat der reiche Herr jenes Votivkreuz setzen lassen. Es ist ein Kunstwerk: das Gebälk des Kreuzes ganz roh, wie ein Kreuz sein muß, nicht durch Beiwerke verunziert, und der Cruzifixus, ein göttlich schöner Menschenleib, hebt sich von den elenden Balken, an die seine Todesleiden geheftet sind, in erschütterndem Gegensatze ab.
Auch die Ewige Lampe ist ein gutes Werk. Da ist mal einer gewesen, der noch Eisen schmieden konnte. Das rubinrote Licht der Lampe ist überall im Tal zu sehen. Wenn die Lampe einmal ausgeht, kommt ein Unglück, sagen die Leute. Sie behält aber selbst in starken Sturmnächten ihr Licht. Nur wenn die Leute lässig wären, Öl nachzugießen, würde sie ausgehen. Und dann würde Unglück kommen. Das Öl muß immer eine Jungfrau nachfüllen. Die Gemeinde betraut ein armes Mädchen damit, und der geschieht damit große Ehre. Wenn das Mädel Hochzeit hat, kauft ihr die Gemeinde ein weißseidenes Brautkleid.
Mein Kammerdiener Timm hat mich in meine Einsamkeit begleitet. Er ist ein noch ziemlich junger Mann, eine treue Seele; nur, er hat den Vornehmheitsfimmel. Ich übernahm ihn einmal von einem gräflichen Freunde, der »in die Binsen« ging, keinen Kammerdiener mehr brauchen konnte, sondern drüben in Amerika Kellner wurde.
Timmen hat dieses gräfliche Schicksal fast das Herz gebrochen. Nicht, daß er mit so großer Liebe an seinem früheren Herrn gehangen hätte – der behandelte ihn oft schlecht – sondern daß Vornehmheit sich ins Niedrige verlieren, daß ein Hochgeborener in einen Kellnerfrack schlüpfen kann, daß so etwas überhaupt möglich ist auf dieser entarteten Erde, das erfüllt auch heute noch Timms Herz mit Schwermut.
Auch mich betrachtet Timm als einen Halbverlorenen. Als er mein Waldhaus, das mir ein befreundeter Architekt wirklich nett und auch ganz stattlich gebaut hat, betreten hatte, ging er schweigend durch die acht Zimmer, besah die Veranda, die Nebengelasse und sagte dann: »Der gnädige Herr werden hier eine angemessene Wohnung zu vorübergehendem Landaufenthalt haben.«
Ich entgegnete ihm: »Du täuschest dich, Timm! Ich werde hier nicht vorübergehend, sondern immer wohnen. Es wird sich mancherlei ändern. Um gleich etwas zu sagen: du wirst mich fortan nicht ›Gnädiger Herr‹, sondern einfach ›Herr Hubertus‹ nennen, und ich werde nicht mehr ›Du‹ zu dir, sondern ›Sie‹ zu Ihnen sagen. Wir demokratisieren uns. Verstehen Sie, lieber Timm?«
Er sagte kein Wort, er machte nur eine seiner tadellosen Verbeugungen; ich sah aber, daß sein glattrasiertes Gesicht plötzlich mit Kummerfalten überzogen war.
Am selben Abend noch kam Timm zu mir und sagte: »Verzeihen der gnädige Herr, aber wenn ich zum gnädigen Herrn nicht mehr ›gnädiger Herr‹ sagen darf, so müßte ich den gnädigen Herrn bitten, mich zu entlassen; denn ich brächte es anders nicht fertig. Die Anrede ›Sie‹ werde ich aber auf mich nehmen.«
Ich ließ ihn eine Minute lang stehen, dann sagte ich: »Timm, du bist ein merkwürdiger Kauz. Aber wenn du weiter ›gnädiger Herr‹ zu mir sagst, so werde ich dich auch weiter duzen. Das ist selbstverständlich.«
Damit war er sichtlich nur halb zufrieden; aber er fügte sich und sagte nichts mehr von Entlassung.
Timm hat mir schon dreimal die Geschichte eines alten, hochfeudalen Herrn erzählt, der durch irgend welche Schicksale nur mit wenig Dienerschaft auf ein weltverlorenes Schloß verschlagen wurde. Der alte Herr, der täglich ganz mutterseelenallein speisen mußte, machte trotzdem vor jeder Mahlzeit sorgfältig Toilette und hätte keinen Bissen hinuntergebracht, wenn er nicht beim »Diner« in Frack und tadelloser Halsbinde gesessen und wenn ihm der Diener nicht in ebenso tadelloser Livree serviert hätte.
»Er hat nicht verpauvern wollen,« setzte Timm hinzu; »er hat den Respekt gegen sich selbst nicht verloren, er hat es so in seinem Blute geerbt.«
Daraus sieht man, daß Timm ein Psychologe ist, der die geheime Hoffnung hat, mich in aller Ehrfurcht etwas erziehen zu können.
Und er hat gar nicht mal so unrecht.
Gestern Abend hatte ich eine neue Unterhaltung mit Timm. Ich rief ihn zu mir und sagte: »Timm, wir sind zu einsam. Wir müssen uns zunächst einige Tiere anschaffen.«
»Ah –,« sagte Timm, und seine Augen glänzten auf. »Pferde! Ein Reitpferd, ein paar Kutschpferde!«
»Nein, Timm! Was soll ich hier herumkutschieren? Die Waldwege eignen sich dazu nicht, und ewig die Chaussee unten nach der Kreisstadt zu fahren, fällt mir nicht ein. Ein Reitpferd kauf' ich mir vielleicht noch. Aber vorläufig handelt es sich um andere Tiere – um zwei Hunde und um etwa zehn Hühner.«
»Hu – Hunde? Hü – Hühner?«
Es war das erste Mal, daß der zungengewandte Timm stotterte. Aber er faßte sich rasch.
»Einen Windhund? Einen Barsoi? Oder wenigstens eins dänische Dogge? Jawohl, gnädiger Herr! Aber Hü – Hühner? Wer soll denn die rupfen?«
»Gar niemand. Die Hunde werden sie vielleicht rupfen. Aber dann werden sie Prügel kriegen. Und was die Hunde selbst anlangt, so werde ich zwei Stück anschaffen: einen Dackel und einen Pudel.«
Er stand so verdattert vor mir, daß er mir leid tat und ich ihn gleich beruhigte: »Es wird natürlich weder dir noch der Köchin zugemutet werden, euch mit der Pflege der Tiere zu befassen; dafür werde ich ein besonderes Faktotum anstellen, das dann überhaupt die gröberen Arbeiten im Haushalt, die jetzt nur aushilfsweise besorgt werden, ständig übernimmt. Wir kommen hier – mein lieber Timm – mit lauter verfeinerten Kräften nicht aus; wir müssen was Robustes haben.
Er fingerte mit allen zehn Fingern aufgeregt an seinen Hosennähten herum.
»Etwas Robustes!« sagte er endlich; »jawohl, denn wir leben auf dem Lande.«
Die Hunde sind da. Den Dackel habe ich vom Förster bezogen, den Pudel habe ich mir aus einer städtischen Züchterei schicken lassen. Vorläufig machen die Tiere nicht viel Freude. Wenn sie sich sehen, beißen sie sich; wenn sie allein sind, scharren sie sich, und die Hausgenossen knurren sie an.
Oft aber schlafen auch beide, und dann ist's schön.
Auch das Faktotum ist da. Es ist eine Wittib, die dreizehn Kinder geboren hat. Zehn sind jung gestorben, die drei übriggebliebenen Jungen sind in der Lehre. So ist das Weib allein und war froh, als sie bei mir unterkam. Sie heißt Sturz. Empfohlen wurde sie mir vom Gutsinspektor Balthassar. Er gab zu ihrer Empfehlung an, sie sei ehrlich und sauber.
Die Ehrlichkeit und die Sauberkeit sind achtbare Eigenschaften; aber ich zweifle, ob sie allein hinreichend sind, einen Menschen zu einem angenehmen Hausgenossen zu machen.
Die Madame Sturz macht bei ihrer Arbeit einen Mordsspektakel. Drei Vierteile des Tages saust sie irgendwo mit einem Besen oder einem Scheuerlappen umher. Im Hausflur ist ein ewiges Klirren von Blecheimern. Was das alles für einen Zweck hat, weiß ich nicht. Den Holzstall und den Kohlenschuppen dreht Frau Sturz, nach dem Lärm zu schließen, der von dort herdröhnt, zweimal am Tage von oben bis unten. Ich finde, diese Frau ist zu eifrig.
Mit der Köchin verträgt sie sich. Es gibt auch sicherlich keinen Menschen auf Erden, der sich mit meiner guten Mathilde nicht vertragen würde. Die ist noch das einzige lebende Erbteil, das ich von meinen Eltern überkommen habe.
Timm sieht mit grenzenloser Verachtung auf die Sturz herab. Ich bin überzeugt, daß ihm die Frau in tiefster Seele zuwider ist und daß er unter ihrer Gegenwart leidet. Aber er sagt kein Wort. Er wartet nur stumm, bis ich das unästhetische Ungeheuer entlasse. Und ich muß ja zugeben, daß das kleine gedrungene Weib keine Zierde meines Hauses ist. Sie schürzt sich ihren ohnehin kurzen Rock mittels eines Lederriemens immer so hoch auf, daß man die dicken Waden sieht, die in groben Wollstrümpfen stecken. Sie gürtet sich so, als ob sie stets durch den dicksten Schlamm zu waten hätte. Ihr Gesicht glüht immer wie Kupfer, und ihre Haare sind in einem lächerlichen Knoten, der so groß wie eine Haselnuß ist, auf dem Wirbel zusammengehalten.
Daß Timm beim Anblick einer solchen Erscheinung Schüttelfröste kriegt, ist erklärlich. Er würde sicher lieber viele Arbeiten für sie tun, als ihre Gegenwart ertragen. Aber die Hühner! In schmutzigem Stroh nach Eiern zu suchen oder gar den Hühnerstall zu säubern, das brächte Timm nie über sich. Lieber ließe er Teufels Großmutter neben sich rumoren.
Ich habe beim Ankauf vergessen, nach dem Namen der Hunde zu fragen, und mich auch in den ersten Tagen um die Köter wenig gekümmert. Timm natürlich noch viel weniger. So hat die Sturz die Hunde getauft, den Pudel auf den Namen »Fips« und den Dackel auf den Namen »Box«. Als ich ihr sagte, daß das zwei ganz unpassende Namen für diese Gattung Hunde seien, meinte sie, alle Hunde im Dorf hießen entweder Fips oder Box. Ich verfügte, der Dackel hieße »Bims«, der Pudel »Bams«.
Darauf schüttelten alle Hausgenossen die Köpfe, und Timm, der in seiner Jugend eine Realschule bis zur Quarta besucht hat, sagte: »Gnädiger Herr, die Hunde werden die ähnlichen Namen, die nur den kleinen Vokalunterschied aufweisen, nicht immer auseinanderhalten können, wenn man sie ruft.«
Der Sturz stand der Mund offen, als Timm so gelehrt daherredete. Ich aber sagte: »Lieber Timm, das hat nichts zu sagen. Ob ich nun Bims oder Bams rufe, kommen wird immer nur der eine Hund, und das ist der Pudel; denn der Dackel kommt sowieso nicht.«
Hühner haben wir zehn; neun Hennen und einen Hahn. Es sind lauter Legehühner vom vorigen Jahre. Gelegt hat aber noch keine. Ich hatte deswegen eine Beratung mit Timm, welcher sagte: »Gnädiger Herr, ich glaube, es sind lauter Hähne. Hähne legen nicht.«
Timm glaubte wahrscheinlich, mit dieser Mitteilung mir seine Erfahrungen in landwirtschaftlichen Dingen darzutun, aber ich entgegnete ihm: »Nein, Timm! Es kräht nur einer, also kann es nur ein Hahn sein; denn Hennen krähen nicht.«
Da war ich ihm über; denn daß Hennen nicht krähen, hatte Timm nicht gewußt. Ach, wir Landbewohner und Hühnerzüchter!
Mathilde wurde befragt. Die sagte das, was sie immer gesagt hat, wenn ich mal einen Erfolg im Leben nicht abwarten konnte:
»Ach Gott – nur Geduld! Es kommt schon noch!«
Schließlich befragte ich die Sturz, deren sämtliche Urahnen bis zum Urvater Noah hinauf sicher bei Hühnervolk auf dem Lande gelebt haben. Timm war dabei, als ich mit der Sturz sprach. Ich sagte ihr unsere Meinung über den Fall, und darauf erwiderte sie, indem sie eine Pfütze Wasser, die sie vorher ganz sinnlos über die Fliesen des Hausflurs gegossen hatte, mit einem Rutenbesen halb zur offenen Tür hinausschleuderte und zur anderen Hälfte den Kacheln der Wandbekleidung sowie Timmens und meinem Anzug mitteilte: »Tummes Zeug! 's is halt noch zu kalt zum Legen!«
Ich bemerkte die unangenehme Dusche an meinen Beinkleidern sowie den Ausdruck »dummes Zeug« mit Mißfallen und erwiderte streng: »Frau Sturz, ich bitte, daß Sie sich in Ihren Äußerungen gegen mich einer höflicheren Form bedienen.«
Die Sturz schrubbte schweigend weiter. Ich ließ sie stehen, hörte aber noch, wie Timm in die Küche trat und zu Mathilde mit Befriedigung sagte: »Er wird energisch!«
Von Herrn Balthassar und von Mielchen und Malchen - Vom Skatspielen und von der Lehrerin mit dem Reisekorb und dem Kleiderschrank
Ich halte es ohne menschliche Gemeinschaft nicht aus. Die Wogen des Meeres, auf dem ich bisher draußen fuhr, schlagen in diesen stillen Hafen herein und schütteln das »gerettete Boot« zum Erbarmen. Ich studiere wie ein Student, der in sechs Monaten durchs Examen sein will, weil die Geliebte auf die Heirat wartet. Philosophie, Kunstgeschichte. Auch einige naturwissenschaftliche Werke liegen auf meinem Tisch. Ich habe in meiner Schulzeit einen jämmerlichen naturwissenschaftlichen Unterricht gehabt und muß eigentlich von vorn anfangen. Doch halte ich mich vielfach an Bücher, die Volksschullehrer geschrieben haben; die sind einfach, sinnfällig, anschaulich. Es liegt auch manchmal ein Schimmer von Poesie über dem Text.
Der erste Bekannte, den ich gewonnen habe, ist der Gutsinspektor Balthassar. Dieser Mann trat eines Tages in meine Stube und sagte, ich möchte entschuldigen, er erlaube sich, mir einen Antrittsbesuch zu machen. Ich glaubte zwar mit gutem Grund, daß der »Antrittsbesuch« als Neuankömmling meine Sache gewesen wäre, aber ich hieß in meiner Einsamkeit den Gast herzlich willkommen.
Herr Balthassar ist ein etwas überproportionierter Vierziger, dessen Äuglein munter und freundlich aus dem roten Landmannsgesicht leuchten. Er verwaltet das Waldgut eines reichen Kaufmanns, der nur selten aus der Hauptstadt zu Besuch kommt, und ist der Amtsvorsteher und auch der Lokalschulinspektor des Ortes.
»Wenn Sie sich hier einbürgern wollen, Herr Hubertus, so kann ich Ihnen vielleicht hie und da nütze sein.«
Timm mußte Wein bringen und bediente mit der nur mir erkennbaren Lässigkeit, die der Schlingel immer zeigt, wenn ein nach seiner Meinung nicht ganz »gesellschaftsfähiger« Gast da ist.
Herr Balthassar ist ein gesprächiger Mann. Es stellte sich heraus, daß er die bauliche Einrichtung meines Hauses viel genauer kannte als ich selbst; denn er hatte sich während der Bauzeit ständig in dem Neubau herumgetrieben, obwohl ihn die Sache gar nichts anging.
»Als Amtsvorsteher,« sagte er, »muß man sich um alles kümmern.«
Ich beschloß, diesen Mann als Auskunftsbüro zu benutzen, wenn immer ich ein solches nötig hätte. Ich tat ihm zunächst den Gefallen, ihn durch meine Zimmer zu führen, um seine deutlich erkennbare Neugierde zu befriedigen, mußte aber zu meinem Bedauern bemerken, daß das, was er da sah, seine Zutraulichkeit beeinflußte. Er wurde kleinlaut und verlegen. Das bißchen Komfort oder auch Luxus, das ich habe, machte der naiven Haut Beklemmungen. Das lag nun gar nicht in meinem Interesse.
»Herr Balthassar,« sagte ich, »es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben. Ich will ja hier ganz einsam leben – wie lange, weiß ich noch nicht – ich will den Wald haben und im übrigen in meinem Hause und bei meinen Büchern sitzen. Aber manchmal möchte ich doch ausgehen und ein paar Bekannte treffen. Auch ins Gasthaus möchte ich manchmal. Gehen Sie auch ins Gasthaus, Herr Balthassar?«
»Jawohl – jawohl – ich gehe auch ins Gasthaus – selten natürlich – aber es kommt doch vor.«
»Spielen Sie auch Skat?«
»Skat!«
Sein Gesicht verklärte sich.
»Jawohl – jawohl – sogar sehr gern – man sagt mir nach, ich sei ein guter Spieler. Mit allen Schikanen. Herr Bernert hier – er ist Kantor und Hauptlehrer – spielt auch 'ne gerissene Nummer. Ist übrigens der einzige gebildete Mensch, der als Dritter in Frage käme.« »Na schön! Vielleicht paßt es den Herren mal. Die Winterabende sind lang, und das Gasthaus unten macht ja einen recht netten Eindruck. Es ist wohl im Sommer Ausflugslokal?«
»Jawohl – recht nettes Gasthaus. Wird von zwei Schwestern bewirtschaftet. Eine heißt Emilie, eine Amalie. Mielchen und Malchen werden sie gerufen. Wenn mir's egal ist, welche kommen soll, rufe ich Mulchen.«
Er lachte über seinen Scherz und drückte mir beim Abschied die Hand herzlich und schmerzlich.
Als er fort war, sah mich Timm stumm, aber vorwurfsvoll an.
»Das ist unsere neue Gesellschaft?«
Ich hatte selber einige Zwittergefühle in der Seele, beschloß aber, solange ich Waldbewohner sei, mit den Waldbewohnern im Einvernehmen zu leben.
Gestern ist nun der erste Skatabend gewesen. Das Gasthaus heißt »Zur Traube«. Warum, weiß ich nicht; denn in dem ganzen hochgelegenen Waldtal gibt es nicht einen Weinstock. Die beiden Wirtinnen, Mielchen und Malchen, sind zwei saubere Mädchen von etwa dreißig Jahren, Zwillingsschwestern und von fabelhafter Ähnlichkeit. Da sie beide den blonden Scheitel und die Haarkrone ganz gleich tragen, beide ganz dieselbe Stimme, ganz denselben Gang haben, sich auch ganz gleich kleiden, so begreife ich nicht, wie sie ein Mensch zu unterscheiden vermag.
Der Kantor erzählte mir, als kleine Kinder seien sich die Mädchen so ähnlich gewesen, daß auch die Eltern sie nicht zu unterscheiden vermochten. Da habe man denn dem Mielchen bald von der Geburt an immer ein rotes und dem Malchen immer ein blaues Schleifchen angemacht. Einmal aber, als die Kinder etwa zwei Jahre alt waren, hätten beide gleichzeitig die Schleifen verloren, und es sei nun eine schwere Not gewesen, festzustellen, wer das Mielchen und wer das Malchen sei, zumal die Kinder auf alle Fragen nach ihrer Identität nur mit einem ganz gleich klingenden Gebrüll antworteten. Da habe denn der Traubenwirt als Vater auf gut Glück entschieden: »Diese ist das Malchen und diese ist das Mielchen, und jetzt werden schleunigst neue Schleifen gemacht. Und was ich jetzt gesagt habe, dabei bleibt es!« Wolle Gott, daß sich der Traubenwirt nicht geirrt habe und daß es wegen des Taufregisters stimme.
Der Kantor sagte weiter, er könne die beiden auch nicht unterscheiden, obwohl er sie doch in der Schule gehabt habe und sie nun immer wiedersehe.
Herr Balthassar lachte spöttisch.
»Das ist, mein Lieber, weil Sie keinen Blick haben, sozusagen keine Schätzung! Ich weiß immer, welche von beiden es ist. Aber das ist mein Geheimnis.«
»Ja,« sagte die eine der Schwestern, die uns gerade Bier brachte; »das Geheimnis ist aber sehr einfach. Ich habe einen goldenen Backenzahn und das Malchen nicht. Da paßt Herr Balthassar auf, wenn eine spricht oder gähnt, und dann weiß er's.«
Da war der Prahlhans entlarvt.
Es ist hübsch in der »Traube«. Ein ganz molliges Honoratiorenstübchen ist da mit brauner Holztäfelung. An den Wänden hängen vier gute Bilder, drei Landschaftsstücke und ein Porträt. Dieses heißt »Mielchen und Malchen«. Das Porträt stellt nur eine Person dar und diese könnte ebensogut die eine wie die andere der Schwestern sein, und ich vermutete gleich, daß beide abwechselnd Modell gesessen hätten, je nachdem, welche von beiden gerade Zeit hatte.
Das Porträt und auch die Landschaften sind Originale, alle von demselben Maler mit guter Technik gemalt.
Wieder war es der Kantor, der mir Aufschluß gab.
»Die Bilder sind von Werner Lohmann. Der ist ein junger Künstler, der meist im Ausland lebt, aber manchmal hierherkommt.«
»Der Sohn von meinem Gutsherrn,« setzte Balthassar erläuternd hinzu. »Er soll sehr begabt sein. Sein Vater, mein Gutsherr, war ja ganz dagegen, daß der Sohn Maler wurde, und er hatte recht. Mir gefallen diese Klexereien gar nicht. Früher, da hing hier 'n Kaiser Wilhelm und 'n Bismarck und 'n Moltke. Hat der junge Herr alles rausgeschmissen, obwohl jedes dieser Bilder über zwanzig Mark gekostet hat.«
»Ja,« sagte das Mielchen wie entschuldigend zu mir, »wir konnten nicht anders, weil es doch der Sohn vom gnädigen Herrn ist.«
»Mein liebes Fräulein,« entgegnete ich, »die Lohmannschen Bilder sind gut – das Porträt da ist geradezu entzückend.«
Sie lachte.
»So soll ich aussehen? O Gott, o Gott! Dann muß es das Malchen sein, die hat viel öfter Modell gesessen als ich!«
Es ist hübsch in der »Traube«. –
Und nun kam es zum Skat. Herr Balthassar, der Kantor Bernert und ich. Ich halte es mit dem Skatspielen wie mit dem Theatergehen. Alle Tage – schrecklich! Aber von Zeit zu Zeit – ganz gerne.
Ich verlor andauernd. Meine Mitspieler waren mir weit überlegen. Herr Balthassar ist der Typ eines guten, aber nervösen Spielers. Wenn ich als sein Gegenspieler einen Fehler machte, wodurch er sein Spiel gewann, lachte er gutmütig und tröstete mich: »Na, die Fehler, die nicht gemacht werden, haben ihren Beruf verfehlt!« Wenn ich aber als sein Partner etwas verbockte, wurde er aufgeregt, und nur der Respekt, den ich ihm als Neuling eingeflößt hatte, hielt ihn zurück, mir grob zu kommen. Seine kritischen Bemerkungen wurden aber doch immer deutlicher. Zuerst sagte er nur: »Man hätt's auch anders machen können!« – dann: »Na ja, man greift halt manchmal daneben!« – dann: »Dunnerwetter! Dunnerwetter!« – dann: »Aber erlauben Sie mal!« – dann: »Verdammt, nu schneidet er mir die Zehn raus!« – zuletzt: »Aber, Herr Hubertus, so passen Sie doch endlich auf!«
»Ich kann's nicht besser,« sagte ich.
»Ja, aber ich habe Ihnen doch gesagt; immer die lange Farbe anziehen! Unter allen Umständen die lange Farbe! Die da sagen: dem Spieler die kurze, dem Gegenspieler die lange Farbe, das mögen ganz gute Leute sein, aber vom Skatspielen haben sie keine Ahnung. Denn sehen Sie, entweder hält die ›Lange‹, dann ist der Gegner futsch, oder sie hält nicht, dann kommt er um einen Trumpf zu kurz. Ist immer ein Vorteil.«
Wenn das mein Diener Timm beobachtet hätte – o weh! Ich aber blieb geduldig. Die Skatspieler leben in ihrer mündlichen Unterhaltung von etwa einem Schock feststehender Redensarten, angefangen von: »Na, wer gibt?« über »Dicke rinn, gered't wird nicht!« und »Mancher lernt's nie und dann noch unvollkommen« bis: »Da leg' ich die Karten hin und scheide aus« und endlich zum Schluß: »Wann spielen wir wieder?«
Ist das so lächerlich? Alle Hantierungen des Menschenlebens haben ihren Kanon: Regierungsmaßnahmen, Milchwirtschaft, Hotelbetrieb, literarische Kritik.
Warum sollte ich mich über Herrn Balthassar erbosen?
Es kam auch bald eine ganz neue Note in die Unterhaltung.
Balthassar legte die Karten hin und sagte: »Der Skat ist eigentlich ein recht demokratisches Spiel; denn die Könige haben dabei nicht viel zu sagen.«
»Das ist eine gute Bemerkung!« warf ich höflich ein. Auch der Kantor griff die Idee auf. Er meinte: »Dann müssen die Asse die Großgrundbesitzer sein; denn die zählen am meisten.«
Damit kam er mm bei Herrn Balthassar sehr schlecht an; denn der war ein Agrarier bis auf die Knochen.
»Jawohl – jawohl: immer die Landwirtschaft – wenn man der nur was am Zeuge flicken kann, und sei es auch bloß durch eine bissige Bemerkung! Die Großgrundbesitzer zählen am meisten? Geld meinen Sie wohl? Sie haben 'ne Ahnung! Fragen Sie mal, was die Kohlenbarone und die Herren Fabrikbesitzer und was vor allen Dingen die Juden zählen, dann werden Sie wissen, wer die Asse sind.«
»Der ganze Vergleich ging ja von Ihnen aus,« entgegnete der Kantor. »Jawohl, und nu will ich Ihnen auch sagen, wer die Buben sind, die alles wegstechen, gegen die nichts anderes aufkommt, obgleich sie alle zusammen nicht so viel wert sind wie der lumpigste Zehner: das sind die Herren Reichstagsabgeordneten und die Pressefritzen und die Volksredner und die anderen großfressigen Kerle.«
»Meinen Sie mich?« fragte der Kantor in Seelenruhe.
»Na, 'n Reichstagsabgeordneter sind Sie ja nich – Gott sei Dank! – aber in Volksreden haben Sie sich auch schon betätigt, und in der Zeitung haben Sie – nur nichts für ungut – auch schon manchen gehörigen Bockmist verzapft. Zum Beispiel neulich über die Kartoffelpreise.«
Der Kantor nahm die Brille ab, putzte sie mit seinem Taschentuch und sagte: »Bockmist kann man nicht verzapfen – das müßten Sie doch wissen, Herr Inspektor. Das ist ja 'ne ganz falsche Ausdrucksweise.«
»Ausdrucksweise hin – Ausdrucksweise her! Was verstehen Sie denn von Kartoffelpreisen? Was wissen Sie denn, wieviel teurer und mühsamer der Kartoffelbau z. B. ist als die Gerstenbestellung? Und was einem verfault! Und die Abfuhr zur Bahn! Keine Ahnung haben Sie – ebenso wenig wie ich 'ne Ahnung von Ihrer Schulmeisterei hab'.«
»Dabei sind Sie Lokalschulinspektor – also mein Vorgesetzter, nach dessen pädagogischen Anweisungen ich eigentlich –«
»Qualm! Reden Sie doch nicht! Was kann ich denn dafür, daß ich Lokalschulinspektor bin? Ich pfeif' doch darauf! Ich bin's doch bloß par ordre du mufti geworden. Störe ich Sie etwa? Lieg' ich Ihnen auf der Pelle? Wenn Sie mir schon Ihre dämlichen Listen und Plans zum Unterschreiben schicken, wird mir schlecht. Und jedes Jahr die Schulprüfung. Drei Stunden lang auf einem so elenden Stuhle zu sitzen und sich die Zehngebote und 's Einmaleins und die Schlacht bei Fehrbellin anhören! Ich danke!«
»Bitte, bitte – immer gemütlich!« warf ich ein.
»Ja,« sagte der Kantor, »spielen wir einfach weiter!«
»Nee!« brummte der Inspektor; »Sie haben mich zu nervös gemacht. Ich muß erst mal rausgehen.«
Er verschwand. Als er zurückkam, grollte er schon von der Tür her: »Mit dem Lokalschulinspektor haben Sie mich gerade aufs richtige Hühnerauge getreten. Nischt wie Schererei hat man. Zum Beispiel jetzt wieder mit der neuen Lehrerin, die in drei Tagen ankommt. Abgeholt soll sie werden von der Bahn mit ihren Sachen. Ja, was geht mich denn diese Lehrerin an mitsamt ihrem Reisekorbe und ihrem Kleiderschrank? Da heißt's: die Gemeinde müßte sie abholen, der Schulze wäre verantwortlich; dann wieder heißt's: der Schulverband muß sie abholen, ich als Lokalschulinspektor wäre verantwortlich; dann wieder: 's Dominium muß sie abholen, was für mich dasselbe ist, weil 's Dominium Patron is – Schockschwerenot noch mal! – und auf wem bleibt dieses Frauvolk, diese Lehrerin, mitsamt ihrem Reisekorb und ihrem Kleiderschrank schließlich sitzen? Auf mir!«
»Das wird schwer sein,« sagte der Kantor, »wenn so alles auf Ihnen sitzt: die Lehrerin und der Korb und der Schrank!«
»Höhnen Sie nur! Sie haben es ja leicht. Sie gehn ihr einfach bis an die Haustür entgegen und sagen: ›Gott segne Ihren Eingang und Ausgang!‹ oder so was Ähnliches, und dann singen Sie mit den Kindern: ›Heil sei dem Tag, an welchem du bei uns erschiehenen, dideldum, dideldum, dideldum!‹ oder so was Ähnliches. Basta! Das ist alles, was Sie zu tun haben. Aber ich! Auf mir –«
»Sitzt sie!« warf der Kantor ein.
»Sitzt sie auch!« grollte Balthassar. »Seit drei Wochen handle ich mich mit dem Schulzen wegen des Abholens rum. Dreimal bin ich bei ihm gewesen, dreimal hab' ich mir von ihm saugrob kommen lassen; ich hab' sogar schon einen Beschwerdebrief an den Landrat geschrieben, ich hab' ihn bloß noch nicht abgeschickt.«
»Das hätte ich mir viel einfacher gemacht,« sagte der Kantor.
»Einfacher? Wieso?«
»Ich hätt' mich an Ihrer Stelle gar nicht erst aufgeregt; ich hätte das Fräulein einfach abgeholt.«
Ein Lachen kollerte durch die Stube.