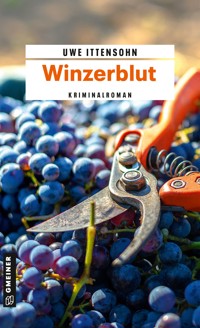Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Achill und Stadtführer Sartorius
- Sprache: Deutsch
Ein abgetrennter Finger am Strand der Ludwigshafener Parkinsel, ein Einbruch bei einem ansässigen Chemieunternehmen und ein toter Wachmann bei der Mannheimer Eichbaum-Brauerei. Handelt es sich hier um tägliche Polizeiroutine oder hängen die Fälle etwa miteinander zusammen? Und dann geht auch noch ein Erpresserschreiben bei der Speyerer Bürgermeisterin ein - das Bier für das Brezelfest soll vergiftet werden. Wird es dem Ermittlerteam um Sartorius und Achill gelingen, die tödliche Gefahr für die Festbesucher abzuwenden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Uwe Ittensohn
Festbierleichen
KRIMINALROMAN
Zum Buch
Rhein-Neckar-Pfalz-Krimi Am Strand der Ludwigshafener Parkinsel findet man einen abgetrennten Finger, ein dort ansässiges Chemieunternehmen wird bestohlen und ein Wachmann der Mannheimer Eichbaum-Brauerei stirbt unter mysteriösen Bedingungen. Handelt es sich um Einzelfälle und die übliche Polizeiroutine oder gibt es etwa einen Zusammenhang zwischen den Fällen? Und dann geht auch noch ein Erpresserschreiben bei der Speyerer Bürgermeisterin ein. Das Bier für das Brezelfest soll vergiftet werden. Alle Stränge scheinen auf dem größten Bierfest am Oberrhein zusammenzulaufen. Bei der Wahl zur Brezelkönigin ist ein mysteriöser Fremder unter den Zuschauern, der alles in einem anderen Licht erscheinen lässt. Mehr und mehr wird klar, dass der Fall weitaus verstrickter ist, als zunächst erwartet. Sind es ein oder mehrere Täter? Und welche Rolle spielt der Fremde im Hintergrund? Wird es dem ungleichen Ermittlerteam um Sartorius und Achill trotz aller Rückschläge gelingen, die tödliche Gefahr abzuwenden und den Erpresser zu fassen?
Uwe Ittensohn, 1965 in Landau geboren, ist bekennender Pfälzer und lebt seit der Kindheit in Speyer. Seit seinem Studium ist er in der Finanzbranche tätig und war daneben viele Jahre als Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule in Mannheim aktiv. In der Freizeit beschäftigt sich Ittensohn intensiv mit der Speyerer Stadtgeschichte. Er sanierte ein denkmalgeschütztes Stiftsgebäude und kümmert sich um den historischen Klostergarten, in dessen schattigen Winkeln er auch die Muße zum Schreiben findet. Mit seinem dritten Roman zeigt er, dass Krimis nicht trocken sein müssen. Auf spannend-humorvolle Weise geht er einem der flüssigen Schmankerl der Region – nämlich dem Festbier für das Speyerer Brezelfest – auf den Grund.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © janny2 / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6740-0
Figurenübersicht
Die Ermittler und ihr Anhang:
André Sartorius: privater Schnüffler und Stadtführer in Speyer
Irina Worobjowa: BWL-Studentin und Sartorius’ Mieterin
Johanna: Irinas Freundin
Frank Achill: Kriminalhauptkommissar bei der Mordkommission Ludwigshafen, daneben Andrés Freund
Verena Bertling: Kriminaloberkommissarin und rechte Hand Achills
Jonas: : Mitglied in Achills Team
Bernd Scherer: Kollege und Freund von Achill im Kriminaldauerdienst
van Liek: Kriminalrat beim LKA-Mainz
Benneisen: Mitarbeiter von van Liek
*
Die Vertreter der Stadtverwaltung Speyer:
Melanie Weiler: Oberbürgermeisterin von Speyer
Annika Raps: Erste hauptamtliche Bürgermeisterin von Speyer
Andreas Hecht: Fachbereichsleiter für innere Sicherheit bei der Stadt Speyer
Karl Gabarek: Mitarbeiter bei der Gewerbeaufsicht der Stadt Speyer
Olliczek: Mitarbeiter der IT-Abteilung bei der Stadt Speyer
Klaus Hirschtaler: Geschäftsführer der Brezelfest GmbH
*
Brauerei Eichbaum:
Thomas Wolf: Geschäftsführer der Brauerei Eichbaum
Ernst Berger: Leiter der Buchhaltung bei der Brauerei Eichbaum
Karin Berger: Ernst Bergers Ehefrau
Quirin Braxmeier: Praktikant (siehe auch unten)
*
German-Biotech:
Dr. Niam Li: Betriebsleiter bei der German Biotech GmbH
Dr. Bernhard Kreißler: Vorgesetzter von Li
*
Brauerei Hirschbräu in Neuploching:
Quirin Braxmeier: auch Quirl genannt. Enkel von Ferdinand Braunleitner und damit jüngster Spross der Brauerei-Dynastie Hirschbräu; aktuell als Praktikant bei der Brauerei Eichbaum in Mannheim tätig
Ferdinand Braunleitner: Seniorchef der Brauerei Hirschbräu
Jonny Braunleitner: Onkel von Quirin und aktueller Chef von Hirschbräu
Grit Vermeulen: Marketingleiterin von Hirschbräu
*
Sonstige:
Igor Komarow: russischer Universalkrimineller
Parkinsel
Freitag, 7. Juni 2019, 18.30 Uhr
»Karlhoinz, bass e’mol uff, dass der Klääne nedd so weit noi geht!«, plärrte die Alte neben ihnen nun zum zehnten Mal.
Irina rollte mit den Augen. »Ob wir auch mal so werden, wenn wir alt sind und ein Enkelkind haben?«
Johanna lachte. »Was heißt hier werden? So wie die aussieht, war die schon immer so.«
»Du meinst, Opa Karlheinz hat sich das bewusst angetan?«
»Darauf kannst du Gift nehmen, manche Männer brauchen das«, gab Johanna spöttisch grinsend zurück.
»Wow, dann hab ich ja auch noch Chancen, einen devoten Typen zu finden, der mir jeden Wunsch von den Lippen abliest.«
»Wenn du erst mal Brezelkönigin bist, werden die Männer sowieso bei dir Schlange stehen«, erwiderte Johanna mit funkelnden Augen.
Im Gegensatz zum sonnigen Lächeln ihrer Freundin legte sich ein dunkler Schatten auf Irinas Züge. »Ich hätte mich nicht von dir bequatschen lassen dürfen. Das passt alles gar nicht zu mir. Es war eine dämliche Idee, mich zur Wahl zu stellen. Ich werde mich morgen bis auf die Knochen blamieren. Die Speyerer können mit einer russischen Brezelkönigin bestimmt nichts anfangen. Und so, wie ich aussehe?« Dabei zupfte sie nervös an ihrem Bikini-Oberteil, als könnte sie damit ihre Oberweite vergrößern.
»Wirst du nicht! Das spricht doch für dich, dass du dich nach nur vier Jahren in Speyer schon so integriert hast. Die Presse wird das feiern. Und im Dirndl wirkst du richtig knackig. Und denk dran, ich hab das Jahr als Karnevalsprinzessin auch überstanden.«
»Aber du kommst von hier. Die alteingesessenen Speyerer werden mich dafür hassen, wenn ich mich in ihre Traditionen reindränge.«
»Jesses, Karlhoinz, wommer nedd iwweral soi Aache hot. Muss ich donn alles selwer mache?«, zeterte die Alte, stand stöhnend auf und zerrte den etwa acht Jahre alten Jungen zu sich auf das überdimensionale Badetuch.
»So, Fronschesgo, die Oma liest där jetzt was vor.«
Irina schüttelte den Kopf. »Ihr Pfälzer macht aber auch wirklich jeden Namen kaputt.«
»Ja, unser Fronschesgo hat ganz schön die Arschkarte gezogen«, flüsterte Johanna lachend.
»Wenn wir nächstes Mal hierher kommen, heißt es wohl ›Augen auf bei der Liegeplatzwahl‹«, sagte Irina genervt und legte sich, den Rücken der Alten zugewandt, auf ihr Badetuch.
Gut eine halbe Stunde lagen die beiden jungen Frauen schweigend nebeneinander und genossen die milde Frühsommersonne. Der Kiesstrand zog sich hier an der nördlichen Hälfte der Ludwigshafener Parkinsel wie ein schmales beigegraues Band über einige 100 Meter am Rheinufer entlang. Die langgestreckte Parkinsel verdiente zu Recht die Bezeichnung Insel, da sie an ihrer Ostseite vom Rhein und an der zum Stadtgebiet weisenden Westseite vom Becken des Luitpoldhafens umgeben und nur über zwei Brücken sowie einen Deich im Süden zu erreichen war. Aber nicht nur aus geografischen Gründen durfte sie sich als Insel rühmen. Im von alten Hafen- und Industrieanlagen, baufälligen Hochstraßen und Bausünden der Nachkriegsjahre durchzogenen, verkehrsüberfluteten Stadtgebiet Ludwigshafens wirkte sie mit ihren Alleen, schönen Architektenhäusern und dem weitläufigen Park wie ein vom Himmel gefallenes Juwel.
Das leise Gurgeln der sich am Kiesstrand brechenden Strömung des Flusses und der immer wieder zu ihr herüberwehende monotone Vorleseton der Alten ließen Irina müde werden. Dösend, mit halb geschlossenen Augen, starrte sie in die Wellen, die das abendliche Sonnenlicht golden widerspiegelten.
In Gedanken versunken betrachtete sie das vorbeiziehende Flusskreuzfahrtschiff, das behäbig mit blubberndem Schiffsdiesel gegen den Strom ankämpfte. Für ein paar Sekunden ließ die auf den Strand anlaufende Heckwelle das sanfte Plätschern zu einer leichten Brandung anschwellen. Fast wie am Meer, dachte Irina schlaftrunken und verfolgte, wie Obelix, Johannas Jack–Russell-Terrier, sich hektisch vor den anrollenden Wogen in Sicherheit brachte.
»Därf unsern Klääne mit eierm Hund schbiele, odder macht der was?«, durchschnitt die schrille Stimme der Alten die Idylle.
Irina schreckte hoch. Als ihr auffiel, dass Johanna neben ihr schlief, nickte sie der Frau stumm zu.
Sofort lief Francesco auf den kleinen zweifarbigen Hund zu, dem eine Laune der Natur die eine Gesichtshälfte weiß und die andere braun gefärbt hatte.
Aus dem Augenwinkel beobachtete Irina, wie Obelix, in Erwartung eines neuen Spielgefährten, aufgeregt auf und ab sprang. Er schnappte sich ein dünnes Stück Treibholz, das die Wellen gerade angespült hatten, und hielt es quer im Maul steckend dem Jungen entgegen.
Irina sah noch, wie sich Francesco zu Obelix herunterbeugte und nach dem Holzstück griff.
Plötzlich schrie der Junge gellend auf. Tränen liefen ihm übers völlig fassungslose Gesicht.
Karlheinz kam stöhnend auf die Beine. Von der abrupten Bewegung benommen, torkelte er ein paar Schritte. Dann stapfte er eilig über die unter den Sohlen nachgebenden Kieselsteine auf seinen Enkel zu. Den Kopf gesenkt, starrte er auf den Kies zu Francescos Füßen. Mit schmerzlich verzerrter Fratze brüllte er dann außer sich: »O Jesses Gott, der Keder hot dem Bu de Finger abgebisse!«
Essenszeit
Freitag, 7. Juni 2019, 19.30 Uhr
Das elegant minimalistisch eingerichtete Restaurant in Mannheims Norden war fast voll besetzt.
Der Einkäufer, wie er sich neuerdings nannte, war ein hünenhafter Mann mit grobem pockennarbigem Gesicht. Er war es gewohnt, dass Menschen in seiner Gegenwart ängstlich reagierten, und er genoss es.
»Was ist das?«, herrschte er mit unverkennbar osteuropäischem Akzent den zierlichen vietnamesischen Kellner an und deutete mit dem Zeigefinger, der so breit war wie bei anderen Männern die Daumen, auf die Schale, die dampfend auf der Warmhalteplatte stand. Einige Gäste horchten erschrocken auf.
»Bò nýớng – gegrillter Rinderspieß«, antwortete der asiatische Ober kleinlaut.
»Rinderspieß? Rinderspieß – so nennst du also die Fleischkrümel an diesem Mikadostäbchen. Du hast Glück, dass ich sie überhaupt unter diesem Unkraut da gefunden habe!« Dabei griff er mit angeekeltem Gesichtsausdruck mit bloßen Fingern in die kleine Schüssel vor sich. Er nahm einige der kunstvoll um die Rindfleischstücke gewickelten La-Lot-Blätter heraus und warf sie vor dem aufgelösten Mann aufs Tischtuch.
»Entweder du bringst mir jetzt einen anständigen gegrillten Rinderspieß, oder ich steck dir das hier in deinen kleinen Vietnamesenarsch!« Dabei fuchtelte er bedrohlich mit dem Holzspieß, auf dem noch einige in Blätter gewickelte Fleischstücke steckten, vor dem Gesicht des völlig fassungslosen Kellners herum.
Von hinten eilte die Eigentümerin ihrem Mitarbeiter zu Hilfe. »Kein Problem, wir werden Ihnen einen neuen Grillspieß bringen!«, sagte sie mit erstaunlich fester Stimme und gequältem Lächeln, nahm die Schale von der Wärmeplatte und marschierte mit energischen Schritten, ihren Kellner buchstäblich vor sich her treibend, zur Küchentür.
Beschämt senkten die anderen Gäste, die dem Schauspiel aufmerksam gefolgt waren, die Blicke.
*
Zu selben Zeit saß André Sartorius an seinem Lieblingstisch nahe beim Fenster im Mediterraneo, einem Café-Restaurant mit Feinkostverkauf in der Speyerer Innenstadt. In den letzten Jahren war das Mediterraneo zu so etwas wie seinem zweiten Esszimmer geworden. Gleich, ob er hier den Tag mit Cappuccino und Cornetto begann oder sich einfach zwischendurch einen eiligen Espresso gönnte, man gab ihm stets das Gefühl, willkommen zu sein. Ganz besonders liebte er es, sich eine schöne Portion Pasta zu gönnen.
Als er heute auf der Tageskarte »Linguine mit schwarzem Trüffel und Parmesan« entdeckt hatte, reservierte er kurzerhand für sich und Irina einen Tisch. Sie war nicht mehr nur seine Mieterin. Seit er sich vor fünf Jahren hatte breitschlagen lassen, einer Abiturientin aus Speyers Partnerstadt Kursk für ein sechswöchiges Auslandspraktikum eine Bleibe in seinem Haus zur Verfügung zu stellen, hatte sich einiges getan. Als sie ein Jahr später vor seiner Tür stand und ihn bat, ihm doch ein Zimmer zu vermieten, da sie kurzfristig ein Auslandsstipendium an der Uni Mannheim erhalten hatte, stimmte er widerwillig zu, dass sie bei ihm einzog. Für ihn, den Eremiten, war es schier undenkbar gewesen, sein Haus mit einem fremden Menschen zu teilen. Nun lebten sie schon vier Jahre unter einem Dach. Aus dem Mietverhältnis für ein Zimmer mit Bad war mittlerweile so etwas wie eine Wohngemeinschaft geworden. Und aus der Mieterin so etwas wie eine Adoptivtochter.
Inzwischen war es für beide ganz normal, zusammen Konzerte oder Lesungen zu besuchen, gemeinsam zu verreisen oder, wie heute, miteinander zu schlemmen.
Doch Irina, die heute Morgen noch so begeistert auf seine Einladung reagiert hatte, hatte ihn versetzt. Weder seine Textnachrichten noch seine Anrufe nahm sie entgegen. Nach einer halben Stunde hatte er es schließlich aufgegeben und sich damit abgefunden, heute alleine speisen zu müssen.
Gerade brachte ihm Camilla, die Miteigentümerin des Mediterraneo, einen Teller dampfende, in Butter geschwenkte und mit Parmesan bestreute Linguine und stellte ihn vor ihm ab. Mit einem rasiermesserscharfen Edelstahlhobel löste sie hauchdünne Späne des schwarzen Trüffels, den sie vorsichtig über die Klinge zog.
André wedelte mit der Hand den Duft des frisch gehobelten Trüffels, der sich verführerisch mit dem feinen Butteraroma vermischte, an seine Nase. Camilla, die ihn dabei beobachtete, schmunzelte nur stumm, als sie sein verzücktes Lächeln sah. So war er eben: ein Genießer durch und durch, der es liebte, wenn man für ihn einfache Gerichte aus feinsten Zutaten zauberte. Er nippte noch einmal an seinem Ca dei Frati, einem Rosé vom Südufer des Gardasees, dann bohrte er die Gabel mit einer Drehung in die Pasta.
Just als er sie zum Mund führte, meldete sich sein Smartphone. Verdammt! Für einen Augenblick spielte er mit dem Gedanken, das Gespräch wegzudrücken, doch dann siegte sein Verantwortungsgefühl. Was, wenn ihn Irina erreichen wollte, weil sie mit einer Autopanne am Straßenrand stand?
Am anderen Ende der Leitung meldete sich Kriminalhauptkommissar Frank Achill, mit dem ihn seit einigen Jahren eine enge Freundschaft verband.
»Ich hoffe, ich störe dich nicht, André.«
»Nein, natürlich nicht«, antwortete er mit einem sehnsüchtigen Blick auf die dampfende Trüffelpasta vor sich.
»Könntest du Irina bei mir im Präsidium in Ludwigshafen abholen? Ich will nicht, dass sie in ihrem Zustand noch Auto fährt.«
André spürte, wie ihm ein dumpfer Schlag durch die Eingeweide fuhr. »Zustand?«, stammelte er.
»Keine Sorge, ihr ist nichts passiert. Sie musste nur etwas mitansehen, was ihr auf den Magen geschlagen ist.«
Achill hatte noch nicht ausgesprochen, da stand André auch schon. Wie in Trance zog er zwei Banknoten aus dem Portemonnaie und ließ sie neben seinem Pastateller auf den Tisch segeln. Unter Camillas völlig verdutztem Blick verließ er grußlos das Restaurant.
Krisensitzung
Samstag, 8. Juni 2019, 8.30 Uhr
Das Sitzungszimmer der Brauerei Hirschbräu war ein lang gezogener düsterer Raum. Die mit dunklem Holz getäfelten Wände schluckten einen großen Teil des spärlichen Lichts, das sich neben der an der Schmalseite heruntergelassenen Leinwand hindurchschlängelte. Die zu einer langen Tafel zusammengeschobenen wuchtigen Holztische, deren tiefbraunes Nussbaumfurnier schon an vielen Stellen abgeplatzt war, verliehen dem Raum eine triste, angestaubte Atmosphäre. Um sie herum standen hochlehnige, mit beigebraunem, brüchigem Leder bezogene Stühle, die vom einstigen Wohlstand der Brauerei zeugten.
Auf dem vorderen rechten Stuhl im Dirndl saß Hildegard Braunleitner mit verkniffenem Gesicht. Sie war, wie die meisten im Besprechungszimmer, Mitinhaberin der HirschbräuOHG und zuständig für die Buchhaltung und das Personalwesen. Zu ihrer Linken saß in Cordhose und ärmelloser Strickweste Georg Gruber, Braumeister und Urgestein der Brauerei. Auch seine Miene spiegelte Ablehnung wider. Allein schon die Tatsache, dass er hier still sitzen musste, während im Nebenraum gerade der neue Sud angesetzt wurde, machte ihn unruhig. Ihnen gegenüber saß eine etwa 30-jährige Frau. Sie war strohblond, trug ein schwarzes Kostüm, hochhackige Schuhe und eine rote Designerbrille. Sie hieß Grit Vermeulen, war die neueste Akquisition des Geschäftsführers, hatte in Rotterdam in Marketing-Management promoviert und anschließend bei einem multinationalen niederländischen Bierkonzern im Social-Media-Management gearbeitet. Sie folgte gebannt den Ausführungen und starrte im Drei-Minuten-Takt auf das Display des vor ihr liegenden iPads.
Neben ihr, nicht weniger eloquent wirkend, saß Angelo Sassari, Vertriebsleiter und frischgebackener Chef des Einkaufs in hautengem Hemd und einem sportlich grob karierten Anzug, der zwei Nummern zu klein wirkte.
Mit drei leeren Stühlen dazwischen bewusst abseits saßen ein alter Mann im Trachtenanzug und ein 25-Jähriger in feschen Lederhosen und sportlichem Hemd.
Bei den beiden handelte es sich um den 82-jährigen Ferdinand Braunleitner, den seit acht Jahren zurückgetretenen Seniorchef des Familienbetriebs, und seinen unehelichen Enkel Quirin Braxmeier, Sohn seiner verstorbenen Tochter. Der alte Braunleitner wusste, dass er schon lange nicht mehr erwünscht war, dass man jeden Redebeitrag von ihm jäh abwürgte und er trotz seiner 24-prozentigen Beteiligung faktisch nichts mehr zu sagen hatte.
Ähnlich erging es Quirin. Man hatte ihm, dem Bankert, wie er von seiner Tante Hildegard häufig hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, nur gnadenhalber eine Brauerlehre ermöglicht und ihn danach übernommen. Ansonsten leugnete man im täglichen Umgang mit ihm hartnäckig jegliches verwandtschaftliche Verhältnis zum Hause Braunleitner. Und dies, obwohl es jeder hier im Raum und natürlich auch die meisten alteingesessenen Einwohner der 12.000 Seelen zählenden, in der oberbayerischen Region Pfaffenwinkel gelegenen, Gemeinde Neuploching wusste. Heute war er nur hier, weil sein Großvater, der Einzige in der Familie, der zu ihm hielt, darauf bestanden hatte.
Obwohl sie unterschiedlicher kaum sein konnten, hatten sie eines gemeinsam. Alle starrten wie gebannt auf die bunten Charts und Schaubilder, die ihnen Joachim, genannt Jonny, Geschäftsführer und einziger Sohn des alten Braunleitner – wie immer höchst eloquent – auf die Leinwand beamte.
»Also, ich fasse zusammen: Unser heimischer Absatz schmilzt dahin wie die Polkappen. Im letzten Jahr haben wir wieder 50.000 Hektoliter weniger in der Region verkauft. Im Exportgeschäft besteht das Risiko, dass wir aufgrund fehlender Abfüllkapazitäten für die in Russland üblichen 0,95-Liter-Dosen den Folgevertrag mit der russischen Inter Pivo LLC verlieren werden. Durch Preissteigerungen im Einkauf und Tariferhöhungen steigen unsere Kosten ungebremst weiter, und unsere Produktionsanlagen sind veraltet!«
Jonny Braunleitner, der das Ganze in einer Art und Weise präsentiert hatte, als sei es eine Erfolgsbotschaft, machte eine bedeutungsvolle Pause, grinste süffisant und schaute in die Runde.
Dem alten Braunleitner rollte eine einsame Träne über die faltige Wange. Quirin starrte bestürzt auf seinen Großvater, als könnte dieser mit einem Wink seiner dürren Hand diesen Albtraum vertreiben. Hildegard schwieg und presste ihre Lippen, die noch schmaler wirkten als sonst, schmerzvoll zusammen. Das Gesicht des alten Braumeisters Gruber war krebsrot. Fast schien es, als würden die dünnen roten Äderchen auf seiner großen Nase platzen.
Im krassen Gegensatz dazu stand das Auftreten der rotbebrillten Marketing-Doktorin Vermeulen und ihres Tischnachbarn Sassari, der sich mit hinter dem Kopf verschränkten Armen breitbeinig zurücklehnte und den muskulösen Oberkörper im hautengen Hemd blähte.
Ungeduldig schob Doktor Vermeulen das vor ihr liegende Skript hin und her. Offensichtlich konnte sie es kaum erwarten, ihre Sicht der Dinge zu präsentieren.
Nachdem Jonny Braunleitner die sich auf den Gesichtern der Familienmitglieder abzeichnende Bestürzung ausreichend ausgekostet hatte, fuhr er beschwingt fort.
»Frau Doktor Vermeulen wird Ihnen nun aufzeigen, mit welchen Konzepten wir den Turnaround unseres Hauses gemeinsam gestalten werden.«
Der alte Braumeister konnte seinen Ärger nun nicht länger zurückhalten. »Hättn’s uns ned zwunga, des kinesische Glump von am Hopfn in unsa guads Hirschbräu zum kippn, datn’s die Leit weida trinkn. Seit üba 100 Johr bsorgn mia unsan Hopfn in da Hallertau. Und der war scho ollawei guad.«
»Aber Herr Gruber, es dürfte auch Ihnen nicht entgangen sein, dass die von mir veranlasste Kostenbremse bitter nötig war. Wir müssen unsere Rohstoffe dort einkaufen, wo sie am günstigsten sind. Teure Traditionstümelei können wir uns nicht mehr erlauben. Ohne Herrn Sassaris Kontakte, die uns dies erst ermöglicht haben, wären wir längst pleite.«
Während Sassari generös grinste, grunzte Gruber nur ablehnend und winkte mit der klobigen Hand ab.
»So, Frau Doktor Vermeulen, darf ich Sie nun um Ihren Vortrag bitten«, säuselte Jonny Braunleitner.
Vermeulen stand dynamisch auf, zeigte lächelnd ihr makelloses Gebiss und stöckelte zur Leinwand.
»Think pink!«, sagte sie mit fester Stimme, klickte, und auf der Leinwand materialisierte sich Pixel um Pixel ein ganz in Pink gehaltener Präsentationschart mit eben diesen zwei Worten. Erwartungsvoll ließ sie den Blick über die Zuhörer schweifen. Während Jonny Braunleitner und sein Vertriebsleiter gönnerhaft lächelten, wirkte der Rest des Auditoriums verdutzt.
»Wir brauchen ein völlig neues Konzept für unseren Laden!«, fuhr sie fort und machte erneut eine Kunstpause.
»Die 2020er werden das Jahrzehnt der Frauen.« Pause.
»Mit unserer Linie Female Fun bringen wir das Bier für die moderne Frau auf den Markt.« Dabei dehnte sie das Wort »das« und zeigte wieder ihre weißen Zähne.
»Wir werden hier alles umgestalten, damit jeder sieht, für was wir stehen.« Dabei klickte sie, und es erschien eine animierte Außenansicht der Brauerei, die den Anstrich des Gebäudes in ein leuchtendes Pink übergehen ließ.
»Wir brauchen Visibility!«, sagte sie, als würde sie einen Schlachtruf ausstoßen. »Influencer, die uns mit den richtigen Social Clips viral gehen lassen. Wir leben in einer disruptiven Welt, in der wir nur durch Real-Time-Marketing unsere User auf eine herausragende Customer Journey mitnehmen. Wir müssen dabei agil und customer centered vorgehen. Wir verkaufen unser Produkt nicht mehr über die Theke, sondern für unser Female Fun gilt: mobile first und Convenience first. Das erste Bier, das man customized direkt übers Netz bezieht.«
Jonny Braunleitner war der Erste, der nach Vermeulens Vortrag zu klatschen begann. »Bravo, das ist es«, rief er verzückt lächelnd.
Sassari folgte dem Beispiel seines Chefs. »Das wird unseren Profit in ungeahnte Höhen schießen lassen«, sagte er dauernickend. Dabei gab er dem Klang des Wortes »Profit« eine amerikanische Note.
Hildegard, die mit einem Gesichtsausdruck, als würde man ihr gerade ohne Narkose ein Bein amputieren, dem Vortrag Vermeulens gefolgt war, schob ihre Papiere zusammen, stand auf und verließ wortlos den Raum.
Die Gesichtsfarbe des Braumeisters war mittlerweile in ein ungesundes Violettrot übergegangen. »Ihr kennt’s eich an andern Deppen suachn. I mach den Scheiß nimma lenga mit«, brummte er, stand auf und verließ ebenfalls benommen schwankend den Raum.
Der alte Braunleitner vergrub stumm das Gesicht in den faltigen Händen. Quirin wurde von Mitleid für seinen Großvater übermannt.
Showtime
Samstag, 8. Juni 2019, 10.55 Uhr
Und wieder hallte das Klatschen der rund 100 Handpaare von den kahlen Wänden des Foyers der Postgalerie, einer Einkaufspassage im Herzen von Speyer. Hier fand offiziell die vom Verkehrsverein und vom Dirndl- und Lederhosenkomitee organisierte Vorauswahl unter den fünf Bewerberinnen für das Amt der Brezelkönigin statt. Das Quintett war eingeladen, damit die Jury und die Speyerer prüfen konnten, ob sie auch wirklich die Voraussetzungen erfüllten. Jeder wusste, dass es eine reine Promotion-Veranstaltung war, die Interesse wecken sollte, am 13. Juli im Bierzelt auf dem Brezelfest bei der Endauswahl dabei zu sein.
Die bedirndelten jungen Frauen, die nebeneinander auf der Bühne standen, lächelten artig. Nur in Irinas Gesicht erstarb das Lächeln allzu schnell. Sie fühlte sich unwohl. Unsicher zupfte sie am Ausschnitt ihres Dirndls. Ihr Blick suchte Johanna, die sie begleitete. Warum nur hatte sie sich von ihr breitschlagen lassen, bei diesem Wettbewerb mitzumachen – sie, die Russin und damit eine völlige Außenseiterin.
Johanna schmunzelte und bedeutete Irina, mit an die Mundwinkel gelegten Zeigefingern, zu lächeln. In Irina keimte Zorn auf. Johanna war ein Profi. Vor einem Jahr war sie Karnevalsprinzessin gewesen und hatte Irina nach ein paar Aperol Sprizz überredet, sich für das hier zu bewerben.
Die hat gut reden, dachte Irina. Sie ist hübsch, hat eine gute Figur, und das Lächeln ist ihr geradezu ins Gesicht gewachsen. Dazu hat sie Charme.
Sie selbst hingegen war alles andere als ein Showgirl, sie war dünn, zierlich, ernst und eher zurückhaltend. Am liebsten würde sie von der Bühne schleichen und einfach abhauen.
Sie warf Johanna einen leidenden Blick zu. Die rollte mit den Augen. Sie konnte das Zaudern ihrer Freundin ganz und gar nicht nachvollziehen.
In diesem Augenblick löste sich eine kleine Gruppe um Johanna aus dem Publikum. Offensichtlich wollten sie ihre Einkäufe fortsetzen und nicht weiter zuschauen. An ihre Stelle schoben sich zwei bekannte Gestalten – André Sartorius und Frank Achill.
Irina erlebte ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits freute sie sich über den unerwarteten Beistand, hatte sie doch bewusst ihre Teilnahme vor den beiden verheimlicht. Andererseits war nun jede Flucht ausgeschlossen. Sie war viel zu stolz, um ihnen gegenüber ihre Schwäche einzugestehen. Sie hatte sich diese Suppe selbst eingebrockt und würde sie nun auch auslöffeln. Und das, obwohl sie sich sicher war, auf dem letzten Platz zu landen.
Der Moderator kündigte unter dem Beifall des Publikums an, dass die Kandidatinnen nun ihr Geschick im Brezelteigschlingen unter Beweis zu stellen hatten. Irina stöhnte innerlich auf.
*
»Immerhin warst du die Schnellste beim Teigschlingen«, sagte André und klopfte Irina anerkennend auf die Schulter.
»Wir Russen sind eben das Arbeiten noch gewohnt.« Sie lächelte befreit, man konnte ihr ansehen, wie erleichtert sie war, weitab vom Trubel der Postgalerie nun hier mit André und Frank im gemütlichen Berzelhof-Café zu sitzen. André hatte wie immer einen guten gastronomischen Riecher bewiesen, als er sie in diesen von historischen warmroten Sandsteinmauern umgebenen Innenhof geschleppt hatte. Jetzt, im Frühsommer, wo die Bienen ihre Saugrüssel in die engen Lippenblüten der Lavendelrispen zwängten oder sich auf den fast handtellergroßen roten Blüten des türkischen Mohns tummelten, gab es keinen romantischeren Ort in der Altstadt.
»Und wie ging die Sache mit dem Finger weiter?«, wechselte Irina das Thema und sah erwartungsvoll zu Frank.
Der räusperte sich. Er tat sich schwer, mit Dritten über laufende Ermittlungen zu sprechen.
»Na ja«, begann er stockend, »der Finger wurde, wie vermutet, ans Ufer getrieben. Die Kollegen der Rechtsmedizin haben herausgefunden, dass er wohl schon etwa 20 Stunden im Rhein gelegen haben muss, ehe ihn Johannas Hund dem Jungen vor die Füße gelegt hat.«
André rieb sich das Kinn. »Bei einer Fließgeschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde, die der Rhein in unserem Flussabschnitt hat, könnte das bedeuten, dass er rund 120 Kilometer rheinaufwärts in den Fluss geworfen wurde. Also so etwa bei Straßburg.«
Achill stieß Luft durch die Lippen. »Du kannst es aber auch nicht lassen, dir unseren Kopf zu zerbrechen. Als du letztes Jahr meintest, dich in die Polizeiarbeit einmischen zu müssen, hätte dich das beinahe das Leben gekostet.«
»Einmischen?«, hob André an, verstummte aber sofort wieder. Er wusste, wie es seinen Freund noch immer wurmte, dass es André gewesen war, der überhaupt erst auf die Mordserie aufmerksam geworden war. Achill hatte damals seiner Theorie zu spät Glauben geschenkt und dabei das Leben eines Opfers aufs Spiel gesetzt.
»Könnte es nicht sein, dass der Finger schon in oder kurz vor Ludwigshafen in den Rhein gefallen ist, am Ufer hängen blieb und erst durch ein vorbeifahrendes Schiff losgerissen wurde? Also auf die gleiche Weise, wie er an der Parkinsel angeschwemmt wurde?«, führte Irina Andrés Gedanken fort.
»Jetzt fängst du auch noch an zu spekulieren. Seid ihr beide denn noch zu retten?«, brummte Achill resigniert.
»20 Stunden? Das heißt, der Finger wurde am Donnerstag so gegen 23.00 Uhr in den Rhein geworfen. Es war also dunkel, eine passende Zeit, um Leichenteile zu entsorgen«, machte André weiter.
»Es handelt sich dabei nicht um ein Leichenteil, deshalb werde ich möglicherweise diesen Fall auch wieder los«, sagte Achill hart, als wolle er damit die Diskussion beenden.
»Wie, was? Wieso kein Leichenteil?«, fragte Irina unbeirrt weiter.
»Weil der Finger nicht post mortem abgetrennt wurde. Der Eigentümer hat noch gelebt, als er ihn verlor. Es kann also auch ein harmloser Unfall gewesen sein. Und ihr habt euch umsonst den Kopf zerbrochen.«
»Verlor?«, flötete Irina lachend. »Das hört sich irgendwie harmlos an. Der Eigentümer wird ja wohl kaum im Fundbüro anfragen.«
»Nein, wird er nicht, der Finger wurde wohl mit einer Zange oder schweren Schere abgeschnitten, und er gehörte zur rechten Hand eines Asiaten, hat die Rechtsmedizin herausgefunden. So, jetzt wisst ihr alles und könnt mich endlich in Ruhe lassen. Die Kollegen sind gerade dabei, sämtliche Krankenhäuser und Chirurgen zwischen Straßburg und Ludwigshafen abzutelefonieren. Sie werden bestimmt bald den armen Teufel finden, dem das zugestoßen ist, und ich bin aus der Sache raus. Keine Leiche, keine Arbeit für die Mordkommission. Basta!«
Arbeit
Montag, 17. Juni 2019, 6.40 Uhr
Irina fröstelte. Obwohl man für heute warmes Frühsommerwetter vorausgesagt hatte, war die Nacht frisch gewesen. Zudem verunsicherte sie das Neue, das ihr in den nächsten zwei Monaten bevorstand. Nach einer erholsamen Pfingstwoche, die sie zum Ausschlafen nach dem Prüfungsstress an der Uni genutzt hatte, sollte heute ihr Praktikum beginnen. Nach langem Abwägen hatte sie sich für eine Tätigkeit bei der Brauerei Eichbaum in Mannheim entschieden. Eigentlich war alles nach ihrem Geschmack. Ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 400 Beschäftigten, in dem es noch familiär zuging und das dennoch zukunftsorientiert arbeitete. In den letzten Jahren hatte man es geschafft, sich – an vielen großen Brauereien vorbei – erfolgreich die ausländischen Märkte zu erschließen. Der springende Punkt bei der Sache war, dass man im Moment ausgerechnet nach Russland expandierte und sich im Vorstellungsgespräch ganz entzückt über ihre muttersprachlichen Russischkenntnisse gezeigt hatte. Sie würde sich also nützlich machen können und nicht, wie sie es oft von anderen Praktikanten in ihrem Jahrgang hörte, in der Ecke sitzen und Imagebroschüren oder Arbeitsanweisungen lesen müssen. Dazu war sie viel zu umtriebig und praktisch veranlagt.
Nervös ging sie vor der breiten Einfahrt, die noch mit einem riesigen Schiebetor verschlossen war, auf und ab. Bei jeder Runde warf sie einen flüchtigen Blick auf das Pförtnerhäuschen, das, hätte es nicht die grüne Dachverblendung in der Unternehmensfarbe und mit dem Logo des stilisierten Eichbaums gehabt, auch gut an der russischen Grenze hätte stehen können. Die Dame darin schien nicht daran zu denken, das Tor zu öffnen. Kein Wunder, schließlich war Irina auch eine gute Viertelstunde vor dem vereinbarten Termin hier aufgeschlagen.
Aus dem Augenwinkel nahm sie einen jungen Mann wahr. Unschlüssig schlurfte er auf dem Gehweg der Käfertaler Straße entlang, verweilte an jedem der Eingänge und Tore des weitläufigen Werksgeländes und glich sie mit einem Papier ab, das er in Händen hielt.
Als er näher kam, musterte er Irina unsicher. »Kean Sie do dazua?«, fragte er mit kehliger Stimme.
Irina starrte ihn fragend an. Sie hatte rein gar nichts von dem Kauderwelsch verstanden.
»Exkjuse mi, du ju wörk hier?«, versuchte es der junge Mann erneut.
Wieder musste sie grinsen. Deutsch konnte er nicht und Englisch offensichtlich auch nicht. Aus welchem Kral war wohl dieser komische Vogel geflohen?
»Wot’s so funny? Wei du ju laf ät mi?«
»Sorry, I’m Irina from Russia.«
Der junge Mann schien nun völlig aus dem Konzept gebracht. »Sorry, ei dont schpiek Russian. Ei äm from Bavaria.«
Irina konnte sich nun nicht mehr zurückhalten und prustete los. »Dann red doch Deutsch, du komischer Vogel!« Dabei streckte sie ihm freundlich die Hand entgegen.
Der junge Mann errötete und reichte ihr nun seinerseits die Hand. »I hob ma hoid denkt, oiso … i bin da Quirl.«
»Quirl? Was ist das denn? Arbeitest du nebenberuflich als Mixer?«
»Na, so song meine Freind hoid zu mia.«
Irina schüttelte den Kopf. »Wo kommst du denn her? Wer nennt denn seinen Freund Mixer?«
»Quirl«, verbesserte er. »I bin aus Neiploching.«
»Neiwas? Leider ist mir diese Metropole noch nicht untergekommen.«
Er schaute nur betroffen. Irgendwie tat er Irina mit seinen großen braunen Augen, die sie nun anschauten, als gehörten sie einem treuen Hund, leid.
»Sorry. Ich war wohl …«, begann sie.
Er winkte ab. »Basst scho.«
»Und was wolltest du mich fragen?«
»I woit bloß wissn, wo’s do nei geht?«
»Nei geht’s hier, wenn die Dame da drin die Güte hat, uns zu öffnen.« Irina wies zum Pförtnerhäuschen.
»Du bist aba fei koa Brauerin.« Er musterte Irina abschätzig.
Sie lachte laut auf. »Wieso? Sieht man mir das an?«
»Na, äh, des hoaßt, äh …«, stammelte er mit geröteten Wangen.
Irina bedauerte sogleich, ihn derart gefoppt zu haben. So unbeholfen, wie er war. Er wirkte überfordert. Wahrscheinlich war er in seinem Leben noch nicht oft in eine fremde Stadt gekommen. Die Situation erinnerte sie daran, wie sie vor vier Jahren zum ersten Mal in Mannheim vor der Uni stand und niemanden hatte, der sie ein wenig eingeführt hätte.
»Mir hat jemand gestern am Telefon erklärt, dass ich mich hier an dieser Pforte melden muss. Der Praktikumsbetreuer wird mich hier abholen. Bei dir ist es bestimmt ähnlich. Und nein, ich bin keine Brauerin. Ich studiere hier an der Uni Betriebswirtschaftslehre und mache bei Eichbaum ein zweimonatiges Praktikum in internationalem Marketing.«
Die Züge des Jungen entspannten sich. Dankbar nickte er. »Und i wui heia im Heabscht mei Studium zum Diplom-Braumoasta an da TU in Minga, also München moan i, ofanga.«
Irina entging nicht der Stolz, mit dem er die Worte »Diplom-Braumeister« aussprach.
»I hob scho a Lehr zum Brauer und Mälzer g’macht und mecht ma des ez amoi oschaun, wia de do braun.«
Allmählich gewöhnte sich Irina an den merkwürdigen Dialekteinschlag und verstand schon weitgehend, was er sagte.
Da ertönte plötzlich ein Signal, und das mächtige Eisentor schob sich zur Seite. Der junge Mann hastete als Erster durch und eilte zum Pförtnerhäuschen. Irina lief ihm hinterher und musterte ihn. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass er eine Trachtenweste trug. Unwillkürlich musste sie an ihr Dirndl denken, das sie vorletzten Samstag, als sie für den Brezelköniginnen-Contest aufgetreten war, getragen hatte. Fesch war er, wie er da mit seinem kräftigen Körper und knackigen Hintern vor ihr herlief.
Felco
Samstag, 23. Juni 2019, 0.55 Uhr
Ernst Berger war ein schreckhafter Mann. Linkisch schaute er alle 50 Meter über die Schulter, ob ihm jemand folgte. Zu dieser Tageszeit wäre er nie auf die Idee gekommen, sich in diesem Stadtteil zu bewegen. Dabei war der Mannheimer Jungbusch nicht mehr das, was er noch vor zehn Jahren gewesen war. Ursprünglich waren die schönen alten Häuser hier im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts für reiche Reeder und Kapitäne erbaut worden. Nach dem Niedergang der Rheinschifffahrt in den 70er-Jahren waren sie zunehmend heruntergekommen. Amüsierlokale, Prostitution und Drogenhandel hatten sich hier breitgemacht – zum sozialen Brennpunkt war der Jungbusch geworden. Doch nun siedelte sich allmählich eine neue Bevölkerungsgruppe hier an. Die Studenten der Uni und der zahlreichen anderen hier beheimateten Hochschulen – wie der unweit von hier gelegenen Pop-Akademie – machten sich mit ihren Wohngemeinschaften in den oft großzügig geschnittenen Altbauwohnungen breit. Ihnen folgte ein bunter Mix aus Szenekneipen und kleinen Läden. Der Stadtteil war im Aufwind und wurde bei der jungen urbanen Gesellschaft immer beliebter. »Gentrifizierung« nannte man das neuerdings.
Dennoch gab es nachts noch genügend finstere Gestalten, die die Gegend für Berger, den ängstlichen Buchhalter bei der Brauerei Eichbaum, zur No-go-Area machten. Er hatte am Rand der Hafenstraße geparkt und marschierte schnellen Schrittes durch die um diese Tageszeit noch trister wirkende Böckstraße mit ihrem verfallenen Mühlengebäude gleich am Straßenanfang. Er hatte sich bewusst für diese ruhige Straße entschieden und nicht die belebtere Jungbuschstraße mit der legendären Onkel-Otto-Bar und den anderen um diese Zeit stark frequentierten Kneipen genommen. Er wollte nicht, dass man ihn hier sah.
Vor einem Haus türmten sich alte Matratzen und ein Sessel mit aufgeplatztem Polster. Wilder Müll aus den Wohnungen der vier- bis fünfstöckigen Gründerzeithäuser, einfach am Straßenrand entsorgt, war hier keine Seltenheit. Vor ihm huschte eine fette Ratte über die Straße und verschwand in einem offenen Kellerfenster. Er beschleunigte sein Tempo und bog um die Ecke in die Beilstraße. Hinter sich hörte er unregelmäßige Schritte. Ein Betrunkener, der über den Bürgersteig wankte und sich hin und wieder an einem Laternenmast festhalten musste.
Was tat er nur hier? Warum hatte er sich derart beunruhigen lassen? Seit wann ließ er sich erpressen? Wer war überhaupt dieser Typ mit dem russischen Akzent, der ihn heute Nachmittag angerufen hatte? Heute Morgen erst hatte er den Umschlag mit der Aufschrift »Herrn Ernst Berger – persönlich« aus der Hauspost gefischt. Zum Glück war er noch verschlossen gewesen. Nicht auszudenken, wenn das Foto darin auf dem Tisch eines Kollegen gelandet wäre. Es zeigte ihn nackt auf dieser Blondine, die sich Natascha genannt hatte und angeblich aus Moskau kam. Es war in jenem Speyerer Bordell aufgenommen worden, das er, bis zu dessen Schließung vor zwei Jahren, einige wenige Male besucht hatte. Sollte er das Foto doch schicken, wohin er wollte, er würde nicht zahlen, redete er sich trotzig ein.
Es fiel ihm schwer, sich im schwachen Licht der Straßenbeleuchtung zu orientieren. Haus um Haus näherte er sich der von diesem Typen am Telefon angegebenen Hausnummer. Warum nur machte er es so kompliziert? Wieso wollte er ihn persönlich sprechen? Warum konnte er ihm nicht telefonisch seine Forderung nennen? Um irgendwo ein paar 1.000 Euro zu deponieren oder, wie es im Erpressermilieu üblich war, ein paar Bitcoins zu transferieren, brauchte man wahrlich kein Treffen. Und Negative, die man ihm im Ausgleich übergeben würde, gab es im Digitalzeitalter sowieso nicht mehr.
»Da rein!«, unterbrach eine harsche Stimme mit osteuropäischem Akzent seine Überlegungen. Ein wuchtiger Schemen schälte sich aus der Dunkelheit eines offenen Eingangs. Er fühlte den Griff einer kräftigen Hand, die ihn in die Tür zog.
Das Treppenhaus war völlig finster. Nur durch ein kleines Fenster gelangte etwas vom fahlen Schein des Halbmonds ins Innere. Mit dessen Hilfe gelang es ihm wenigstens, die Umrisse des schmalen Flurs zu erkennen. Es roch nach modrigem altem Holz und frischem Zement. Jeder Schritt verursachte ein unangenehmes Scharren. Offensichtlich mahlte er Bauschutt, der den alten Fliesenboden bedeckte, unter den Füßen. Die feuchte Kälte der Nacht kroch ihm in die Knochen und nährte die Angst, die in ihm aufstieg. Wieso nur hatte er sich auf das hier eingelassen? Er war sich nun sicher, dass es eine riesige Dummheit gewesen war, alleine hierher zu kommen.
»Hier rein!«, herrschte ihn der Osteuropäer, der sich noch immer hinter ihm hielt, mit einer Stimme rau wie Schmirgelpapier an.
Er gehorchte. Was sollte er auch sonst tun, so schmächtig und wenig wehrhaft, wie er war.
Mit einem groben Stoß drückte ihn der Unbekannte durch eine der offenen Wohnungstüren. Die beiden Fenster des Zimmers, in das er mehr gestolpert als gelaufen war, waren größer und ließen das trübe Mondlicht in den Raum dringen. Weiterhin blieb der Fremde außerhalb seines Sichtfeldes. Er traute sich nicht, sich nach ihm umzudrehen.
Als hätte der Mann seine Gedanken gelesen, schrie er ihn nun an: »Wenn du dich umdrehst und mich ansiehst, bist du tot!«
Im gleichen Atemzug legte sich eine raue, kräftige Hand um seinen knochigen Nacken. Daumen und Mittelfinger umspannten den schlanken Hals zu drei Vierteln. Sein Kopf fühlte sich an, als wäre er zwischen den stählernen Backen eines mächtigen Schraubstocks eingespannt. Der Fremde musste gewaltige Hände haben. Berger wagte es nicht, sich zu bewegen, und blieb wie angewurzelt stehen. Dabei spürte er, wie seine Knie weich wurden. Für einen Augenblick fürchtete er, einfach kraftlos niederzusacken.
»Du hörst jetzt genau zu, was ich dir sage!«
»Kein Problem, ich zahle Ihnen, was Sie wollen. Ich mache Ihnen keine Schwierigkeiten«, stieß Berger mit brüchiger Stimme hervor.
»Maul halten! Ich rede. Du redest nur, wenn du gefragt wirst.«
»Jawohl!«, antwortete er servil, außer sich vor Angst.
Der Unbekannte drückte die Hand, die noch immer um seinen Hals lag, wie eine schwere Rohrzange zusammen.
Berger brachte nur ein Stöhnen heraus, das in ein heiseres Gurgeln überging.
»Du wirst das tun, was ich dir sage. Und zwar genau das. Sonst werde ich die Fotos deiner Frau schicken, du alter Hurenbock. Und danach werde ich mir deine Tochter vornehmen!« Er lachte diabolisch. »Sie hat genau das richtige Alter! Wenn ich mit ihr fertig bin, wird sie kein Mann mehr anfassen. Und wenn ich gehe, werde ich ihr noch erzählen, dass sie das alles ihrem geilen Vater zu verdanken hat.« Wieder lachte er dröhnend.
»Ich tue alles, was Sie sagen, aber …« Berger kam nicht dazu weiterzusprechen, wieder schloss sich die Hand fest um seinen Hals.
»Sei ganz entspannt, mein Freund«, säuselte der Fremde süßlich. »Ich will doch nur ein paar Dosen Bier bei dir kaufen.«
»Ja, ja, natürlich«, stammelte Berger.
»Die Bestellung über 20.000 Dosen für meine russische Firma wird in den nächsten Tagen bei dir eingehen.«
»Kein … kein Problem«, antwortete Berger, in dem gerade die Hoffnung wuchs, es könnte sich doch alles in Wohlgefallen auflösen.
»Und weißt du was, mein Buchhalterchen, ich werde dir sogar dabei helfen, sie zu befüllen.«
Berger nickte hektisch.
»Du wirst am …« Jetzt stockte der Fremde, nestelte in seiner Jacke herum, Papier knisterte, ein Feuerzeug flammte auf. Für den Bruchteil einer Sekunde sah Berger das Spiegelbild des Fremden, der ihn um mehr als einen Kopf überragte, in der Fensterscheibe vor ihm. Sein Haar war kurz, das Gesicht grob und pockennarbig. Zwischen seinen Lippen klebte eine selbstgedrehte Zigarette. Der Augenblick war lang genug, um seine Angst in rasende Panik zu verwandeln, aber zu kurz, um ihn je wiederzuerkennen.
»Du wirst in der Nacht vom 8. auf den 9. Juli um 2.00 Uhr bei deiner Brauerei eine Tankladung erhalten und den Inhalt in die Bierdosen füllen, die dann am Mittwoch, dem 16.7., abgeholt werden. Verstanden?!«
»Aber ich bin nur Buchhalter. Sie müssen mich verwechseln, ich habe mit der Abfüllung nichts zu tun. Ich …«, wimmerte Berger.
Wieder lachte der Fremde gallig. »Dann hast du es eben ab jetzt!«
»Aber ich …«, begann Berger, bevor ihm die kräftige Hand förmlich die Stimme abdrückte.
»Weißt du, was das ist?«, dröhnte der Fremde und hielt ihm eine grobe Schere mit roten Griffen vors Gesicht.
»Eine … eine Gartenschere«, stotterte Berger heiser.
Der Fremde lachte. »Nicht irgendeine Gartenschere, es ist eine Felco, Schweizer Wertarbeit, die Königin der Baumscheren, ich hab sie extra für dich ausgesucht.«
Berger konnte sich kaum noch auf den Füßen halten, das nackte Entsetzen schlug ihm wie ein Stock in die Kniekehlen.
»Mit dieser schönen Felco werde ich dich jetzt zum Abfüller umschulen, mein Freund.«
»Bitte, bitte …«, flehte Berger.
»Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie auch eine gute Gedächtnisstütze für Leute wie dich ist, die gerne vergessen, was man ihnen aufträgt!«
Berger brachte nur noch ein Glucksen heraus.
Der Hüne löste den Würgegriff um Bergers Nacken, nahm dessen knochige Hand und schob den kleinen Finger zwischen Klinge und Gegenklinge der Schere.
Berger versuchte, sich ihm zu entwinden, doch die muskulösen Arme seines Peinigers hatten sich wie riesige Tentakel um seinen zierlichen Körper gelegt.
»Nein!«, schrie er atemlos.
Ein Geräusch, als schnappe die scharfe Klinge durch ein dünnes Gehölz, wie es Berger kannte, wenn er den Zweig einer seiner historischen Rosenstöcke beschnitt, ertönte. Dann folgte ein stechender Schmerz an seiner linken Hand, der ihm für einen Augenblick die Besinnung raubte. Er krümmte sich, die Beine knickten endgültig unter ihm weg. Er glitt zu Boden.
Laut grölend hielt ihm der Fremde den abgetrennten Finger vors Gesicht und warf ihn dann kichernd auf einen Schutthaufen.
Berger wimmerte laut auf, seine Sinne vernebelten.
»Merk dir den 9. Juli um 2.00 Uhr. Wenn du die Bullen rufst oder sonst jemandem davon erzählst, werde ich diese Schere an den Fingerchen deiner Tochter ausprobieren. Verstanden?«
Berger brachte nur ein kraftloses Nicken zustande, zu sehr war er damit beschäftigt, mit einem Taschentuch das pulsierend aus der Wunde spritzende Blut zu stoppen.
Fortan nahm Berger alles um sich herum nur noch wie in Trance wahr. Die ausgerauchte Zigarette, die dicht an seinem Kopf vorbei auf den Bauschutt geschnippt wurde. Den unbarmherzigen Griff an seinem Kragen, der ihm die Luft abschnürte. Die Kaltblütigkeit, mit der ihn der Fremde über den mit Steinbrocken und Schutt übersäten Fußboden vor die Haustür schleifte und ihn wie einen Kartoffelsack einfach auf dem Bauch liegen ließ. Berger hörte, wie er die alte Holztür ächzend ins Schloss drückte. Zum Abschluss packte er ihn im Genick und schob sein Gesicht ruckartig so dicht an den Türgriff, als wollte er ihm daran die Nase zertrümmern.
»Schau her!«, herrschte er ihn an, steckte einen Dietrich ins Schloss und brach ihn ab.
»So, jetzt kannst du es dir sparen, nach deinem dürren Buchhalterfinger zu suchen. Bis du einen gefunden hast, der die Tür aufkriegt, haben ihn längst die Ratten gefressen. Und überleg erst gar nicht, ins Krankenhaus zu laufen. Man fragt dort zu viel. Und von deinen Antworten würde ich irgendwann hören, und dann wärst du tot. Ein Druckverband, und in zwei Tagen ist alles gut. Sei keine Memme, denk dran, ich habe ein Auge auf dich!«
In diesem Augenblick näherten sich Schritte. Ein einsamer Fußgänger kam auf sie zu. Eine unbestimmte Hoffnung keimte in Berger auf.
»Komm, Briederchen, der letzte Wodka war zu viel fier diiech«, lallte Bergers Peiniger leutselig. Er stützte ihn. Dabei legte er wieder seine Schraubzwingenhand um dessen Kehle und drückte sich Bergers Gesicht fest an die Brust, sodass ihn niemand erkennen konnte und er außerstande war, um Hilfe zu rufen.
Berger würgte. Die Schmerzen, dazu der scharfe Geruch nach Mentholtabak und das aufdringliche Rasierwasser forderten ihren Tribut.
Der Fußgänger, dem ein knurrender Pitbull an einer Leine folgte, schüttelte nur den Kopf.
Schweinsbraten
Montag, 25. Juni 2019, 12.35 Uhr
»Und des soi a Schweinsbron sei?«, sagte Quirin und stocherte lustlos in der zerfaserten Fleischscheibe vor sich.
»Wow, der Herr ist wohl ein Feinschmecker? Das kannst du dir in der Mensa abschminken. Was erwartest du für drei Euro?«
»An echt’n Schweinsbron hoid.«
»Sei lieber froh, dass ich dich mit meinem Studentenausweis hier reingeschmuggelt habe. Jeden Tag ein durchgeweichtes belegtes Brötchen vom Supermarkt ist auch keine gastronomische Sensation und kostet fast genauso viel.«
»Bei meina Muadda schmeckt’s jedenfois bessa«, beharrte Quirin.
»Muttersöhnchen!«, sagte Irina und lächelte ihn dabei an. »Wenn du mir heute Abend noch mal brav dieses ganze Zeug mit Stammwürze und ober- und untergärigen Biersorten erklärst, lade ich dich mal zu mir nach Speyer ein. Dann koche ich dir einen echten Borschtsch, so wie ihn mir meine Mutter beigebracht hat. Das gibt’s eh nie bei uns, weil mein Mitbewohner ein Veggie ist.«
Quirin horchte auf. »Mitbewohna?«
»Ja, ich wohne bei ihm im Haus.«
Er zögerte. »Du bischt? Also er is …?«, stammelte er unbeholfen.
»Er ist ein prima Kerl, und wir verstehen uns gut.« Irina kostete Quirins fragenden und enttäuscht wirkenden Gesichtsausdruck aus.
»Aber jetzt mal was ganz anderes«, wechselte sie das Thema. »Ist dir eigentlich bewusst, dass die eine Riesenmenge Bier nach Russland exportieren? Und nach China auch. Die haben sogar eine spezielle Abfüllanlage für diese komischen 0,95-Liter-Dosen.«
Quirin nickte nur. Sein Mienenspiel verriet ihr, dass sie einen wunden Punkt getroffen hatte.
»Was ist? Du guckst, als wär dein Goldfisch eingegangen.«
»Es is … Es is wega Dahoam. Wenn mia so a Abfüllanlag’n hätt’n, de des kannt, dann hätt’n mia bessare Chancen, unsa Bier im Ausland zum vermarkt’n. De hom do einfach ois. Neie Sudkessl, große Lagertanks, neie Abfüllanlag’n und a riesig’s Lager. Dahoam is ois oid und nimma wettbewerbsfähig.«
»Wie? Ihr habt eine Brauerei?«, fragte Irina überrascht.
»Ja, scho no, aba wenn des so weida geht … mei Onkel, da Jonny, macht se hie. Er versteht nix vom Bierbrau’n.«
»Und was treibst du hier, wenn ihr zu Hause eine eigene Brauerei habt?«
»Wega meim Großvater. Er wui, dass i mi umschaug, wias andere mach’n. Damit i dann füa unsa Brauerei wos leana ko.«
Irina konnte förmlich beobachten, wie in den letzten Minuten sämtliche Farbe aus dem vitalen rotbäckigen Gesicht des Jungen gewichen war. Sie glaubte sogar zu erkennen, dass seine Augen wässrig wurden.
»Und du meinst, du kannst eurer Brauerei helfen?«
»Na«, sagte Quirin und vergrub sein Gesicht in den Händen.
Irina legte behutsam einen Arm um seine Schultern.
*