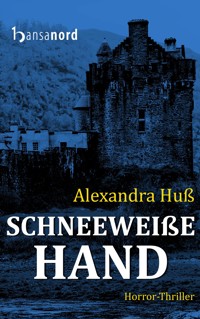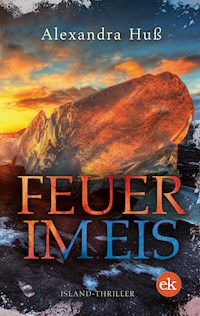
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Fjord der isländischen Stadt Seyðisfjörður macht Fischer Andri Finnarsson eine grauenvolle Entdeckung: Im Eiswasser treibt die Leiche eines gehäuteten Mannes. Die Polizei in Reykjavík setzt Gunnar Arnarsson auf den Fall an. Bald schon wird die kleine Stadt im Osten Islands auf eine harte Probe gestellt. Unter den rauen Bedingungen eines Jahrhundertsturmes, der die Bevölkerung von der Außenwelt abschneidet, müssen sie dem Bösen buchstäblich ins Gesicht blicken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra Huß
Feuer im Eis
Island-Thriller
Huß, Alexandra: Feuer im Eis. Island-Thriller. Hamburg, edition krimi 2021
Originalausgabe
ePub-eBook: ISBN 978-3-948972-34-9
Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
ISBN 978-3-948972-33-2
Lektorat: Bernhard Stäber
Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, Hamburg
Umschlagmotiv: © Jag_cz/stock.adobe.com; Struktur © pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die edition krimi ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© edition krimi, Hamburg 2021
Alle Rechte vorbehalten.
https://www.edition-krimi.de
Inhalt
„Teil 1“
„Seyðisfjörður, Mittwoch 7:05 Uhr“
„Abgeschnitten“
„Eine Woche früher“
„Abgeschnitten 2“
„Eine Woche zuvor“
„Eishaus“
„Teil 2“
„150 Reykjavík“
„Technisches Museum“
„150 Reykjavík“
„Eddi“
„Jondis“
„Der Plan“
„Andri“
„Teil 3“
„Gunnar“
„Matthildur und Björn“
„Hafrún“
„Andri“
„Berlin 2000“
„Katla“
„Das Dorf“
„Fakten“
„Die Totenhose“
„150 Reykjavík“
„Die Wahrheit und die Lüge“
„Berlin bis 2013“
„National University Hospital of Iceland“
„Neubeginn“
„Oliver“
„Déjà-vu“
„Eddi“
„Danksagung“
„Die Autorin“
Im Traume hört’ ich Odins Ruf
er lockte mich zur Reise
zum Wunderland, das er erschuf
mit Glut tief unterm Eise.
Ganz tief in mir fühl ich, ich werde
zu diesem Land einst fahren,
zu schau’n die Wunder dieser Erde
und sie im Herz zu wahren.
Wo eisbedeckte Gipfel ragen
und Lava rot zu Tale fließt,
möcht’ lauschen ich den alten Sagen
aus denen mancher Ase grüßt.
Die Sehnsucht hin zu diesem Land
der Gletscher und Geysire,
durch Odins Ruf in mir entstand.
Ich harr, dass er mich führe.
Unbekannter Autor
Teil 1
Seyðisfjörður, Mittwoch 7:05 Uhr
Sie sagten, der Winter würde kommen, und nun kam er und trieb alles Leben vor sich her. Hafrún legte ihren Kopf in den Nacken und blickte hinauf zur Hochebene Fjarðarheiði, die das Tal und den Fjord umgab. Sie steckte ihre kalten Hände tief in die Anoraktaschen und beobachtete die kleinen zahlreichen Wasserfälle, die der Fluss Fjarðará zu ihnen hinunterschickte. Bald schon würden sie zufrieren, aufhören zu plätschern und bis zur ersten wärmenden Sonne am Hang kleben bleiben.
Dahinter, gar nicht mehr ganz so weit entfernt, zogen tiefliegende Wolken wie Gespenster in das Dorf. Sie gehörten dazu wie alles, was ihnen diese Jahreszeit bescherte.
Der Winter in Island war dunkel und geprägt von stürmischem Wetter. Wenn man hier nicht aufgewachsen war, konnte er einem Angst machen.
Hafrún mochte die kühle Witterung, die trübe Luft durchdrungen vom Staub der Jahrhunderte. Uralte Weihnachtsgeschichten erwachten in ihrem Kopf zum Leben, der Dezember begann und hier und da sah man erste bunte Lichter hinter den Fensterscheiben.
Als kleines Kind hatte sie gerne den Erzählungen über die Naturgeister und die der Wintersonnenwende gelauscht, die ihr die Mutter zuweilen aus einem Buch vorgelesen hatte. Den Gedanken an sie verwarf Hafrún schnell wieder, denn das war in einer anderen Zeit, in einem anderen Leben.
Gedankenversunken richteten sich ihre Augen auf die Wasseroberfläche, deren zunehmende Strömung die Autofähre aus Dänemark ankündigte. Noch war die MS Norræna nicht in Sicht, doch in weniger als dreißig Minuten würde sich ihr majestätischer weißer Bug in den kleinen Hafen schieben. Sie konnte das Tuckern des Lotsenbootes hören, es vermischte sich mit dem Kreischen der Seevögel.
Hafrún setzte sich in Bewegung. Der Wind blies ihr eisige Luft in das gerötete Gesicht. Schnee knirschte unter ihren Füßen und die feinen Flocken, die beständig vom Himmel fielen, blieben an ihren Wimpern hängen. Hafrún blinzelte sie weg, mit einer raschen Geste zog sie ihre Kapuze tiefer über die Stirn.
Die Anlegestelle Strandabakki lag im Nebel und auch die schneebedeckten Berge waren nun in eine dicke, niedrige Wolkendecke gehüllt. Nicht mehr lange und das gesamte Dorf würde von ihr verschluckt sein. Die Grenze zwischen Himmel und Erde verwischte, wie ein Farbklecks auf einem Blatt Papier.
Hafrún reckte den Kopf. Sie hielt Ausschau nach Torger, der die Fähre mit den Touristen abfertigten sollte, doch er war nirgends zu sehen.
Bevor Hafrún weiter auf den Pier zuging, hörte sie ein Geräusch. Ein Plätschern, es klang so, als fiele etwas ins Wasser. Erschrocken blieb sie stehen und versuchte durch den Dunstschleier zu spähen.
»Torger? Hallo?«
Weiße Atemwölkchen entwichen ihrem Mund und ihre Augen tränten vom bitterkalten Wind, den der Nordatlantik in den Fjord blies. Sie trat an die Kaimauer und sah hinunter. Gischt spritzte Hafrún ins Gesicht, die Kapuze wirbelte ihr vom Kopf und die blonden Haare auf der Stirn gaben einen verblassten blauen Flecken preis.
Im Hafenbecken schwammen zwei Bojen und ein toter Seevogel, aber nichts, was dieses Geräusch verursacht haben könnte.
Zögerlich ging sie weiter, die grell blinkenden Lichter des Leuchtfeuers waren ein guter Fixpunkt für das Mädchen. Im Winter gab es wenig Tageslicht, die Sonne ging um zehn Uhr auf und um sechzehn Uhr wieder unter. Sie musste aufpassen, wohin sie trat. Es war rutschig und der Steg nicht besonders gut gesichert. Die Beleuchtung auf dem Gelände hatte kaum die Kraft, sich gegen die düstere Stimmung, die hier herrschte, durchzusetzen.
Es war seltsam ruhig am Fährhafen, ganz ungewöhnlich leise sogar. Die Geräusche der herannahenden Fähre und die Stimmen der Sturmvögel wurden vom zunehmenden Wind verschluckt. Doch das war nicht die Stille, die sie meinte.
Wenn Hafrún sonst hierherkam, lief jederzeit das Radio mit den neusten Nachrichten und Torger kommentierte schlecht gelaunt die Politik der Hauptstadt.
»Torger. Wo bist du denn?«
Sie schob die Tür zur Abfertigungshalle auf und lauschte erneut. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Instinktiv blieb sie ihm Türrahmen stehen. Die Deckenbeleuchtung war aus, es roch nicht nach Torgers herbem Rasierwasser, das Radio gab keinen Ton von sich und auf dem Bürostuhl saß weder ihr Freund noch sonst irgendein Mitarbeiter der Hafenbehörde.
Die Uhr an der blau gestrichenen Wand zeigte sieben Uhr und fünfzehn Minuten. Die Fähre würde in einer Viertelstunde anlegen. Hafrúns Herz schlug plötzlich schneller.
Wo steckte der hagere, etwas raue Mann, den das Mädchen in ihr Herz geschlossen hatte?
Sie dachte nach und fragte sich, ob er eine Erkältung hatte.
Er musste krank sein, anders war es gar nicht möglich. Hafrún drehte sich um, sie schloss die Tür und rannte los. Ihre Gedanken überschlugen sich, denn noch nie, nicht ein einziges Mal hatte Torger ihre wöchentliche Verabredung verpasst. Einmal in der Woche kam die MS Norræna in den Fjord und an diesem Tag, dem Mittwoch, schlich sie zum Fährhafen, um ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen.
Sie folgte dem schneebedeckten Weg zur Hafnargata, in der das gelbe Haus von Torger Olafsson stand. Hafrún bog am Post-Hostel ab, denn direkt dahinter befand sich ihr Ziel.
Sie hielt an und schnappte nach Luft. Von weitem sah es nicht so aus, als ob er zu Hause war. Hinter den Fenstern brannte kein Licht und das Auto stand nicht auf dem Parkplatz.
Den verbeulten, grünen Isuzu D-Max mit den großen Allradreifen und der rostigen Seilwinde mochte sie sehr, in dem hatte sie auf dem Hafengelände fahren gelernt.
Komm schon. Nur Mut, hatte Torger eines morgens zu ihr gesagt und sie hatte sich gefragt, wie es wohl war, in so einem riesengroßen Wagen hinter dem Steuer zu sitzen?
Zuerst drehten sie eine kleine Runde, dann fuhren sie die Strecke bis zur Schotterstraße und zurück.
Zuversichtlich ging sie auf das Haus zu und stieg die Stufen zur Tür hinauf. Auf der verschmutzten Fußmatte lagen winzige schwarze Steinchen vom Streusalz. Es war komisch, hier zu sein, mit dem Daumen auf der Klingel. Bislang war nur der Hafen ihr Treffpunkt gewesen. Jetzt stand sie vor seiner Haustür und wartete darauf, dass er öffnete.
Sie war aufgeregt und hibbelig. Wie würde er reagieren? Hafrún wollte sich um ihn kümmern, denn da gab es ja sonst niemanden. Sie klingelte noch einmal, und als ihre Füße sich wie Eisklumpen anfühlten, gab sie auf. Hafrún zog die Stirn kraus, legte beide Hände an die Fensterscheibe zur Wohnstube und schaute ins Innere. Nichts zu sehen. Torger war nicht da. Sie drehte sich um.
Ihre Fußspuren im Schnee waren die einzigen.
Enttäuscht und wütend lief Hafrún nach Hause. Sie schimpfte vor sich hin und mied die Blicke der Menschen, die ihr entgegenkamen.
Unterwegs musste sie an die dummen Touristen denken, die jedes Jahr aufs Neue die Insel verseuchten. Sie taten so, als wären sie die Helden von Island, und am Ende gerieten sie in lebensbedrohliche Situationen.
Auf Eisberge und Eisschollen in der Gletscherlagune zu klettern, war bei Wassertemperaturen von 0°C wirklich keine gute Idee: Die Eisberge konnten rasch kippen und alles unter sich begraben. Und die beliebte Lagune floss ins offene Meer, da war es schnell zu Ende mit denen, die sich hineinwagten. Hafrún lächelte. Auch sollte man auf keinen Fall auf glitschigen Klippen in Meeresnähe stehen – die Wellen würden einen erbarmungslos mitreißen. Sie hob wie zur Entschuldigung die Arme. Was fehlte noch? Ah.
Der schwarze Sandstrand bei Reynisfjara war ebenso fesselnd wie tödlich, denn wenn man sich zu nahe an die Brandung begab, war es aus. Mehrere Touristen hatten dort bereits ihr Leben gelassen.
Hafrún trottete weiter durch den Schnee, doch ihre Stimmung wurde und wurde nicht besser. Sie verscheuchte ein paar Vögel, die zu ihren Füßen nach Würmern pickten und überlegte, was sie nun den lieben langen Tag anstellen sollte.
Abgeschnitten
Der Blizzard fegte gnadenlos über Ostisland hinweg. Die Wetterprognose für die nächsten Tage war miserabel und gab keine Hoffnung auf eine baldige Besserung der Lage. Die Temperaturen lagen bei minus acht Grad, die Flüge, national und international, wurden eingestellt. Die Menschen mussten mit Stromausfall und bis zu einem Meter Neuschnee rechnen.
Für den Nordatlantik rund um Island galt eine Orkanwarnung des isländischen Seewetterdienstes. Die Bewohner und die Gäste waren von der Außenwelt abgeschnitten.
In der Kaffi Lará El Grillo Bar in der Norðurgata Nummer 3 saß Gunnar Arnarsson vor dem Wetterbericht und schüttelte sein leicht angegrautes Haupt. Er nahm das Glas mit dem Brennivín zwischen Daumen und Zeigefinger, setzte es an die Lippen und trank den Schnaps aus. Während er mehrmals aufstieß und hustete, schlug Gunnar sich mit der Faust vor die Brust. Sein Schnurrbart zuckte.
»Du wolltest doch aufhören mit dem Fusel«, rief ihm Katla vom Tresen aus zu.
»Das sind die Zigaretten und der Fusel«, entgegnete er grantig und stand auf. Gunnar schaltete den Fernseher aus, er hatte genug gesehen.
»Verfluchte Insel«, zischte er und zog seine fleckige Jacke über. Er ignorierte die Beschwerden der Jugendlichen, die das Abschalten des Flachbildschirms mit einem Buhruf quittierten. Strom würde es nicht mehr lange geben, das war so gut wie sicher, dann mussten sich die Bewohner mit Kerzen, Batterien, Gas und den Generatoren behelfen. Ohne sich zu verabschieden, stampfte er zur Tür und trat hinaus auf den bunten, vom Schnee befreiten Steinweg, der zur Kirche führte. Gunnar schnalzte mit der Zunge, den Geschmack vom Brennivín hatte er noch am Gaumen.
Er stieß noch einmal auf, dann bog er links ab und machte sich auf den Heimweg.
Keine Landschaft war auf so eigentümliche Weise still wie Island. Das begriff jeder, der nur einen Fuß auf die Insel setzte. Es war keine beschauliche Stille, sondern eine merkwürdig gärende Ruhe, die über den Lavafeldern, den Vulkankegeln und den Gletschern lag, eine Lautlosigkeit, die vibrierte und rauschte. Gunnar Arnarsson zupfte das Päckchen mit den Zigaretten aus der Jackentasche und versuchte, sich eine anzuzünden. Nach mehreren Fehlversuchen gab er auf.
»Verfluchter Wind, verfluchter«, schimpfte er und stopfte die Zigarette unverrichteter Dinge wieder in die Schachtel zurück.
Er ließ seinen Blick über die schneebedeckten Hänge wandern.
Wie schwarze Tintenkleckse hatten sich Raben dort oben im Schnee niedergelassen und dicke, wollige Schafe fraßen sich an Moos und Flechten ihre Leiber voll.
Ein geheimes Beben drang ihm durch Mark und Bein. Es war die Stimme der Insel, ein Zittern, welches unablässig daran erinnerte, dass die dünne Haut der Erde jeden Augenblick aufplatzen könnte, um sie alle zu verschlingen.
Er wollte es nicht noch einmal erleben, der Ausbruch des Eyjafjallajökull steckte ihm noch nach Jahren in den Knochen. Die gigantische Aschewolke, die der Wind aus dem Krater über das europäische Festland schob, hatte ein beispielloses Chaos ausgelöst. Am helllichten Tag war es pechschwarz wie mitten im Winter geworden. Bäche veränderten durch die Asche des Gletschers ihren Lauf, manche verschwanden ganz, andere wiederum bildeten sich neu.
Gunnar schob die Erinnerung zur Seite. Mit großen Schritten lief er gen Osten, bis sich in der Ferne sein Holzhaus abzeichnete. Es lag direkt am Wasser, zu Fuße des Bjólfur.
Schnell und schleichend wie Gift begann die Dunkelheit. Alle Dinge verblassten in ihr und nahmen gespenstische Formen an. Vor dem Hintergrund der schwarzen Bergwand verlor sich der Raum ganz und gar. Blieb man zu lange stehen, zweifelte man an seiner Existenz. Gunnar hatte dieses Gefühl mehr als einmal erlebt und das reichte ihm. Sein Magen knurrte und er war froh, gleich im Haus zu sein. Ein Abendessen aus Brot und Fisch wartete auf ihn, er würde etwas fernsehen und dann ins Bett gehen.
Am nächsten Morgen rebellierte sein Telefon, es klingelte schon seit einer halben Stunde. Er lag mit geöffnetem Mund auf dem Rücken und döste leicht. Langsam schlug er die Augen auf. Der alte Wecker, der auf seinem Nachtschrank stand, gab ihm zu verstehen, dass sich da wohl jemand verwählt haben musste. Um sechs Uhr zweiundzwanzig wagte niemand, ihn anzurufen. Gunnar drehte sich behäbig auf die Seite und versuchte nochmal einzuschlafen.
Draußen herrschte tiefste Finsternis, es schneite stark und die Temperaturen waren weiter gesunken. Er nahm sich vor, im Haus zu bleiben. Es waren noch eine über Schafsdung geräucherte Forelle und ein paar Scheiben Brot von gestern da. Der Kühlschrank war voll, es gab daher keinen Grund, bei dem Sauwetter vor die Tür zu gehen.
Das Haustelefon schwieg endlich, dafür piepte jetzt sein Handy im Minutentakt. Gunnar Arnarsson gab es auf, er schob die Beine aus dem Bett und stand auf. Der schwere Morgenmantel gehörte in die Wäsche, er fühlte sich kühl und kratzig an. Er schlüpfte in die Pantoffeln und ging in die Küche. Die schräge Falte über der Nase verlieh ihm einen grüblerischen Anstrich. Doch wenn Gunnar so aussah, hatte er schlechte Laune und die Furche war tief, er trug sie schon sein halbes Leben mit sich rum.
Das Mobiltelefon lag auf dem Tisch. Er schnippte die Gräte, die auf dem Display klebte, weg und nahm den Anruf entgegen.
»Arnarsson«, sagte er und drückte dann auf die Taste für den Lautsprecher. Er legte das Handy zur Seite und machte sich an der Kaffeemaschine zu schaffen.
Am anderen Ende rauschte und knisterte es unangenehm.
Die Verbindung war sehr schlecht, kein Wunder bei dem Sturm. Gunnar gab drei Löffel Kaffeepulver in den Filter und füllte Wasser ein. Das Handy knackte, dann erklang der Besetztton, er schaltete es aus.
Erneut klingelte sein Haustelefon. Er verzog den Mund, schnappte sich den Hörer und sprach seinen Namen hinein. Eine aufgeregte Stimme schlug ihm entgegen.
»Hier spricht der Justizminister. Björn Bjarnasson mein Name.«
Gunnars Mund klappte auf. Justizminister?
»Gunnar Arnarsson«, sagte der Mann gereizt, »ich bin der oberste Dienstvorgesetzte der isländischen Lögreglan. Die Polizeiwache auf Seydisfjördur ist aufgrund des Orkans nicht besetzt. Die abgestellten Männer sitzen in Reykjavík fest.«
Gunnar zog die Stirn kraus.
»Ja und?«, fragte er pampig. »Was hat das mit …?«
»Ja, ich weiß. Sie sind lange außer Dienst, aber wir brauchen jeden Mann. Ziehen Sie die alte Uniform über und beziehen Sie Posten. Unten am Fjord gibt es eine Leiche und die bedarf sofortiger Sicherstellung durch einen Fachmann. Sie werden dort einen Fischer finden, er erwartet Sie. Dieser Mann hat den Leichnam entdeckt und mich mit seinem Funkgerät benachrichtigt. Gehen Sie behutsam mit ihm um, er steht unter Schock. Ich verlasse mich auf Sie, Arnarsson. Ich erspare einem Spezialisten wie Ihnen das übliche Prozedere, hiermit haben Sie alle Rechte der Polizei von Island. Tun Sie, was Sie tun müssen.« Dann legte er auf.
Leiche? Gunnar stand wie angewurzelt da. Das musste er erst einmal verdauen. Drehen die dort im Ministerium durch?
Er hielt es immer noch für einen schlechten Scherz, bis sein Mobiltelefon erneut piepte. Vier SMS hintereinander.
Dass die aus Reykjavík seine Nummer hatten, wunderte ihn nicht. Es gab Zeiten, die er besser vergaß, anstatt darüber nachzudenken. Aber was sollte dann dieser Anruf?
Er schnappte sich das Handy und begann die Nachrichten zu lesen.
In der ersten bekam er den Zugangscode für die Polizeiwache und den Hinweis, wo die Autoschlüssel lagen. Er konnte zwischen einem Volvo S 80 und einem Toyota Landcruiser J 12 als Dienstwagen wählen.
In der zweiten Mail teilte man ihm mit, wo er die ausgediente Uniform samt seiner Ausweismarke finden würde. Und jetzt wurde es spannend. Die beiden anderen SMS enthielten den Ablageort der Glock 17 und des Pfeffersprays samt Gummiknüppel. Perplex legte er das Handy auf den Tisch.
Er goss sich einen Kaffee ein und zog den Stuhl hervor. Langsam ließ er sich darauf nieder, in seinem Kopf herrschte Chaos. Eine Leiche im Fjord, hoffentlich niemand, den er kannte. Er klopfte einen Takt auf die Tischplatte. Es war eine längst vergessene Geigenmelodie, ein Folksong, den er damals so oft gespielt hatte.
Gunnar versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Warum ich? Lag es am Namen?
Blitzschnell packte er das Handy und tippte mit dem Zeigefinger seinen Vornamen, den Nachnamen und Island ein. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Es gab neun Arnarsson auf Island, davon zwei mit dem Rufnamen Gunnar. Bei dem einem handelte es sich um einen ehemaligen Polizisten, der, wie es hier stand, vor gut zwei Jahren in Seydisfjördur gestorben war.
Und ihn.
»Na das ist ja mal eine Beförderung ersten Grades«, sagte er und zum allerersten Mal seit langer Zeit lachte er. So konnte eine offensichtliche Verwechslung zweier Personen und die Hilfe des Blizzards zum Fest werden. In Reykjavík musste das absolute Durcheinander herrschen, wenn man einen längst Verstorbenen zurück auf seinen Posten beorderte. Er holte den Brennivín aus dem Kühlschrank und gönnte sich ein halbes Gläschen. Das flüssige Gold rann seine trockene Kehle hinunter und brannte ihm in den Eingeweiden. Er schüttelte sich und war froh über sein konsequentes Schweigen hier im Ort. Niemand wusste was über sein Leben, und falls etwas durchgesickert sein sollte, wagte es keine einzige Person, ihn darauf anzusprechen. Sie mieden ihn, gingen ihm einfach aus dem Weg.
Bis auf Katla, die Besitzerin der Grillo Bar, die schenkte ihm ab und an ein Lächeln, das er auf keinen Fall erwidern wollte. Die Dorfbewohner hielten ihn für einen Gestrandeten, einen Mann, der unbequem und launisch war. Einer, der nichts zu Ende brachte und im Haus seiner Eltern vor sich hin soff. Zwei unerträgliche Geheimnisse, die er hütete, waren nie an die Öffentlichkeit gelangt. Sonst wäre ein Leben hier im Dorf unmöglich geworden.
Die jungen Leute zogen in die Städte, die Alten starben. Es war ein Kommen und Gehen. Die Zugezogenen hielten sich zurück und die, die hier weiter lebten, blieben unter sich. Viele waren es nicht mehr.
Er sah auf die Uhr, dann ging er in die Schlafstube und zog sich an.
Er steckte das Handy und die Kippen ein, nebenbei entriegelte er die Tür und verschwand, dem Strahl der Taschenlampe folgend, im dichten Schneetreiben.
Den Spaß, als Polizist aufzutreten, ließ er sich nicht entgehen, ein wenig Abwechslung hatte schließlich noch niemandem geschadet.
Gunnar erreichte endlich die Polizeistation. Der Sturm hatte es mühsam gemacht, die Strecke zu bewältigen, doch nun stand er im Dienstzimmer und begutachtete die Uniform und das Equipment. Er nahm das Ledermäppchen mit der Dienstmarke in die Hand und schlug es auf. Sein Daumen glitt über die blanke Plakette mit der Aufschrift Police Officer.
In dem vierzig Quadratmeter großen Raum roch es nach getragenen Lederstiefeln und in die Wände gezogenem Tabakrauch, die Gardine vor dem Fenster war nikotingelb.
Alles wirkte zweckmäßig und verstaubt.
Gunnar zog die Dienstuniform über und stattete sich mit der vorgegebenen Ausrüstung aus, anschließend prüfte er, wie die Leute im Film es taten, die Glock 17.
»Gesichert«, sagte er und zielte spielerisch auf eine eingerahmte Urkunde an der Wand.
Mittlerweile war es halb acht und bis zum Sonnenaufgang dauerte es noch knapp drei Stunden. Aber Gunnar wollte nicht warten, bis das Tageslicht ihm den Weg wies, er machte sich sofort auf zum Fjord, wo nicht nur eine Leiche auf ihn wartete, sondern auch der erste Fall für Police Officer Gunnar Arnarsson.
Wenn die im Ministerium wüssten, wen sie da zum Bullen befördert haben, die würden hintenüberkippen.
Seine Lippen zuckten kaum merklich, er begann, etwas zu flüstern: »Ich bin an graubedeckten Tagen versunken unter tausend Fragen und fand mich neben dir allein.« Gunnar wischte sich über die Augen. Er packte seine Sachen zusammen und schloss die Tür zur Dienststube.
Draußen überlegte er, ob er mit dem Auto fahren sollte, entschied sich aber aufgrund des konsumierten Alkohols und der Dunkelheit dagegen.
Der Nordwind peitschte mit Böen bis zu einhundertzwanzig Stundenkilometer durch die Straßen, die Schneeverwehungen nahmen Gunnar die Sicht. Der Lichtkegel der Taschenlampe brachte nicht den gewünschten Erfolg, er brach sich mit den umherwehenden Flocken im Wind.
Gunnar fluchte, er zog sich die Mütze der Uniform über die rotgefrorenen Ohren, seine Nase tropfte. Gern hätte er sich ein Schnäpschen gegönnt, einen eiskalten Tropfen, der ihn innerlich zum Glühen gebracht hätte. Er stapfte weiter und versuchte gegen den Wind anzukämpfen. Nach fünfhundert Metern konnte er schwach den dunklen Rücken des Berges ausmachen. Davor lag der Fjord, und nach Angaben des Justizministers würde er da die gefundene, angespülte Leiche finden.
Der Schein eines Feuers oder einer Fackel zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Das Licht schien aus dem Berg zu kommen.
Er lief schnurstracks darauf zu und erkannte schon bald den dunklen Schemen eines Menschen, der vor einem Lagerfeuer hockte. Gunnar konzentrierte sich auf die Rolle, die er spielen musste.
Er räusperte sich und trat mit zwei großen Schritten unter den Felsvorsprung, den der Mann sich zum Schutz vor dem Unwetter gesucht hatte.
»Police Officer Arnarsson«, sagte er angeberisch und zog die Dienstmarke aus der Tasche.
Der Fischer hob erschrocken den Kopf und stand auf. Seine Augen wirkten geistesabwesend, die Gesichtshaut war bleich und schwitzig. Er taumelte, als er Gunnar die Hand reichte.
»Andri. Also ich heiße Andri«, stammelte er. Der Griff war im Vergleich zu seiner Verfassung fest und zeugte von einer Kraft, die er ihm beim ersten Anblick wirklich nicht zugetraut hätte. Gunnar versuchte erst gar nicht, sich hinzuhocken, um seine Füße dem Feuer entgegenzustrecken. Er wäre nicht wieder hochgekommen.
»Wo ist die Leiche?«, fragte er stattdessen und sah sich um. An der Wand lehnte eine Schaufel, daneben lag ein Sack aus Leinen.
Da er nicht sofort Antwort bekam, wiederholte er die Frage. Andri rieb sich die Hände und stotterte los.
»Ich wollte … also ich hatte vor … Torf. Ich wollte Torfstechen und dann … sie trieb mit dem Gesicht nach unten im eiskalten Wasser.«
Beide schwiegen für eine Weile. Gunnar sah sich den Fischer genauer an. Andri war noch nicht alt. Er hatte glattrasierte Haut, finstere Augen und schmale, farblose Lippen. Unter seiner Mütze lugten rote, fast orangene Haare hervor. Er war dünn und knochig, aber trotz dessen attraktiv. Er hätte zu den femininen Models gehören können, die für Saint- Laurent auf dem Laufsteg posierten.
»Ich bin nicht von hier. Ich wohne drüben in Berufjörður. Dem Fischerdorf. Der Blizzard hat mir die Tour vermiest. Ich wollte Torfstechen. Ich brenne Whisky und …« Er brach ab und schlug mit der flachen Hand gegen die Felsplatte.
Die Männer wechselten einen kurzen, abschätzenden Blick.
»Gehen wir«, sagte Gunnar, er drehte sich um und verließ mit dem Fischer im Gefolge den Felsvorsprung.
Durch das wärmende Feuer fühlte sich der Wind jetzt noch brutaler und unbarmherziger an. Wie klitzekleine Rasierklingen schabte er über die Hautstellen, die nicht durch dicken Stoff geschützt wurden. Statt auf den Fjord zuzugehen, bog Andri links ab. Gunnar war zuerst irritiert, doch dann sah er, wo der junge Fischer hinlief. Das Schneemobil parkte etwas abseits der Schotterpiste, der einzigen Straße über den Pass, die noch nicht gesperrt war.
Er startete die Zündung und ließ Gunnar aufsteigen.
Langsam fuhren sie über den holprigen, schneebedeckten Weg hinunter zum Wasser.
Der Seyðisfjorð war noch nicht komplett zugefroren, das konnte sich allerdings von Tag zu Tag ändern.
Es war unmöglich, vorauszusagen, wann die Stürme zuschlugen und welche Winde der Atlantik zu ihnen schickte. Dieser Wind spielte mit den Einwohnern ein böses Spiel, das nur er gewann, mit dem tückischen Nordmeer und dem Islandtief als ständige Begleiter. Ein Leben ohne Windstille kannte hier niemand. Inmitten des Sturmrauschens knisterte es plötzlich. Andris Hand legte sich auf die Brusttasche seiner Lammfelljacke. Er hielt an, zog den Reißverschluss hinunter und holte ein Funkgerät heraus.
»Hier Andri. Frequenz 121 Island«, sprach er mit fragender Mine. Er blickte Gunnar an und zuckte mit der Schulter.
»Ist er da? Hat er den Toten in das Eishaus gebracht?«, brüllte ihm eine schlechtgelaunte Stimme entgegen. Der Justizminister. Der Empfang war miserabel.
»Er scheint es nicht für nötig zu halten, an sein Handy zu gehen.«
Ein Rauschen, Geknister, dann war die Verbindung weg. Sich keiner Schuld bewusst spuckte Gunnar in den Schnee. Er machte eine wegwerfende Geste und gab Andri damit zu verstehen, das Gerät wegzupacken.
Der Fischer reagierte sofort und stopfte das Walkie-Talkie zurück in die Jacke.
Gunnar Arnarsson hatte nicht vor, einen Blick auf das Mobiltelefon zu werfen. Es war ihm im Augenblick relativ egal, was der Typ aus dem Ministerium zu sagen hatte.
»Wo liegt der Tote?« Er wollte nun endlich wissen, um wen es sich handelte.
Andris Finger deutete auf eine Stelle, wo es das Eis noch nicht bis ans Ufer geschafft hatte, ein großes Loch mit mindestens zwei Metern Durchmesser. »Da ist es.«
Gunnar konzentrierte sich und ging los. Der Wind hatte nachgelassen und für einen Augenblick fiel der Schnee nur mäßig. Die Basaltberge trugen wieder ihren Schleier, wie eine immerzu tanzende Braut.
Abrupt hielt er an und sah sich nach dem Fischerburschen um. »Soll ich helfen?«, fragte Andri sogleich.
»Es geht schon«, log Gunnar. Wasser war nicht sein Ding, würde es nie werden. Und Fische gingen gar nicht.
Wenn ihm da unten gleich ein glitschiges Vieh zu nahe kam, war die Blamage vorprogrammiert. Sobald ihn ein Glubschauge ins Visier nahm, war es vorbei mit seiner Coolness.
Er nahm sich zusammen und setzte zögerlich einen Fuß vor den anderen.
Der glatte, rutschige Untergrund machte Gunnar zu schaffen, doch er schaffte es, ohne auszurutschen, bis hinunter zum Fundort der Leiche.
Eine Woche früher
Jondis Jónsdóttir war eine betagte Frau. Sie besaß nicht viel, aber das, was sie hatte, genügte ihr vollkommen.
Seit sieben Jahren lebte sie alleine in dem hellgrauen Haus in der Nähe des alten Krankenhauses. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie sie dort als Pflegeschwester ihr Geld verdient hatte. In dem imposanten Gebäude befand sich jetzt eine Jugendherberge, rot angestrichen, mit grünen Fensterrahmen und einer weißen Balustrade. Es nannte sich heute Old Hospital.
Die zahlreichen Besucher in den Sommermonaten belebten ihr sonst recht einsames Dasein in der Suðurgata.
Sie saß am Fenster, in der Hand hatte sie eine Zeitschrift, in der sie gerne blätterte. Jondis warf einen Blick hinaus. Der wolkenverhangene, verschneite Berg gab ächzende Geräusche von sich, bei denen sie an das Schnaufen ihres verstorbenen Mannes denken musste. Sie lächelte sanft.
Später, wenn der Wind nachließ, wollte sie ihn auf dem Friedhof besuchen gehen.
Jondis versuchte aufzustehen, beim zweiten Versuch klappte es. Sie nahm ihren Gehstock, der neben dem Sessel lehnte und stakste damit in die Küche.
Sie knipste das Radio an und suchte ihren Lieblingssender. Solange noch Strom da war, nutzte sie es aus.
Wer bei der kleinen robusten Dame zu Gast gewesen wäre, hätte zuerst den Geruch in dem Häuschen wahrgenommen. Es roch nach Kaminholz und Anistee, der in einer Kanne auf dem Herd stand, nach Möbelpolitur, die sie erst gestern auf die Tischplatte aufgetragen hatte und nach dem Parfüm, das ihr ihre Freundin aus Reykjavík schickte, Lavendel mit einem Hauch von Zitrone.
Der Dezember gehörte zu den kältesten und dunkelsten Monaten auf Island. Für die alte Frau keine leichte Zeit, denn der Rücken schmerzte ihr bei diesem Klima besonders. Für gewöhnlich verbrachte sie die Wochen um Weihnachten in Reykjavík, bei Drifa, ihrer alten Freundin. Doch der angekündigte Blizzard machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Man konnte nie ahnen, wann genau er zuschlug, und das war ihr zu riskant.
Sie goss sich Tee ein und entnahm einer Blechdose zwei Kekse. Jondis stellte alles auf ein Servierbrett. Sie klemmte sich den abgeblätterten Gehstock aus weißem Holz unter den Arm und schnappte sich das Tablett mit ihrem Nachmittagssnack. Dann ging sie konzentriert, aber etwas unsicher auf den Beinen, zurück in die Wohnstube.
Und da war es wieder, dieses Geräusch. Es klang wie ein Kratzen oder Rascheln an der Haustür. Jondis blieb erschrocken stehen und lauschte, der Tee in dem Glas schwappte über. Mit zittrigen Händen stellte sie das Gedeck auf den kleinen Beistelltisch und ging auf die Tür zu. Sie öffnete sie einen Spalt und linste hinaus auf den von leichten Schneeflocken umwehten Fjord. Es war niemand zu sehen, nicht heute, nicht gestern und auch nicht in den Tagen zuvor. Genaugenommen gab es dieses unheimliche Schaben schon seit einer Weile. Immer zur gleichen Zeit, genau dann, wenn sie den umliegenden Schnee weggefegt hatte und ihren Nachmittagstee einnahm.
Jondis konnte es sich nur damit erklären, dass ihre Ohren Dinge hörten, die es nicht gab. Kopfschüttelnd verriegelte sie die Tür und schlurfte zurück in die vom Kaminofen beheizte Stube. Sie trank ihren Tee und nickte ein. Als sie nach einer halben Stunde die Augen aufschlug, war sie ganz durcheinander. Was wollte sie nochmal erledigen?
Ach ja, der Friedhof und ein Besuch bei Katla in der Bar. Sie schaute rasch aus dem Fenster, noch war es relativ hell, doch weiter hinten im Dorf gingen schon die Straßenlaternen an. Nicht mehr lange, ein paar Tage noch, dann würde die Weihnachtsbeleuchtung hinzukommen. Das ermöglichte der alten Frau einen ausgiebigeren Spaziergang durch den Ort, der sonst aufgrund der Lichtverhältnisse recht kurz ausfiel.
Jondis strich die Falten ihrer warmen Jersey Hose glatt und überprüfte den Sitz ihrer aufgesteckten, schlohweißen Haare. Der selbstgestrickte, ausgeblichene Lammfellpullover hatte am Ärmelbund ein Loch, das würde sie beizeiten stopfen. Anfangs hatte sein schönes Rundmuster ein kräftiges Blau besessen. Nun konnte man den Pullover bestenfalls hellblau nennen, er war ausgewaschen und kratzig. Für einen neuen hatte Jondis kein Geld, doch das machte ihr nichts aus, sie trug ihn gerne.
Im Eingangsbereich standen gefütterte Stiefel, in die sie schlüpfte. Mit dem Steppmantel, einer Skimütze und ihrem Gehstock verließ sie das Haus.
Sie bewegte sich umsichtig und setzte immer einen sicheren Schritt vor den anderen. Der Schneefall ließ nach, der Wind blies weiter kräftig aus Nordosten.
Auf der Hochebene Fjarðarheiði versammelten sich die Rentiere, und wenn es still im Dorf war, konnte Jondis sie hören. Geweihe, die beim Kampf um das Weibchen aneinanderschlugen und die klackernden Schritte der Hufe, die weit gespreizt nicht im Schnee einsinken konnten.
Dieses Geräusch war ihr so vertraut, es hatte etwas Warmes und Beruhigendes. Sie war sich sicher, man konnte es bis hinaus auf den Eisfjord hören.
In Ostisland gab es etwa dreitausend Rentiere. Im Winter kamen sie manchmal bis hinunter in die Täler der Ostfjorde, dann, wenn ihr Lebensraum im Hochland selbst für sie zu unwirtlich und nahrungsarm wurde.
Ihr Fell zeigte verschiedene Varianten von graubraun, silbern und weiß. Die Tiere waren die einzigen Hirsche, bei denen sowohl Bullen als auch Kühe ein Geweih trugen. Im Frühjahr dieses Jahres hatte Jondis das deutlich kleinere Geweih eines Weibchens gefunden und mitgenommen. Es sollte ein Geschenk für ihre Freundin Drifa werden.
Schon seit Kindertagen streifte Jondis hier umher, stets den gleichen Weg nehmend, früher fidel und lebenslustig, heute gebeugt und vom Alter und seinen Gegebenheiten gezeichnet.
Jondis überlegte, ob sie zuerst ihren Mann besuchen oder eine kleine Tasse Kakao bei Katla trinken sollte. Für einen Großen fehlte ihr das Geld. Sie entschied sich für den Friedhof am Ortsausgang.
Das Dorf wirkte verlassen, nur hinter den Fenstern brannte gelegentlich ein Licht. Es begegnete ihr weder ein Mensch, noch kam ihr ein Auto entgegen. Es war einfach zu kalt und ungemütlich.
Bis auf die bunten Häuserwände am Straßenrand war der Rest des Dorfes vom Schnee bedeckt.
Bei jedem ihrer Schritte knirschte es, der Wind heulte wie ein getretener Hund durch die Straßen.
Jondis erreichte den Friedhof, der von zwei Meter hohen Mauern und Sträuchern umgeben war. Sie öffnete das schmiedeeiserne Tor und ging auf das Grab ihres Mannes zu.
Das Feld lag still und friedlich da. Ringsumher kämpften die Flammen der Grablichter gegen die Kraft des Windes an.
Jondis Herz schlug etwas schneller, als sie unter der vom Wind gekrümmten Birke stehen blieb. Ihre Äste strichen durch die zunehmende Dunkelheit, es rauschte und raschelte.
Es gab keinen Grabstein, bloß ein schlichtes, weißes Holzkreuz ohne Aufschrift.
Sie lehnte den Gehstock gegen den Baum und faltete die Hände zum Gebet. Ihr feines Stimmchen sprach mal mit Porgeir, dann mit Gott.
Sie murmelte ein Memento, ihr Flüstern wurde mit jeder Silbe lauter, verzweifelter. An ihren Händen traten die Fingerknöchel deutlich hervor, sie bewegte den Oberkörper vor und zurück, immer wieder vor und zurück. Erst als eine Rotdrossel auf einem Ast der Birke landete, öffnete sie die Augen. Ein Ruck ging durch ihren hageren Körper, Jondis warf einen Blick zum dunklen Himmel, ein Augenaufschlag, in dem alles möglich war, weil er verging.
Betrübt schnappte sie sich den Stock. Einen Moment lang stand sie einfach da, ratlos. Ihre kalten Knochen riefen sie zur Vernunft, sie drehte sich um und ging fort.
Jondis Jónsdóttir versuchte, wie damals als Kind in die gleichen Fußstapfen wie auf dem Hinweg zu treten.
Am schmiedeeisernen Tor blieb sie noch einmal stehen und sah zurück. Sie kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich auf den Platz mit den amerikanischen Grabsteinen. Stand dort jemand? Da bewegte sich doch was.
Jondis hatte extra auf andere Fußspuren im Schnee geachtet. Es gab keine.
»So langsam wirst du verrückt, Jondis«, sagte sie und setzte ihren Weg fort. Sie freute sich wie ein kleines Mädchen auf den heißen Kakao und einen Plausch mit Katla, die ihr ans Herz gewachsen war.
In der Kaffi Lará El Grillo Bar in der Norðurgata Nummer 3 war es warm und gemütlich. Jondis trat durchgefroren ein und erkannte gleich ein paar bekannte Gesichter. Sie winkte Katla zu, zog den Mantel aus und brachte ihn zur Garderobe.
Anschließend setzte sich auf ihren Stammplatz unter den großen Spiegel und atmete durch.
Die Mütze und den Stock hatte sie auf den leeren Stuhl neben sich gelegt. Nun sah sie sich um und ließ die Stimmung auf sich wirken. Stimmengewirr vermischte sich mit dem Klirren der Gläser an der Bar. Am Nebentisch klapperten zwei Teenager mit dem Besteck, sie aßen je einen Burger und eine Ofenkartoffel. Jondis lief das Wasser im Mund zusammen, ihr Magen begann zu knurren. Die meisten Tische waren besetzt. Schöne, dunkle Holztische mit zwei oder mehreren Stühlen darum und je einer Kerze darauf, die unstet flackerte.
Am Klavier saß niemand, was sie schade fand, denn sie mochte Livemusik jeglicher Art.
Aus dem Augenwinkel nahm sie Katla wahr, die mit einem Block in der Hand auf ihren Tisch zukam. Sie lächelten sich an.
»Góðan daginn, Jondis. Wie geht es dir heute?«, fragte Katla und hockte sich neben sie.
Ihre dunklen Augen schimmerten im Licht der Kerze. Sie trug eine Jeans und einen rosa Pulli, die hellen Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden.
»Góðan daginn, Katla. Ich war bei Porgeir. Danach fühle ich mich immer so niedergeschlagen.«
Die junge Frau legte ihre Hand auf die von Jondis und drückte sie sanft. Sie beugte sich zu ihr.
»Gegen Trübsal und Traurigkeit gibt es keine Medizin, aber Schokokuchen mit Sahne und warmen Kakao«, flüsterte sie verschwörerisch. Dann stand sie auf und machte sich hinter der Theke an die Arbeit.
Jondis Jónsdóttir blieb das Herz stehen. Wie sollte sie das bezahlen? Nervös rutschte sie auf dem Stuhl hin und her. Eine unangenehme Situation, die sie zutiefst verabscheute. Sie bekam kalte Finger und heiße Ohren, verlegen schaute sie zu Boden.
Als Katla nach wenigen Minuten zurück an den Tisch kam, ahnte sie, was die alte Dame gerade durchmachte. Sie kannte die finanzielle Situation, die der Verlust ihres Ehemannes mit sich gebracht hatte.
»Ich lade dich heute ein«, sagte sie fröhlich und stellte den duftenden Kakao und den Teller mit dem Kuchen vor ihr auf den Tisch.