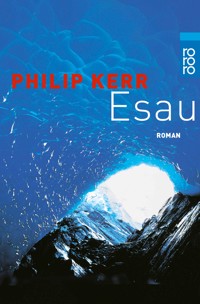9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther ermittelt
- Sprache: Deutsch
In seiner Berlin-Trilogie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther schafft es Philip Kerr, in der Form des spannenden Kriminalromans die schmutzig-düstere Atmosphäre der Nazi- und Post-Nazi-Zeit in Berlin zu beschwören. Geschickt verwebt er die historischen Ereignisse und ihre Protagonisten mit seinen Kriminalgeschichten – eine atemberaubende Mischung. «Finster, komplex und schonungslos witzig – eine perfekte Verbindung von bedrohlichem geschichtlichem Hintergrund und einfallsreicher Handlung mit einem deutschen Philip Marlowe.» (Kirkus Review) «Kerr ist die europäische Krimi-Entdeckung der letzten Jahre.» (Radio Bremen)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Philip Kerr
Feuer in Berlin
Die Berlin-Trilogie
Roman
Über dieses Buch
In seiner Berlin-Trilogie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther schafft es Philip Kerr, in der Form des spannenden Kriminalromans die schmutzig-düstere Atmosphäre der Nazi- und Post-Nazi-Zeit in Berlin zu beschwören. Geschickt verwebt er die historischen Ereignisse und ihre Protagonisten mit seinen Kriminalgeschichten – eine atemberaubende Mischung.
«Finster, komplex und schonungslos witzig – eine perfekte Verbindung von bedrohlichem geschichtlichem Hintergrund und einfallsreicher Handlung mit einem deutschen Philip Marlowe.» (Kirkus Review)
«Kerr ist die europäische Krimi-Entdeckung der letzten Jahre.» (Radio Bremen)
Vita
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon-Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 verstarb.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2013
Copyright © 1995 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«March Violets» Copyright © 1989, 1990 by thynKER ltd
Covergestaltung Notburga Stelzer
Coverabbildung Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin
ISBN 978-3-644-47621-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Mutter
Berlin 1936
Erster Mann: Ist dir aufgefallen, wie die Märzgefallenen es geschafft haben, alte Parteigenossen wie dich und mich hinter sich zu lassen?
Zweiter Mann: Du hast recht. Hätte Hitler auch noch ein bißchen gewartet, ehe er zu den Nationalsozialisten ging, wäre er vielleicht schneller Führer geworden.
Das Schwarze Korps, November 1935
1
Merkwürdige Dinge ereignen sich in den dunklen Träumen des Großen Verführers …
Heute morgen sah ich an der Ecke Friedrichstraße und Jägerstraße zwei SA-Männer, die einen roten Schaukasten des Stürmers von der Mauer eines Gebäudes abschraubten. Der optische Eindruck dieser Schaukästen mit ihren halb-pornographischen Strichzeichnungen von arischen Mädchen in den lüsternen Umarmungen langnasiger Monster zielt darauf, den schwachköpfigen Leser anzuziehen und ihm einen flüchtigen Kitzel zu verschaffen. Anständige Leute wollen damit nichts zu tun haben. Die beiden SA-Männer luden die Kästen jedenfalls auf die Ladefläche ihres Lastwagens, wo bereits viele andere lagen. Sie machten ihre Arbeit nicht gerade sorgfältig, da bei ein paar Kästen die Glasscheiben ohnehin schon zerbrochen waren.
Eine Stunde später sah ich dieselben Männer vor dem Rathaus wieder, wo sie einen Kasten von einer Straßenbahnhaltestelle entfernten. Diesmal ging ich zu ihnen und fragte sie, was sie da trieben.
«Es ist wegen der Olympiade», sagte einer von ihnen. «Wir haben Befehl, sie alle wegzuräumen, damit die ausländischen Besucher, die nach Berlin kommen, um sich die Wettkämpfe anzusehen, keinen Schock kriegen.»
Meines Wissens ist eine solche Rücksichtnahme seitens der Behörden einmalig.
Ich fuhr mit meinem Wagen nach Hause – es ist ein alter schwarzer Hanomag – und zog meinen letzten guten Anzug an: Er ist aus hellgrauem Flanell und hat mich, als ich ihn vor drei Jahren kaufte, hundertzwanzig Mark gekostet. Der Stoff ist von einer Qualität, die in diesem Land immer seltener zu finden ist: wie Butter, Kaffee und Seife. Die heutigen Wollstoffe sind meistens Ersatz. Gewiß, sie sind einigermaßen brauchbar, nur nicht sehr strapazierfähig und ziemlich unwirksam, wenn es darum geht, im Winter die Kälte abzuhalten. Oder im Sommer die Hitze.
Ich überprüfte mein Aussehen im Schlafzimmerspiegel, und dann griff ich nach meinem besten Hut. Es ist ein breitkrempiger dunkelgrauer Filzhut mit einem schwarzen Baratheaband. Nichts Besonderes. Aber wie die Männer von der Gestapo trage ich meinen Hut anders als üblich, nämlich tief in die Stirn gezogen. Dadurch werden natürlich meine Augen verdeckt, und das erschwert es den Leuten, mich zu erkennen. Es ist eine Marotte, die bei der Kripo aufgekommen ist und die ich mir dort zu eigen gemacht habe.
Ich steckte ein Päckchen Muratti in meine Jackentasche, klemmte mir vorsichtig ein in Geschenkpapier verpacktes Stück Rosenthal-Porzellan unter den Arm und machte mich auf den Weg.
Die Hochzeit fand in der Luther-Kirche am Dennewitzplatz statt, genau südlich vom Potsdamer Bahnhof und einen Steinwurf von der Wohnung der Brauteltern entfernt. Der Vater, Herr Lehmann, war Lokführer am Lehrter Bahnhof und fuhr viermal in der Woche den D-Zug nach Hamburg hin und zurück. Die Braut, Dagmar, war meine Sekretärin, und ich hatte keinen Schimmer, was ich ohne sie anfangen würde. Es war auch nicht so, daß mir ihre Heirat nichts ausmachte: Ich hatte oft selbst daran gedacht, Dagmar zu heiraten. Sie war hübsch und wußte mich richtig zu nehmen, und ich schätze, daß ich sie auf meine komische Art liebte; aber mit achtunddreißig war ich vermutlich zu alt für sie und vielleicht eine Spur zu schwerfällig. Ich habe keine große Neigung zur Ausgelassenheit, und Dagmar war die Art von Frau, die ein bißchen Spaß verdiente.
Da stand sie also nun und heiratete ihren Flieger. Und auf den ersten Blick besaß er alles, was eine junge Frau sich nur wünschen konnte: Er war jung, stattlich, und in der graublauen Uniform des nationalsozialistischen Fliegerkorps wirkte er wie der Inbegriff des strahlend jungen, arischen Mannes. Doch als ich ihm beim Hochzeitsempfang begegnete, war ich enttäuscht. Wie die meisten Parteimitglieder hatte Johannes Buerckel das Aussehen und Gehabe eines Mannes, der sich überaus wichtig nahm.
Dagmar machte uns miteinander bekannt. Johannes schlug, wie bei seinem Typ nicht anders zu erwarten, mit lautem Krachen die Hacken zusammen und bedachte mich mit einem kurzen Kopfnicken, ehe er mir die Hand schüttelte.
«Glückwunsch», sagte ich zu ihm. «Sie sind ein echter Glückspilz. Ich habe Dagmar gebeten, mich zu heiraten. Ich glaube nur nicht, daß ich in Uniform so gut aussehe wie Sie.»
Ich sah mir seine Uniform genauer an: Auf der linken Brusttasche trug er das silberne SA-Sportabzeichen und das Pilotenabzeichen; über diesen beiden Schmuckstücken prangte das allgegenwärtige Parteiabzeichen; und an seinem linken Arm trug er die Hakenkreuzbinde. «Dagmar hat mir erzählt, Sie wären ein Lufthansa-Pilot und vorübergehend dem Luftfahrtministerium zugeteilt, aber ich hatte keine Ahnung … Sagten Sie nicht, Dagmar, er wäre ein …»
«Sportflieger.»
«Ja, richtig. Ein Sportflieger. Nun, ich wußte gar nicht, daß ihr Burschen Uniform tragt.»
Natürlich brauchte man kein Detektiv zu sein, um darauf zu kommen, daß «Sportflieger» eine dieser phantasievollen Umschreibungen der Nazis war und sich auf die geheime Ausbildung von Kampffliegern bezog.
«Er sieht prächtig aus, nicht wahr?» sagte Dagmar.
«Und du siehst wunderschön aus, mein Schatz», flötete der Bräutigam pflichtbewußt.
»Entschuldigen Sie meine Frage, Johannes, aber ist die deutsche Luftwaffe inzwischen offiziell anerkannt?»
«Fliegerkorps», sagte Buerckel. «Es ist ein Fliegerkorps.» Aber das war seine ganze Antwort. «Und Sie, Herr Gunther – Privatdetektiv, wie? Das muß interessant sein.»
«Ich führe private Ermittlungen durch», verbesserte ich ihn. «Manchmal ist es spannend.»
«Welcher Art sind Ihre Ermittlungen?»
«Ich mache fast alles, ausgenommen Scheidungsfälle. Die Leute verhalten sich merkwürdig, wenn sie von ihren Frauen oder ihren Ehemännern betrogen werden. Einmal beauftragte mich eine Frau, ihrem Mann zu sagen, sie plane, ihn zu verlassen. Sie hatte Angst, er würde sie abknallen. Also sagte ich’s ihm, und, wissen Sie was, der Hundesohn versuchte, mich abzuknallen. Ich lag drei Wochen mit geschientem Hals im Gertrauden-Krankenhaus. Danach war für mich auf Dauer Schluß mit Ehesachen. Im Augenblick mache ich alles. Ich arbeite für Versicherungen, bewache Hochzeitsgeschenke und suche vermißte Personen – solche, von deren Verschwinden die Polizei noch nichts weiß, aber auch andere, deren Verschwinden gemeldet ist. Ja, das ist ein Bereich meines Geschäfts, der seit der Machtübernahme richtig aufgeblüht ist.» Ich lächelte so freundlich, wie ich konnte, und zwinkerte ihm vielsagend zu. «Ich denke, wir haben alle ganz hübsch vom Nationalsozialismus profitiert, nicht wahr? Richtige kleine Märzgefallene.»
«Du mußt Bernhard nicht ernst nehmen», sagte Dagmar. «Er hat einen komischen Sinn für Humor.» Ich hätte weitergesprochen, doch die Kapelle hatte zu spielen begonnen, und Dagmar war so klug, Buerckel auf die Tanzfläche zu führen, wo sie mit herzlichem Beifall empfangen wurden.
Da der Sekt, der angeboten wurde, mich anödete, ging ich auf der Suche nach einem richtigen Schluck in die Bar. Ich bestellte ein Bock und einen Klaren zum Nachspülen, einen farblosen Kartoffelschnaps, für den ich eine Schwäche habe. Ich kippte Bier und Schnaps ziemlich schnell runter und bestellte dasselbe noch mal.
«Durstige Angelegenheit, so eine Hochzeit», sagte der kleine Mann neben mir: Es war Dagmars Vater. Er lehnte sich mit dem Rücken an die Theke und beobachtete voller Stolz seine Tochter. «Sieht zum Anbeißen aus, nicht wahr, Herr Gunther?»
«Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen werde», sagte ich. «Vielleicht können Sie sie dazu überreden, ihre Meinung zu ändern und weiter bei mir zu bleiben. Ich bin sicher, daß sie das Geld gebrauchen können. Junge Paare brauchen immer Geld, wenn sie heiraten.»
Lehmann schüttelte den Kopf. «Ich fürchte, es gibt nur eine Art von Arbeit, für die eine Frau geeignet ist, wenn es nach Johannes und seiner Naziregierung geht, und die muß sie leisten, wenn neun Monate vorbei sind.» Er zündete seine Pfeife an und paffte nachdenklich vor sich hin. «Ich schätze, daß sie eines dieser Ehedarlehen beantragen werden, und das wird sie vom Arbeiten abhalten, oder?»
«Ja, ich denke, Sie haben recht», sagte ich und goß den Klaren hinunter. Ich sah seinem Gesicht an, daß er überrascht war, mich trinken zu sehen, und darum sagte ich:
«Lassen Sie sich durch dieses Zeug nicht täuschen, Herr Lehmann. Ich benutze es nur als Mundwasser und bin bloß zu faul, die Brühe auszuspucken.» Er grinste, schlug mir auf die Schulter und bestellte uns zwei Doppelte. Wir tranken, und ich fragte ihn, wo das glückliche Paar seine Flitterwochen verbringen werde.
«Am Rhein», sagte er. «Wiesbaden. Meine Frau und ich sind damals in Königstein gewesen. Wunderschöne Gegend. Er hat nicht lange Urlaub, dann muß er schon wieder weg. Irgendeine dieser Kraft-durch-Freude-Reisen vom Reichsarbeitsdienst.»
«Ja? Wohin?»
«Mittelmeer.»
«Glauben Sie das?»
Der alte Mann runzelte die Stirn. «Nein», sagte er grimmig. «Hab’s Dagmar gegenüber nicht erwähnt, aber ich schätze, er fährt nach Spanien …»
«… und in den Krieg.»
«Und in den Krieg, ja. Mussolini hat Franco geholfen, also wird auch Hitler sich den Spaß nicht entgehen lassen, oder? Er wird erst zufrieden sein, wenn er uns in einen neuen verdammten Krieg verwickelt hat.»
Danach tranken wir noch ein paar Lagen, und dann tanzte ich mit einer hübschen, kleinen Strumpfverkäuferin aus dem Kaufhaus Grünfeld. Ihr Name war Carola, und ich überredete sie, mit mir zu verschwinden, und wir gingen hinüber zu Dagmar und Buerckel, um ihnen Glück zu wünschen. Es kam mir sonderbar vor, daß Buerckel sich gerade diesen Augenblick aussuchte, um auf meine Kriegsteilnahme zu sprechen zu kommen.
«Dagmar erzählt mir, daß Sie an der türkischen Front waren.» Macht es ihm etwa ein wenig zu schaffen, dachte ich, daß er nach Spanien ging? «Und daß Sie das Eiserne Kreuz bekamen.»
Ich zuckte die Achseln. «Bloß zweiter Klasse.» So war das also, grinste ich; der Flieger war scharf auf Ruhm.
«Trotzdem», sagte er. «Immerhin ein Eisernes Kreuz. Das Eiserne Kreuz des Führers war auch zweiter Klasse.»
«Na ja, ich kann nicht für ihn sprechen, aber soweit ich mich erinnere, war es für einen Soldaten – vorausgesetzt, er tat seine Pflicht und war relativ ehrlich –, der an der Front diente, wirklich ziemlich leicht, gegen Ende des Krieges an ein Eisernes Kreuz zu kommen. Sie wissen ja, die meisten Orden erster Klasse wurden Männern verliehen, die im Grab liegen. Ich kriegte mein Eisernes Kreuz dafür, daß ich mich aus dem Schlamassel raushielt.» Das Thema brachte mich in Schwung. «Wer weiß», sagte ich. «Wenn alles gutgeht, kriegen Sie vielleicht selber eins. Würde sich auf so einer piekfeinen Uniform gut machen.» Die Muskeln in Buerckels schmalem Jungengesicht strafften sich. Er beugte sich vor und roch meinen Atem. «Sie sind betrunken», sagte er. «Si», sagte ich. Unsicher auf den Füßen, wandte ich mich zum Gehen. «Adiós, hombre.»
2
Es war spät, ein Uhr vorbei, als ich schließlich zu meiner Wohnung in der Trautenaustraße fuhr. Sie liegt in Wilmersdorf, einer bescheidenen Gegend, aber immer noch um vieles besser als der Wedding, wo ich aufgewachsen bin. Die Straße verläuft in nordöstlicher Richtung von der Güntzelstraße, am Nikolsburger Platz vorbei, in dessen Mitte eine Art von künstlichem Springbrunnen sprudelt. Ich wohnte recht angenehm am Ende des Prager Platzes.
Ich schämte mich ein bißchen, daß ich Buerckel in Gegenwart Dagmars gehänselt hatte und wegen der Dinge, die ich mit Carola im Tiergarten beim Goldfischteich getrieben hatte. Ich saß in meinem Wagen und rauchte nachdenklich eine Zigarette. Ich mußte mir selber eingestehen, daß mir Dagmars Hochzeit mehr zugesetzt hatte, als ich es vorher für möglich gehalten hatte. Es wurde mir klar, daß nichts dabei herauskam, wenn ich weiter darüber nachgrübelte. Ich glaubte nicht, daß ich sie würde vergessen können, doch todsicher würde ich jede Menge Möglichkeiten finden, nicht an sie zu denken.
Erst als ich aus dem Wagen stieg, bemerkte ich das große, dunkle Mercedes-Kabriolett, das etwa zwanzig Meter hinter mir parkte, und die beiden Männer, die daran lehnten und auf jemanden warteten. Ich straffte mich, als einer der beiden seine Zigarette wegwarf und rasch auf mich zuging. Als er näher kam, erkannte ich, daß er für einen Gestapo-Mann zu gepflegt war und daß der andere eine Chauffeur-Uniform trug, obwohl er, gebaut wie ein Varieté-Gewichtheber, in einem Trikot aus Leopardenfell erheblich mehr hergemacht hätte. Seine alles andere als diskrete Anwesenheit gab dem gutgekleideten jüngeren Mann unverkennbar Selbstvertrauen.
«Herr Gunther? Sind Sie Bernhard Gunther?» Er blieb vor mir stehen, und ich warf ihm einen Blick zu, der den stärksten Bären gefällt hätte: Ich kann Leute nicht leiden, die mich um ein Uhr morgens vor meinem Haus ansprechen.
«Ich bin sein Bruder. Bernhard ist im Augenblick nicht in der Stadt.» Der Mann grinste breit. Das kaufte er mir nicht ab.
«Bernhard Gunther, der Privatdetektiv? Mein Chef würde sich gern mit Ihnen unterhalten.» Er deutete auf den großen Mercedes. «Er wartet im Wagen. Ich sprach mit der Frau des Hausmeisters, und sie sagte mir, daß Sie am Abend zurück sein würden. Das war vor drei Stunden. Sie sehen also, daß wir ziemlich lange gewartet haben. Es ist wirklich sehr dringend.»
Ich hob das Handgelenk und warf einen Blick auf meine Uhr.
«Freundchen, es ist zwanzig vor zwei. Also, was immer Sie mir verkaufen wollen, ich bin nicht interessiert. Ich bin müde, und ich bin betrunken, und ich will ins Bett. Ich habe ein Büro am Alexanderplatz, also tun Sie mir den Gefallen und warten Sie bis morgen.»
Der junge Mann, ein freundlicher Bursche mit einem Frischlingsgesicht und einer Blume im Knopfloch, stellte sich mir in den Weg. «Die Sache kann nicht bis morgen warten», sagte er, und dann lächelte er gewinnend. «Bitte, sprechen Sie mit ihm, es dauert bloß eine Minute, ich bitte Sie.»
«Mit wem soll ich sprechen?» knurrte ich und warf einen Blick zum Wagen hinüber.
«Hier ist seine Karte.» Er reichte sie mir, und ich starrte sie blöde an, als wäre sie das Gewinnlos einer Tombola. Er beugte sich vor und las laut, ohne hinzusehen: «Dr. Fritz Schemm, Deutscher Rechtsanwalt, Schemm & Schellenberg, Unter den Linden 67. Das ist eine gute Adresse.»
«Das stimmt», sagte ich. «Aber ein Rechtsanwalt von einer so gediegenen Firma, der sich nachts draußen rumtreibt? Denken Sie, ich glaube an Märchen?» Aber ich folgte ihm trotzdem zum Wagen. Der Chauffeur öffnete die Tür. Einen Fuß auf dem Trittbrett, lugte ich ins Innere. Ein nach Kölnischwasser riechender Mann beugte sich vor, das Gesicht im Schatten verborgen, und als er sprach, war seine Stimme kalt und unfreundlich, als quäle er sich auf einer Kloschüssel. «Sie sind Gunther, der Detektiv?»
«Richtig», sagte ich, «und Sie sind …» Ich tat so, als läse ich von seiner Visitenkarte ab – «Dr. Fritz Schemm, Deutscher Rechtsanwalt». Ich sprach das Wort «deutscher» mit einer bewußt sarkastischen Betonung aus. Ich habe es auf Visitenkarten und Ladenschildern wegen seiner Betonung der rassischen Anständigkeit immer gehaßt; und das um so mehr, weil dies mittlerweile – zumindest was Rechtsanwälte betrifft – ganz und gar überflüssig ist, weil man jüdischen Anwälten ohnehin verboten hat zu praktizieren. Ich würde nie auf die Idee kommen, mich als «Deutscher Privatdetektiv», als «Evangelischer Privatdetektiv», «Asozialer Privatdetektiv» oder als «Verwitweter Privatdetektiv» zu bezeichnen, obwohl ich alles das eine Zeitlang war oder noch bin (heutzutage lasse ich mich in der Kirche selten blicken). Es ist wahr, daß viele meiner Kunden Juden sind. Es lohnt sich, für sie zu arbeiten (sie zahlen bar), und immer wieder geht es um dieselbe Sache – um verschwundene Personen. Auch die Ergebnisse meiner Nachforschungen sind fast immer dieselben: eine Leiche, mit freundlicher Hilfe der Gestapo oder SA in den Landwehrkanal gekippt; ein einsamer Selbstmord in einem Ruderboot auf dem Wannsee oder ein Name auf einer Polizeiliste von Verurteilten, die man ins KZ geschickt hatte. Ich mochte ihn deshalb auf Anhieb nicht, diesen Anwalt, diesen Deutschen Anwalt.
Ich sagte: «Hören Sie, Herr Doktor, wie ich Ihrem Laufburschen soeben gesagt habe, bin ich müde und betrunken genug, um zu vergessen, daß ich einen Bankdirektor habe, der sich um mein Wohlergehen sorgt.» Schemm faßte in seine Jackentasche, und ich zuckte nicht einmal, was zeigt, wie blau ich war. Doch er zog lediglich seine Brieftasche heraus.
«Ich habe Erkundigungen über Sie eingezogen, und ich weiß, daß man sich auf Sie verlassen kann. Ich brauche Sie im Augenblick für zwei Stunden. Dafür zahle ich Ihnen 200 Mark: Das ist im Grunde genug für eine Woche.» Er legte seine Brieftasche aufs Knie und schob mit dem Daumen zwei Blaue auf sein Hosenbein. Das war für ihn gar nicht so einfach, denn er hatte nur einen Arm. «Und anschließend wird Ulrich Sie nach Hause fahren.»
Ich nahm die Scheine. «Zum Teufel», sagte ich, «ich wollte ja bloß zu Bett gehen und schlafen. Das kann ich immer noch.» Ich zog den Kopf ein und stieg in den Wagen. «Fahren wir, Ulrich.»
Die Wagentür knallte zu, Ulrich klemmte sich hinter das Steuer, und der elegante Frischling nahm neben ihm Platz. Wir fuhren nach Westen.
«Wohin fahren wir?» fragte ich.
«Alles zu seiner Zeit, Gunther», sagte er. «Bedienen Sie sich. Was zu trinken oder eine Zigarette?» Er ließ die Türen eines Cocktailschränkchens aufspringen, das aussah, als habe man es aus der «Titanic» geborgen, und zog eine Packung Zigaretten heraus. «Amerikanische.»
Ich nahm eine Zigarette, aber keinen Drink: Wenn Leute sich so bereitwillig von 200 Mark trennten wie Dr. Schemm, zahlte es sich aus, wenn man einen klaren Kopf behielt.
«Würden Sie mir bitte Feuer geben?» sagte Schemm und schob sich eine Zigarette zwischen die Lippen. «Streichhölzer sind das einzige, womit ich nicht fertig werde. Ich habe meinen Arm unter Ludendorff bei der Einnahme der Festung Liège verloren. Waren Sie im Feld?» Die Stimme war verbindlich, beinahe ölig, mit einem winzigen Unterton von Grausamkeit. Eine Art von Stimme, die einen dazu verleiten konnte, sich unversehens selber zu beschuldigen, und dafür dankte ich bestens. Eine Art von Stimme, die ihm, hätte er für die Gestapo gearbeitet, gute Dienste geleistet hätte. Ich zündete unsere Zigaretten an und lehnte mich in die Polster zurück.
«Ja, ich war in der Türkei.» Du liebe Güte, mit einem Mal waren so viele Leute an meiner Militärzeit interessiert, daß ich mich fragte, ob ich mich nicht besser um ein Veteranenabzeichen beworben hätte. Ich blickte aus dem Fenster und stellte fest, daß wir in Richtung Grunewald fuhren.
«Rang?»
«Feldwebel. «Ich spürte, daß er lächelte.
«Ich war Major», sagte er, und das wies mich deutlich in die Schranken. «Und nach dem Krieg wurden Sie Polizist?»
«Nein, nicht sofort. Eine Weile war ich Beamter, aber ich konnte das ewige Einerlei nicht ertragen. Ich kam erst 1922 zur Polizei.»
«Und wann schieden Sie wieder aus?»
«Hören Sie, Herr Doktor, ich kann mich nicht erinnern, daß Sie mich unter Eid genommen hätten, als ich in den Wagen stieg.»
«Tut mir leid», sagte er. «Ich war bloß scharf darauf, rauszubekommen, ob Sie aus eigenem Entschluß gingen oder ob man Sie …»
«Rausgeschmissen hat? Sie sind ganz schön dreist, mich das zu fragen, Schemm.»
«Wirklich?» sagte er mit Unschuldsmiene.
«Aber ich werde Ihre Frage beantworten. Ich ging von selber. Allerdings glaube ich, man hätte mich, wie all die anderen, ausgesiebt, hätte ich lange genug gewartet. Ich bin kein Nazi, aber ein verdammter Roter bin ich auch nicht; ich habe eine Abneigung gegen den Bolschewismus, genauso wie die Partei; wenigstens läßt sie mich das glauben. Aber das reicht nicht für die heutige Kripo oder Sipo oder wie immer man das jetzt nennt. Wenn man nicht für sie ist, folgt für sie daraus, daß man gegen sie sein muß.»
«Und so verließen Sie, immerhin Inspektor, die Kripo», sagte er, hielt inne und setzte mit gespielter Überraschung hinzu, «um Hausdetektiv im Hotel Adlon zu werden.»
«Sie sind ziemlich ausgeschlafen», feixte ich, «mir alle diese Fragen zu stellen, wenn Sie die Antworten bereits kennen.»
«Mein Klient weiß gern über die Leute Bescheid, die für ihn arbeiten», sagte er blasiert.
«Ich habe den Fall noch nicht übernommen. Vielleicht werde ich ihn hinschmeißen, bloß um Ihr Gesicht zu sehen.»
«Vielleicht. Aber dann wären Sie ein Narr. In Berlin gibt es ein Dutzend von Ihrer Sorte – Privatschnüffler.» Er nannte meinen Beruf ziemlich angewidert beim Namen.
«Warum also ich?»
«Sie haben schon einmal für meinen Klienten gearbeitet, indirekt. Vor ein paar Jahren bearbeiteten Sie einen Versicherungsfall für die Germania-Lebensversicherung, und das ist eine Gesellschaft, bei der mein Klient Hauptaktionär ist. Während die Kripo immer noch im dunkeln tappte, gelang es Ihnen, ein paar gestohlene Aktien wiederzubeschaffen.»
«Ich erinnere mich.» Und ich hatte Grund dazu. Es war einer meiner ersten Fälle gewesen, nachdem ich das Adlon verlassen und mich als Privatdetektiv niedergelassen hatte. «Ich hatte Glück», sagte ich.
«Glück soll man nie unterschätzen», sagte er würdevoll. Wie recht er hat, dachte ich, man braucht sich bloß den Führer anzusehen.
Inzwischen waren wir am Rand des Grunewalds, in Dahlem, angekommen, wo ein paar der reichsten und einflußreichsten Leute des Landes, zum Beispiel die Ribbentrops, wohnten. Wir näherten uns einem riesigen schmiedeeisernen Tor, das sich zwischen dicken Mauern spannte, und der Frischling mußte aus dem Auto springen, um es aufzudrücken. Ulrich fuhr durch.
«Fahren Sie weiter», befahl Schemm. «Warten Sie nicht. Wir sind sowieso schon spät dran.» Wir fuhren etwa fünf Minuten eine Allee entlang, bevor wir einen ausgedehnten, mit Kies bestreuten Hof erreichten, an dessen einer Seite das Hauptgebäude stand, an das sich zwei Seitenflügel anschlossen. Ulrich hielt vor einem kleinen Springbrunnen und sprang heraus, um die Wagentüren aufzureißen. Wir stiegen aus.
Um den Hof zogen sich Arkaden mit einem von dicken Streben und hölzernen Säulen getragenen Dach, unter denen ein Mann mit einem Paar bösartig aussehender Dobermänner auf und ab ging. Von der Laterne an der Eingangstür abgesehen, gab es nicht viel Licht im Hof, doch ich konnte erkennen, daß das Haus Mauern mit weißem Rauhputz und ein tiefes Mansardendach hatte. Es war so groß wie ein dezentes Hotel der Kategorie, die ich mir nicht leisten konnte. Irgendwo in den Bäumen hinter dem Haus schrie aus Leibeskräften ein Pfau.
Als wir uns der Tür näherten, konnte ich den Doktor zum ersten Mal genauer betrachten. Ich würde sagen, daß er ein ziemlich stattlicher Mann war. Da er wenigstens fünfzig war, würde man ihn wohl eine distinguierte Erscheinung nennen. Er war größer, als er mir im Rücksitz des Wagens vorgekommen war, und anspruchsvoll gekleidet, freilich ohne jede Rücksicht auf die heutige Mode. Er trug einen steifen Kragen, mit dem man Brot hätte schneiden können, einen hellgrauen Nadelstreifenanzug, eine cremefarbene Weste und Gamaschen; dazu kam ein grauer Glacéhandschuh, und auf seinem sauber geschorenen, kantigen, grauen Kopf trug er einen großen grauen Hut mit einer Krempe, welche die hohe, sauber gekniffte Krone wie ein Burggraben umschloß. Er sah aus wie eine alte Rüstung.
Er schob mich zu einer großen Mahagonitür, die sich öffnete. Wir erblickten das aschfahle Gesicht eines Butlers, der zur Seite trat, als wir die Schwelle überquerten und in die ausladende Empfangshalle traten. Es war eine jener Hallen, die ein Glücksgefühl vermitteln, bloß weil man heil durch die Tür gekommen ist. Doppeltreppen mit schimmernden weißen Geländern führten ins Obergeschoß, und an der Decke hing ein Kronleuchter, der größer als eine Kirchenglocke und protziger war als die Ohrringe einer Nackttänzerin. Ich durfte nicht vergessen, mein Honorar anzuheben.
Der Butler, ein Araber, verbeugte sich gemessen und bat mich um meinen Hut.
«Ich behalte ihn bei mir, wenn Sie nichts dagegen haben», sagte ich und ließ die Krempe durch meine Finger gleiten. «Das wird mir helfen, meine Hände vom Silber zu lassen.»
«Wie Sie wünschen, mein Herr.»
Schemm händigte dem Butler seinen Hut aus, als ob er in dieser Welt zu Hause sei. Vielleicht war er das, doch Anwälten unterstelle ich immer, daß sie ihren Wohlstand und ihre Stellung durch Habsucht und mit gemeinen Methoden erlangt haben: Ich bin noch nie einem begegnet, dem ich trauen konnte. Er entledigte sich seines Handschuhs mit nahezu artistischer Geschicklichkeit und ließ ihn in den Hut fallen. Dann sagte er dem Butler, er solle uns melden.
Wir warteten in der Bibliothek. Nach den Maßstäben eines Bismarck oder Hindenburg war sie nicht groß, und man hätte zwischen dem Schreibtisch, so groß wie der Reichstag, und der Tür nicht mehr als sechs Autos parken können. Der Raum war auf frühes Mittelalter getrimmt, hatte große Balken, einen Kamin aus Granit, in dem leise ein Scheit knisterte, und allerlei Waffen an den Wänden. Es gab jede Menge Bücher, der Art, die man meterweise kauft: deutsche Dichter und Philosophen und Juristen, die mir jedoch nur als Namen von Straßen, Cafés und Bars vertraut waren.
Ich machte einen Erkundungsmarsch durch den Raum. «Wenn ich in fünf Minuten nicht zurück bin, schicken Sie einen Suchtrupp los.»
Schemm seufzte und setzte sich auf eines der beiden Ledersofas, die rechtwinklig zum Kamin angeordnet waren. Er nahm eine Zeitschrift aus dem Ständer und tat so, als lese er. «Kriegen Sie in diesen kleinen Hütten nicht auch Platzangst?» Schemm seufzte gereizt wie eine altjüngferliche Tante, die im Atem des Pfarrers den Geruch von Gin schnuppert.
«Setzen Sie sich, Gunther», sagte er. Ich nahm keine Notiz von seiner Bemerkung. Ich befingerte die zwei Hunderter in meiner Hosentasche, und das half mir, wach zu bleiben. Ich schlenderte zum Schreibtisch hinüber und warf einen Blick auf seine grüne Lederplatte. Eine Nummer des Berliner Tagblatts, die aussah wie sorgfältig gelesen; eine Lesebrille; ein Füllfederhalter; ein schwerer Messingaschenbecher mit dem Stumpen einer zerkauten Zigarre und daneben das Kästchen mit schwarzen Havannas, dem sie entnommen war; ein Stapel Briefe und ein paar Fotos in silbernen Rahmen. Ich warf einen Blick auf Schemm, der mit seiner Zeitschrift und seinen Augenlidern seine liebe Not hatte, und nahm dann eines der Fotos in die Hand. Sie war dunkel und hübsch, mit einer üppigen Figur, genau so, wie ich sie an Frauen liebe, wenngleich ich mir an den Fingern abzählen konnte, daß sie mein Geplauder nach Tisch kaum unwiderstehlich finden würde: Das verriet mir der Doktorhut, den sie trug.
«Sie ist schön, meinen Sie nicht auch?» sagte eine Stimme, die von der Tür kam und Schemm veranlaßte, vom Sofa aufzuspringen. Es war eine monotone Stimme mit einem leichten Berliner Akzent. Während Schemm sich eilfertig verbeugte, murmelte ich etwas Schmeichelhaftes über das Mädchen auf dem Foto.
«Herr Six», sagte Schemm unterwürfiger als eine Haremsdame, «darf ich Ihnen Bernhard Gunther vorstellen.» Er wandte sich mir zu und sagte mit einer Stimme, die zu meinem bedrückenden Kontostand paßte: «Dies ist Doktor Hermann Six.»
Ist doch komisch, dachte ich, in diesen gehobenen Kreisen hat jeder einen verdammten Doktortitel. Ich schüttelte ihm die Hand. Mein neuer Klient hielt sie unangenehm lange fest, während er mir ins Gesicht blickte. Das machen viele Klienten: Sie glauben von sich, den Charakter eines Mannes beurteilen zu können, denn schließlich wollen sie ihre peinlichen kleinen Probleme nicht einem Mann anvertrauen, der verschlagen und unehrlich aussieht. Es ist mein Glück, daß ich wie jemand aussehe, der aufrecht und verläßlich ist. Übrigens, die Augen meines neuen Klienten waren blau, groß und vorstehend und wiesen eine Art wäßriger Helligkeit auf, als sei er gerade aus einer Senfgaswolke gekommen. Ich zuckte ein wenig zusammen, als mir dämmerte, daß der Mann geweint hatte.
Six ließ meine Hand los und griff nach dem Foto, das ich gerade betrachtet hatte. Er starrte es ein paar Sekunden an, dann stieß er einen tiefen Seufzer aus.
«Sie war meine Tochter», sagte er mit gepreßter Stimme. Ich nickte geduldig. Er legte das Foto mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch und strich sich das graue, nach Art einer Tonsur geschnittene Haar aus der Stirn. «Sie war es, denn sie ist tot.»
«Das tut mir leid», sagte ich würdevoll.
«Das sollte es nicht», erwiderte er, «denn wenn sie noch am Leben wäre, stünden Sie nicht hier und hätten nicht die Chance, eine Menge Geld zu verdienen.» Ich spitzte die Ohren: Er sprach meine Sprache. «Sie wurde ermordet, wissen Sie.» Um des dramatischen Effekts willen machte er eine Pause: Klienten gefallen sich oft darin, doch ihm gelang er gut. «Ermordet», wiederholte ich dumpf.
«Ermordet.» Er zupfte an einem seiner flappigen, riesenhaften Ohren, bevor er die knotigen Hände in die Taschen seines sackartigen, marineblauen Anzugs schob. Mir stach sofort ins Auge, daß die Manschetten seines Hemdes ausgefranst und schmutzig waren. Ich war noch nie einem Stahlmagnaten begegnet (ich hatte von Hermann Six gehört; er war einer der wichtigsten Ruhrindustriellen), aber das kam mir doch höchst sonderbar vor. Als er mit den Füßen wippte, warf ich einen Blick auf seine Schuhe. Die Schuhe der Klienten können einem eine Menge verraten. Das ist das einzige, was ich von Sherlock Holmes gelernt habe. Six’ Schuhe waren reif für das Winterhilfswerk. Andererseits sind Schuhe in Deutschland heutzutage von schlechter Qualität. Das Ersatzleder ist wie Pappe; genauso wie das Fleisch, der Kaffee, die Butter und die Kleidung. Um aber auf Herrn Six zurückzukommen, so schloß ich aus seinem Äußeren nicht, daß er vor lauter Kummer in seinen Kleidern schlief. Nein, ich kam zu dem Schluß, daß er einer dieser exzentrischen Millionäre sei, von denen man gelegentlich in der Zeitung liest: Sie gönnen sich nichts, und in erster Linie dadurch kommen sie zu ihrem Geld.
«Sie wurde kaltblütig erschossen», sagte er bitter. Ich sah voraus, daß es eine lange Nacht werden würde. Ich holte meine Zigaretten aus der Tasche.
«Was dagegen, wenn ich rauche?» fragte ich. Bei diesen Worten schien er zu sich zu kommen.
«Entschuldigen Sie, Herr Gunther», seufzte er. «Ich vergesse meine gute Kinderstube. Möchten Sie einen Drink oder etwas Ähnliches?» Das «oder etwas Ähnliches» hörte sich nicht übel an. Ich dachte an ein Himmelbett, zum Beispiel, bat aber lieber um einen Mokka. «Fritz?»
Schemm rührte sich auf dem großen Sofa. «Danke, bloß ein Glas Wasser», sagte er bescheiden. Six zog am Klingelzug und wählte dann aus dem Kästchen auf dem Tisch eine dicke, schwarze Zigarre. Er bedeutete mir, Platz zu nehmen, und ich ließ mich, Schemm gegenüber, in das andere Sofa sinken. Six entzündete eine dünne Wachskerze, brannte sich seine Zigarre an und nahm neben dem Mann in Grau Platz. Hinter ihm öffnete sich die Tür der Bibliothek, und ein junger Mann um die Fünfunddreißig betrat den Raum. Eine randlose Brille, sorgsam auf die Spitze seiner breiten, beinahe negroiden Nase gesetzt, bildete einen Kontrast zu seiner athletischen Figur. Er nahm die Brille ab und starrte verlegen erst mich, dann seinen Arbeitgeber an.
«Wünschen Sie, daß ich an dieser Sitzung teilnehme, Herr Six?» Seine Stimme hatte einen unmerklichen Frankfurter Akzent.
«Nein, alles in Ordnung, Hjalmar», sagte Six. «Legen Sie sich schlafen, seien Sie ein guter Junge. Vielleicht könnten Sie Farraj bitten, uns einen Mokka und ein Glas Wasser zu bringen und für mich das Übliche.»
«Hm, sehr wohl, Herr Six.» Abermals blickte er mich an, und ich kam nicht dahinter, ob es meine Anwesenheit war, die ihn beunruhigte, oder etwas anderes. Also nahm ich mir vor, mit ihm zu sprechen, sobald sich die Gelegenheit bot.
«Da wäre noch etwas», sagte Six und drehte sich auf dem Sofa herum. «Bitte, erinnern Sie mich daran, daß ich morgen als erstes die Vorkehrungen für die Beerdigung mit Ihnen durchgehe. Ich möchte, daß Sie sich um alles kümmern, während ich fort bin.»
«Sehr wohl, Herr Six.» Und er wünschte uns gute Nacht und verschwand.
«Also, Herr Gunther», sagte Six, nachdem sich die Tür geschlossen hatte. Während er sprach, behielt er die schwarze Zigarre im Mundwinkel, so daß er wie ein Marktschreier aussah und seine Stimme sich anhörte wie die eines Kindes mit einem Bonbon im Mund. «Ich muß mich dafür entschuldigen, daß ich Sie zu dieser unchristlichen Zeit herbringen ließ; aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Was jedoch am wichtigsten ist, das müssen Sie verstehen: Ich bin auch ein Mann, der keine Öffentlichkeit wünscht.»
«Trotzdem, Herr Six», sagte ich, «muß ich von Ihnen gehört haben.»
«Das ist sehr wahrscheinlich. In meiner Position muß ich bei vielen Anlässen den Schirmherrn spielen und viele wohltätige Einrichtungen fördern – Sie wissen, wovon ich spreche. Reichtum hat seine Verpflichtungen.»
Ein Plumpsklosett auch, dachte ich. Ich sah voraus, was kommen würde, und gähnte innerlich. Aber ich sagte: «Das will ich gern glauben», mit derart übertriebenem Mitgefühl, daß er sich veranlaßt sah, einen kurzen Augenblick innezuhalten, ehe er mit den abgedroschenen Phrasen fortfuhr, die ich schon so oft gehört hatte. «Notwendige Diskretion» und «keine offizielle Untersuchung meiner Privatangelegenheiten» und «Bewahrung absoluter Vertraulichkeit» etc., etc. Das bringt mein Beruf mit sich. Die Leute erzählen dir immer, wie du ihren Fall zu behandeln hast, beinahe so, als ob sie dir nicht ganz trauten, fast so, als müßtest du dir andere Maßstäbe zulegen, um für sie zu arbeiten.
«Wenn ich mit weniger Diskretion mehr herausschlagen könnte, hätte ich’s schon vor langer Zeit versucht», sagte ich ihm. «Aber in meinem Gewerbe ist Redseligkeit schlecht fürs Geschäft. So etwas spricht sich herum, und eine oder zwei gutbetuchte Versicherungsgesellschaften und Anwaltsbüros, die ich zu meinen ständigen Klienten zählen kann, würden sich jemand anderen suchen. Hören Sie, ich weiß, daß Sie mich haben überprüfen lassen, kommen wir also jetzt zum Geschäft.» Das interessante an den Reichen ist, daß sie es mögen, wenn man ihnen sagt, wo es langgeht. Sie verwechseln das mit Ehrlichkeit. Six nickte zustimmend.
In diesem Augenblick glitt der Butler, geräuschlos wie auf Gummirädern, ins Zimmer, und schwach nach Schweiß und irgendeinem Deo duftend, servierte er mir den Mokka, Schemm das Wasser und seinem Herrn den Cognac, mit dem ausdruckslosen Gesicht eines Mannes, der sechsmal am Tag die Wattepfröpfchen in seinen Ohren wechselt. Ich schlürfte meinen Kaffee und sinnierte darüber, daß der Butler, hätte ich Six erzählt, meine neunzigjährige Großmutter sei mit dem Führer durchgebrannt, weiterserviert hätte, ohne daß ihm auch nur ein einziges Haar zu Berge gestanden hätte. Ich schwöre, daß ich kaum bemerkte, wie er den Raum verließ.
«Das Foto, das Sie gesehen haben, wurde erst vor ein paar Jahren gemacht, anläßlich der Promotion meiner Tochter. Später wurde sie Lehrerin am Arndt-Gymnasium in Dahlem.» Ich kramte einen Bleistift hervor und schickte mich an, auf der Rückseite von Dagmars Hochzeitseinladung Notizen zu machen. «Nein», sagte er, «machen Sie sich keine Notizen, hören Sie bloß zu. Herr Schemm wird Ihnen im Anschluß an unser Gespräch ein vollständiges Dossier aushändigen. Eigentlich war sie eine ziemlich gute Lehrerin, doch ich will ehrlich sein und Ihnen sagen, daß ich mir gewünscht hätte, sie hätte etwas anderes aus ihrem Leben gemacht. Grete – ja, ich vergaß, Ihnen ihren Namen zu sagen –, Grete hatte die schönste Singstimme, und ich wollte, daß sie sich zur Sängerin ausbilden ließ. Doch 1930 heiratete sie einen jungen Juristen vom Berliner Landgericht. Sein Name war Paul Pfarr.»
«War?» fragte ich. Mein Einwurf entlockte ihm abermals einen tiefen Seufzer.
«Ja. Ich hätte es erwähnen sollen. Leider ist er ebenfalls tot.»
«Also zwei Morde», sagte ich.
«Ja», sagte er verlegen. «Zwei Morde.» Er nahm seine Brieftasche heraus und gab mir ein Foto. «Es wurde bei ihrer Hochzeit aufgenommen.»
Dem Foto war nicht viel zu entnehmen, höchstens, daß der Empfang, wie bei den meisten Hochzeiten der Gesellschaft, im Adlon stattgefunden hatte. Ich erkannte die elegante Pagode des Flüster-Springbrunnens mit ihren geschnitzten Elefanten. Ich unterdrückte ein echtes Gähnen. Es war kein besonders gutes Foto, und von Hochzeiten hatte ich allmählich die Nase voll. Ich gab das Foto zurück.
«Ein schönes Paar», sagte ich und steckte mir eine neue Muratti an. Six’ schwarze Zigarre lag rauchlos im runden Messingaschenbecher.
«Grete unterrichtete bis 1934, als sie, wie viele andere Frauen, ihre Stellung verlor – eine Begleiterscheinung der Benachteiligung arbeitender Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Währenddessen ergatterte Paul einen Posten im Innenministerium. Nur wenig später starb meine erste Frau, Lisa, und Grete wurde sehr depressiv. Sie fing an, zu trinken und spät nach Hause zu kommen. Aber gerade vor ein paar Wochen schien sie wieder zu sich selber gefunden zu haben.» Six betrachtete grämlich seinen Cognac und stürzte ihn darauf in einem Zug hinunter. «Doch vor drei Tagen starben Paul und Grete bei einem Feuer in ihrem Haus in Lichterfelde-Ost. Aber bevor das Haus in Flammen aufging, wurden beide mit mehreren Schüssen umgebracht und der Safe ausgeraubt.»
«Haben Sie eine Ahnung, was im Safe war?»
«Den Burschen von der Kripo habe ich erzählt, ich hätte keine Ahnung.»
Ich dachte mir mein Teil und sagte: «Was nicht ganz der Wahrheit entsprach. Richtig?»
«Was den größten Teil des Inhalts angeht, habe ich keine Ahnung. Doch im Safe war eine Kleinigkeit, von der ich wußte, ihnen aber nichts sagte.»
«Warum taten Sie das, Herr Six?»
«Weil es mir lieber war, daß sie nichts davon wußten.»
«Und ich?»
«Die betreffende Sache bietet Ihnen eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Mörder vor der Polizei aufzuspüren.»
«Und was dann?» Ich hoffte, daß er nicht eine kleine, private Hinrichtung plante, denn ich war nicht in der Stimmung, mich mit meinem Gewissen herumzuschlagen, und das schon gar nicht, wenn eine Menge Geld im Spiel war.
«Bevor Sie den Mörder der Polizei übergeben, werden Sie mir mein Eigentum wiederbeschaffen. Die Behörden dürfen es auf keinen Fall in die Hände bekommen.»
«Über welche ‹Kleinigkeit› reden wir eigentlich?»
Six faltete nachdenklich die Hände, entfaltete sie wieder, und dann hüllte er sich in seine Arme wie ein Revuegirl in seinen Schal. Er blickte mich sonderbar an.
«Vertraulich, natürlich», knurrte ich.
«Es geht um Juwelen», sagte er. «Sehen Sie, Herr Gunther, meine Tochter starb ohne Hinterlassung eines Testaments, und in diesem Fall geht ihr gesamter Besitz in den ihres Ehemanns über. Paul hat ein Testament hinterlassen, in dem er alles dem Reich vermacht.» Er schüttelte den Kopf. «Können Sie sich eine solche Dummheit vorstellen, Herr Gunther? Er hinterließ dem Reich alles. Alles. Man kann es kaum glauben.»
«Er war eben ein Patriot.»
Six entging die Ironie meiner Bemerkung. Er schnaubte verächtlich. «Mein lieber Herr Gunther, er war Nationalsozialist. Diese Leute glauben, daß sie die ersten wären, die das Vaterland lieben.» Er lächelte grimmig. «Ich liebe mein Land. Und niemand spendet mehr als ich. Aber ich kann den Gedanken einfach nicht ertragen daß das Reich sich auf meine Kosten noch mehr bereichert. Verstehen Sie mich?»
«Ich denke schon.»
«Nicht nur das, sondern es kommt hinzu, daß die Juwelen ihrer Mutter gehörten, so daß sie, abgesehen von ihrem wirklichen Wert, der beträchtlich ist, wie ich Ihnen sagen kann, auch einen gewissen gefühlsmäßigen Wert für mich darstellen.»
«Wieviel sind sie wert?»
Schemm regte sich, um ein paar Fakten und Zahlen zu nennen. «Ich denke, hier kann ich behilflich sein, Herr Six», sagte er, wühlte in einer Aktentasche, die zu seinen Füßen lag, zog einen lederfarbenen Aktendeckel heraus und plazierte ihn auf dem Läufer zwischen den beiden Sofas. «Ich habe hier sowohl die letzte Taxierung der Versicherung als auch ein paar Fotografien.» Er hob ein Blatt in die Höhe und las mit einem Gesichtsausdruck, als handle es sich um seine monatliche Zeitungsrechnung, die Zahl am Schluß der Seite ab: «Siebenhundertundfünfzigtausend Reichsmark.» Ich stieß unwillkürlich einen Pfiff aus. Schemm zuckte zusammen und reichte mir ein paar Fotos. Ich hatte schon größere Steine gesehen, aber bloß auf Fotos der Pyramiden. Six begann die Geschichte der Juwelen zu erzählen.
«1925 wurde der Edelsteinmarkt der Welt von Edelsteinen überflutet, die von russischen Exilanten veräußert oder von den Bolschewiken zum Verkauf angeboten wurden, die im Palast des Fürsten Jussupoff, dem Gatten der Nichte des Zaren, eine eingemauerte Schatzkammer entdeckt hatten. Im selben Jahr erwarb ich einige Stücke in der Schweiz: eine Brosche, ein Armband und, als kostbarstes Stück, ein in Diamanten gefaßtes Halsband, das aus zwanzig Brillanten bestand. Cartier hatte es angefertigt, und es wiegt über hundert Karat. Es versteht sich von selbst, Herr Gunther, daß es nicht einfach sein wird, ein solches Stück abzusetzen.»
«Nein, wirklich nicht.» Es mag zynisch klingen, aber der gefühlsmäßige Wert der Steine erschien mir jetzt ziemlich unbedeutend gegenüber ihrem Verkaufswert. «Erzählen Sie mir etwas über den Safe.»
«Ich habe ihn bezahlt», sagte Six. «Genauso wie das Haus. Paul hatte nicht viel Geld. Als Gretes Mutter starb, gab ich ihr die Juwelen, und zur selben Zeit ließ ich den Safe einbauen, damit sie sie aufbewahren konnte, wenn sie nicht im Tresor der Bank waren.»
«Sie hat sie also noch vor kurzem getragen?»
«Ja. Sie begleitete mich und meine Frau zu einem Ball, bloß ein paar Abende vor ihrem Tod.»
«Was war das für ein Safe?»
«Ein Stockinger-Wandsafe. Kombinationsschloß.»
«Und wer kannte die Kombination?»
«Meine Tochter und Paul natürlich. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander, und ich glaube, daß er dort gewisse Papiere aufbewahrte, die mit seiner Arbeit zu tun hatten.»
«Sonst niemand?»
«Nein. Nicht einmal ich.»
«Wissen Sie, wie der Safe geöffnet wurde? Wurde Sprengstoff benutzt?»
«Ich glaube, es wurde kein Sprengstoff benutzt.»
«Also ein Schränker.»
«Was ist das?»
«Ein professioneller Safeknacker. Und ich sage Ihnen, es muß ein sehr guter Mann gewesen sein, der das ausgeknobelt hat.» Six beugte sich vor. «Vielleicht», sagte er, «zwang der Dieb Paul und Grete, den Safe zu öffnen, und schickte sie dann wieder ins Bett, wo er beide erschoß. Und anschließend steckte er das Haus in Brand, um seine Spuren zu verwischen und die Polizei auf eine falsche Spur zu locken.»
«Ja, das ist möglich», stimmte ich zu. Ich rieb einen vollkommen runden Fleck glatter Haut in meinem ansonsten stoppligen Gesicht: Dort hatte mich in der Türkei ein Moskito gestochen, und seitdem brauchte ich mich dort nie mehr zu rasieren. Doch ich stelle fest, daß ich diesen Fleck sehr oft reibe, wenn ich mich unbehaglich fühle. Und wenn es etwas gibt, das mir garantiert Unbehagen einflößt, dann ein Klient, der Detektiv spielt. Ich schloß nicht aus, daß sich vielleicht alles so abgespielt hatte, wie er sagte, aber jetzt war ich an der Reihe, den Fachmann zu spielen. «Möglich, aber schlampig», sagte ich. «Ich kann mir keine bessere Methode vorstellen, Alarm zu schlagen, als den Reichstagsbrand zu imitieren. Van der Lubbe zu spielen und das Gebäude in Brand zu setzen, das sieht nicht nach der Arbeit eines professionellen Diebes aus, und ein Mord paßt auch nicht dazu.» Natürlich blieb dabei vieles offen: Ich wußte ja nicht einmal, ob es ein Profi gewesen war, aber nach meiner Erfahrung kommt es selten vor, daß ein Profi eine Arbeit übernimmt, die Mord einschließt. Ich wollte bloß dem Gespräch eine andere Wendung geben.
«Wer könnte gewußt haben, daß sie Juwelen im Safe hatte?» fragte ich.
«Ich», sagte Six. «Grete hätte das niemandem erzählt. Ich weiß nicht, ob Paul es jemandem erzählt hat.»
«Und hatten die beiden Feinde?»
«Von Paul weiß ich das nicht», erwiderte er, «aber ich bin sicher, daß Grete in der ganzen Welt keinen Feind hatte.» Während ich es für durchaus denkbar hielt, daß Papas kleines Mädchen sich immer die Zähne putzte und ihre Nachtgebete hersagte, konnte ich schwer übersehen, wie unbestimmt sich Herr Six über seinen Schwiegersohn äußerte. Dies war das zweite Mal, daß er unsicher war, was Paul gewußt oder getan haben könnte.
«Wie steht es mit Ihnen?» sagte ich. «Ein reicher und mächtiger Mann wie Sie muß eine gehörige Anzahl von Feinden haben.» Er nickte. «Gibt es jemanden, der Sie so sehr haßt, daß er Ihre Tochter benutzt hat, um sich an Ihnen zu rächen?»
Er setzte seine Zigarre wieder in Brand, zog daran und hielt sie dann in den Fingerspitzen von sich weg. «Feinde sind unvermeidlich die logische Folge großen Reichtums, Herr Gunther», sagte er. «Aber ich spreche von geschäftlichen Gegnern, nicht von Gangstern. Ich glaube nicht, daß einer von ihnen zu einer so kaltblütigen Tat imstande wäre.» Er stand auf und ging zum Kamin hinüber. Mit einem großen Schürhaken aus Messing beförderte er energisch das Scheit zurück, das vom Rost zu fallen drohte. Während er nichts Böses ahnte, versetzte ich ihm einen Tiefschlag: «Kamen Sie und der Gatte Ihrer Tochter gut miteinander aus?»
Er fuhr herum, um mich anzublicken, den Schürhaken noch in der Hand, das Gesicht leicht gerötet. Das war die Antwort, die ich brauchte, aber gleichwohl versuchte er, mir Sand in die Augen zu streuen. «Wie kommen Sie dazu, eine solche Frage zu stellen?» wollte er wissen.
«Wirklich, Herr Gunther!» sagte Schemm, indem er so tat, als sei er über meine gefühllose Frage schockiert.
«Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten», sagte Six, «aber zeigen Sie mir den Mann, der nicht zuweilen anderer Meinung ist als sein Schwiegersohn.» Er legte den Schürhaken hin. Ich schwieg eine Minute. Schließlich sagte er: «Also, im Hinblick auf die Durchführung Ihrer Ermittlungen würde ich es vorziehen, wenn Sie Ihre Aktivitäten speziell auf die Suche nach den Juwelen beschränken würden. Ich hätte es nicht gern, wenn Sie in meinen Familienangelegenheiten herumschnüffeln würden. Ich werde Ihr Honorar bezahlen, wie hoch auch immer es sein mag …»
«Siebzig Mark pro Tag, plus Spesen», log ich und hoffte, daß Schemm es nicht nachgeprüft hatte.
«Mehr noch: Die Germania-Lebensversicherung und die Germania-Versicherungsgesellschaft werden Ihnen eine Wiederbeschaffungsprämie in Höhe von fünf Prozent zahlen. Sind Sie damit einverstanden, Herr Gunther?» Das würde, wie ich rasch im Kopf errechnete, 37500 Mark ergeben. Mit dieser Summe war ich saniert. Ich nickte, wenngleich mir die Spielregeln, die er festlegte, nicht gefielen. Andererseits ging es um fast 40000 Mark, da konnte ich ihn schon gewähren lassen.
«Aber ich warne Sie, ich bin kein geduldiger Mann», sagte er. «Ich will Ergebnisse, und ich will sie rasch. Ich habe einen Scheck für Ihre unmittelbaren Bedürfnisse ausgestellt.» Er nickte seinem Handlanger zu, und dieser reichte mir einen Scheck. Es war ein Barscheck über tausend Mark, einzulösen bei der Commerzbank. Schemm kramte wieder in seiner Aktentasche und übergab mir einen Brief, auf dem Briefpapier der Germania geschrieben.
«Hiermit wird bestätigt, daß Sie von unserer Gesellschaft verpflichtet worden sind, den Brand zu untersuchen, bevor ein Anspruch auf Schadenersatz an uns ergeht. Das Haus war bei uns versichert. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, sollten Sie mit mir Verbindung aufnehmen. Unter keinen Umständen dürfen Sie Herrn Six behelligen oder auch nur seinen Namen erwähnen. Hier ist ein Dossier, das alle Hintergrundinformationen enthält, die Ihnen nützlich sein könnten.»
«Sie scheinen an alles gedacht zu haben», sagte ich spitz.
Six erhob sich, ihm folgte Schemm, und ein wenig mühsam stand ich ebenfalls auf.
«Wann werden Sie mit Ihren Ermittlungen anfangen?»
«Sofort am Morgen.»
«Ausgezeichnet.» Er klopfte mir auf die Schulter. «Ulrich wird Sie nach Hause fahren.» Darauf ging er zu seinem Schreibtisch, setzte sich in seinen Sessel und machte sich daran, ein paar Papiere durchzusehen. Er nahm von mir keine Notiz mehr.
Als ich wieder in der bescheidenen Halle stand und darauf wartete, daß der Butler mit Ulrich erschien, hörte ich, daß draußen ein weiteres Auto vorfuhr. Für eine Limousine war das Motorengeräusch zu laut, und ich schätzte, daß es sich um einen Sportwagen handelte. Eine Tür knallte zu, ich hörte Schritte auf dem Kies, und dann drehte sich knirschend ein Schlüssel im Schloß der Eingangstür. Eine Frau trat ein, in der ich auf Anhieb den Ufa-Star Ilse Rudel erkannte. Sie trug einen schwarzen Zobelmantel und ein Abendkleid aus blauem Satin. Sie blickte mich verblüfft an, während ich sie einfach nur anglotzte. Sie war es wert. Sie hatte genau den Körper, von dem ich immer nur geträumt hatte, in jenen Träumen, von denen man sich wünscht, daß sie sich wiederholen. Es gab nicht viel, was ich mir in diesen Träumen nicht ausmalen konnte, ausgenommen die gewöhnlichen Dinge wie Arbeit und Allerweltsmänner.
«Guten Morgen», sagte ich, doch der Butler war wie auf Samtpfoten zur Stelle, um sie von mir abzulenken und ihr aus dem Pelz zu helfen.
«Farraj, wo ist mein Mann?»
«Herr Six ist in der Bibliothek, Madame.» Meine blauen Augen traten ein wenig aus den Höhlen, und mir fiel das Kinn herunter. Daß diese Göttin mit dem Gnom im Arbeitszimmer verheiratet war, gehörte zu den Dingen, die mich in der Überzeugung bestärkten, daß Geld alles war. Ich sah ihr zu, wie sie zur Bibliothekstür hinter mir schritt. Frau Six – es wollte mir nicht in den Kopf – war großgewachsen, blond und sah so blühend aus wie das Schweizer Bankkonto ihres Gatten. Es war ein Zug um ihren Mund, der schlechte Laune verriet, und meine Fähigkeit, in Gesichtern zu lesen, sagte mir, daß sie gewohnt war, ihren Willen durchzusetzen: in bar. An ihren vollendeten Ohren blitzten Brillantclips, und als sie näher kam, roch ich den Duft von Eau de Cologne. Als ich gerade dachte, sie werde mich nicht beachten, warf sie einen Blick in meine Richtung und sagte kühl: «Gute Nacht, wer Sie auch sind.» Dann verschwand sie in der Bibliothek, bevor ich etwas erwidern konnte. Ich verschluckte meine Zunge und klappte den Mund zu. Ich blickte auf meine Uhr. Es war halb vier. Ulrich erschien wieder.
«Kein Wunder, daß er lange aufbleibt», sagte ich und folgte Ulrich durch die Tür.
3
Der folgende Morgen war grau und feucht. Ich erwachte mit einem ekelhaften Geschmack im Mund, trank eine Tasse Kaffee und überflog die Berliner Börsenzeitung, die ungenießbarer war als gewöhnlich, denn die Sätze waren so lang und so unverständlich wie eine Rede von Rudolf Heß.
Ich rasierte mich, zog mich an, klemmte meinen Wäschesack unter den Arm und war weniger als eine Stunde später am Alexanderplatz. Nähert man sich ihm von der Neuen Königstraße, wird der Platz von zwei großen Bürohäusern flankiert: dem Berolina-Haus rechts und dem Alexander-Haus links, wo ich im vierten Stock mein Büro hatte. Bevor ich ins Büro ging, lieferte ich meinen Wäschesack im Erdgeschoß bei der Adler-Wäscherei ab.
Beim Warten auf den Lift war eine kleine Anschlagtafel kaum zu übersehen, an der eine Aufforderung klebte, die Sammlung für Mutter und Kind zu unterstützen, sowie die Anordnung der Partei, einen antisemitischen Film zu besuchen, und dazu kam noch ein prachtvolles Führerbild. Für diese Anschlagtafel war der Hausmeister Gruber verantwortlich, ein verschlagener kleiner Mann, der aussah wie ein Leichenbestatter. Er ist nicht nur der Blockwart mit Polizeibefugnis (die ihm die Orpo, die reguläre uniformierte Polizei, übertragen hat), sondern auch ein Spitzel der Gestapo. Vor langer Zeit war ich zu dem Schluß gekommen, daß es schlecht für das Geschäft war, wenn man sich mit Gruber anlegt; also gab ich ihm, wie alle anderen Bewohner des Hauses, wöchentlich drei Mark, in der Annahme, damit alle meine Beiträge zu den immer neuen Geldbeschaffungsmaßnahmen abgedeckt zu haben, welche die Deutsche Arbeitsfront sich einfallen ließ.
Ich verfluchte die Langsamkeit des Lifts, als Grubers Tür sich gerade so weit öffnete, daß sein Haifischgesicht den Flur entlangspähen konnte.
«Ah, Herr Gunther, Sie sind’s», sagte er, aus seinem Büro kommend. Er watschelte auf mich zu wie ein Krebs, der unter Hühneraugen leidet.
«Guten Morgen, Herr Gruber», sagte ich und vermied es, ihm ins Gesicht zu sehen. Sein Gesicht hatte etwas von Nosferatu, wie ihn Max Schreck im Film verkörpert hatte, ein Eindruck, der durch die manischen Waschbewegungen seiner skelettartigen Hände verstärkt wurde.
«Da war eine junge Dame, die Sie sprechen wollte», sagte er. «Ich habe sie raufgeschickt. Ich hoffe, das war richtig so, Herr Gunther.»
«Ja …»
«Das heißt, falls sie noch da ist», sagte er. «Das war vor mindestens einer halben Stunde. Da ich wußte, daß Fräulein Lehmann nicht mehr für Sie arbeitet, mußte ich ihr mitteilen, daß ich nicht sagen könne, wann Sie aufkreuzen würden, weil Sie immer zu so ungewöhnlichen Zeiten kämen.» Zu meiner Erleichterung kam der Lift, ich zog die Tür auf und trat hinein.
«Danke, Herr Gruber», sagte ich und schloß die Tür.
«Heil Hitler», sagte er. Der Lift begann im Schacht nach oben zu schweben. Ich rief: «Heil Hitler.» Bei jemandem wie Gruber sollte man den Hitlergruß nicht vergessen. Es lohnt den Ärger nicht. Aber eines Tages werde ich diesem Wiesel die Zähne einschlagen, bloß aus reinem Vergnügen.
Ich teile die vierte Etage mit einem «Deutschen» Zahnarzt, einem «Deutschen» Versicherungsagenten und einer «Deutschen» Arbeitsvermittlung; das letztgenannte Büro hat mir die vorläufige Sekretärin besorgt. Sie war vermutlich die Frau, die jetzt in meinem Vorzimmer wartete. Als ich aus dem Lift trat, hoffte ich, daß sie nicht abgrundhäßlich war. Natürlich nahm ich nicht an, daß ich ein knackiges Mädchen kriegen würde, andererseits war ich auch nicht scharf genug darauf, mich auf eine Brillenschlange einzustellen. Ich öffnete die Tür.
«Herr Gunther?» Sie stand auf, und ich schätzte sie mit einem Blick ab: Nun, sie war nicht so jung, wie ich nach Grubers Worten angenommen hatte (ich schätzte sie auf etwa fünfundvierzig), aber nicht übel, wie mir schien. Vielleicht ein bißchen bieder und schnuckelig (sie hatte einen gediegenen Hintern), aber zufällig mag ich das. Ihr Haar war rot, mit einer Spur Grau an Schläfen und Wirbel, und zu einem Knoten zurückgebunden. Sie trug ein Kostüm aus schlichtem grauem Tuch, eine weiße, hochgeschlossene Bluse und einen schwarzen Hut mit umlaufendem, hochstehendem Rand.
«Guten Morgen», sagte ich so liebenswürdig, wie ich es angesichts meines ausgewachsenen Katers vermochte. «Sie müssen meine vorläufige Sekretärin sein.» Ich war froh, daß ich überhaupt eine Frau bekommen hatte, und diese sah halbwegs annehmbar aus.
«Frau Protze», erklärte sie und reichte mir die Hand. «Ich bin verwitwet.»