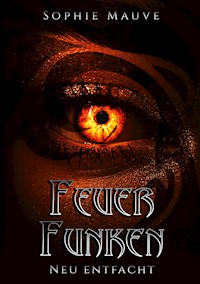
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die ganze Welt ist eine Bühne - so sehen es Annabelle, Melinda und Jackie, die auf die Akademie der Schaustellung gehen und der Musiktheatergruppe Feuerfunken beitreten. Sie wollen tanzen und singen und im Internatszimmer über ihre Gefühle und Träume reden. Wie man das mit 14 halt so macht. Doch sie erfahren schnell, dass das Leben kein Wunschkonzert ist. Dass manchmal gerne zwei Personen die gleiche Rolle in der romantischen Komödie spielen würden. Doch nur eine bekommt sie! Und es ist gar nicht so einfach, die Charakterfarbe von dem zu übernehmen, den man liebt, wie es im Weizental üblich ist. Zum Glück gibt ihnen das Bühnenleben die Möglichkeit, ihre äußeren und inneren Kämpfe "nur zu spielen"... Dann kommt Jackie auf die irrsinnige Idee, das Land zu verlassen. Einfach so zum Spaß, weil es ihr trotz des ganzen Gefühlschaos noch zu langweilig ist. Sie will die Welt erkunden, nur in Begleitung ihrer Fuchsdämonin Diana. Bringt sie diesen Schritt übers Herz? Oder wird sie von ihren Freundinnen und einem frechen Kater mit Gesangstalent zurückgehalten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen (echten) Kater Whiskey. Ruhe in Frieden auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke. Und für meine Großeltern.
Falls du eine Inhaltswarnung benötigst, findest du diese auf der letzten Seite des Buches. Achtung, die Warnung enthält leichte Spoiler.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Sieben Jahre zuvor …
Brot
Eis und Feuer
Träume
Spiegelbild
Fauchen
Lagerfeuer
Aussichten
Erinnerungen
Tonscherben
Frechheit siegt
Zukunft
Rückkehr
Vogelhochzeit
Zügel und Leinen
Von allen guten Geistern verlassen
Paradies
Grünlicht
Tempelfassade
Im Sog
Silber
Ricky!
Gerüchteküche
Kreidestaub
Katzensprung
Regen bringt Segen
Hefe
Eine andere
Improvisation
Mittsommernacht
Das Fass ist übergelaufen
Hörrohre für alle!
Ich. Sie. Er.
Mausefänger
Klartext
Gleichgesinnte
Zielscheibe
Der Ritter
Flügge
Die Türme von Algon
Vorwort
Mit wichtigem Disclaimer
Die Geschichte der Feuerfunken basiert auf wahren Begebenheiten, und ich habe sie selbst erlebt.
Warum ist das wichtig?
Weil Annabelle, Melinda und Jackie (und auch all die anderen Charaktere in diesem Buch) keine Ideale sind. Sie sind keine ausgedachten Heldinnen oder Vorbilder. Was sie denken und tun, ist nicht unbedingt richtig. Aber es ist echt und ich wollte, abgesehen von den Fantasyelementen, so nah an der Wahrheit bleiben wie möglich.
Wir haben diese Story in den Jahren 2008 – 2010 erlebt und waren damals 14 – 16 Jahre alt. Da kann sich eine unerwiderte Liebe schon einmal anfühlen wie das Ende des Lebens. Auch wenn es das natürlich nicht ist!
Außerdem möchte ich euch etwas zu dem Hintergrund der »Signaturen« erzählen und warum in meiner Welt nur Männer von sich aus Tiermerkmale haben. Es war damals eine Art Geheimsprache für uns. Wir haben, als man sich noch nicht getraut hat, zu sagen, in wen man sich verknallt hat, Spitznamen verwendet. Oft waren das Tiere, aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel nannten wir einen Jungen namens Lars heimlich »den Eisbären«, wegen des entsprechenden Kinderbuchcharakters. Zudem sind wir in einer Theaterwelt aufgewachsen und wenn in einem Stück jemand einen Esel gespielt hat, dann war er für uns von nun an eben "der Esel". So entstand die Idee für diese Welt.
Also nein, ein Mädchen ist nicht erst komplett, wenn sie einen Jungen liebt! Erst recht nicht erst dann, wenn die Gefühle erwidert werden. Ihr seid selbst stark und vollständig und habt sicher im Inneren euer eigenes Seelentier. Dieses Buch beschreibt nur, wie wir es als Teenager gesehen und gefühlt und wie wir geredet haben.
Mit diesem Wissen im Hinterkopf wünsche ich euch nun viel Spaß.
Eure Sophie Mauve
Es war einmal ein Gefühl, das sich Liebe nannte. Ob es wohl schon gestorben ist?
(anonyme Wandmalerei in Algon)
Sieben Jahre zuvor …
Mucksmäuschenstill lag Melinda mit ihrer schwarzen Katze Chibi auf dem Bett. Sie lag auf dem Bauch und wippte leicht mit den Füßen. Durch die leicht geöffnete Zimmertür konnten das Schulkind und ihre Katze zwei Jungen sehen und hören. Der eine von ihnen war Melindas Bruder, der andere war dessen bester Freund, ihr Nachbar.
Bald stand der zehnte Geburtstag des Nachbarn an. Deswegen waren die Jungs schon ganz aufgeregt.
»Weißt du schon, was dir dann für Dinger wachsen?«, fragte Melindas Bruder seinen Kumpel.
»Ich hab keinen Plan«, antwortete dieser seufzend.
»Ich glaube«, sagte der erste wieder, »du wirst ein Fisch. Weil weißt du, irgendwie tauchst du immer in deine eigene Welt ab. Keine Ahnung, warum du das machst, aber ist so.«
Der Nachbar gab Melindas Bruder einen freundschaftlichen Stoß. Daraufhin meinte wieder ihr Bruder: »Ja, wirklich, ich glaube, du wirst ein Fisch! Oder ein Reptil, das sich verkriecht. Aber irgendwas Harmloses. Für einen Hai oder eine Schlange bist du nämlich zu friedlich. Ist echt schwierig.«
Kurzes Schweigen.
»Ich sag ja nur. Du versteckst dich ständig und dir ist immer kalt, du musst irgendein Kaltblüter sein.«
Bei diesen Worten zog der angesprochene Junge seine Ärmel über die Hände.
Melinda streichelte weiterhin ihre Katze, bemüht lautlos zu atmen, damit sie weiter lauschen konnte. Sie wollte so gerne wissen, wie ihr Nachbar aussehen würde, wenn er zehn Jahre alt geworden war.
Wenn ihr lebender Bruder es schon nicht wusste, vielleicht hatte ihr ungeborener Bruder zwischen ihren Schulterknochen eine Vorahnung. Er wusste sicher auch, warum Melinda in diesem Moment still zusammenbrach.
»Annabelle, wann ist endlich der Reis fertig!?«, rief Belles Mutter durch das ganze Haus.
»Gleich Mama«, kam die patzige Antwort.
»Ich hasse Reis!«, motzte Belles Bruder.
»Ich esse meinen nur, wenn ich den Holzteller haben kann«, warf Annika ein, die älteste von Belles jüngeren Schwestern.
Belle seufzte. Fünf kleine Geschwister saßen um sie herum. Keiner von ihnen konnte ihr helfen, nur sie allein musste arbeiten. Sie alle waren noch zu klein, um Aufgaben im Haushalt zu übernehmen. Belle war ja selbst erst sieben Jahre alt. Die jüngste Tochter der Familie Empre war gerade mal drei Monate auf dieser Welt. Die sollte eigentlich auf ihrer Decke schlafen, doch sie schrie unentwegt.
Belle mochte es manchmal gar nicht, in einer Großfamilie zu leben. Der ältere ihrer Brüder, August, saß neben ihr auf dem Hocker und versuchte, Karotten zu schälen. Er und Annika waren die einzigen, die wenigstens ein bisschen was machen konnten. Und aus irgendwelchen Gründen hatten ihre Eltern jedem Kind einen Namen mit A gegeben.
Die kleinen Zwillinge krabbelten über den Boden und bewarfen sich mit allem, was sie finden konnten.
Ihre Mutter kam in die Küche: »Annabelle, warum dauert das so lange?!?«
Sie sah gestresst aus.
»Ich habe nur zwei Hände!«, rief Belle zurück.
Ihr jüngster Brüder schaute auf seine Hände. »Ich hab auch zwei!«
Belle verdrehte die Augen.
»Annabelle«, fing ihre Mutter wieder an. »Gehst du nach dem Essen noch zum Markt? Danke, wir brauchen nämlich Äpfel. Und nimm Oma mit. Sie muss mehr laufen oder sie rostet uns noch ein.«
Belle nickte stumm. Was hätte sie auch sonst tun sollen? Hinter ihr erklang ein Schrei. Die zweitjüngste Schwester hatte einen Holzlöffel ins Gesicht bekommen. Sie blutete an der Stirn. Ihre Mutter seufzte, packte die Weinende und brachte sie ins Bad.
Belle rührte weiter. Das Familienleben war anstrengend. Aber es war alles, was sie kannte.
So heftig wie heute hatte die Sonne schon lange nicht mehr vom Himmel gebrannt.
Jackie blieb hechelnd auf der obersten Stufe einer Steintreppe stehen. Wo war er? Hinter ihr vielleicht? Aber dann hätte sie Schritte hören müssen. Sie schnaufte ein bisschen leiser. Puh, war das warm.
Es herrschte ein reges Treiben um sie herum und ein Stimmenwirrwarr aus dem, was die Gäste des Dorffestes sich zu erzählen hatten. Die Musik hatte schon vor einer Weile aufgehört zu spielen. Aber das war besser so! Denn jetzt konnten die Jungs, die vorhin noch die Musik gemacht hatten, Jackie und ihrer Freundin Belle hinterherjagen, kreuz und quer über den Platz.
Die Kerle waren ein Stück älter als die beiden Mädchen, sie hatten sogar schon Tiersignaturen. Da war ein Löwe, der lustig redete. Ein kleiner munterer Salamander. Noch jemand, bei dem Jackie beim besten Willen nicht wusste, was er mal werden sollte und da war ein Schwan. Ein Schwan mit einem ansteckenden Lächeln, der es aber faustdick hinter den gefiederten Ohren hatte. Achtung, da hinten war er!
Drohend hob Jackie ihren Becher voll Wasser, den sie in der Hand hielt. Ihr Ziel war, den Schwan und die anderen damit nass zu machen. Die Jungs waren ein wenig genervt davon und natürlich wollten sie nicht gegen ein siebenjähriges Mädchen verlieren. Aber wirklich böse waren sie ihr auch nicht. Immerhin herrschte eine unerträgliche Hitze, die eine kleine Abkühlung herzlich willkommen machte.
Das Lustigste war, dass die Jungs sich mit Kohle und Ton eine Art Flammenzeichen auf den Arm gemalt hatten. Diese galt es nun zu ›löschen‹, also mit dem Wasser verschwimmen zu lassen.
Jackie entschied sich, ihre Schuhe auszuziehen. Die machten sie beim Rennen bloß langsamer, wenn sie nass wurden. Barfuß und mit Gebrüll stürmte sie auf den Salamander los. Er reagierte zu spät, sie holte ihn ein. Belle kam in dem Moment von einer Bank gesprungen. Zusammen drängten sie den Salamander in die Ecke. Panisch ließ er seine türkisene Zunge hervorschnellen.
Jackie zögerte nicht. Unter Lachen schleuderte sie das gesamte Wasser in sein Gesicht. Der Salamander prustete. Dann rief er: »Los!«, und im nächsten Augenblick hatten mindestens drei Paar Hände Jackie fest im Griff. Sie wehrte sich ein bisschen, aber nicht zu arg, denn zwei der Hände gehörten Salomon, dem Schwan.
Leert mir doch alles über, dachte sich Jackie. Ich bin so kaputt vom Rennen, das täte jetzt echt gut!
Was dann passierte, hätte sie nie erwartet.
Der Kleinste aus der Bande, der nicht nur grüne, flauschige Signaturen, sondern auch feuerrote Haare hatte, kam mit einem schweren Eimer quer über den Marktplatz gelaufen. Jackie schwante Übles, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie zappelte ein wenig mehr. Belle neben ihr redete auf die Jungs ein, das wäre nicht fair, sie würden sich freiwillig ergeben und so weiter. Keine Chance. Ehe Jackie sich versah, war sie nass bis auf die Knochen. Die Jungs mit den Feuerzeichnungen auf der Haut hatten ihr den gesamten Eimer Wasser übergegossen!
Verdammter Mist! Aber es tat gut …
Brot
Die Straßen von Lechim waren voller Menschen. Es war Markttag, wie an jedem Vollmondtag. Reges Treiben, wo das Auge hinsah. Alle Bürger des Dorfes und die Besucher von außerhalb kauften und verkauften, schwatzten, lachten, tranken, riefen und sangen. Ein alter Mann mit weißem Bart saß auf einem Wagen, der von einem Esel gezogen wurde und ließ seinen Blick schweifen. Über dem Stand des Metzgers leerte eine Frau wütend ihr Putzwasser aus dem Fenster und fluchte etwas zu ihrem Ehemann. Der Metzger duckte sich erschrocken weg.
»Trink doch nicht so viel schon am Mittag!«, schrie die feine Dame ihren Mann an. Am Fenster neben ihr streckte eine jüngere Frau den Kopf heraus und brüllte zurück: »Halten Sie Ihr Maul! Mein Kleiner ist gerade erst eingeschlafen!« Die Frau mit dem Putzeimer schlug temperamentvoll die Läden zu. Dudelsackmusik setzte ein. Das Rauschen und Zischen der Feuerspeier untermalten ihn. Es schepperte, klackerte und hallte von überall.
Melinda bahnte sich ihren Weg durch die Menge. Sie war von ihrer Mutter geschickt worden, um Brot zu holen. Im Getümmel trat sie versehentlich einem kleinen Jungen auf den Fuß, der sofort zu weinen anfing. Seine Mutter schaute böse auf Melinda herab. Die zog sich ihre schwarze Kapuze tiefer in die Stirn. Die Frau scharrte mit einem Huf auf dem Kopfsteinpflaster. Was für ein widerliches Geräusch.
Obwohl es so eine Banalität war, kämpfte Melinda mit den Tränen. Seit letzter Woche tat sie nichts anderes, als ihre Tränen zu unterdrücken. Doch nicht mal in ihren Gedanken traute sie sich, in Worte zu fassen, was ihr vor wenigen Tagen passiert war. Die Ratlosigkeit, der Ekel, die Wut – alles versuchte, sich über diesen nassen, salzigen Weg ans Freie zu kämpfen.
»Dieser … dieser ekelhafte Mistkerl!«, fluchte Melinda vor sich hin. »Stirb, verdammt noch mal! Ich will, dass du elendig im Feuer verbrannt wirst. Oder dass du langsam verblutest. Qualvoll! So wie ich es innerlich tue.«
Sie schaffte es irgendwie, sich zum Bäcker durchzukämpfen. Der Bäcker war ein grober, aber herzensguter kräftiger Mann mit roten krausen Haaren und karierter Schürze. Seine pelzigen Bärentatzen hatte er in die Seiten gestemmt, sein Blick ging zur Holzbühne gegenüber der Bäckerei. Die ließ Bäcker Bär immer im Sommer aufbauen und von Musikanten und Tänzern belagern, um die Kundschaft zu locken. Wer ihm oder dem Publikum besonders gut gefiel, der bekam auch mal Gebäck geschenkt.
Auf den Brettern tanzte gerade eine Gruppe Jungs, die ein wenig älter als Melinda waren, vermutlich so sechzehn oder siebzehn. Melinda musste trotz ihrer betrübten Laune zugeben, dass die Tänzer gar nicht schlecht waren. Sie alle trugen Federn auf den Köpfen; zwei von ihnen hatten sogar große geschwungene Flügel.
»Die machen das gut, oder?«, fragte ein Mädchen neben ihr, das wohl Melindas Blick bemerkt hatte.
Das Mädchen hatte lange feuerrote Locken, trug lose Kleidung, war recht groß und hatte einen Fuchs im Arm. Zwischen dem weichen Fuchsfell konnte man ihre grau-rosa Fingernägel sehen und auch ihre Augen waren von einem freundlichen Rosa mit grauem Rand. Die Haare könnte sie mit Henna gefärbt haben, sonst würden sie wahrscheinlich ähnlich aussehen.
Neben ihr stand noch ein anderes Mädchen, kleiner, mit kurzen, wilden, blonden Haaren und hellgrünen Strähnen, die von einem Haarreif notdürftig in Zaum gehalten wurden. Auf der Wange hatte sie einen dunklen Schönheitsfleck, ihre Nägel waren natürlich auch von einem fröhlichen Grün und sie konnte sich kaum halten vor Lachen, als sie sagte: »Guck mal, wie die mit ihren Entenpopos wackeln!« Sie quiekte und kicherte ohne Hemmungen.
»Ja schon«, meinte Melinda, »aber eigentlich bin ich nur hier, um Brot zu kaufen.«
In diesem Moment wurde die Musik schneller und lauter.
»Irgendwie hätte ich Lust, mitzumachen«, überlegte das Mädchen mit dem Fuchs.
Kaum hatte sie das gesagt, setzte sie ihren Fuchs auf den Boden und zog ihre noch immer lachende, blond-grüne Freundin mit sich auf die Holzblanken. Die Zuschauer und die Tänzer begrüßten die beiden mit Applaus.
Melinda sah lieber zu. Aber irgendein Vollpfosten hinter ihr wollte sich nach vorne drängen und schob Melinda dabei regelrecht auf die Holzbretter hoch. Das Fuchsmädchen, so nannte Melinda sie nun, streckte ihr die Hand entgegen. »Komm. Wir brauchen eh mehr Stimmung hier oben.«
Melinda zuckte mit den Schultern. Sie zog sich ihre Kapuze vom Kopf, schnickte ihr schwarz-lila, seidig glattes Haar aus dem Gesicht und kletterte unbeholfen auf die Bühne. Ein Blick nach links, einer nach rechts – egal! Drauf geschissen! Sie fing vorsichtig an zu tanzen.
Die Vögel hatten inzwischen belustigt die Fläche für die drei Tänzerinnen geräumt. Das Publikum klatschte im Takt. Nach und nach verlor Melinda ihre Hemmungen. Es machte ihr tatsächlich Spaß. Die drei Mädchen flogen über die Bühne, bis ihnen schwindelig wurde. Zum Schluss ließen sie sich wie ohnmächtig und völlig außer Atem auf die Bretter fallen. Für einen kurzen Moment war alles still. Dann fingen die Leute an zu applaudieren und zu pfeifen. Erst leise, dann immer lauter, noch lauter als bei jedem Lied davor. Melinda konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Applaus ihr gelten sollte. Das war bestimmt wegen dem blonden Mädchen. Sie war wirklich gut.
Der Bäcker hob einen seiner Brotkörbe hoch. Behäbig ging er auf die Bühne zu. »Meine Damen, meine Damen, das war ja der Wahnsinn. Wenn ihr hier weiter so tanzt, lockt ihr mir noch mehr Kunden vor die Türe, als ich bedienen kann. Nehmt als Zeichen meiner Dankbarkeit jeder ein frisches Roggenbrot. Nur für euch gebacken natürlich.«
Er zwinkerte freundlich.
Hinter ihm kam eine junge Frau aus der Bäckerei heraus, im eng geschnürten Kleid und mit davor verschränkten Armen. Ihr Blick stach auf Melinda und die beiden anderen ein. Doch sie sahen es nur aus den Augenwinkeln. Als sie mit dem duftenden Brot unter dem Arm von der Bühne abgingen, sprang der Fuchs wieder auf den Arm seines Frauchens. Sie kraulte ihn am Rücken. »Ist ja gut, Kleine. Du bekommst auch was ab.«
Melinda hatte eben zum ersten Mal seit Tagen gelacht. Es kam ihr so merkwürdig vor, dass sie ihre Mundwinkel direkt wieder nach unten zog. Sie fand allerdings auch, dass es an der Zeit war, sich ihren vorübergehenden Stimmungsheberinnen vorzustellen. »Ich bin übrigens Melinda. Ich wohne auf diesem Bauernhof genau am Waldrand, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum ich das hier gerade gemacht habe.« Sie griff sich an den Kopf. »Normalerweise wäre mir so etwas zu peinlich. Aber irgendwie auch wieder nicht.«
»Oh, aber du hast es überlebt«, sagte das Fuchs-Mädchen, »und ich glaube nicht, dass wir peinlich waren. Ich bin Jackie. Eigentlich Jacoba, aber so sagt niemand zu mir. Das hier …«, sie zeigte auf ihre Freundin, »ist Belle, und ich glaube, ich mache dich auch mit Diana bekannt.« Sie hob ihren Fuchs hoch und ging mit ihm näher an Melinda heran.
Dianas Blick war von einem strahlenden Türkis, aber er war kein wenig kalt, sondern angenehm warm. Es war, als würde eine tiefe innere Ruhe von dem Tier ausgehen. Melinda konnte es sich nicht verkneifen, Diana durch das weiche Fell zu streichen. Sie zuckte zusammen. Hatte eben eine Stimme aus den Augen der Füchsin gesagt: »Das fühlt sich gut an« – oder verlor Melinda jetzt endgültig ihren Verstand?!
Belle zog an Jackies Ärmel. »Jackie, ich hab ne Idee, wir kaufen da vorne gebratene Maiskolben. Damit erschlag ich dann den Eberhardt. Weißt du«, sprach sie an Melinda gewandt. »Eberhardt ist ein absoluter Depp. Ich verstehe null, wie ich den mal gut finden konnte. Ich meine, ich hatte einen verdammten knallgrünen Rüssel!!!!«
Melinda zog die Mundwinkel noch einmal kurz hoch. Rüssel? Dieser Eberhardt musste Elefantensignaturen haben. »Hast du seine Signaturen verloren oder sind sie noch da?«, fragte sie zögerlich.
Belle nickte hektisch. »Ja, verloren. Und ich hoffe«, lachte sie nervös, »mir wachsen so schnell keine mehr. Dann wäre ich nämlich ein ziemlicher Esel – oder was halt immer ich dann bin.«
Interessant. Eine ehemalige Elefantendame also. Melinda kratzte sich am Nacken. Dort spürte sie ihre ledrige Haut, die von steifen Schuppen durchzogen war. Verdeckt von ihrem Mantel hatte sie auf ihrem Rücken einen angedeuteten Schildkrötenpanzer. Doch die fremdartige Hornhaut war dunkellila – nicht silbergrau, wie sie sein sollte. Und ihr Nachbar Ricky würde niemals auch nur eine einzige dunkle Strähne im Haar tragen. Das würde ja auch nicht zu seiner hellen Aura passen. Leider.
Melinda wollte es den beiden anderen lieber gleich erzählen, bevor sie eines Tages zufällig darauf stießen. »Bei mir ist es Wasserschildkröte.«
Jackie schaute sie an. »Oh, schön. Darf man wissen, von wem?«
Melinda zog sich wieder die Kapuze über.
»Wollte es nur gesagt haben. Als Warnung halt. Ist schon seit vier Jahren so, seit ich überhaupt welche bekommen konnte. Dummerweise wird der Mist für alle Ewigkeiten lila bleiben. Sie werden nie, nie, nie silbern sein.« Sie ließ die Schultern hängen. Jackie berührte Melinda am Rücken und fühlte die harten Schuppen. Dabei schwieg sie.
Sie hatte nichts zu erzählen, denn seit Ewigkeiten hatte sie selbst keine wirklichen Signaturen mehr an sich finden können. Als vor etwas über vier Jahren auch bei ihr zum ersten Mal welche aufgetaucht waren, hatte sie ein paar Schwanenfedern gehabt. Aber was machte das schon aus? Gar nichts. Sie konnte jedoch gut erfühlen, dass sich unter dem Stoff von Melindas Kapuze schuppige Haut befand. Es fühlte sich an, als wären diese Schuppen dort sehr fest verwachsen.
Die Marktstände wurden nach und nach abgebaut, die Waren eingepackt. Man hörte hier und dort das Klappern von Rädern auf Stein, Menschen, die angetrunken durch die Gassen taumelten, das Rufen ungeduldiger Frauen, die ihre Männer einsammelten oder das Quengeln eines Kindes. Der Vollmond ging hell am Himmel auf und der Horizont wurde lila und rot, während Belle mit sich überschlagenden Worten erzählte, wie sie den Elefanten Eberhardt kennengelernt hatte.
Eis und Feuer
Melinda kam erst spät abends zuhause auf dem Bauernhof an. Sie legte das Brot auf den hölzernen Küchentisch. Ihre Mutter schnitt gerade Gemüse. Sie begrüßte ihre Tochter kurz angebunden: »Wo warst du so lange?« Sie nahm eine weitere Tomate, wobei sie Melinda nicht ansah. »Geh mal zu deinem Bruder und Ricky und schau nach, ob sie endlich das Heu raus zu den Tieren gebracht haben. Das hätten sie besser tun sollen als es noch hell war, aber du kennst die beiden ja.«
»Ja, ist gut.« Melinda machte kehrt.
Gute Gelegenheit eigentlich, dachte sie, heute muss ich es endlich über mich bringen.
Sie schlich auf Zehenspitzen auf den Heuboden, denn sie hatte von oben Schritte und Stimmen gehört. Nervös zupfte sie an der tiefblauen Blüte herum, die sie sich auf dem Heimweg ins Haar gesteckt hatte. Hoffentlich sah sie so schön aus, wie Melinda sich das vorstellte.
Dort oben auf dem Heuboden saßen tatsächlich ihr Bruder Nolan und sein bester Freund, Ricky. Melinda lief es kalt den Panzerrücken hinunter. Nolans graue Tatzen umklammerten ein großes Stück Holz. Sein buschiges Fell an den Armen war übersät mit Sägespänen. Er schnitzte mal wieder etwas. Ricky hockte daneben. Er hatte Melinda den Rücken zugewandt. Trotz seiner länger gewordenen Haare und dem dicken Hemd konnte sie die Panzerschuppen darunter ausmachen. Auch an Händen und Füßen hatte er silbrig-graue Stellen, doch die waren so verschmutzt, dass sie nun eher braun waren.
Nolan bemerkte Melinda an der Dachluke. »Guten Abend Schwesterchen. Wie war dein Ausflug auf den Markt?« Er unterbrach dabei seine Schnitzerei.
Nun drehte Ricky den Kopf. Seine stechend blauen Augen schienen sich in Melindas Kopf zu bohren. Sie starrte erst mal nur ausdruckslos zurück. Wenn sie in diese Augen sah, fühlte sich wie gefangen in einem Tunnel aus Eis, in dem sie leider erfrieren musste.
»Hör auf«, sagte sie.
Ricky zog eine Braue hoch: »Womit?«
Melinda schüttelte den Kopf und winkte ab. »Vergiss es.« Dabei verrutschte ihre Blüte ein wenig. Sie schluckte, dann fuhr sie fort: »Nolan, Mama hat gesagt, ihr sollt noch das Heu zu den Tieren bringen. Und sie wollte noch irgendwas anderes von dir.«
Seufzend erhob sich Nolan. Er warf zwei Ballen seitlich aus der Scheune heraus. »Kommst du mit?«, fragte er Ricky. Ricky wollte mitgehen. Melinda stieg die letzten Stufen durch die Falltür nach oben auf den Heuboden. Sie ließ ihren Bruder durch. Als Ricky nach ihm die Stufen hinabsteigen wollte, zog sie schnell an der Leine und ließ die Klappe zufallen. Dann stellte sie einen Fuß darauf.
»Was ist los?«, wollte Ricky wissen. »Ich muss da runter und ihm helfen.«
Melinda verschränkte die Arme vor der Brust. »Setz dich hin.« Ricky gehorchte. Melinda tappte nervös mit dem Fuß. Ricky kratzte sich mit seinen schmutzigen Fingernägeln am Knie. »Was ist denn, Melinda?!«
Wie ein Tiger im Käfig lief sie auf dem Heuboden auf und ab. Es war Abend, doch es war furchtbar heiß hier drin. Sie schwitzte am ganzen Körper.
»Hör zu Ricky«, brachte sie heraus. »Ich … ich mag … dich sehr gerne.«
So, jetzt hab ich’s gesagt, dachte sie triumphierend.
»Hä? Ich mag dich doch auch.« Ricky kratzte sich erneut.
»Wirklich?!« Melindas Augen standen weit offen.
»Ja klar!«, antwortete Ricky. »Du bist die kleine Schwester meines besten Freundes, der wie mein Bruder ist. Also bist du auf gewisse Art auch meine Schwester. Ich freu mich immer, dich zu sehen, weißt du doch.«
Melindas Mund war nun so weit offen wie ihre Augen. Sie blinzelte ungläubig. »Kleine … Schwester???« Sie schluckte. Ein neuer, unangenehm großer Kloß steckte jetzt in ihrem Hals.
»Ja genau, wir sind wie eine Familie«, wiederholte Ricky und stand auf.
»Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe?!«, krächzte Melinda. Sie nahm noch einmal tief Luft: »Ich – mag – dich. Und – ich – ich habe einen Panzer!«
Für einen kurzen Moment herrschte Stille. Dann lachte Ricky los. Er lachte und lachte und konnte nicht mehr aufhören.
»Ach Schwesterlein«, sagte er, »es ist normal, dass kleine Schwestern ihre Brüder lieben. Und da wir genau genommen nicht miteinander verwandt sind, baut dein Körper Signaturen. Der kann das nicht unterscheiden. Das ist doch aber alles Blödsinn. Ich geh dir doch jeden Tag auf die Nerven. Wie ein Bruder eben!«
Er lief zur Falltür, zog an der Leine, sodass sich die Luke öffnete und sprang in zwei Sätzen hinunter. »Auf Wiedersehen, Schwesterlein. Ich mag dich auch!« Weg war er.
Melinda ließ einen spitzen Schrei fahren, den sie direkt mit ihrer Hand erstickte. Dafür hatte sie nun all die Jahre geprobt?!?!
Immer wieder war sie die Situation in ihrem Kopf durchgegangen. Sie wollte sogar, dass es auf diesem Heuboden war. Allein. Also eigentlich zu zweit. Sonst weit und breit niemand. Sonnenstrahlen würden durch die Ritzen im Holzdach fallen. Gut, das war heute nicht gegeben. Aber der Mond schien. Die Strahlen würden sich in Rickys Eiswasseraugen widerspiegeln. Und sie würden sich zusammen ins Heu legen, Seite an Seite und sich geheime Dinge erzählen bis tief in die Nacht. Soweit der Plan.
Zornig trat sie gegen das halbfertig geschnitzte Holzstück ihres Bruders.
Meine Hornhaut auf dem Rücken habe ich seit vier Jahren. Seit ich alt genug bin, welche zu haben. Wobei ich mich sogar schon lange vorher verliebt hatte. So leicht geht die jetzt nicht mehr weg. Da wächst nie wieder was anderes. Dabei ist er so ein Idiot. Ein absoluter Idiot! Melinda trampelte auf, dass die Balken bebten. Doch sie verharrte augenblicklich. Was, wenn ihre Mutter sie hörte? Oder Nolan?
Verzweifelt schaute sie sich um. Es wird nichts Neues mehr wachsen, ich kann es nicht wegschneiden lassen – das täte zu sehr weh. Ich muss es beenden. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten. Schweiß rann aus den langen glänzenden Haaren in ihre Augen. Es brannte höllisch. Doch in ihr drin brannte es mehr. Da war so viel Wut. So viel Machtlosigkeit. Sie sah das kleine Fenster an der hohen Wand, an der die Heuballen gestapelt waren. Da kletterte sie hinauf. Die trockenen Halme kratzten fürchterlich an ihren Beinen, Händen, Füßen. Melinda kletterte weiter. Ihr war das alles egal. Immer wieder hörte sie eine Kinderstimme, die ihr sagte: »Mach weiter. Klettere weiter. Du findest da oben deine ersehnte Erlösung.«
Als sie oben ankam, sah sie kurz hinunter. Felsen, ein Bach, etwas weiter die Mühle. Sie lehnte sich ein Stück hinaus. Hoffentlich sahen ihr Bruder und Ricky nicht nach oben. Mit der linken Hand griff sie nach einem Ast, der bis an die Scheune reichte. Sie kniete sich auf den Rahmen. Die rechte Hand kam noch nicht an den Ast vor ihr heran. Melinda schloss die Augen, spannte ihren Arm an und schwang sich aus dem Fenster. Panisch griff ihre andere Hand nach oben. Sie bekam einen Ast zu fassen. Doch er war zu dünn. Ihre Hand rutschte ab. Sie schnappte noch mal nach oben. Diesmal konnte sie einen stärkeren Zweig erfassen. Sie öffnete vorsichtig die Augen. Unter ihr das kleine Rinnsal und diese spitzen Felsen. Genau, was sie jetzt brauchte! Das Vollmondlicht strahlte auf ihren Rücken, auf die verdammten Schuppen. Sie hing dort oben für ein paar Sekunden. Dann schwang sie ihre Beine nach vorn, bis sie eine Astgabelung berührten. Sie ließ die linke Hand schnell los, schwang sich zu dem dicken Baumstamm hin und wurde von hartem Gestrüpp aufgefangen.
Der Baum war riesig und stark verzweigt. Melindas Ziel war eine breite Gabelung weiter oben, die direkt über einem der spitzesten Steine lag. Von dort wollte sie fallen.
Wenn selbst Ricky mich auslacht, dann bin ich für diese Welt zu lächerlich, dachte Melinda. Sie hörte unten im Hof ihren Bruder etwas rufen. Es hatte damit zu tun, dass zu viel Asche um die Feuerstelle herum lag. Ricky half ihm sofort, sie aufzufegen.
Asche zu Asche, Staub zu Staub, ging es Melinda durch den Kopf.
Sie hatte ihre Astgabelung fast erreicht. Sie stieg noch eine Stufe höher. Sie griff nach einer moosigen Stelle – ein Fauchen vom Himmel her – es wurde schwarz vor ihren Augen.
Unten im Hof drehten Ricky und Nolan sich um. »Hast du das auch gehört?«, fragte Nolan.
Ricky zuckte nur mit den Schultern. »Da ist irgendein Tier durch eure Bäume gesprungen.«
War wohl wirklich bloß ein Tier gewesen, dachte Nolan. Das Geräusch war jedenfalls nur kurz da gewesen und dann verstummt.
Jackie saß bei Belle in der Küche. Sie mischten Kuchenteig. Belles Geschwister sprangen überall durchs Haus. Die verzweifelte älteste Empre-Tochter jagte sie immer wieder aus der Küche, sodass sie und Jackie Platz zum Arbeiten hatten. Doch es hatte keinen Zweck. Der kleine Bruder kletterte auf den Tisch und klaute Teig aus der Schüssel, seine Zwillingsschwester wollte ihm hinterher, schaffte es aber nicht, auf die Tischplatte zu kommen. Der kleine Junge versuchte, seiner Zwillingsschwester zu helfen, doch ihre Hände waren klebrig und nass. Sie fiel auf ihren Hintern, weinte kurz und laut, rappelte sich wieder auf und rannte lachend aus dem Zimmer. Jackie und Belle stöhnten gleichzeitig.
Belle knetete den Teig. »Was hältst du davon, wenn wir ab jetzt öfters vor dem Bäckersladen tanzen? Klar, wir bekommen wahrscheinlich nicht jedes Mal Brot, aber ich finde, das hat voll Spaß gemacht! Und wir könnten damit für die Akademie üben. Melinda hat mir gesagt, dass sie auch an die Akascha gehen wird und hat sich sogar bei der Leiterin gewünscht, dass wir zusammen in ein Zimmer kommen! Ist das nicht toll? Ich freu mich so.«
»Ja klar, können wir machen!« Jackie fand es auch gut. Sie hatte Mehl an den Händen und schmierte es Belle ins Gesicht. »Du siehst aus wie ein Geist, und ich bin ganz begeistert von deiner Idee.«
In dem Moment betrat Belles Mutter die Küche. »Ist August bei euch? Oh, und ihr macht das wirklich schön.«
»Danke, aber nee, der ist nicht hier«, stellte Jackie fest.
»Ach Mama, übrigens«, fing Belle an, »ich habe keinen Rüssel mehr. Was immer du hier in meinem Gesicht siehst, das existiert nicht mehr.« Sie schnaubte zur Betonung durch ihre stinknormale Nase.
Jackie sah an sich herunter. Keine Signaturen. Nichts von Wert. Hier und da standen ihr noch ein paar Federn vom Arm ab, natürlich noch von Salomon, doch sie waren so zart wie Flaum und fast durchsichtig.
Die weißen Eisbärentatzen von Belles Mutter streichelten dem Zwillingsmädchen den blonden Kopf. Die Kleine hatte die ganze Zeit auf dem Tisch gesessen.
Das Fell von Belles Mutter ist wunderschön und so sauber, dachte Jackie.
Belle schob den Teig in den heißen Ofen. Die Glut stieg ihr entgegen. Bei dem Anblick kam Belle eine Idee: »Und was hältst du vom Thema Feuerfunken?«
»Ähm, viel«, antwortete Jackie verdutzt. »Der Ofen taugt ja sonst nichts, so ganz ohne Feuer?«
»Nein«, sagte Belle. Sie verdrehte die Augen. »Du Schwachkopf weißt genau, was ich meine. Die Feuerfunken von der Akademie. Ich finde, jetzt wo wir endlich alt genug für das Internat sind, sollten wir auch endlich da beitreten.«
»Ehrlich gesagt«, antwortete Jackie im Ofen herumhantierend, »stand das für mich schon längst fest. Wundert mich, dass du erst jetzt davon anfängst.«
Sie konnte es kaum erwarten, bei ihrer ersten Feuerfunkenprobe dabei zu sein. Es war eine Musiktheatergruppe, geleitet von einer ehemaligen Gesangslehrerin der Akademie der Schaustellung, kurz Akascha genannt. Ihr war es im Ruhestand zu langweilig gewesen, deswegen leitete sie seit einigen Jahren die Gruppe der Feuerfunken in einem kleinen Haus in der Nähe der Akademie – für viele Schüler eine willkommene, weil unbenotete, Abwechslung.
Nach einem ihrer Auftritte, an einem besonders heißen Sommertag vor vielen Jahren, hatten Raffael, der Salamander, Jackies Schwan Salomon, ein kleinerer Junge, dem gerade die ersten grünen Signaturen wuchsen und ein Löwe Belle und Jackie mit Wasser über den Markt gejagt. Und natürlich umgekehrt. Die Jungs waren alle Feuerfunken und sind es zum Teil bis heute noch. Es war ein wundervoller Tag gewesen. Also wundervoll war er immerhin so lange, bis drei der Jungs Jackies Arme gepackt hatten und der vierte ihr den ganzen Eimer Wasser übergeleert hatte. Jackie selbst hatte das damals unheimlich lustig gefunden. Ihre Eltern aber waren den Jungs ziemlich böse, denn Jackie war völlig durchnässt gewesen und das mitten im Dorf.
»Und wieder bin ich ganz begeistert«, stellte Jackie mit einer bedrohlichen Menge Mehl in den Händen erneut fest.
Belle wischte die Tischplatte ab. »Dann sind wir uns ja einig. Wir hätten das eigentlich schon viel früher tun können."
August, den die Mutter vorhin gesucht hatte, kletterte gerade durchs Fenster rein.
»Sagt Mama nicht, dass ich hier bin«, flüsterte er und verkroch sich unter der Fensterbank.
»Doch, du gehst zu ihr, wenn sie dich sucht!«, befahl Belle. Sie lief zur Tür und rief nach ihrer Mutter. Die kam sofort. Als sie August sah, zog sie ihn hoch und fragte: »Warum nur hast du so viel Angst? Wir gehen schwimmen, damit du es lernst.«
Der Junge wehrte sich vehement.
Jackie stieß Belle an. »Also wegen dem Feuerfunken-Kram: Ich bin dabei und ich freue mich.«
Wie zur Bestätigung ihrer Aussage klatschte sie die Hände vor Belles Gesicht zusammen. Mehl flog in Belles Gesicht. Die hustete. »Schön. Warum hast du das jetzt gemacht?«
Jackie meinte: »Weil es hier kein Wasser gibt, um mir die Hände abzuwaschen.«
Belle wischte sich die Augen. Jackie hatte Recht. Der Krug für das Wasser war tatsächlich leer. Wo war der volle Wassereimer, wenn man ihn brauchte?!
Der kugelrunde Mond stand nun hoch am Himmel. Eine Eule rief, und Sterne klebten am Himmel wie tausend kleine Staubkörner auf einem schwarzen Tuch. Keine Wolke war zu sehen. Die Eule rief erneut. Melinda hob den Kopf. Es schmerzte. Überall. Und es war dunkel. War sie etwa in der Unterwelt gelandet? Melinda konnte sich nicht erinnern, je etwas wirklich Böses getan zu haben. Ihr Körper zitterte. Melinda spürte es nicht einmal. Ihre Beine und Hände waren taub. Unter ihr glitzerte es geheimnisvoll. Sie schien in der Luft zu schweben. Der Wind jedenfalls wehte eiskalt von allen Seiten, er peitschte sie regelrecht. Alles, was sie fühlen konnte, tat ihr weh. Melinda wunderte sich: Konnte man, wenn man tot war, überhaupt noch Schmerzen fühlen? Sie versuchte, sich zu kratzen, doch ihr Arm klemmte fest. Sie konnte ihre Hand zwar sowieso nicht spüren, aber sie ließ sich eindeutig nicht bewegen. Melinda ließ sich hängen. Gut, also konnte man seinen Körper nicht mehr bewegen, wenn man im Jenseits angekommen war. Doch warum verließ ihr Geist nicht seine sterbliche Hülle? Musste sie dazu erst etwas Bestimmtes tun? Sie schloss die Augen. Sofort tauchte vor ihr ein Bild von Rickys Blick auf. Das klare Blau brannte sich wie eine überheiße Flamme in Melindas Gehirn. Sie schaffte es nicht einmal, ihre Augen wieder aufzureißen, so lähmend war es. Sie spannte jeden Muskel in ihrem Gesicht an, doch – Moment! Sie konnte ihre Muskeln anspannen! Das hieß, ihr Körper war doch noch funktionsfähig. Oder war es nur der Kopf, den man weiterhin fühlte? Vielleicht, damit man im Jenseits noch sprechen, sehen und riechen konnte? Melinda bekam Angst. Was war mit ihr los? In diesem Moment rief erneut die Eule. Danach setzte das Heulen eines Wolfes ein und ein leichter Luftzug zog über ihren Nacken. Sie spürte es kaum, denn der Hals war von etwas Schützendem bedeckt. Sie hatte noch immer diesen dämlichen Schuppenpanzer! Das hieß, sie würde Ricky nicht einmal im Tod vergessen können? Die Blüte hing ihr halb über den Augen.
»Oh nein«, stöhnte sie, »ich bin so eine dumme Nuss. Ich lebe noch.« Wütend biss sie sich auf die Zunge. Ansonsten konnte sie sich noch immer nicht rühren. Sie würde für immer und ewig in dieser Schwebe hängen bleiben, in der Dunkelheit und Kälte.
Eine Träne rollte über ihre Wangen. Was hatte sie sich und der Welt nur angetan? Nie wieder in der Sonne sitzen. Nie wieder mit ihrer Katze spielen. Nie wieder mit ihrem Bruder auf dem Hof arbeiten. Stattdessen war ihre Seele gefangen in einer kalten Finsternis; ohne die Fähigkeit, zu fliegen.
Neben sich hörte Melinda ein Rascheln. Es klang beinahe wie Blätter in einem Baum, durch die ein kleines Tier kroch. Ein Vogel möglicherweise. Oder eine Schlange. Das Rascheln erklang ein weiteres Mal. Diesmal näher, lauter, angsteinflößender. Intuitiv schlug Melinda mit der Hand nach dem Geräusch. Gleich darauf ließ sie einen spitzen Angstschrei fahren. Sie hatte sich bewegt! Und sie war gefallen. Nach unten. Sie schwebte nicht. Sie war noch immer von der Schwerkraft beeinflusst. Was war hier los? Nach einem kurzen Schreck sah sie sich um. Alles war dunkel, wie bisher. Weiter unten das seltsame Glitzern. Es musste etwas Flüssiges sein, so wie es schimmerte.
Erst jetzt bemerkte Melinda, dass sie ihren Arm frei bewegen konnte. Er baumelte nach unten. Sie bewegte ihn unsicher, dann zog sie ihn schnell heran – und schlug dabei mit der Hand gegen einen Ast.
»Verdammt!« Mit einem Mal dämmerte es ihr: »Ich hänge im Baum. Kein natürlicher Lebensraum für eine Schildkörte.«
Das konnte doch nicht wahr sein! Melinda realisierte so langsam, dass sie quicklebendig war. Sie atmete, ihr Herz schlug, ihr Kopf tat weh. Sie war bloß steif von der Kälte und schwebte in der Luft, da sie auf einem stabilen Netz aus Blättern und Zweigen lag. Das Glitzern unter ihr war der Bach, der über den Hof der Adams floss. Der Versuch, dem Fluch namens Ricky zu entfliehen war hiermit kläglich gescheitert.
Melinda fragte sich, welche Uhrzeit und welcher Tag es war und warum niemand nach ihr gesucht hatte. Langsam streckte sie ihren Arm in die Luft und tastete umher. Sie brauchte einen starken Zweig, an dem sie sich hochziehen konnte. Noch wurde sie vom Geäst in der Luft gehalten. Nur wie lange würde dieser Zustand noch anhalten? Eine falsche Bewegung und sie würde doch noch auf die harten Felsen fallen. Und wenn sie recht darüber nachdachte, wollte Melinda das gar nicht mehr. Stattdessen wollte sie Ricky zur Rede stellen. Diese Mistkröte. Was bildete er sich ein, schon als Kind so faszinierend gewesen zu sein und nun, als ausgewachsener Mann, Melindas Leben zur Hölle zu machen? Oder besser gesagt diesen Baum zu ihrer kurzzeitigen Hölle zu machen.
Ja, seit sie denken konnte, dachte Melinda an Ricky. Obwohl sie wie Geschwister aufgewachsen waren, hatte sie ihn nie als Konkurrenten betrachtet, wie man das meistens unter Geschwistern tat. Mit ihrem echten Bruder Nolan konnte sie streiten, bis die Wände bebten. Ricky aber hatte sie nie verärgern wollen. Viel zu sehr liebte sie sein schüchternes Lächeln und viel zu sehr würde es ihr leidtun, ihn zu verletzen. Sie wollte ihn sehen.
Das Problem war nur: Sie hing in einem Baum fest.
Nach einigem Tasten, Strecken und Klammern saß Melinda dann doch richtig herum auf einer Astgabel. Sie suchte mit ihren Füßen in der Dunkelheit nach einem sicheren Weg nach unten. Links, rechts, links, rechts hangelte sie sich hinunter. Als sie am Boden angekommen war, atmete sie erst mal erleichtert auf. Gut, dass sie nicht auf die Steine gefallen war. Was hätte sie damit ihrer Familie und ihren Freunden angetan? Streng genommen konnte sie sich nicht mal an einen Sprung erinnern.
Sie war auch nie abgesprungen. Sie musste schon zuvor bewusstlos geworden sein.
Leise schlich sie durch den Garten. Das Feuer im Haus war längst erloschen. Nach Melindas Schätzung musste es bereits kurz vorm Morgendämmern sein. Die eisige Kälte war ein eindeutiger Hinweis auf die Tageszeit. Irgendwie gefiel es Melinda gerade. Alles war so friedlich, so klar, so still. Dennoch störte es sie, dass niemand nach ihr gesucht hatte. Sie öffnete die Stalltür und besuchte die Tiere. Die meisten von ihnen schliefen. Nur die Hasen im Gehege mümmelten an ihrem Futter.
Hier drinnen war es noch finsterer als draußen.
Sie konnte nicht ins Haus, denn der Riegel war jede Nacht vor die Tür geschoben. Also musste Melinda hier schlafen. Fachmännisch zog sie Stroh aus den großen Ballen und legte eine Decke darüber. Einen Sack mit frischem Gras benutzte sie als Kissen. Die nie gebrauchte Pferdedecke musste sie für diese wenigen Stunden warmhalten. Melinda kauerte sich auf dem Stroh zusammen und dachte nach:
So gesehen war es ja ganz schön, dass sie noch auf dieser Welt sein durfte. Doch von nun an würde es noch schwerer werden, mit Rickys Existenz klarzukommen. Sie würde ihm nicht mehr in die Augen sehen können. Dabei wollte sie gerade das. Sie wollte ihm auf alle Ewigkeit in die Augen schauen. Sie wollte ihm durch die Haare fahren und sagen, dass er sich nicht immer so verkriechen sollte in seinem Panzer. Doch sie würde ihm auch sagen, dass es sie nicht störte, wenn er manchmal in seiner eigenen Welt zu leben schien. Sie mochte seine verträumte Art. Sie wollte Ricky trösten, wenn er sich Sorgen machte und von ihm getröstet werden, wenn sie sich Sorgen machte, seine sanfte Stimme hören und sein schiefes Lächeln betrachten, denn das würde sie immer aufmuntern.
All das klang paradiesisch.
Melinda wusste, dass es nie so kommen würde.
Er hatte es ihr gesagt, verdammt nochmal, direkt ins Gesicht. Er hatte sie nicht einmal ernst genommen. Melinda wollte schlafen. Sie schloss ihre Augen. Zusammengekauert wie ein Tier im Winter schlummerte sie ein.
Als sie wieder aufwachte, waren Melindas Haare feucht vom Tau. Ihre Glieder schmerzten immer noch. In der Ferne hörte sie jemanden nach ihr rufen.
»Ich bin hier.« Sie murmelte bloß, den Schlaf noch in den Augen.
Wieder rief jemand nach ihr. »Melinda? Meliiindaa!«
Sie rappelte sich auf, schlang die Pferdedecke um sich und schob die Tür auf. Auf der Wiese unten am Teich konnte sie Nolan sehen. Er rannte suchend hin und her und verscheuchte dabei Mücken mit seinen Bärentatzen. Die graue Nase schnupperte die Luft ab. Die Katze Chibi sah ihm dabei zu und schien sich über ihn zu amüsieren.
Melinda fiel ein Stein vom Herzen. Man suchte sie doch.
»Ich bin hier!«, rief sie ihrem Bruder zu. Er drehte den Kopf. In dem Moment verging Melinda das Lächeln. Ihr Bruder suchte sie – aber nicht Ricky. Sie ließ die Schultern hängen. Die Decke glitt von ihrem Rücken. Melinda spürte, wie sie über die elendigen Schuppen strich.
»Da bist du ja, Schwesterchen.« Nolan war heilfroh, sie zu sehen. »Wo hast du gesteckt?«
Melinda zuckte mit den Schultern. »Ich war im Stall.«
»Warum nachts?«
»Weil – ich weiß es nicht.« Sie starrte auf den Boden. »Ich lebe noch. Hake es also ab.«
Nolan grummelte. Manchmal wurde er aus seiner Schwester nicht schlau. Aber immerhin war sie heil zurück. »Was sollen wir unseren Eltern erzählen?«, fragte er.
»Keine Ahnung«, antwortete Melinda. »Die Wahrheit?«
Oder zumindest das, was er für die Wahrheit hielt?
Träume
Etwa eine Woche war vergangen, seitdem Belle, Melinda und Jackie mit ihrem Tanz das Brot gewonnen hatten. In der Zwischenzeit hatte der Hochsommer seine volle Kraft entfaltet.
Die gesamte Zeit über hatten Belle und Jackie jedoch nichts von ihrer neuen Bekanntschaft gehört. Sie hatten ihr Haus besucht, doch sie wurden jedes Mal fort geschickt mit der Begründung, Melinda ginge es nicht gut, sie sei krank und dürfte niemanden sehen.
Nun lag Jackie mit dem Rücken im Gras und starrte in den wolkenlosen Himmel. Belle legte sich daneben. »Früher oder später müssen wir sie besuchen dürfen. Die muss sich doch voll einsam fühlen. Was könnte bloß mit ihr los sein?«
Jackie zuckte die Achseln. »Ich finde«, meinte sie, »wir sollten uns nicht zu sehr aufdrängen. Je mehr sie ihre Ruhe hat, desto schneller wird sie gesund und ehrlich gesagt kennen wir sie kaum.«
Belle drehte sich herum und stützte sich auf die Ellenbogen. »Nein«, widersprach sie. »Wir gehen da hin und fragen noch einmal. Ich will wissen, was Sache ist. Irgendwas ist komisch, sie hätte uns doch was geschrieben oder ausrichten lassen. Wir waren doch verabredet. Oder meinst du nicht?«
Sie rollte sich ein paar Mal hin und her, dann stand sie auf und wischte das Gras von ihrem ohnehin schon grünen Kleid. Sie reichte Jackie die Hand.
Zusammen schlenderten sie über die Straßen bis zum Bauernhof am Waldrand. Schon von weitem sah Jackie einen jungen Mann mit blonden strähnigen Haaren und silbern schimmernder Haut. Als sie näherkam, sah sie, dass seine Hände mit einem ledrigen Muster überzogen waren. Er kniete im Feld und pflückte Unkraut. Als er Schritte hinter sich hörte, drehte er den Kopf. Seine blauen Augen überschwemmten Jackie und Belle beinahe. Sein schiefes Lächeln mit den strahlend weißen Zähnen hatte etwas an sich, das die beiden Freundinnen nicht ganz definieren konnten. Jedenfalls mussten sie ihn anstarren, bis sie vor Melindas Haustür standen. In diesem Moment flüsterte der Junge ein zaghaftes »Hallo« und drehte den Kopf weg.
»Hallo«, antwortete Belle. Sie überlegte kurz, ob das Melindas Bruder Nolan sein könnte. Aber den hatte sie doch anders beschrieben. Jackie klopfte bereits an die Tür. Erst leise. Dann etwas lauter. Niemand öffnete. Der Junge, der das Unkraut rupfte, drehte sich wieder zu den Mädchen um. Er sprach wie ein schüchternes Kind, nur mit tieferer Stimme: »Tut mir leid, die sind nicht da. Melinda musste zum Arzt.«
»Wann sind sie losgegangen?«, fragte Jackie.
Der Junge kratzte sich nachdenklich am Kopf. »Ich glaube, vor zwei Tagen. Sie musste zu einem Spezialisten. Übrigens, ich bin Ricky. Ricky Andersson. Ich wohne da vorne, im Haus neben den Adams. Sehr erfreut, euch kennenzulernen.«
»Ähnliche Namen bei benachbarten Häusern? Das muss zu Verwechslungen führen, oder?« Jackie schaute von einem Bauernhaus zum anderen.
»Kommt vor, aber die Post kennt uns schon.«
Er wischte sich die schmutzigen Hände an der Hose ab und streckte sie erst Jackie und dann Belle hin. Vorsichtig schüttelten sie die Hände, denn seine Haut war rauer als man erwarten würde.
»Tut mir leid. Schildkröte«, murmelte Ricky, dann fuhr er mit seiner Arbeit fort. Jackie zog die Brauen hoch. Schildkröte? Sie sah Belle an, da hörten beide das Getrappel von Pferdehufen hinter sich. Von der Straße näherte sich eine Kutsche. Darin saßen vier Personen, eine von ihnen war eindeutig Melinda. Ihr Blick war zu Boden gesenkt. Der Vater hielt die Pferde an und half seiner Frau und seiner Tochter aus dem Wagen. Melinda sah Belle und Jackie. Und Ricky. Sie erstarrte. Dann zog sie sich ihre Kapuze über, nahm Belle an der Hand und zog sie in den Garten neben den Stall. Dort nahm sie die Kapuze wieder ab. Fast panisch fragte sie: »Habt ihr eben mit Ricky geredet?« Belle und Jackie bejahten.
Melinda biss die Zähne zusammen. Dann rollte sie die Augen und jammerte: »Ist er nicht süß? Er ist so schön. Ich kann ihm nicht in die Augen sehen. Nicht mehr. Ich will ihn überhaupt nicht mehr sehen. Aber dann will ich es doch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich wollen soll.«
Sie machte eine kurze Atempause. »Ich will, dass er wegzieht.«
Jackie schaute Melinda ruhig an. Schildkröte. Daher kam ihr das bekannt vor. Melinda las Jackies Gedanken: »Ja, genau. Ricky ist der Grund, warum ich die Schuppen habe.«
Belle war etwas eingefallen: »In der Schule habe ich schon Leute von diesem Ricky reden gehört.«
»Diesem!?!« Melinda riss schockiert die Augen auf.
»Ja«, meinte Belle, »ich bin mir relativ sicher. Die sagten allerdings, er hätte Frosch. Oder war es doch ein Seepferdchen?«
»Das«, erwiderte Melinda, »ist ein Hirngespinst. Schildkröte! Er ist eine Wasserschildkröte. Nicht die lahmen Landdinger, kein Seepferdchen und auch kein glitschiger Frosch. Das würde doch vorne und hinten nicht passen. Er hat einen Panzer wegen seiner Verletzlichkeit, aber er ist anmutig.«
Jackie und Belle waren erschlagen von den ganzen Informationen und starrten Melinda nur an.
Die zog sich an den eigenen Haaren. »Denkt ihr etwa, es gibt nur Signaturen von Tieren, die schönes, weiches Fell haben? Es ist nicht seine Schuld, dass seine Schale so hart ist. Aber das heißt doch automatisch, dass er einen weichen Kern hat, oder? Aber alle, die das nicht verstehen, halten ihn für kalt! Ihr habt doch gesehen, wie freundlich er ist, oder? Er hat das nur zum Selbstschutz … ich. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel darüber rede. Beschäftigt mich halt.« Melinda verstummte und schaute zu Boden.
Eine Frauenstimme durchbrach die Stille. »Ich komme, Mama!«, antwortete Melinda.
»Ihr dürft das nicht herumerzählen. Bitte! Ricky macht mich fertig. Ich kann nicht ohne ihn leben, aber ich bin ihm egal. Ich bin für ihn ein kleines Mädchen, so was wie ein Haustier, das man behüten muss und mit dem man spielen kann.«
Kaum hatte sie den Satz beendet, schlug sie ihren Ärmel zurück, nahm einen Ast und kratzte tiefe Spuren in ihr Handgelenk. Jackie hielt erschrocken Melindas Hand fest. »Was tust du da?«
Sie fragte zwar nach, doch sie wusste nur zu genau, was Melinda da tat.
Melinda zuckte die Schultern, ließ den Ast fallen und sagte: »Das fühlt sich gut an. Wollt ihr auch mal?« Sie wartete gar keine Antwort ab, sondern ging noch beim Reden zum Haus, wo ihre Mutter und Nolan bereits warteten.
Melindas Mutter, eine Frau mit breiten Hörnern, klopfte ihrer Tochter vorsichtig auf den Rücken. Sofort fragte sich Jackie, ob sie wohl auch die Schuppen dort spüren konnte.
Plötzlich rief Belle ihr nach: »Melinda, wenn du willst, können wir heute alle drei bei mir übernachten. Hast du Lust?«
Es brauchte ein paar Überredungskünste, doch dann hatte sie Melinda von der Idee überzeugt.
Jackie, Belle und Melinda lagen Seite an Seite in Belles Zimmer und starrten an die dunkle, hölzerne Decke. Sie sprachen darüber, was sie sich für die nächsten Jahre wünschten.
Belle fing an. Sie berichtete von ihrem Traum, beruflich Sängerin zu werden. Von allen dreien freute sie sich am meisten darauf, in wenigen Tagen auf die Akademie der Schaustellung gehen zu dürfen und dort das nötige Handwerk, oder Mundwerk, wie Jackie es nannte, zu lernen.
Jackie selbst erzählte daraufhin von ihren Plänen, auf die Aurum-Inseln zu reisen. Sie hatte viele abenteuerliche Geschichten über die weit entfernten Inseln gehört. Nun wollte sie mit ihren eigenen Sinnen erfahren, ob an diesen etwas dran war. In früheren Generationen, noch in der Jugend ihrer Großmutter Ida, sei es üblich gewesen, dass junge Erwachsene mit etwa sechzehn Jahren einmal auf eigene Faust in ein fremdes Land reisten. Um etwas von der Welt zu erfahren und vollends erwachsen zurückzukehren. Doch die Tradition wurde von immer weniger Jugendlichen durchgeführt. Sie hielten es nicht mehr für nötig, da die Bildung in den Schulen besser wurde und sie es für wichtiger hielten, schnell sesshaft zu werden. Dem konnte Jackie nicht zustimmen. Sie wollte ihre Reise zu den exotischen Ländern antreten.
Belle und Melinda waren zunächst still. Irgendwann brachte Belle hervor: »Ich fürchte, ich gehöre zu denen, die das nicht machen wollen. Das könnte ich nicht. Ganz allein reisen, ohne zu wissen wohin?! Hier ist es doch schön. Echt, ich könnte das wirklich nicht, ich würde euch zu sehr vermissen.«
Jackie schmunzelte in die Dunkelheit. »Du wirst es überleben und ich auch. Will es nur für ein paar Monate machen. Außerdem habe ich Diana. Ich bin nie allein.«
Sie schaute durch das kleine Dachfenster nach draußen. Was sie sich eher fragte, war, ob die Goldenen Inseln wirklich so fantastisch waren, wie alle sagten. Sie hatte das Gefühl, dass einige Rückkehrer sich nur in ihren Abenteuergeschichten überbieten wollten.
»Und du, Melinda?«
Melinda atmete tief ein. Es klang, als wollte sie sich sammeln, um dann etwas besonders Bedeutsames zu sagen. Wenn dem so war, dann behielt sie es spontan doch für sich. Sie zitterte stattdessen, denn inzwischen war es wieder ziemlich frisch geworden. Die Mädchen stritten sich um die Wolldecken. Jackie pfiff nach Diana, die durch das Zimmer wuselte.
Aus irgendeinem Grund war die Füchsin besonders zurückhaltend gegenüber Melinda und weigerte sich, in ihre Nähe zu kommen.
»Erzählst du auch noch was, oder willst du nicht?«, fragte Belle sie währenddessen. Melinda drehte sich mehrfach hin und her. Wieder holte sie tief Luft, drehte sich zu Belle und sagte: »Kann ich machen. Aber nur wenn ihr wirklich wollt und noch nicht zu müde seid für meine langweiligen Träume.«
Belle und Jackie wollten. Also fing Melinda zögerlich an, ihre Wünsche zu erzählen.
»Jetzt kennt ihr ja Ricky. Er ist der Grund, warum ich krank war. Ich wäre in dieser einen Nacht beinahe erfroren.«
»Welche Nacht?«, fragte Jackie.
»Die, nachdem wir uns kennengelernt haben.« Sie machte eine kurze Pause. Belle war ganz Ohr. Jackie kraulte Diana und hatte ein wenig Angst vor dem, was Melinda als nächstes sagen würde. Die fuhr fort: »Ich kenne Ricky, seit ich denken kann. Er wohnt schon immer neben uns. Mein Bruder und Ricky helfen auch, seit sie klein sind, auf den Höfen. Schafe hüten, Gemüse ernten, Pferde striegeln. Ich habe ihnen gerne dabei zugesehen, ich selbst war noch zu klein. Eines Tages im März, als der letzte Schnee geschmolzen war, nahm Ricky mich vor Freude über den Frühling in den Arm und wirbelte mich so um sich rum. Ich sah direkt in seine Augen. Diese unfassbar blauen Augen. Dazu hatte er diese niedliche Zahnlücke. Nolan und er haben sich den ganzen Tag nur albern benommen. Ich durfte mit ihnen mitspielen, das war so toll. Am Abend waren meine Hosen dann nur noch Löcher! War mir aber egal, weil von dem Moment an hatte das Spielen mit Ricky was Magisches. Jeder Tag war, als würde ein Winter enden und die Vögel zum ersten Mal singen.«
»Du hast dich in ihn verliebt!«, rief Belle begeistert. Es schüttelte sie am ganzen Körper. Dieses Wort klang so zauberhaft. Verliebt!
»Ganz genau«, antwortete Melinda. »Aber Ricky war erst neun Jahre alt. Es hat noch ein paar Monate gedauert, bis ihm die Schuppen an den Händen gewachsen sind und seine Haut so fest wurde. Von den Rückenplatten wusste ich nichts, bis er drei Jahre später vor meinen Augen im See Baden war. Weißt du, Ricky will nicht, dass ihn jemand ohne Kleidung sieht. Und das, obwohl so eine Panzerhaut ihn doch viel besser schützt, auch vor Blicken, als ein Tuch. Er ist einfach zu schüchtern. Er hasst das, weil er sich trotzdem angreifbar fühlt.«
»Wie süß!« Belle konnte ihre Rührung kaum halten.
Melinda sah sie vorwurfsvoll an. »Ja, ich weiß! Danke für die Erinnerung.«
Belle hörte sofort auf. Sie zog sich die Decke ins Gesicht, musste aber weiter lächeln.
»Ja, und was war jetzt mit deiner Krankheit?« Jackie ließ Diana los, die sich sehr langsam Melinda näherte.
»Ähm ja. Ich habe Ricky ins Gesicht gesagt, dass ich Signaturen von ihm habe. Es hat Jahre gedauert, mutig genug dafür zu werden. Ich habe oft davon geträumt, dass er dann sagt ›Guck mal, sie sind silbern und meine Augen sind so lila wie dein Haar‹, aber das kam natürlich nicht. Pah! Gar nichts kam. Er hat mich lieber ausgelacht. Für ihn bin ich noch immer die kleine Schwester. Wir sind doch eine Familie. So in etwa sieht er das.«
Stille trat ein. Jackie war verwirrt. Was hatte Melinda jetzt krank gemacht? Die Niedergeschlagenheit wegen Ricky?
Als hätte sie Jackies Gedanken gelesen, sagte Melinda: »Nun. Und dann wollte ich mein sinnfreies Leben beenden. Doch irgendwas kam mir dazwischen. Ich dachte, ich wäre tot, doch in Wirklichkeit hing ich in den Ästen von dem großen Baum fest. Ja, und die Nacht war kalt. Ich hab in der Scheune geschlafen. Viel zu feucht. Deshalb war ich so krank.«
»Plus das Mentale«, vollendete Jackie die Erzählung.
Melinda drehte den Kopf weg. »Ich kann nicht mit euch bei Feuerfunke einsteigen. Ricky macht dort mit.«
Jackie hatte eine andere Frage: »Willst du die Signaturen denn behalten?«
Melinda drehte sich auf den Bauch. »Ich, ich muss ja wohl. Weißt du, wie teuer so eine beschissene Behandlung ist? Und wie schmerzhaft? Entweder sie verschwinden von selbst, oder sie tun es eben nicht.«
Jetzt tat es Jackie leid, dass sie so eine Frage gestellt hatte.
Sich die Signaturen per Magie entfernen lassen, das taten nur die, die sonst keinen Ausweg aus der Hölle ihrer Gefühle sahen.
Wenn man es genau nahm, war Melinda so ein Fall. Sie hatte versucht, sich umzubringen! Doch es war allgemein bekannt, dass eine solche Operation, schwarzhumorig auch Exorzismus genannt, schlimmer sein konnte als der Tod. Es war die letzte Rettung jener, die mit der Last ihrer Signaturen nicht mehr leben konnten, doch andere Gründe hatten, auf dieser Welt zu bleiben, wie Kinder, ihre Arbeit oder andere wichtige Verpflichtungen.
Das Blut, das bei diesen Behandlungen verloren ging, war nicht von biologischer Natur. Deshalb wurde es nie reproduziert. Man fühlte sich danach blutleer. Manche Behandelten verlernten für immer, zu lieben.
Auf einmal war Jackie dankbar, dass sie keine Signatur an sich hatte. Sie legte einen Arm um Melinda, war aber unsicher, wie die sich dabei fühlte. Diana sprang auf Jackies Beine und machte es sich dort gemütlich. Ihr war trotzdem eine gewisse Unruhe anzumerken.
Belle hatte sich unter der Decke verkrochen. Sie war im ersten Moment nicht so schockiert gewesen, doch je mehr sie darüber nachdachte, desto unheimlicher kam ihr Melindas Lage vor.
Wenn Belle sich zurück erinnerte an ihren dämlichen Rüssel, dann konnte sie nur darüber lachen. Zu klein und fein war das Ding gewesen und nach wenigen Monaten hatte es sich in Wohlgefallen aufgelöst. Da die Wurzeln von Melindas Schuppen aber noch vor ihrem zehnten Lebensjahr zu sprießen begonnen hatten, würden sie wohl nicht so einfach Platz machen für neue Dinge. Belle wollte nach ihrem besten Gewissen helfen: »Melinda, ich–«
Sie wurde unterbrochen. »Lass, du musst nichts sagen. Ich habe es wieder geschafft, mir meine Maske aufzusetzen. Niemand kann jetzt sagen, wie ich mich fühle. Ich könnte jetzt raus gehen und jeder denkt, es geht mir gut. Aber dadurch wisst ihr dann auch nicht, wenn es mir wirklich gut geht. Für euch besteht also kein Unterschied.« Für Melinda war die Sache damit geregelt.
Belle wollte sich damit nicht zufriedengeben. »Hä, was? Melinda, wir haben doch gehört, was du gerade erzählt hast. Du musst uns nichts vorspielen. Es ist in Ordnung, wenn es dir mies geht.« Melinda hielt Belle die Hand vor den Mund. Trotz der Finsternis konnte man ihren strafenden Blick sehen.
»Belle«, sagte Melinda. Es war fast ein geisterhaftes Flüstern. »Bitte ignoriere mich und meine Gefühlswelt. Es wird dir nichts bringen und mir wird es auch nichts bringen. Ich ziehe dich nur mit runter. Also lass es gut sein. Kümmer dich um dich, du bist wichtiger.«
Spiegelbild
Feinsäuberlich aufgereiht saßen die Schüler in der Aula, deren Decken und Marmorwände mit roten und schwarzen Tüchern geschmückt waren. Vor den neuen Schülern lief eine Frau auf und ab, die schon etwas älter aber noch in sportlicher Verfassung zu sein schien.
Melinda kauerte sich auf ihrer Bank zusammen. Ihr war diese große Gruppe von Menschen auf engem Raum unangenehm. Belle rutschte aufgeregt auf ihrem Hinterteil hin und her. Jackie versuchte zu sehen, wer sonst noch in der Aula war. Sie entdeckte ein paar wenige bekannte Gesichter, doch da die Akademie so beliebt in der Gegend war, waren auch Schüler von weiter weg angereist, die sie nie zuvor gesehen hatte.
»Ich«, hörte Jackie eine freundliche, aber feste Stimme sagen, die das Gemurmel augenblicklich unterbrach, »bin Frau Olivia. Ich bin ab heute eure Stufenlehrerin. Ihr, meine Lieben, seid der neue Jahrgang der Akademie der Schaustellung. Ich heiße euch herzlich willkommen.« Sie lächelte, wobei sie darauf achtete, dass ihr auch jeder im Raum zuhörte. Die Schüler sahen sich gegenseitig erwartungsvoll an.
»In den folgenden vier Jahren werden wir viel Zeit haben, uns kennenzulernen. Heute soll es nur um das Wichtigste gehen.«
Kurze Pause.
»Wir alle aus dem Kollegium freuen uns, dass ihr unsere Schule gewählt habt. Eine Akademie der Schaustellung, nun, was ist das? Es ist vieles. Vor allem aber ist es eines: Kunst. Hier an der Akascha lernt ihr alles, was zu den Darstellenden Künsten gehört. Wir bieten, wie ihr sicher wisst, ein breites Spektrum an Fächern. Da sind Tanz und Schauspiel, Gesang und Instrumentalunterricht, Zeichnen und Gestalten, Lyrik, Pantomime, Akrobatik und einiges mehr.« Erneut ging Getuschel durch den Saal. Jackie vermutete, dass jeder seinem Sitznachbar kurz mitteilen musste, welche der Fächer er oder sie belegen wollte.
Belle fing an, auf ihren Nägeln zu kauen. Sie wollte mit dem Unterricht loslegen. Jetzt! Theater, das wäre doch was für sie. Und natürlich Gesang. Tanz sowieso. Davon träumte sie schon so lange. Sie wippte mit den Beinen, kratzte sich an der Nase und bemerkte kaum, dass Frau Olivia längst weitersprach.
»Ich bin mir sicher, ihr freut euch alle auf eure individuelle Fächerwahl. Zum Halbjahr könnt ihr etwas Neues belegen, wenn ihr möchtet. Oder aber in die nächsthöhere Stufe derselben Fächer aufsteigen. Das ist eure Entscheidung. Die ersten Wochen allerdings, und das ist ganz wichtig, werdet ihr alle gemeinsam die Grundlagen lernen. Allem voran die Standardtänze gehören zum Basisrepertoire, das ein jeder hier beherrschen sollte.«
Das Getuschel wurde lauter.
»Und nun«, fuhr Frau Olivia fort, »bitte ich euch, auf eure Zimmer zu gehen und euch erst mal einzurichten. Der Plan, wer in welchem Raum wohnt, hängt in der Eingangshalle aus. Es sind immer Dreier- oder Viererzimmer. Eure Wünsche wurden dabei bestmöglich berücksichtigt. Wir sehen uns dann zum Mittagessen. Viel Spaß und viel Erfolg auf der Akademie der Schaustellung!«














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














