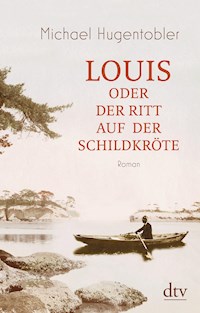9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Schweizer Buchpreis 2021 Thomas Bridges wächst als Ziehsohn eines britischen Missionars am südlichen Ende Südamerikas auf, unter den Kindern der Yamana. Fasziniert von der reichen Welt und Sprache dieses Volkes, beginnt er, obsessiv ihre Wörter aufzuschreiben. Diese wertvolle Sammlung, sein Buch, wird ihm Jahrzehnte später gestohlen und fällt dem deutschen Völkerkundler Ferdinand Hestermann in die Hände. Hestermann spürt, dass er es mit einem einmaligen Schatz zu tun hat. Er verschreibt ihm sein Leben. Als in den 1930er Jahren die Nationalsozialisten beginnen, Bibliotheken zu plündern, begibt er sich auf eine gefährliche Reise, um das Buch in Sicherheit zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Hugentobler
Feuerland
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Thoas
Unconsciously, perhaps, we treasure the power we have over people by their regard for our opinion of them, and we hate those upon whom we have no such influence. I suppose it is the bitterest wound to human pride.
William Somerset Maugham
We live, as we dream – alone.
Charles Marlow
ERSTER TEIL
Es ist die Morgenröte nach der Finsternis
Es ist der Triumph, der die Niederlage verhöhnt
Es ist ein Herz, in dem jede Furcht verglüht
Es ist ein unbezahlbarer und gefährlicher Schatz
1.
Er sah den Mann auf der Bank sitzen, er näherte sich ihm von hinten, er streckte den Arm aus und wollte dem Mann die Hand auf die Schulter legen – aber kurz bevor seine Finger die Schulter berührten, tastete seine Hand ins Leere.
Der Mann neigte sich nach vorn, erhob sich, in schwarzem Mantel, den Kragen hochgeklappt, auf seinem Kopf saß ein schwarzer Bowler. Als der Mann voranschritt, als ihm sein Schatten hinterherglitt, da strahlte das einfallende Licht auf ein Buch mit blau-rot marmoriertem Einband.
Das Buch lag nun einfach da, auf dieser grün gestrichenen Bank, ganz allein, während rundherum Menschen waren, Menschen überall, ihre eilenden Halbschuhe klapperten und die metallenen Spitzen ihrer Gehstöcke klimperten.
Er rief dem Mann hinterher, er wedelte mit den Armen, er brüllte, aber der Bowler verschmolz mit anderen Bowlern, und das Letzte, was er sah, war ein Zipfel schwarzen Mantelsaums, der durch ein Gitternetz aus Hosenbeinen aufflackerte, dann entschwand.
Ein Dieb könnte daherkommen und das Buch stehlen, dachte er, eilte um die Bank herum und setzte sich, denn bestimmt würde der Besitzer den Irrtum bald bemerken und zurückkehren. Aber er wartete und wartete und wartete.
Als er abermals auf den blau-rot marmorierten Einband hinunterschaute, empfand er das Verlangen, ihn zu berühren. Er widerstand dem Drang vielleicht fünf, vielleicht zehn Minuten, dann legte er seine Hand ganz sanft neben sich auf die Bank und betastete den Einband mit dem kleinen Finger. Der Ringfinger folgte, der Mittelfinger, die ganze Hand, mit der er über den Einband des Buches strich wie über den Kopf eines verlassenen Kindes. Er fühlte sich dem Buch so nah, als wäre er sein neuer Besitzer.
In diesem Moment wachte er auf. Er lag auf dem Bauch und sein Rücken schmerzte. Als er die Augen öffnete, blinzelte er, so hell war es. Seine rechte Hand hatte er unter das Kissen geschoben. Diese Hand zog er nun hervor. Und mit der Hand kam auch das blau-rot marmorierte Buch zum Vorschein, das er im Traum gestreichelt hatte.
2.
Professor Hestermann saß in seinem lila Pyjama auf der Bettkante und rieb sich den Schlaf aus den Augen.
Durch das offene Fenster hörte er die Züge unten in der Victoria Station rumpeln. Und oben, über den Dächern Londons, sah er zwischen zwei Kaminen den Bogen der aufgehenden Sonne. Die Sonne hatte die Farbe einer Apfelsine und blendete stark, Hestermann drehte sich dem Raum zu, wo das Licht in sanftem Perlenrosa von den Wänden zurückgeworfen wurde. Er griff nach seiner Hose, die eine Armlänge entfernt über eine Frisierkommode aus dem Holz des Narrabaums geworfen lag, schob seine Finger in die rechte Gesäßtasche und zog einen Kamm aus vanillebraunem Horn hervor. Einige Zinken am Kamm fehlten, aber nicht so viele, dass der Professor den Kamm für nutzlos empfunden hätte, und diesen Kamm zog er sich nun durch das weiße Haar, scheitelte erst von links nach rechts, dann von rechts nach links und schließlich wieder zurück.
Es war Freitag, der 25. Februar 1938, und einen Tag zuvor hatte er am University College of London einen Vortrag über allgemeine Satzlehre in der sumerischen Keilschrift gehalten, mit einem Schwerpunkt auf der Verwendung des Verbs im dritten Jahrtausend vor Christus. Ihm war gewesen, als hätte er seine Theorie zum hundertsten, nein, tausendsten Mal erklärt und als wären die Sätze in seinem Mund ganz und gar leblos gewesen. Entsprechend zaghaft war der Applaus gekommen, und Hestermann hatte darüber nur abwesend genickt.
Unter den Zuhörern war ein Kollege gewesen, der kürzlich ein bahnbrechendes Wörterbuch über britischen Slang veröffentlicht hatte und gegenwärtig an einer Etymologie der Sprache von Dieben, Mördern und Prostituierten arbeitete. Für den heutigen Tag hatten sie sich zu einem Besuch im botanischen Garten verabredet, um gemeinsam eine wichtige Sache zu besprechen, über die Hestermann bereits in einem Brief geschrieben hatte. Danach würde Hestermann zurück nach Deutschland fahren, mit dem Drei-Uhr-Zug, über Dover, Calais, Brüssel, Lüttich, Aachen, Köln, bis Münster.
Der Völker- und Sprachkundler Ferdinand Hestermann, Angestellter der Universität Münster, war an diesem sonnigen Februarmorgen sechzig Jahre alt, und er schaute voller Sorge in die Zukunft. Ihm war, als kreiste ihn etwas Bedrohliches ein. Aber wenn es ihm doch gelang, einen optimistischen Blick auf die kommenden Jahre zu werfen, so sah er sich in seinem Büro sitzen, wo die Bücherstapel zur Decke reichten, er würde sich über bedruckte Seiten beugen, bis zu jenem Tag, da ihm der Bleistift aus den Fingern glitt und das Licht in ihm erlosch.
Hestermann war ein groß gewachsener Mann, sehr schlank, mit Handgelenken wie ein Mädchen, und hätte man jetzt unter diesem lila Pyjama seine Ellbogen gesehen, so wäre man erstaunt gewesen, dass die Ellbogen nicht viel dicker waren als die Handgelenke. Seine Finger waren lang und dünn, und der Zeigefinger seiner rechten Hand hatte stets einen Gelbstich; der Geruch, den der Professor ausströmte, hatte seine Studenten dazu veranlasst, ein Gerücht in die Welt zu setzen, wonach Hestermann in der Asche seiner Zigaretten schlafe, und dies wiederum hatte ihm den Übernamen Aschenputtel eingebracht, aber keiner der Studenten hatte sich jemals getraut, dies dem Professor gegenüber laut auszusprechen, und es ist fraglich, ob Hestermann je von seinem Spitznamen erfahren hat.
Bemerkenswert, oder geradezu irritierend, waren seine Augen, genauer gesagt, sein Blick, in dem man eine seltsame Art von Wut vermutete, oder allenfalls das Nachhallen eines längst vergangenen Schreckens. Dieser Eindruck wurde verstärkt durch senkrechte Furchen, die zwischen seinen Augenbrauen begannen und bis zum Haaransatz reichten. Die Furchen hätten auch das Ergebnis von jahrelangem angestrengtem Nachdenken sein können, aber beim genauen Hinschauen zeigten sie sich als das, was sie wirklich waren: Narben.
Während er sich den Kamm von der Schläfe in Richtung rechtes Ohr zog, ließ er den Kopf im Nacken kreisen, dann griff er nach einer Schachtel Zigaretten, und im nächsten Moment erinnerte er sich daran, dass er sich zu seinem sechzigsten Geburtstag vorgenommen hatte, am Morgen als Erstes zu frühstücken.
Mit einem Seufzer bückte er sich und tastete in seiner Reisetasche nach einer Packung aus braunem Wachspapier, auf das mit roter Farbe ein fröhliches Kindergesicht gedruckt war, und aus dieser Packung zog er eine Scheibe Zwieback.
Professor Hestermann hatte stets alles dabei, was er zum Leben brauchte, egal ob er nun eine Vorlesung in Münster hielt oder einen Vortrag in London. Seine Tasche war aus Rindsleder gefertigt, sie hatte die Größe eines Aktenordners und war etwas abgewetzt; eingeklemmt neben der Packung Zwieback lagen zuunterst ein Hemd, eine Unterhose und ein Paar schwarzer Socken, dazwischen ein Tütchen besonders schonenden Seifenpulvers – eine eigens hergestellte Mischung aus Natriumcarbonat und geraspelter Kernseife; in einem rotgegerbten Schreibetui bewahrte er Zahnbürste, Zahnpasta, zwei Bleistifte und einen Anspitzer aus silbernem Metall auf; ein schmales Fach auf der Innenseite der Tasche enthielt ein Tagebuch und den Reisepass. Nun, in London, hatte er noch einen Stapel Papiere dabei, mit allerlei Stempeln, Siegeln, Hakenkreuzen.
Er knabberte am Zwieback und zog sich den Kamm über den Hinterkopf, dabei stieß er ein wohliges Stöhnen aus.
Er schob sich den Rest des Zwiebacks in den breiten Mund und tat schließlich, was er in den vergangenen sechsundzwanzig Jahren jeden Morgen getan hatte: Er widmete sich dem Buch mit dem blau-rot marmorierten Einband.
Das Buch war ein handschriftliches Exemplar. Es war ein Wörterbuch der Sprache eines Eingeborenenvolkes namens Yamana, die am südlichsten Zipfel Südamerikas gelebt hatten, in Patagonien, in Tierra del Fuego, dem Land des Feuers. Diese Informationen standen in englischer Sprache auf der Innenseite des Buchdeckels, auch die Übersetzungen der Yamana-Wörter waren auf Englisch verfasst.
Durch die Seiten schimmerten blassrosa die vertikalen Striche eines Kassenbuches. Der erste Eintrag lautete ammbj’a, oder a’mimbj’a oder anambja; das Wort war schwer entzifferbar, da es etliche Male durchgestrichen und neu geschrieben worden war. Der Verfasser hatte mit blauer Tinte Gewürz, Unkraut dahinter geschrieben und mit stärkerer schwarzer Tinte Gemüse ähnlich wie Chicorée. Der zweite Eintrag musste jüngeren Datums sein, hatte Hestermann nach langen Stunden der Analyse entschieden, denn die Tinte sah frischer aus. Was ihn allerdings befremdete, waren die beiden Definitionen des Wortes: Zwischen Unkraut und Chicorée schien ihm ein erheblicher Unterschied zu liegen. Diese Kontraste zogen sich durch das ganze Buch, mal waren sie stärker, mal schwächer. Unter mūlahana stand als Erklärung Den Mund verschließen, und später war angefügt worden: Mit dem Kopf unter Wasser schwimmen.
Viele Nächte hatte Hestermann wach gelegen und in seinem Geist diese fremde Welt auferstehen lassen, diese Welt, in der die Menschen einander aus purer Eifersucht mit bloßen Händen das Genick brachen und dafür einen Begriff hatten. Er hatte die Namen ihrer Pfeilspitzen auswendig gelernt und die Namen ihrer Sterne und die Namen ihrer Götter. Er hatte ihre Verben und Adjektive bestaunt, etwa iskāsinana, was Schnell zu Stärke heranwachsen wie ein kleines Kind bedeutete, oder kögurāiūa, was man sagte, wenn man starken Hunger hatte oder aber plötzlich sehr ungeduldig wurde.
Von dem Buch ging ein Zauber aus, dem Hestermann nur allzu gerne erlag.
Die Tatsache, dass das Buch die Sprache eines fernen Volkes dokumentierte, erschien ihm nicht weiter bemerkenswert. Aber noch heute war es ihm ein Rätsel, wie diese Worte die Berge und die Meere und die Wälder und die Menschen dermaßen scharf umrissen. Welche Technik hatte der Autor benutzt, dass dies alles lebendig, ja greifbar wurde? Was hatte er getan, um diese Bilder voller Licht und Schatten in den Kopf des Lesers zu zaubern? Wie kam es, dass alles vor Farben funkelte? In einem Wörterbuch!
Es war schlicht ein Meisterwerk.
Es hatte für sich eine ganz eigene Gattung geschaffen, es war ein Baldanders: mal Landschaftsbeschreibung, mal völkerkundliche Forschungsarbeit, mal Gemälde, mal Gedicht, und oft steckte all dies in einer einzigen Wortdefinition, respektive: in diesem Mischmasch aus Versionen, in diesem unglaublichen Reichtum an gesammelten Fetzen von Leben. Allein die Beschreibung des Otters! Das Glitzern seines Fells! Das Gefühl der Wärme bei einer Berührung – ein fast schon manisches Festhalten an Erlebtem! Dies waren keine Einträge eines Wörterbuchs, Hestermann hatte bisweilen das Gefühl, dieses Buch sei nur als Wörterbuch getarnt, in Wahrheit sei es ein Bauplan, eine Anleitung zum Erschaffen eines Teils der Welt, für den Fall, dass diese Welt einst untergehen sollte.
Es war eine Kopie der Wirklichkeit in Form von Wörtern, es war ein philosophischer Gral, nichts mehr und nichts weniger.
Einmal, in Münster, hatte er das Buch in seiner privaten Sammlung nicht mehr gefunden, augenblicklich war er nervös geworden, war kreuz und quer über das Universitätsgelände geirrt, von Hörsaal zu Hörsaal, hatte Unbekannte gefragt: »Haben Sie mein Buch gesehen?« und hatte an den Litfaßsäulen Vermisstenanzeigen aufgehängt, mit der Bitte, falls man das Buch fände, möge man es sofort in sein Büro bringen, ein Finderlohn sei garantiert. Kurz darauf aber hatte er es im Küchenschrank seiner Wohnung wiedergefunden, eingeklemmt zwischen zwei Packungen Zwieback. Fortan hatte er das Buch immer öfters in seine Tasche gepackt, damit das nicht mehr passierte. Er wollte das Buch in seiner Nähe haben, und mittlerweile fand er keinen Schlaf mehr, wenn es nicht direkt unter dem Kissen lag. Und schlief er endlich ein, träumte er oft diese Szene von dem Buch auf der grün gestrichenen Bank und dem Mann mit Mantel und Hut, der sich in Luft auflöst.
Professor Hestermann kämmte sich die Augenbrauen, dabei legte er die Stirn genussvoll in Falten. Er sank ins Hotelkissen, das Buch kippte auf seine Brust, und er fuhr mit den Fingerkuppen über den Einband. Schließlich legte er den Kamm zwischen die Seiten und klappte den Deckel zu.
Sein Blick glitt über die Zimmerwände, über den elfenbeinfarbenen Damast, über die Sessel aus grüngefärbtem Chagrin-Leder und über die Lampen aus Milchglas, deren Form stark an Blüten von Engelstrompeten erinnerten. Ihm fiel nun auf, dass an dem Lampenschirm, der ihm am nächsten war, nämlich jenem auf dem Nachttisch, drei dünne, haarige Beine hervorguckten; er hob den Kopf und sah eine Hausspinne, eine Winkelspinne vermutlich, mit einem leopardenartig gemusterten Hinterleib. Hestermann holte ein Zahnglas aus dem Badezimmer, bückte sich zur Nachttischlampe, hielt das Glas unter die Vorderbeine der Spinne und schubste das Tier mit einer millimeterkleinen Bewegung des rechten Zeigefingers an, sodass sie ins Glas krabbelte. Er deckelte das Glas sorgsam mit der Fläche seiner Hand, ging zum Fenster, öffnete es mit dem Ellbogen und legte die Spinne draußen auf das Mauerwerk. Vermutlich würde sie in der Kälte bald sterben, aber nur vermutlich; blieb sie hingegen hier drinnen, erwartete sie der garantierte und qualvolle Tod durch Insektengift.
Er schloss das Fenster wieder und schaute eine Weile auf die Spinne hinunter. Vom elektrischen Radiator nahm er den Geruch von erhitztem Staub wahr, und im einfallenden Sonnenlicht sah er feinste Partikel in der Luft schweben, die er mit der Hand wegwischte und so zum Tanzen brachte. Kurz kam ihm der Gedanke, er müsse sich wohl beim University College für die Buchung dieses exklusiven Zimmers bedanken, aber schon huschte der Gedanke wieder davon, so rasch wie eine Schwalbe im Flug.
Er legte sich zurück ins Bett. Er schloss die Augen, was er immer tat, wenn er die Dinge klar sehen wollte, und durch seinen Geist fluteten Bilder von nackten Kriegern.
So döste er ein.
Als er die Augen aufriss, hob er die Hand und schaute auf seine Armbanduhr. Er stand auf, zog den Pyjama aus, stopfte ihn in seine Tasche, nahm Hose, Hemd und Jackett vom Stuhl und schlüpfte hastig hinein.
Während er durch die Victoria Station in Richtung U-Bahn eilte, flatterte ein lila Ärmel hinter ihm her, wie eine Girlande, befestigt an des Professors Ledertasche, im Duft des frühen Morgens.
3.
Hestermann kam eine Stunde zu spät.
Am Bahnhof Kew Gardens sprang er aus der U-Bahn, noch bevor der Wagen zum Stehen gekommen war, lief in die verkehrte Richtung und bemerkte seinen Irrtum erst, als die Plattform abfiel und unter seinen Schuhspitzen Gleise in einem Bett von Kieselsteinen funkelten; er drehte sich um und eilte den ganzen Weg wieder zurück, rannte zum Ausgang, keuchte, hechelte, und jetzt lächelte er.
Kollege Parridge, der Verfasser des Wörterbuchs über die Sprache von Dieben, Mördern und Prostituierten, stand noch immer vor der U-Bahn-Station und wartete. Auf seinem Kopf saß ein schwarzer Homburger, darunter fluteten Locken hervor, er trug einen Übermantel aus gebürstetem Filz, und am Revers trocknete Eigelb. Hestermann zog eine rot-weiße Packung mit der Aufschrift Lux aus der Tasche seines Jacketts und zündete sich eine Zigarette an. Er reichte Parridge die Hand und wollte eine Entschuldigung für seine Verspätung murmeln, doch er schwieg.
Normalerweise fand man Eric Parridge auf Sitzplatz K1 im Leseraum des British Museum im Zentrum von London. Sein Sitzplatz war von weither sichtbar, dort türmten sich die Bücher. Er trug den Spitznamen Professor Schmierfink, da alle wussten, dass er seine angegessenen Schinkenstullen und halbvollen Kaffeetassen zwischen den Bücherstapeln vergaß, und einmal war über Nacht einer dieser Stapel eingestürzt und man hatte am frühen Morgen eine erschlagene Ratte gefunden. Aber man ließ Parridge gewähren, er war nun mal ein bahnbrechender Wissenschaftler. Es gab nur sehr wenige Tage, die er nicht im British Museum verbrachte, sogar seine Verabredungen fanden bei Sitzplatz K1 statt, was dem Ort die seltsame Aura eines temporären Gelehrtenbüros verlieh.
Gestern jedoch war Parridge zu Hestermanns Vortrag am linguistischen Institut des University College gekommen, und für den nächsten Tag hatte er diesen Ausflug an den Rand der Stadt vorgeschlagen, wo er im botanischen Garten mit einem weiteren Kollegen verabredet sei. Dieser Kollege, ein ausgefuchster Kerl übrigens, könne die Sache bereinigen, die Hestermann so sehr Sorgen bereite, und die er ja bereits in seinem Brief erwähnt habe. Alles sei bestens, der Kollege habe die Lösung parat. Hestermann hatte irritiert, dass Parridge ohne Rücksprache eine weitere Person eingeweiht hatte, aber er beschloss, die Dinge auf sich zukommen zu lassen – das würde schon gutgehen.
Nun also spazierten die beiden Wissenschaftler in die Richtung des botanischen Gartens. Es war ein milder Vormittag mit dreizehn Grad. Sie schwiegen weiterhin, Hestermanns Zigarette brannte bis auf einen feuchten Stummel nieder, er steckte die freie Hand in die Tasche seines Jacketts, zog eine frische Zigarette hervor und entzündete sie mit dem Stummel.
Gewundene Straßen führten identische Häuser entlang, deren Fenster allesamt mit derselben weißen Farbe gestrichen waren, als Parridge sagte: »Ach, der Penis.«
Er schüttelte betrübt den Kopf. Er habe die Herausforderung seines aktuellen Werks unterschätzt. Es drohe vulgär zu werden. Das Risiko habe von Anfang an bestanden, aber dieses Ausmaß habe er nicht erwartet.
Hestermann nickte, die Hände auf dem Rücken verschränkt. »Eine verzwickte Sache«, sagte er.
Sie bogen in die High Park Road ein, dann in die Atwoods, gingen vorbei an der Kirche Our Lady of Loreto and St Winefride, und Hestermann warf dem Gebäude einen scheuen Blick zu, dabei zog er an der Zigarette und seine Wangen wölbten sich nach innen.
»Allerdings«, sagte Hestermann, »ist bei einem guten Wörterbuch die Überzeugung des Autors irrelevant, viel wichtiger ist die Vielfalt.«
»Natürlich«, sagte Parridge, »aber beim Penis hört der Spaß auf.«
»Wenn Sie die Sprache zu zensieren beginnen, haben Sie verloren«, sagte Hestermann und seufzte. Er fügte hinzu, Obszönität könne nie ein ernstzunehmender Kritikpunkt sein, Mangelhaftigkeit aber sehr wohl.
Parridge sah aus, als wollte er gleich in Tränen ausbrechen, Hestermann schnippte Asche zu Boden.
Der botanische Garten war bereits in Sichtweite, als Hestermann sagte: »Meiner Ansicht nach, Kollege Parridge, wäre es in Ihrem Fall denkbar, den Ausweg über membrum virile zu versuchen.«
Parridge blieb stehen, den ausgestreckten Zeigefinger in der Luft, sein Mund stand offen und er blickte zum wolkenlosen Himmel empor.
»Membrum virile!«, jauchzte er.
Hestermann vertrat auf diesem Gebiet zwar eine leicht andere Meinung, denn für ihn musste die Definition eines Wortes möglichst leicht verständlich sein, und dies bedeutete, das antiquierte Latein zu verbannen. Aber bei Parridge sah er gern über seine Prinzipien hinweg. Er hatte schließlich große Bewunderung für den Kollegen übrig: In Hestermanns Augen war Parridge der letzte echte Lexikograf, ein Einzelkämpfer, der Gruppenarbeit mied, ein weiser, asketischer, einsiedlerischer Mann, der sich nicht von den Moden einlullen ließ, sehr wohl wissend, dass eine Vielzahl von Erschaffern jedem Werk die Seele raubten, ob es sich nun um ein Bild, ein Gedicht oder ein Wörterbuch handelte.
Einmal, vor einigen Jahren, hatte Hestermann einen Druck des Yamana-Wörterbuchs in streng limitierter Auflage angefertigt und ein Exemplar davon Parridge geschenkt. Der Brite aber hatte kein großes Interesse gezeigt, dieser Druck sei schon eine tolle Sache, allein die hochkomplizierte Phonetik, aber das alles erscheine ihm irgendwie blass und fahl, hatte er gesagt. Dies sei ihm auch aufgefallen, hatte Hestermann geantwortet, der Zauber sei verflogen.
»Zauber?«, hatte Parridge gefragt. »Was für ein Zauber?«
Die beiden Männer hatten sich über das handschriftliche Original gebeugt, ihre Schultern sich leicht berührend, und Hestermann hatte das Gefühl gehabt, dem Kollegen würde das Wasser im Mund zusammenlaufen, Parridge hatte geschmatzt und geschluckt und war ganz erregt geworden: Das sei ja unglaublich, ein Schatzfund, ein Eldorado der Lexikografie! Diese sichtbare Arbeit an einzelnen Definitionen! Dieser verbildlichte Lauf der Zeit! Dieses allmähliche Entstehen einer fremden Welt! Eine seltsame Art von Monomanie, deren Vielfalt dem Unendlichen nahekäme! Wie dieses Kunstwerk denn nach Deutschland gekommen, ja, wer der Verfasser sei? Unerhört! Hestermann hatte mit den Schultern gezuckt und den Kopf geschüttelt, gemurmelt, den Namen eines Verfassers habe er nirgends im Buch finden können. Jahre später würde sich Hestermann noch dafür schämen, dass er in diesem Moment den Kollegen Parridge sanft und doch etwas zu ruppig zur Seite geschoben, das Buch zu sich herangezogen, es ganz sachte zugeklappt und behutsam in seine Tasche zurückgesteckt hatte.
Im botanischen Garten näherten sie sich einer Schwarzkiefer, unter der ein kleiner Mann saß und eine Pfeife rauchte. Der Mann trug eine erdfarbene Tweedjacke, einen moosgrünen Cardigan und eine ziemlich straff geknöpfte braune Krawatte. Nachdem er an seiner Pfeife gezogen hatte, beobachtete er den dichten Rauch, der aus der Kammer aufstieg, er spitzte die Lippen und pustete Wolken aus.
Er wedelte mit der Hand und er redete, offenbar mit sich selbst, denn da stand niemand in der Nähe, der hätte antworten können. Mit einem Mal drehte er den Kopf, grummelte: »Potz Blitz!«, hüpfte auf die Füße und stürmte auf Hestermann und Parridge zu. Er streckte die Hände aus, auf eine derart ungestüme Weise, als hätte er sehr lange auf dieses Treffen gewartet.
Zu Hestermann sagte er: »Sie sind der Deutsche, ja? Herzliches Beileid.«
Dann nannte er seinen Namen, den Hestermann aber sofort wieder vergaß. Hestermann konnte sich nur die Namen von Leuten merken, mit denen er regelmäßig verkehrte.
»Setzen wir uns, setzen wir uns«, sagte der kleine Mann, »und sinnen über die Wunder dieser Welt nach.«
Er drehte sich um, eilte zurück zum Baum, lehnte den Kopf an den Stamm und zog an seiner Pfeife.
Hestermanns Blick wanderte den Stamm entlang zur Krone des Baumes. Der Baum hatte sonderbar menschliche Züge. Man hätte denken können, er besäße lange Beine, mit denen er in weiten Schritten über das Land liefe. Hestermann legte die Hand an den Stamm: Er fühlte sich warm an, war überzogen von Abertausenden dünner Platten etwa so groß wie ein Daumen, die Ähnlichkeit hatten mit Hautschuppen und herabfielen, wenn man ein wenig daran zog. Ihre Farbe war die von Vanilleschoten, darunter war der Stamm schwarz. Hestermann ging einen Schritt zurück, und da erinnerte ihn die Struktur des Baumstamms an eine Brotkruste.
Parridge zog seinen Übermantel aus, klemmte ihn in der Armbeuge fest und setzte sich auf eine Wurzel, die sich aus der Erde erhob. Auch Hestermann setzte sich. Nun begann der kleine Mann einen Monolog darüber, dass auch er Deutscher sei, gewissermaßen zumindest, vor zweihundert Jahren sei ein Vorfahre auf die Insel ausgewandert, mittlerweile sei man aber Brite durch und durch, und man könne nicht verstehen, in welche Richtung es den Kontinent gerade treibe, ein Feuer werde ausbrechen, und alles wegen des verdammten kleinen Ignoranten mit seinem nordischen Unfug und dem ganz und gar unwissenschaftlichen Quatsch, den dieser Tor erzähle. Und jetzt wolle der auch noch sämtliche völker- und sprachkundlichen Werke des Landes in eine Art Privatbibliothek verfrachten, wo er doch viel zu dumm sei, um diese Bücher verstehen zu können. Übrigens, fuhr der kleine Mann fort, habe er erst kürzlich aus Deutschland ein Schreiben erhalten, er solle seine arische Abstammung bestätigen, ohne die könne das Kinderbuch, das er verfasst habe, in Übersetzung gar nicht erscheinen, und er habe zurückgeschrieben, soweit er informiert sei, habe er keine persischen Vorfahren, und niemand in seiner Familie habe Hindi oder Romani oder ähnliche verwandte Sprachen gesprochen.
Hestermann nickte und unterdrückte ein Kichern.
»Falls Sie etwas besitzen, mein lieber Ferdinand, ohne das Sie nicht leben können, müssen Sie es aus dem Land der Barbaren schaffen, ehe es zu spät ist«, sagte der kleine Mann.
»Dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen«, sagte Hestermann und zündete sich eine weitere Lux an.
Er warf Parridge einen anerkennenden Blick zu, den dieser nicht erwiderte. Parridge hob den Kopf und schaute in die Krone des Baumes.
Der kleine Mann griff nach hinten und tätschelte den Stamm der Schwarzkiefer, und dabei setzte er ein verschwörerisches Lächeln auf. Als junger Mann habe er Berge gesehen, von denen er den Blick nur sehr schwer habe abwenden können, scharf hätten sie gegen den dunkelblauen Himmel gestanden, und zu ihren Füßen hätten sich Kiefernwälder ausgebreitet, die von türkisfarbenen Bächen durchschnitten gewesen seien, nie habe er dort einen Menschen angetroffen, der auch nur ein einziges Wort ausgesprochen habe, und erst viel später sei ihm klar geworden: Diese Menschen hätten längst verstanden, dass ihre Worte es niemals mit der majestätischen Präsenz der Berge aufnehmen könnten, mit der Wucht von Granit und Gneis, dass alles, was sie sagen würden, letztlich nichtssagend sei, und deshalb zögen sie es vor, die ganze Zeit zu schweigen.
»Ach, wirklich?«, fragte Hestermann, »und wo auf der Welt soll dieser Ort sein?«
»In der Schweiz, Freund Ferdinand, in der Schweiz.«
Hestermann wog den Kopf hin und her, nickte, murmelte etwas darüber, dass das ein gefährlicher Gedanke sei, zog eine frische Lux hervor, zündete sie an und drückte den alten Stummel zwischen die Grashalme.
»Ich würde mich strafbar machen«, sagte er.
Der kleine Mann hüstelte und klopfte sich leicht auf die Brust. »Durchaus«, sagte er, »aber dann hätten Sie das – was auch immer es ist – auch nicht nach London mitnehmen dürfen.«
Hestermanns Lux rutschte ihm aus den Fingern, drehte sich in der Luft langsam im Kreis, graziös wie der Salto eines Turmspringers, und fiel lautlos ins Gras. Hestermann griff hastig nach der Zigarette, verbrannte sich die Fingerbeeren an der Glut, steckte sich die Zigarette wieder zwischen die Lippen und zog seine Ledertasche etwas näher zu sich heran.
Wieder hüstelte der kleine Mann, er hüstelte ein silbernes Hüsteln, schaute dabei fast zärtlich zu Parridge, und Parridge nickte.
»Es muss bald geschehen«, sagte Parridge, und dabei zupfte er Grashalme aus der Erde.
Hestermann mochte diesen Ton nicht, und er mochte nicht, dass man anscheinend einen Plan ausgeheckt hatte, ohne ihn, die zentrale Gestalt, zuvor zurate zu ziehen. Aber ihn tröstete, dass Parridge Teil davon war, denn das Vertrauen zu Parridge gab ihm ein Gefühl der Geborgenheit.
Der Rest dieses Vormittags unter der Schwarzkiefer verlief relativ ereignislos, der kleine Mann referierte über eine Sprache, die nicht existierte, und er sagte Stabreime in dieser Sprache auf. Weder Hestermann noch Parridge verstanden auch nur ein einziges Wort, aber eine heitere Stimmung entstand, und irgendwann lachten die drei Männer unter dem Baum schallend, ohne dass Hestermann gewusst hätte, warum.
Trotz allem war ihm nun, als wäre dies eine Welt, in der er Frieden fand.
4.
Hestermann kämmte sich heftig die Haare.
Er rauchte eine Zigarette nach der anderen.
Der L52, der Zug von London nach Münster, ruckelte durch eine Landschaft voller Hügel, durch finstere Wälder und über dunkle Bäche hinweg; Brüssel lag schon zwei Stunden zurück, bald würden sie die deutsche Grenze erreichen. Der Zug war, abgesehen von der belgischen Lokomotive, ein deutsches Fabrikat, und, wie alles aus Deutschland, war auch der Zug sauber und ordentlich.
Hestermann saß im Speisewagen und ließ den Blick wandern über die gepolsterten Sessel, die Klapptischchen aus stabilisierter Eiche, die Schiebetüren aus Glas mit den Messinggriffen, die Servietten mit den Bügelfalten, die Tischlampen mit den drapierten Schirmen, die goldgelben Bananen auf silbernen Tellern, die maschinengeschriebenen Menükarten (Kalbsrücken, Rosenkohl und Bratkartoffeln für zwei Reichsmark, aber Hestermann hatte keinen Hunger), die geschliffenen Salzstreuer mit den polierten Verschlusskappen, die silbernen Halter für die Weißbierflaschen, die glänzenden Schuhe der Schaffner, die angeklatschten Haare an den Köpfen von Frauen und Männern, die steifen Hüte und die steifen Krawatten und die steifen Rücken.
Hestermann bestellte noch eine Tasse Kaffee, sie war mit einem goldenen Hakenkreuz bedruckt, er hob sie mit zitternden Fingern vom Unterteller, und ihm kam das alles schrecklich vor, ganz und gar abscheulich, er fühlte Angst.
Es war schon einige Jahre her, seit sein Vater gestorben war, aber nun, auf dem Weg in das makellose Deutschland, zwang sich ihm eine Erinnerung an eine Zeit auf, in der er ähnliche Angst gespürt hatte, und diese Erinnerung führte ihn ausgerechnet zu seinem Vater oder, genauer, zu dessen Nachtschrank, in einen Raum, in dem nie Licht brannte, mit einer Biedermeier-Tapete an den Wänden, wo unter Flecken und Spinnweben derselbe kirschblütenrosa Paradiesvogel in endloser Wiederholung abgebildet war.
Hestermann sah eine kindliche Version seiner Finger, die sich um den Knauf der Schublade schlossen und die Schublade aufzogen und den doppelten Boden anhoben, und er sah die blassgelbe Karte, auf der eine junge Frau abgebildet war, umgeben von Farnen und Ästen, in nichts als Unterwäsche und Stöckelschuhen, sie hielt einen gespannten Bogen samt Pfeil in den Händen, ihr linkes Bein war angewinkelt, das rechte gestreckt, und in dieser Pose war sie die Jägerin im Wald, die soeben den Laut des Wildes vernommen hatte. Schief auf dem Kopf trug sie einen Blumenkranz, und in ihrem Gesicht lag eine Mischung aus Verwunderung und Heiterkeit.
Diese Frau hatte Hestermann stark erregt, und bei jeder Gelegenheit hatte er sich in das düstere Zimmer geschlichen, das Bild betrachtet und seine Hose bewundert, unter der sich eine Beule abgezeichnet hatte.
Des Vaters Abwesenheiten waren schwer einschätzbar gewesen, als Hausknecht und Tagelöhner hatte er mal hier, mal da gearbeitet, und eines Morgens war er überraschend wiedergekommen, nachdem er gerade das Haus verlassen hatte, und war in den Raum mit der Biedermeier-Tapete getreten. Draußen hatte es geregnet, Wasser war von Vaters Hut getropft, er hatte seinen Wanderstock mit den Stocknägeln in Form von Hirschgeweihen in der Hand gehalten, und über alldem hatte es geklappert und geklirrt vom Abwasch der Mutter in der Küche. Ohne auch nur den Hauch eines Zögerns hatte Vater diesen Wanderstock gehoben und auf Ferdinand eingedroschen, mit derartiger Heftigkeit, dass es dem Jungen vorgekommen war, als würde er aus seinem Körper geschleudert. Ganz plötzlich war er nicht mehr Ferdinand gewesen, sondern ein unbeteiligter Zuschauer, fassungslos in dieses Kindergesicht schauend, das im Bruchteil einer Sekunde von den Hirschgeweihen zerschnitten worden war, als wäre es ein Stück Fleisch, das sich zu einer grotesken Fratze wandelte, nicht einmal die Augen waren noch sichtbar gewesen, da auch sie sich mit Blut gefüllt hatten.
Nach einer längeren Zeit der Heilung hatte der unerschütterliche Glaube an die Liebe Jesu den Vater dazu veranlasst, seinen Sohn in die Obhut katholischer Priester zu geben, auf dass der Kleine in der Gesellschaft der Steyler Missionare lerne, seine Triebe im Zaum zu halten. Den vorwurfsvollen Blick seiner Mutter und ihre zum Gebet gefalteten Hände würde Hestermann nie vergessen, während er an Ostern das Haus seiner Eltern verließ, mit einem Gefühl der Panik in der Brust, allein zu sein in dieser Welt.
Hestermann strich mit der Daumenkuppe über das goldene Hakenkreuz, die Augen geschlossen, als er eine Hand auf seiner Schulter spürte. Er hob den Kopf und sah einen Mann in Uniform.
Er stieß einen unterdrückten Schrei aus.
Der uniformierte Mann wünschte einen guten Abend und bat Hestermann, sich zu seinem Abteil zu begeben.