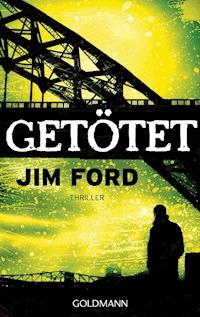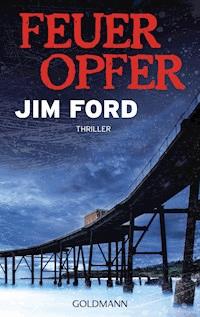
2,99 €
Mehr erfahren.
Der dritte Fall für Detective Chief Inspector Theo Vos aus Newcastle.
Niemand mag Kredithaie, und die Liste der Menschen, die Ged Salkeld den Tod wünschten, würde das Telefonbuch Newcastles füllen. Aber wer hat Salkeld so gehasst, dass er sein Haus abbrannte, während seine Frau und Kinder im Obergeschoss schliefen? Diese Frage stellen sich DCI Theo Vos und sein Team, als sie in den verkohlten Trümmern nach Spuren suchen. Das Tatmotiv scheint zumindest festzustehen. Doch der Fall ist viel komplizierter als Vos zunächst annimmt. Und er hat es mit einem eiskalten Killer zu tun, der auf perfide Weise Katz und Maus mit ihm spielt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Niemand mag Kredithaie, und die Liste der Menschen, die Ged Salkeld den Tod wünschten, würde das Telefonbuch Newcastles füllen. Aber wer hat Salkeld so gehasst, dass er dessen Haus in Brand setzte, während Salkelds Frau und Kinder im Obergeschoss schliefen? Diese Frage stellen sich DCI Theo Vos und sein Team, als sie in den verkohlten Trümmern nach Spuren suchen. Das Tatmotiv zumindest scheint festzustehen. Doch der Fall ist viel komplizierter, als Vos zunächst annimmt. Und er hat es mit einem eiskalten Killer zu tun, der auf perfide Weise Katz und Maus mit ihm spielt …
Informationen zu Jim Ford
und weiteren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
JIM FORD
Feueropfer
EinInspector-Vos-Thriller
Aus dem Englischen
von Jochen Stremmel
Die Originalausgabe erschien 2014
unter dem Titel »In Vitro«
bei Constable & Robinson, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2016
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Jim Ford
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: Copyright © Getty Images/Steve Daggar Photography
Redaktion Alexander Behrmann
mb · Herstellung: Str.
ISBN: 978-3-641-16674-8V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:
Für abwesende Freunde
Teil eins
TITELLOSES MANUSKRIPT: 8. Entwurf
Man sagt, alle Väter sollten sich die Mühe machen, die Meilensteine im Leben ihrer Kinder mitzuerleben.
Ich war dabei, als meine Tochter geboren wurde. Ich sah ihr kleines Herz schlagen und beobachtete, wie rosafarbenes Leben sich in ihrem Körper ausbreitete, als sie ihren ersten Atemzug machte. Ich war sechs Monate später dabei, als sie ihr erstes Wort sagte: ein kurzes, zweifelndes »Ba!«. Ich war dabei, als sie ihren ersten Zahn bekam, als sie begann zu krabbeln und als sie, mit dreizehn Monaten, ihre ersten torkelnden Schritte von der Kante des niedrigen Wohnzimmertischs in meine ausgestreckten Hände machte.
Und ich war natürlich an ihrem dritten Geburtstag dabei. Dem Tag, an dem sie verschwand.
Nach ein paar Stunden, als die Dunkelheit schließlich hereingebrochen war und die Suchtrupps aus den Dünen zurückgekommen waren, blieb eine Polizeibeamtin bei mir im Strandhaus. Ihr Name war Kath Ptolemy, und sie war Detective Constable vom Alnwick CID, der man den Auftrag gegeben hatte, sich um mich zu kümmern. Sie war vielleicht zehn Jahre jünger als ich, und ich dachte unwillkürlich an diesen alten Spruch, dass man weiß, man wird älter, wenn Polizisten anfangen, jünger auszusehen.
»Glauben Sie, sie ist entführt worden?«, fragte ich sie. »Glauben Sie, sie ist tot?«
»Bitte, Richard«, sagte sie. »Solche Sachen dürfen Sie nicht sagen.«
Aber du ertappst dich dabei, solche Sachen zu sagen, nicht weil du irgendwelche Trostworte zur Antwort hören möchtest, sondern weil der Vorgang dein Gehirn nur ein paar glückselige Sekunden lang von dem schreienden Entsetzen ablenkt. Das wusste Ptolemy. Deshalb sorgte sie dafür, dass ich weiterredete.
»Was für eine Art Schriftsteller sind Sie denn?«, fragte sie.
»Ich schreibe Romane. Das ist zumindest mein Traum.«
»Haben Sie schon was veröffentlicht?«
»Ein paar Sachen. Kurzgeschichten. Kleine journalistische Texte hier und da. Aber es ist eine schwierige Zeit. Die Verleger schnallen alle die Gürtel enger. Was für Sachen lesen Sie denn?«
Sie schaute mich verlegen an. »Ich bin keine große Leserin.«
»Dafür ist immer Zeit«, sagte ich zu ihr. »Es ist nie zu spät, um ein Buch in die Hand zu nehmen.«
»Ich muss rasch mal telefonieren«, sagte sie. »Machen Sie doch eine Kanne Tee für uns. Und Sie sollten etwas essen. Sie müssen bei Kräften bleiben. Haben Sie irgendwas im Haus?«
»Im Kühlschrank ist etwas Käse. Cracker. Möchten Sie irgendwas?«
»Das wäre toll.«
Das ist noch ein Trick, siehst du? Halte sie in Atem, die, die einen Verlust erlitten haben. Bring ihnen keinen Tee oder Mitleid entgegen, weil sie nur dasitzen und die Wände anstarren und an ihr Kind denken, das an irgendeinem dunklen und furchtbaren Ort nach ihnen schreit, während du das Zimmer verlassen hast, um das Teewasser aufzusetzen und die Kekse auf einen Teller zu legen.
Deshalb ging ich in die Küche und ließ Wasser in den Kessel laufen. Ich nahm ein großes Stück reifen Cheddar aus dem Kühlschrank und schnitt ihn auf dem Schneidebrett in Scheiben. Ich legte die Scheiben fein säuberlich auf die Kekse. Ich schnitt sogar eine Tomate in vier Stücke.
»Wie lange haben Sie schon dieses Haus?«, sagte Ptolemy, die in der Küchentür erschien.
»Seit ein paar Jahren.«
»Schön. Wie oft kommen Sie hier raus?«
»Früher an den meisten Wochenenden. Seltener, seitdem Beatrice auf die Welt gekommen ist, aber es wird wieder leichter gehen, wenn –«
»Es ist ein wunderschönes Fleckchen«, sagte Ptolemy rasch. »Ich hoffe, Sie haben etwas Milch.«
Sie hatte die ganze Zeit ihr Mobiltelefon in der Hand. Manchmal hob sie es hoch und schaute auf das leere Display, bevor sie die Hand wieder sinken ließ. Gelegentlich scrollte sie nach unten, um nachzuschauen, ob sie eine SMS erhalten hatte. Und wenn sie nicht mit ihrem Handy herumspielte, schaute sie auf das Festnetztelefon auf dem Ständer neben dem Sofa. Weil – abgesehen von der Unterhaltung – das der wahre Grund für ihre Anwesenheit war. Falls jemand anrief, um zu sagen, sie hätten Beatrice gefunden.
Aber in dieser Nacht klingelte das Telefon nicht.
Ich rechnete nicht damit, schlafen zu können. Ich glaubte, ich wäre zu aufgedreht, zu verzweifelt. Zu verdammt schuldbewusst. Aber ich wurde von Ptolemy geweckt, die fest an meiner Schulter rüttelte.
»Richard«, sagte sie. »Wir müssen aufbrechen.«
Ich lag auf dem Sofa unter einer dünnen Decke. Ich konnte es nicht ertragen, im Schlafzimmer zu sein, weil man dafür an dem Gästezimmer vorbeigehen musste, das wir im letzten Sommer für Beatrice eingerichtet hatten.
Furcht ergriff mich. »Was ist passiert? Hat man sie gefunden?«
»Nein. Kommen Sie. Ziehen Sie sich an, wir müssen gehen.«
Ich konnte angesichts des dünnen, grauen Lichts sofort erkennen, dass es gegen sechs Uhr sein musste. Wenn wir mit Beatrice hier waren, war das die Zeit, in der mein Tag begann. Indem ich Toast und Kaffee machte, Rice Krispies in eine Schale schüttete, barfuß neben der offenen Küchentür stand und dem Meeresrauschen auf der anderen Seite der Dünen zuhörte.
Auf ihr Rufen aus dem ersten Stock und den Aufschwung meines Herzens wartete.
»Wohin gehen? Ich darf hier nicht weg. Was ist, wenn …?«
»Ziehen Sie sich an, Richard. Bitte.«
Irgendwo habe ich gelesen, dass die größte Chance, ein vermisstes Kind lebendig und wohlauf zu finden, innerhalb der ersten vier Stunden nach seinem Verschwinden besteht. Danach verringert sich die Wahrscheinlichkeit exponentiell mit jeder Stunde, die verstreicht. Von all den Dingen, über die wir an jenem ersten Abend sprachen, war dies das Einzige, was Ptolemy nicht erwähnte – weil sie wusste, dass es das Einzige war, was mich zu einem kleinen Häufchen Elend reduziert hätte.
Die ersten beiden Stunden, nachdem Beatrice verschwunden war, wurden folgendermaßen verbracht: still dastehend, auf die leere Rückentrage auf dem Boden starrend; ihren Namen rufend; fluchend; am Strand auf und ab gehend; nach oben in die Dünen steigend; Leute fragend, ob sie das Kind gesehen hätten; den Strand hinauf- und hinunterrennend; suchend durch die Brandung streifend; zurück zum Haus rennend; zurück zum Strand rennend; noch ein paarmal ihren Namen rufend; stehend, sitzend, nachdenkend, in Panik geratend, betend.
Die nächste Stunde wurde mit Warten darauf verbracht, dass die Polizei auftauchte, und als sie da war, mit der Erklärung, dass ich Beatrice nur zwei Minuten aus den Augen gelassen hatte, während ich in meiner Spur zurückging und den Sonnenhut suchte, den sie von der Rückentrage aus weggeworfen hatte. Zwei verdammte Minuten. Sie war drei Jahre alt – wie weit konnte sie gegangen sein? Die Polizisten schauten mich an, als wollten sie sagen: Allein oder mit jemand anderem?
Die vierte Stunde – die letzte Stunde, in der die Chancen, ein vermisstes Kind wiederzufinden, gut stehen – wurde damit verbracht, das gleiche Gebiet des Strandes, der Dünen und der Brandung mit zwei Polizisten in Uniform abzusuchen. Den gleichen Leuten die gleiche Frage zu stellen: Haben Sie ein kleines Mädchen gesehen? Drei Jahre alt, braunes, lockiges Haar, leichtes Sommerkleid mit Tupfen?
Und danach verringerte sich die Wahrscheinlichkeit, sie wiederzufinden, mit jeder Stunde, die verstrich, exponentiell.
Als Ptolemy mich weckte, war Beatrice seit sechzehn Stunden verschwunden.
Das Strandhaus liegt am Ende einer Sackgasse, die so ziemlich in den Dünen selbst aufhört. Es hört sich schrecklich eindrucksvoll an, wenn jemand sagt, wir haben ein Wochenendhaus an der northumbrischen Küste, aber an unserem ist nichts Eindrucksvolles. Glaubt mir, einige der anderen Häuser im Dorf haben größere Garagen. Margaret und ich kauften es spottbillig von der Gemeinde, weil sie auf diese Weise um die Abrisskosten herumkam. Es sollte unser »work in progress« werden, etwas, an dem wir herumbastelten, sobald das Geld verfügbar war. Das eingeschossige Steingebäude, das von Dünen und Strandhafer fast verborgen wurde, beherbergte mal zu der Zeit, als Rettungsboote wenig stabile Ruderboote aus Holz waren, das Bamburgher Rettungsboot. Das ganze Ding steht immer noch auf den originalen Holzpfählen; unter dem Fußboden gibt es einen Hohlraum mit festgetretener Erde, worüber wir nicht allzu gern nachdenken, wenn wir im Bett liegen und dem Krächzen und Stöhnen des Hauses in einer windigen Nacht zuhören. Von dort, wo sich jetzt die Küche befindet, führte früher eine Holzrampe über den Sand, und das Boot wurde von Pferden direkt ins Meer gezogen.
Heutzutage kommen die Rettungsboote aus Seahouses oder Berwick-upon-Tweed. Es sind kräftige Schiffe auf dem neuesten technischen Stand mit großen Motoren und Radar, mit denen sie in der Lage sind, große Meeresgebiete abzusuchen. Sie arbeiten mit den Sea King Seenotrettungshubschraubern zusammen, die auf dem RAF-Stützpunkt Boulmer an der Küste im Süden stationiert sind. Wenn man auf See verschollen ist, finden sie einen irgendwann. Und falls sie es nicht tun, wird es irgendjemand sonst tun. Die Küste hier ist ewig lang. Alles hängt davon ab, wo das Meer sich entschließt, einen auszuspucken.
Als ich an jenem Morgen das Haus verließ, konnte ich die Rotoren des Sea King und die grollenden Motoren der Rettungsboote hören, die ihre Suche entlang des lückenlosen Küstenstrichs vom Bamburgh Castle bis nach Seahouses wieder aufnahmen. Es kam mir entgegen, dass sie nicht sehen konnten, wie ich auf dem Rücksitz von Ptolemys Wagen Platz nahm. Ich schämte mich, dass dieser ganze Aufwand betrieben wurde, weil ich kurze Zeit nicht aufgepasst hatte.
»Die Pressestelle in Newcastle hat gestern Abend ein Foto von Beatrice freigegeben«, sagte sie, als sie den Motor anließ und mit einigem Tempo auf der Küstenstraße zum Dorf fuhr. Sie klang verärgert, als sei die Entscheidung ohne ihr Wissen getroffen worden. »In diesem Moment wird die A1 voll sein mit Reportern, die von der Stadt nach Norden unterwegs sind. Sie werden keine zwei Minuten brauchen, um herauszukriegen, wo Sie sich aufhalten. Wir müssen Sie hier wegbekommen, bevor wir von ihnen belagert werden.«
»Wo fahren wir hin? Ich will nicht zu weit weg sein, falls …«
»Keine Sorge. Wir machen nur, dass wir aus Bamburgh rauskommen, das ist alles. Ich kenne einen Ort hier in der Nähe.«
»Wird Maggie dort sein?«
»Ich habe gehört, sie ist unterwegs.«
»Oh.«
»Was hat sie überhaupt in Frankreich gemacht?«
»Eine Schüleraustauschfahrt. Sie ist Lehrerin.«
»Ach ja? Wo?«
»An der Kenton School in Newcastle.«
»Unterrichtet sie Französisch?«
»Eigentlich unterrichtet sie Mathematik. Aber es herrscht Personalknappheit.«
»In Mathematik war ich immer ein hoffnungsloser Fall.«
Ich rieb ein Loch in die beschlagene Rückscheibe und schaute zu dem bedrohlich wirkenden Klotz des Bamburgh Castle. Am Tag zuvor war ich mit Beatrice auf den Schultern die steile Böschung hochgestapft, schwitzend wie ein Kanalarbeiter, während sie mir mit ihren weichen, geballten Fäusten fröhlich oben auf den Kopf trommelte. Als wir den Festungswall erreichten, vollzog ich das Limbo-Tanz-Manöver, das erforderlich ist, um die Rückentrage aufzuhaken. Sofort fiel sie über meine Brille her, fischte sie von meiner Nase und schwenkte sie wie eine Trophäe durch die Luft.
»Bea-trice«, sagte ich mit dieser strengen Erwachsenenstimme, die Kinder mit Vergnügen ignorieren. »Was haben wir wegen Daddys Brille besprochen? Ich kann jetzt überhaupt nichts sehen.«
»Ja, ja«, sagte sie und schlug mir damit quer durchs Gesicht.
Ganz in der Nähe, in einer der Öffnungen für die Kanonen, die inzwischen für Sitzbänke genutzt wurden, stießen sich zwei Frauen mittleren Alters an und lächelten nachsichtig.
»Na ja, wenn das dein letztes Wort zu diesem Thema ist, dann muss ich dich leider über die Brüstung werfen.«
Ich packte sie wie einen Rugbyball und hielt sie am ausgestreckten Arm, sodass ihr Kopf einen Moment lang über der Zinne und den Felsen dreißig Meter tiefer hing. Sie wand sich wie verrückt, schreiend vor Lachen, und ich konnte das missbilligende Einatmen der beiden Frauen fast hören, aber es war völlig ausgeschlossen, sie fallen zu lassen, und das war Beatrice auch klar.
Weil das die Abmachung zwischen uns, Beatrice und mir, von dem Moment an war, als ich sie am Tag ihrer Geburt auf meiner Handfläche hielt.
Der Ort, den Ptolemy kannte, war ein abgelegenes Bed and Breakfast ungefähr sechs Meilen landeinwärts. Es gehörte – wie es bei B&Bs immer der Fall zu sein scheint – einer weißhaarigen Schottin in den Sechzigern. Sie hieß Mrs McLeod, und sie war eindeutig auf unsere Ankunft vorbereitet worden. Wir waren kaum durch die Tür, als wir in einen kleinen Speiseraum geführt wurden und ein komplettes englisches Frühstück serviert bekamen.
»Rufen Sie einfach, wenn Sie irgendwas brauchen«, sagte sie und verließ dann zügig das Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Sie war eindeutig ebenfalls darauf vorbereitet worden, keinen Smalltalk zu machen.
»Essen Sie«, sagte Ptolemy. Sie konnte sehen, dass ich das Essen mit ausdruckslosem Gesicht anstarrte. Aber es ist schwierig, daran zu denken, Würstchen, Speck und Eier zu essen, wenn man ein komisches Gefühl in der Magengrube hat. »Im Ernst, Richard, runter damit. Sie fühlen sich danach besser.«
Ich schnitt versuchsweise ein glänzendes Stückchen Wurst ab und steckte es in den Mund. Ich rechnete damit, dass es nach Asche schmeckte, aber es war auf eine Weise köstlich, wie Würstchen es nie sind, wenn man sie selber macht.
»So ist’s richtig.« Ptolemy nickte zustimmend. »Mrs McLeod macht das beste Frühstück in Northumberland.«
Und damit begann es wieder. Die gnadenlose, optimistische Konversation vom vergangenen Abend. Abgesehen davon, dass es diesmal nicht funktionierte. Ptolemy sprach, und ich erwiderte etwas – aber heute ließen sich die Gedanken nicht ablenken. Ich dachte immer wieder an Beatrice. Daran, wie sich ihr Mund, kurz bevor sie zu weinen anfing, neu anordnete, sodass die vorspringende Unterlippe fast gerade und die Oberlippe zu drei gleich langen Stücken darüber versteift war. Ein vollkommenes gleichschenkliges Trapez, wie Maggie es mal beschrieben hatte.
Wir sahen sie schrecklich gern weinen: die Art, wie ihr Gesicht rot wurde und Tränen sich in ihren Augen sammelten und dann ein Geräusch mit der gleichen ansteigenden Tonhöhe wie eine Luftschutzsirene aus diesem vollkommen trapezförmigen Mund kam. Aber sie sah immer so herzzerreißend klein und verloren aus, wie sie mit ihrer Spielzeugmenagerie verstreut um sich herum auf dem Boden saß, dass wir sie nie lange weinen lassen konnten. Einer von uns ging dann zu ihr, und schon bevor wir bei ihr waren, hatte sie die Arme in Bereitschaft erhoben.
Der Gedanke, dass niemand da sein würde, um sie hochzuheben, ihr die Tränen vom Gesicht zu wischen, mit den Lippen ihren Nacken zu liebkosen und ihr zu sagen, dass alles in Ordnung sei …
Siebzehn Stunden nachdem Beatrice verschwunden war, war es dieser Gedanke, der mir das Herz brach.
Die Morgenzeitung hatte Beatrices Bild auf der Titelseite veröffentlicht. Die Schlagzeile war: HABENSIEBEATRICEGESEHEN? Die Zeile darunter lautete: FIEBERHAFTESUCHENACHVERMISSTEMKLEINKIND.
Das Wort »fieberhaft« stach hervor. Es beschwor Bilder von einem heulenden Mob herauf, der mit brennenden Fackeln herumlief, Türen eintrat, Möbel zertrümmerte, Menschen zu Boden warf und auf ihnen herumtrampelte. Es symbolisierte die Angst der Gesellschaft davor, was sie fähig war, ihren Kindern anzutun. Vor ihrer schwarzen, böswilligen Seele.
Ich lag im ersten Stock auf dem Bett, als Maggie eintraf.
Es war kurz nach ein Uhr, obwohl es mir so vorkam, als starrte ich seit Tagen auf die komplizierten Wirbel und Schleifen der Stuckrosette an Mrs McLeods Zimmerdecke. Das Geräusch von Reifen, die auf der Kieszufahrt vor dem Fenster knirschend zum Stehen kamen, jagte ein furchtbares Gefühl der Vorahnung durch meinen Körper.
Auf den ersten Blick sah meine Frau aus wie immer: elegant, nüchtern gekleidet, beherrscht. Ganz wie eine Lehrerin. Aber als man ihr half, hinten aus dem Streifenwagen zu steigen, sah ich, dass ihr Gesicht abgespannt und ihre Haut blass und matt war, von den dunkel verfärbten Halbmonden der Müdigkeit unter ihren Augen abgesehen.
Ich sah, wie sie zu mir hochschaute, und wandte mich vom Fenster ab. Ich rechnete damit, dass sie wütend auf mich war. Mich schlug, trat und anschrie. Ich war bereit, das zu akzeptieren, weil ihre Wut das war, was ich verdient hatte. Sie war das, was ich brauchte, um meine Schuld zu lindern. Aber sie stand nur da in der Diele mit Ptolemy und einer Polizistin in Uniform und schaute dorthin, wo ich oben an der Treppe stand. Ihr Gesicht war ausdruckslos. Ihre Augen waren tot. Es war so, als ob sie mich nicht erkennen würde.
Dann schien sie zu schwanken, und als Ptolemy nach ihrem Arm griff, dachte ich einen Moment lang, dass sie zusammenbrechen würde. Aber ich war es, der zusammenbrach. Direkt oben an der Treppe. Ich spürte, wie meine Beine unter mir nachgaben, und rutschte an der Wand hinunter, bis ich mit der Stirn auf den Knien dasaß und meine Hände meinen Hinterkopf umfassten, während ich vor lauter Schluchzen kaum atmen konnte.
»Ach Herrgott, Mags, es tut mir so leid.«
Den größten Teil des zweiten Tages saßen wir in einer Atmosphäre beinahe unwirklicher Distanziertheit in Mrs McLeods makellosem Wohnzimmer und sahen die Fernsehnachrichten.
Alle fünfzehn Minuten wechselte der Bericht zum Strand von Bamburgh, wo ein windgepeitschter Reporter eine Aktualisierung bot und die Kamera einen Schwenk an der Küste entlang machte oder ein Rettungsboot oder ein Schiff der Küstenwache heranzoomte, die entschlossen durch die Wellen kreuzten. Doch selbst wenn sich die Kamera auf das Strandhaus konzentrierte – unser Haus, um Himmels willen –, kam es mir so vor, als redete der Reporter von jemand anderem.
Das Foto, das sie in der Nachrichtensendung benutzten, war am Tag zuvor aus einem billigen Holzrahmen von dem Bücherregal des Strandhauses genommen worden. Es war das Bild von Beatrice, das ich am wenigsten mochte, das, von dem ich immer denke, dass es ihr am wenigsten ähnlich sieht, und das ganz und gar ungeeignet ist, ihr Wesen zu erfassen. Darauf sitzt sie auf einem prallen Polster vor einem Hintergrund aus gerüschtem, purpurfarbenem Satin. Sie trägt ein Samtkleid über einem Hemd mit einem rundhalsigen Ausschnitt. Ihre dicken, ungebärdigen Locken sind ordentlich an einer Seite gescheitelt, und ihre dunklen Augen sind mit einem Ausdruck verträumten Unbehagens auf etwas knapp außerhalb des Fotoapparats gerichtet. Wir hatten es von einem professionellen Fotografen machen lassen, obgleich der Henker wissen mag, warum. Ich nehme an, wir dachten, es sei etwas, das Eltern tun sollten. Letzten Endes haben wir keine weiteren Abzüge machen lassen. Wir haben nur das Muster behalten und es rahmen lassen, damit wir in Zukunft daran dachten, es nicht noch einmal zu tun.
»Hätten sie nicht ein anderes Foto nehmen können?« war alles, was Maggie sagte, als sie es auf dem Fernsehschirm erblickte.
Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder so gut wie möglich aussehen, selbst wenn sie verschwunden sind, höchstwahrscheinlich tot.
Um vier Uhr an jenem Nachmittag wurde die Such- und Rettungsoperation reduziert. Um neun Uhr abends wurde sie ganz eingestellt.
Eine Stunde später kam Ptolemy vorbei, um uns mitzuteilen, dass Beatrice lebendig und wohlauf gefunden worden sei. Unsere Tortur sei vorüber.
Ach, wenn es doch nur so gewesen wäre.
EINS
Gestern Abend war die Chiltern Avenue eine unauffällige Straße in Benwell, am westlichen Ende von Newcastle. Heute Morgen ist sie allerdings mit Polizeiwagen und Einsatzfahrzeugen und Fernsehübertragungswagen verstopft. Ein Pressehubschrauber kreist in einer Höhe von sechshundert Metern, die Kamera in seinem Rumpf auf ein Haus im Besonderen gerichtet. Normalerweise sind Brände in Privathäusern kein Gegenstand der landesweiten Berichterstattung, nicht einmal an Tagen, wo sonst nichts passiert. Fast nie müssen sich die Detectives der Major Crime Unit der Polizei von Northumbria darum kümmern. Aber heute Morgen sind vier Menschenleben zu beklagen, zwei davon Kinder, und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Brandstiftung im Spiel ist.
Das Haus mit der Nummer 152 ist eine Doppelhaushälfte mit drei Schlafzimmern, das an der Vorderseite mit einer PVC-Veranda, einer übergroßen Satellitenschüssel und einer knallbunten Fassadenverkleidung aufgemotzt worden ist. Die Veranda und die Schüssel sind allerdings geschmolzen, und der größte Teil der geschwärzten Steinfassade ist inzwischen hinter einem großen, schützenden Baldachin verborgen. Das Dach darüber ist so gut wie verschwunden, und nur noch ein paar verkohlte Dachbalken ragen heraus. Das Nachbarhaus ist zwar nicht so schlimm beschädigt, weist aber trotzdem dicke Rußflecken auf, die wie Finger aus den klaffenden Fensterhöhlen nach oben steigen, und auch sein Dach ist zur Hälfte eingebrochen. Das Feuer war kurz nach Mitternacht von einer Frau im gegenüberliegenden Haus gemeldet worden. Als das erste Feuerwehrfahrzeug acht Minuten später eintraf, war der Brand schon durch das Haus gefegt, und es waren drei Besatzungen notwendig, um es unter Kontrolle zu bekommen. Es wurde hell, bevor sie es riskierten, das Haus zu betreten, und das war der Moment, als die erste Leiche entdeckt wurde.
Detective Chief Inspector Theo Vos bleibt am Eingang des Baldachins stehen. Er schlüpft in ein Paar Plastiküberschuhe sowie in einen Teletubby-Anzug aus Papier und betritt das Haus. Auf der anderen Seite einer schweren Zwischenwand aus Polyäthylenfolie erwartet ihn Gordon Watson, der Leiter der Spurensicherungseinheit. Die Treppe hinter Watson ist ein verkohlter Stumpf, der sich aus dem qualmenden Schutt bis zu einem klaffenden, tropfenden Loch erhebt, durch das man den Morgenhimmel sehen kann. Der Brandgeruch ist fast überwältigend.
Watson schiebt die Kapuze seines Anzugs zurück, um sich an einem struppigen, silbrigen Haarbüschel zu kratzen. »Morgen, Theo«, sagt er mit einem dunkel rollenden, schottischen R.
»Gordon.«
»Hier entlang.«
Seit Tagesanbruch ist Watsons Team in dem ausgebrannten Haus zugange. Mittlerweile ist jeder Quadratfuß abgeteilt, mit einer Nummer versehen und zur Analyse vorbereitet worden. Die beiden Männer folgen einem Trampelpfad aus erhöhten, metallenen Trittplatten durch das, was von der Diele übrig ist, bis in die Küche auf der hinteren Seite des Hauses. Hier finden sie Detective Sergeant Bernice Seagram und den Feuerwehrchef, einen Mann namens Doggart. Sie starren auf eine flache Schlucht aus geschwärztem Linoleum, die sich von der Mitte der Küche aus zurück in die Diele erstreckt.
»Morgen, Boss«, sagt Seagram.
»Bernice«, sagt Vos. »Morgen, Barry.«
Doggart nickt grimmig. Seine Augen sind blutunterlaufene Schlitze, die aus einem rauchgeschwärzten Gesicht hinausgucken. »Das hier ist ein beschissen schlimmes Ding, Theo. Nur gut, dass die Nachbarn weg waren, sonst wäre es noch schlimmer gewesen.«
»Wie sieht es aus?«
»Der Brandherd ist hier.« Doggart zeigt mit einem behandschuhten Finger auf die Schlucht. »Höchstwahrscheinlich Benzin. Von der Küche durch die Diele bis zum Fuß der Treppe gespritzt, wenn man von dem Spurenmuster ausgeht.«
Vos wirft Seagram einen Blick zu. »Wo sind sie reingekommen?«
»Wie es aussieht, durch die Terrassentür, Boss«, sagt sie.
Die Tür, durch die man über eine Fläche erhöhten Bohlenbelags in den Garten kommt, besteht aus wenig mehr als einem Geflecht verkohlter Plastikstreben, die durch angeschmorte Scharniere mit dem Rahmen verbunden sind. Rauten geschwärzten Glases von dem zerbrochenen Spiegelglasfenster liegen auf dem Boden.
»Wir haben das hier gefunden«, sagt Gordon Watson. Er hält einen Beweisbeutel aus Plastik hoch. Darin befindet sich eine vollkommen runde Glasscheibe mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern, leicht mit Ruß bestäubt. »Ich vermute, dass sie einen kreisförmigen Glasschneider mit einem Gummisaugnapf benutzt haben. Gerade genug Spielraum, um mit der Hand durchzugreifen und den Riegel an der Tür innen umzulegen.«
Vos scheint überrascht. »Profis am Werk?«
»Hängt davon ab, was du unter professionell verstehst«, sagt Watson. »Man kann diese Glasschneider für einen Zehner in jeder Eisenwarenhandlung bekommen. Aber es würde auf ein gewisses Maß an Vorsatz schließen lassen. Andernfalls hätten sie einen Vorschlaghammer gebraucht, um die Scheibe zu zerbrechen, und das hätte die halbe Straße wach gemacht, von den Bewohnern des Hauses ganz zu schweigen.«
Vos nickt. Hier liegt mit Sicherheit Vorsatz vor. Und außerdem Raffinesse. Nach seiner Erfahrung liefen die meisten Brandanschläge so ab, dass Brandbeschleuniger hastig durch einen Briefkastenschlitz geschüttet wurde, gefolgt von einem brennenden Lappen oder Stück Zeitungspapier. Wer auch immer für diese Feuersbrunst verantwortlich war, hatte sich Zeit genommen. Nicht nur das, er war auch mit dem Haus vertraut. Er wusste von der Spiegelglastür zur Terrasse und hatte entsprechende Vorbereitungen getroffen.
Eine Metallkette hängt an den Überresten eines hölzernen Kleiderhakens neben der Haustür. An der Kette ist etwas befestigt, das wie ein Streifen angekohlten Leders aussieht.
»Ist das eine Hundeleine?«
»Sieht so aus«, sagt Seagram.
»Wo ist der Hund?«
Einen Moment lang ruhen alle Augen auf Barry Doggart, der mit den Achseln zuckt. »Ich erinnere mich nicht, einen Hund gesehen zu haben.«
Watson schüttelt den Kopf. »Falls er hier drin ist, haben wir ihn nicht gefunden.«
Vos hält einen Finger an die Kette. Sie ist immer noch warm. »Okay«, sagt er. »Ist Tunderman noch hier?«
»Er ist inzwischen bei den Leichen«, meint Seagram.
Auf der Chiltern Avenue schaut sich Detective Constable Phil Huggins einen Haufen von Blumensträußen und handgeschriebenen Karten an, der sich während des Vormittags vor dem Absperrband angesammelt hat, mit dem die Straße abgeriegelt wird.
Schlaft schön im Himmel, ihr kleinen Engel Ihr seid jetzt in Gottes Hand, Schätzchen
Die Buchstaben auf der Karte sind in jener eigentümlich runden Schrift gehalten, wie sie von Blumenhändlern und Grundschullehrerinnen gebraucht wird. Einer der uniformierten Polizisten nimmt einen weiteren Strauß aus der Menge entgegen und legt ihn respektvoll neben die anderen.
Jetzt seid ihr in Sicherheit, ihr Kleinen Im Himmel braucht man keine Tränen
Huggins schiebt seine langen Beine zusammen, um sich hinzuhocken. Wer lässt sich diesen Scheiß einfallen?, denkt er, während er die Karten liest.
Niemand redet so in Benwell. Nirgendwo redet irgendjemand so. Er durchsucht die blumigen Beileidsbotschaften, bis er eine zu Tage fördert, die mit Filzstift auf etwas geschmiert worden ist, was aussieht wie ein abgerissenes Stück Karton von der Rückseite einer Müslipackung.
HAIFISCHFOTZESCHMORINDERHÖLLE
Das kommt der Sache schon näher. Huggins hebt die Notiz mit einem Taschentuch auf und lässt sie in einen Plastikbeutel gleiten. Prägnant, treffend und wahrhaft tief empfunden. Er ist kein Psychologe, aber er ist schon vor langer Zeit zu der Einsicht gelangt, dass stellvertretende Trauer nur das Vorspiel zu einer Standardposition der Schuldzuweisung darstellt. Er erinnert sich, dass die öffentliche Stimmung nach Prinzessin Dianas Tod schnell von Hysterie in tief sitzenden Hass gegen die Königsfamilie umkippte. Im Fall der toten Kinder in Nummer 152 ist bereits mit dem Finger auf ihren Vater gezeigt worden.
Und was ist denn an Ged Salkeld nicht hassenswert?
Ein Stück weiter die Straße hinunter ist Detective Constable John Fallow dabei, eine dicke Frau in einem Morgenmantel aus Nylon zu trösten, deren Schluchzen vom Paffen einer Mentholzigarette unterbrochen wird.
»Sie waren derart süße Kinder«, sagt sie, während sie auf die Überreste von Nummer 152 starrt. »Gute Kinder. Machten ihrer Mutter solche Ehre.«
»Haben Sie die Kinder gestern Abend gesehen, Mrs Mayhew?«, fragt Fallow.
»Ja, sie waren draußen und haben auf der Straße gespielt. Sie waren immer draußen. Alle Kinder hier in der Gegend spielen draußen. Es ist sicher, wissen Sie. Sicher.«
Sie beginnt wieder zu schluchzen, und eine große Schleimblase tritt aus ihrem linken Nasenloch, bevor sie auf ihrer Oberlippe zerplatzt. Sie wischt die Flüssigkeit mit dem Ballen einer mascarabefleckten Hand ab und nimmt dann einen tiefen, beruhigenden Zug von ihrer Zigarette. Eine Gruppe ähnlich verzweifelter Frauen hat sich um sie herum gebildet, und zu Fallows Erleichterung tritt eine von ihnen vor, um sie zu umarmen.
»Kannten Sie Mr Salkeld?«
Mrs Mayhew erstarrt und schaut mit Feuer in den Augen hoch. »Oh, diesen Scheißkerl hab ich allerdings gekannt. Jeder hier im Viertel hat diesen Scheißkerl gekannt.«
»Scheißkerl!«, ertönt der einstimmige Singsang der Frauen.
»Arme Janet«, sagt eine von ihnen.
»Sie hätte was Besseres als diesen Scheißkerl verdient«, sagt eine andere.
»Scheißkerl.«
Fallow kann erkennen, dass die Situation im Begriff ist, ihm zu entgleiten. »Hat irgendjemand von Ihnen gestern Abend etwas Ungewöhnliches gesehen?«, fragt er schnell. »Irgendjemand auf der Straße, den Sie nicht kannten? Irgendwelche merkwürdigen Wagen, die hier herumfuhren?«
Aber natürlich hatten sie nichts gesehen, weil sie es sonst gesagt hätten. Diese Straße war ihre Angelegenheit, und das galt auch für jeden, der dort lebte – besonders wenn er ein Scheißkerl mit einer wunderbaren Frau und zwei engelsgleichen Kindern war.
Detective Constable Mayson Calvert befindet sich im Garten von Nummer 152 und schaut zurück zum Haus, und sein Verstand arbeitet. Auf seiner rechten Seite steht eine massive Ziegelsteinmauer, die die beiden vom Feuer zerstörten Doppelhaushälften voneinander trennt. Der Mann, der auf dem angrenzenden Grundstück wohnt – ein Klempner namens Williams –, ist mit seiner Frau auf Teneriffa und wird einen Mordsschrecken bekommen, wenn er zurückkommt. Auf der linken Seite ist ein Holzzaun, der die Grenze zwischen Ged Salkelds Garten und dem eines Mannes namens Fletcher bildet, der im nächsten Block von zwei Häusern wohnt. Fletcher, ein Witwer, ist ein pensionierter Matrose der Handelsmarine, der nicht glücklich darüber war, um Mitternacht aus seinem Haus evakuiert zu werden, aber seitdem den Vormittag damit verbracht hat, draußen auf der Straße Hof zu halten und die Reporter mit all den Zeugenaussagen zu versorgen, die sie möglicherweise für ihre Tagesberichte und ihre Abendausgaben haben wollten.
Im Zentrum des überwucherten Rasens steht das unvermeidliche Trampolin, das mittlerweile so sehr zum modernen englischen Vorgarten gehört wie früher ein Vogelhäuschen oder eine Sonnenuhr, überlegt Mayson. Daneben stehen ein billiges Tornetz aus Plastik und ein aufblasbares Planschbecken, das einen Teil seiner Luft verloren hat. Puppen und andere Spielsachen liegen auf dem Gras verstreut. Alles ist von einem Rußfilm bedeckt, einschließlich einer hölzernen Hundehütte in einer Ecke. Die Hundehütte gehört dem fünften Mitglied des Salkeld-Haushalts, dem einzigen, dessen Verbleib bislang ungeklärt ist. Lulu ist eine zwei Jahre alte Zwergspitzhündin, Fletcher zufolge ein kleines, kläffendes Mistvieh. Offenbar grub sie sich dauernd unter seinem Zaun durch und schiss in seine Blumenbeete – bis er zu der drastischen Maßnahme gegriffen hatte, einen unterirdischen Zaun zu installieren, um zu verhindern, dass sie durchkam.
»Ich rede natürlich nicht gerne schlecht über die Toten, aber Salkeld hat gesagt, er würde sich an den Kosten des Zauns beteiligen. Bei allem Respekt, aber er wird sich jetzt wohl kaum noch beteiligen, verdammt noch mal.«
Mayson Calvert hat den Verdacht, dass Fletcher es als Lichtblick betrachten würde, wenn Lulus verkohlter Leichnam schließlich in dem Haus entdeckt würde. Aber was ihm im Moment zu schaffen macht, ist der Umstand, dass den Ermittlern zufolge Lulu nicht im Haus gestorben ist. Wenn dem so wäre, würde das erklären, warum sie heute Morgen nicht in ihrer Hütte oder irgendwo in der Nähe des Gartens war.
Sie war allerdings dort gewesen. Fletcher hatte den Hund um Viertel nach zehn am vergangenen Abend in Salkelds Garten gehört. Er war sich der Zeit so sicher, weil er hinter dem Haus gestanden hatte, um seine letzte Zigarette des Abends zu rauchen, wie er es immer während der Werbepause in den News at Ten tat.
»Hab den verd