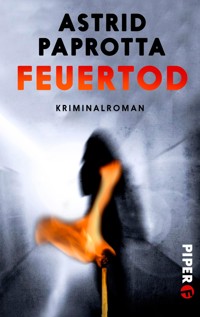
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Astrid Paprotta vereint subtile Spannung mit psychologischer Raffinesse − ein Kriminalroman von höchsten Gnaden. Kein Mensch hatte Ellen Rupp schreien gehört. Noch im Tod schien sie stumm und entsetzt an der Wand zu lehnen. Die umstrittene Anwältin aus dem schicken Frankfurter Nordend war in der Brandhölle ihrer Wohnung regelrecht hingerichtet worden. Kompromisslos hatte sie sich für eine sichere Stadt stark gemacht, wenig überraschend also, dass sie eine Menge politische Feinde besaß. Wer aber würde sie bei lebendigem Leib verbrennen wollen? Hauptkommissar Niklas und sein LKA-Kollege Potofski fahnden nach Hinweisen zu dem verkohlten Unbekannten, der neben Ellen Rupp gefunden wurden: Wer war er? Und warum haben die beiden Opfer keinen Fluchtversuch unternohmen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Die Zitate aus Bertolt Brechts Gedicht »Gegen Verführung (Luzifers Abendlied)« stammen aus dem Band »Bertolt Brechts Hauspostille«, Bertolt Brecht, Gedichte 1, Bd.11, Berliner und Frankfurter Ausgabe im Suhrkamp Verlag 1988.
ISBN 978-3-492-98324-2
© Piper Verlag GmbH, München 2007© dieser Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: Benjamin Haas/shutterstock, Laboo Studio/shutterstockDatenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
1
Als sie die Innenstadt verließ, fuhr sie an ihrem eigenen Foto vorbei. Sie lächelte mit durchbohrten Lippen von dem zerstörten Plakat herunter, das neben einer stillgelegten Tankstelle hing und für die Veranstaltung warb, auf der sie in ein paar Tagen reden sollte: Keine Angst! Sichere Stadt. Sie sah nur flüchtig hin, summte ihr Lieblingslied. Miststück stand über ihrem Namen, mit schwarzem Filzstift hingekritzelt, darunter ein krakeliges Kreuz.
Sie hatte einen freudlosen Abend im Restaurant verbracht, mit faden Leuten, die belanglose Gespräche führten und wissen wollten, warum sie kaum etwas aß. Erst als der Anruf gekommen war, hatte sich ihre Stimmung aufgehellt. So spät? Vor sich hin lächelnd wie ein Kind, das versteckte Geburtstagsgeschenke findet, hatte sie ja gesagt, ja, ich habe Zeit. Als sie gezahlt und dem hübschen jungen Kellner ein großzügiges Trinkgeld gegeben hatte, fing sie an, ihr Lied zu summen, weil das half, die Gedanken zu vertreiben. Sie konnte ihr Lieblingslied bei miserabelster Laune summen, sie konnte auf der Klippe stehen und in den Abgrund blicken und wurde dennoch dieses Lied nicht los.
Vandalismus. Jemand hatte ihr beim Essen von den zerstörten Plakaten erzählt, und sie stritten darüber, ob der Tatbestand Vandalismus zutraf, weil das Plakat, das für eine Veranstaltung warb, kein öffentliches Eigentum war. Egal. Was zählte, war die Zerstörungswut, die diese Sprayer, die sich einbildeten, Kunst zu produzieren, ebenso an den Tag legten wie Plakatschlitzer. Über diesen Ausdruck hatten sie gelächelt, die Leute, mit denen sie zu Abend gegessen hatte.
Die ganze Fahrt über summte sie vor sich hin. Als sie in die Melemstraße einbog, wurde sie langsamer und summte lauter. Der Wagen schlingerte über eine dieser Schikanen, mit denen sie in den ruhigen Gegenden dafür sorgten, dass brav langsam gefahren wurde, und sie tätschelte unwillkürlich den leeren Beifahrersitz, um das mimosenhafte Auto zu beruhigen. Als sie ausstieg, rauschten die Bäume im Wind und knackten ein paar Äste, nur noch wenige Lichter brannten im Haus. Aus der Ferne ein Geräusch, als übte eine Nachteule ihr Lied. Wie romantisch.
Zwei Stufen auf einmal nehmend, lief sie bis ins Obergeschoss, was sie immer tat, weil ihr die Zeit nie reichte, und ihr nichts schnell genug ging, und als sie die Wohnungstür hinter sich geschlossen hatte, schleuderte sie ihre Schuhe quer durch den Flur. Im Esszimmer entkorkte sie eine Flasche Rotwein, stellte sie mit zwei Gläsern auf den Tisch und blieb dann einfach stehen, an die Wand gelehnt, als fehlte ihr die Kraft sich zu bewegen.
Ein paar Minuten lang stand sie so, mit hängenden Armen und geschlossenen Augen, dann ging sie ins Bad, um Wasser in die Wanne einzulassen. Dieses Geräusch fiel den Nachbarn auf, die später angaben, dass es bereits spät war, als sie noch Badewasser einließ, was sie manchmal tat, ohne auf die Zeit zu achten, und was die Nachbarn jedes Mal störte. Auch in dieser Nacht hatte sie es getan, bevor alles aus den Fugen geriet. Nur dieses Geräusch, sonst hatten sie nichts von ihr gehört, denn Ellen Rupp war keine Frau, die schrie. Es gab Leute, sagten die Nachbarn, die sich das wohl anders vorgestellt hätten, die im Gegenteil dachten, dass Ellen Rupp, die man die Ruppige nannte, unentwegt keifte und schrie. Das hatte sie aber nicht getan, oder niemand hatte es wahrgenommen in diesem Chaos, kein Mensch hatte sie schreien gehört.
2
Czerny war in jener Nacht zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, und das war Pech. Die Autofahrer konnten sich alle nicht benehmen, denn obwohl die Straßen frei waren, hupten sie und gestikulierten, als wären sie im Stau gefangen und erlitten Panikattacken oder sonstige Heimsuchungen. Sie tippten sich sogar an die Stirn, als sie ihn sahen, was war denn das für eine Art? Applaudieren hätten sie ihm sollen, statt sich blöd zu echauffieren, weil es nämlich gar nicht einfach war, mit diesem Gefährt, mit dem er unterwegs gewesen war, die Spur zu halten. So hatte es angefangen. Im Grunde mit den Autofahrern.
Czerny fuhr zehn Stundenkilometer schnell, langsam, zugegeben, doch was sollte er machen? Flotter ging es nun einmal nicht. An der Kreuzung wartete er, bis er freie Fahrt hatte, um dann nach links abzubiegen, wo wieder einer mit aufgeblendeten Scheinwerfern auf ihn zukam und hupte. Das kannte er inzwischen. Was ihn über dieses Betragen hinaus kümmerte, war die Frage, wo er sein Fahrzeug abstellen sollte, schließlich war es bei ihm zu Hause ziemlich eng, sowohl im Hausflur unten als auch in der Wohnung, und in seinem kleinen Laden war schon überhaupt kein Platz. Zudem fing er allmählich an zu frieren. Seine Hand, die den Schalter hielt, war eiskalt, aber sonst fühlte er sich gut. Im Krankenhaus hatten sie ihm das kaputte Knie geflickt, doch nach Hause wollten sie ihn nicht lassen. So einen Ausfall konnte er sich als selbstständiger Friseur aber nicht leisten, deshalb hatte er um seine Entlassung regelrecht gebettelt, nur: was verstanden Orthopäden schon von kleinen Mittelständlern? Weil alle Bettelei sinnlos gewesen war, hatte er sich kurz vor der Nachtruhe einen leise summenden Krankenfahrstuhl geschnappt und war ihnen erstaunlich leicht entkommen. Zwei Pfleger hatte er noch gegrüßt, bevor er mit seinem elektrisch betriebenen Gefährt über einen Lieferanteneingang ins Freie gelangt war.
Ein schöner Coup. Die Diebe im Möbelhaus fielen ihm ein, die sich ein schweres Bett ausgesucht und es ächzend am Personal vorbeigeschleppt hatten, und was sollte man sagen? Das Personal hatte ihnen noch die Tür aufgehalten. So fuhr er also dahin, und obwohl er sich an alle Verkehrsvorschriften hielt, hupten die Autofahrer ihn an. Das regte ihn derart auf, dass er sich entschloss, einen kleinen Umweg zu nehmen und durch stillere Straßen zu fahren. Melemstraße, das war das erste Schild, das er sah. Blume, sein Nachbar, hatte ihm erzählt, dass es in diesen villenähnlichen Häusern Eigentumswohnungen gab, die mehr als dreihunderttausend Euro kosteten, was eine unvorstellbare Summe war, und man musste ja trotzdem die laufenden Kosten noch zahlen, Wasser, Gas und Strom. Woher Blume die Preise kannte, hatte Czerny damals nicht gewusst, Blume konnte sich das alles ja auch nicht leisten. Aber es war wirklich eine schöne, ruhige Straße mit großen Bäumen, unter denen friedlich Limousinen parkten, und in der ihm niemand hupend entgegenkam.
Doch etwas störte ihn. Es war dieses Licht. Es schien direkt aus den Wolken zu kommen, weshalb er einen Moment lang glaubte, dass er die aufgehende Sonne sah. Es war aber immer noch Nacht. Czerny stellte sich das Glück in den Farben Rot und Blau vor, wie die Sonne über dem Meer. Als Kind hatte er die Wände seines Zimmers mit Postern geschmückt, auf denen Pärchen am Strand unter der aufgehenden Sonne saßen. Er hatte sich dafür von seinem Vater verhöhnen lassen, der ihn einen Kitschkerl nannte, ein Ausdruck, den er Jahre später noch zu steigern wusste, als Czerny zu Hause mitteilte, er würde Friseur. Da hatte sein Vater ihn einen blöden Kitschkerl genannt, weil ihm der Begriff Romantiker nicht geläufig war, und hinzugefügt, man müsse ja nur in sein Zimmer gucken. Doch da hingen die Poster schon lange nicht mehr, denn bei Czernys erstem Urlaub am Meer war die Sonne nicht richtig rot gewesen und das Wasser nicht blau. Macht nichts, hatte er sich damals gesagt, es war der falsche Strand. Der richtige würde kommen und mit ihm der perfekte Sonnenaufgang, dann saß er da und guckte in die Wellen und verspürte nichts als Glück.
In jenen Minuten schien er allerdings Pech zu haben, weil die Sonne in dieser Nacht vor seinen Augen explodierte. Er stoppte, nein, sein Gefährt stoppte ganz von selbst, weil er in seinem Schrecken die Arme nach hinten riss. Das Geräusch berstender Fensterscheiben hörte er im selben Moment, als er den Kopf in den Nacken warf und Feuer im Obergeschoss eines Hauses sah. Ein Blitz, nur schlimmer. Viel schlimmer auch als bei ihm zu Hause in der Innenstadt, wo sie sich über brennende Müllcontainer aufregten. Beim letzten Mal, als kein Container mehr übrig war, hatte ein Feuerwehrmann zwei Knirpse angebrüllt, dass sie jetzt ihren Müll aus dem Fenster werfen könnten, und sein Kollege hatte böse gelacht und gesagt, das täten die doch ohnehin.
Viel schlimmer war das hier. Flammen schlugen aus dem Fenster, eingehüllt in dichten Qualm, als fingen Feuer und Rauch ein Tänzchen an. Brennende Vorhänge wehten im Wind.
Czerny fuhr wieder an und sah, dass es das Haus Nummer 13 war. Gleichgültig im Grunde, doch er sagte es ständig vor sich hin, Nummer 13, 13. Als er herankam, drückte er die Hand auf das Klingelbrett und schrie: »Feuer!« Er rollte ein Stück zurück. »Es brennt bei euch, oben brennt’s!«
Nummer 13. Bald ein Uhr. Acht Minuten, bis der erste Löschzug kam. Czerny war bis zum übernächsten Haus gefahren, weil er Angst hatte, dass ihm etwas Brennendes auf den Kopf fiel, doch er blieb. Er bildete sich ein, er müsse bleiben, weil er sonst vielleicht eine Art Fahrerflucht beging. Er sah Leute auf die Straße rennen, die immer wieder schreiend auf das Obergeschoss deuteten und wohl hofften, dass die Flammen nicht das ganze Haus zerfraßen. Es war so ein schönes Haus; er zählte drei Stockwerke und fand, es sah wie eine alte Villa aus. Die Feuerwehr tat, was sie konnte, dann kam die Polizei und er sah ein Dutzend Uniformierte herumrennen, er sah überhaupt so viele Menschen plötzlich, dass er nicht wusste, wie er hier jemals wieder durchkommen sollte. Gestank legte sich über alles, als hätte der Teufel kurz die Hölle geöffnet. Irgendwann, als vom Feuer nur noch Rauch geblieben war, tippte ein Polizist ihm auf die Schulter und fragte, wo er wohnte.
Seine Wohnung, sagte Czerny, lag ein Stückchen weiter weg.
»Nicht da drin?« Der Polizist deutete auf die Nummer 13. Er sah angespannt aus, so als würden sie das Obergeschoss nie feuerfrei kriegen, dabei hatten sie es doch gelöscht. Nur noch dünne Rauchschwaden wehten durch die Luft.
Czerny fror. »Nö«, sagte er. »Da drin nicht. Lassen Sie mich vorbei? Ich finde, Sie könnten mir eine kleine Gasse freimachen.«
»Wohin denn?«, fragte der Polizist.
»Ich habe das Feuer gemeldet«, sagte Czerny. »Das heißt, habe ich nicht, aber ich habe am Haus geklingelt und gerufen, sie sollten es melden. Ich hab hier kein Telefon, wissen Sie.« Er reckte sich, als er vorn die Männer sah, die auf die Absperrung zukamen. Sie sahen wichtig aus. Sie trugen keine Uniformen, und sie gingen an den Feuerwehrleuten vorbei in das Haus Nummer 13, dessen Obergeschoss jetzt aussah wie ein breiter, schwarzer Trauerrand.
Der Polizist sah die Männer auch. Hastig wandte er sich wieder Czerny zu und fragte, ob er etwas gesehen hatte oder ob ihm etwas aufgefallen war, doch was sollte er gesehen haben außer dem Feuer? Die Fensterscheiben flogen raus, als er gerade hier ankam, er hatte keine Ahnung, wie lange es in einem Haus brennen musste, bis das geschah.
»Ich brauche Ihren Namen«, sagte der Polizist.
»Ich bin behindert«, sagte Czerny. »Ich muss jetzt nach Hause.«
»Ich brauche trotzdem Ihren Namen. Und wo Sie wohnen, das heißt, Ihre Adresse.« Der Polizist war furchtbar nervös, dabei war es kein junger Mann mehr, man konnte also nicht davon ausgehen, dass der hier seinen ersten Einsatz hatte. Seufzend nannte Czerny seine Adresse.
»Battonnstraße?« Der Polizist schien beinahe die Fassung zu verlieren. »Da müssen Sie aber noch eine ganze Strecke – Sie können doch damit nicht –«
»Doch, der ist tauglich, wollen Sie mal sehen?« Als Czerny auf den Knopf drückte, sprang der Krankenfahrstuhl nach vorn und der Polizist zurück.
»Ihren Namen!«, schrie er.
»Czerny. Charly, Zulu, Echo, Romeo, November, Yankee.«
Der Polizist ließ seinen Notizblock sinken.
»Das ist das Nato-Alphabet.« Czerny machte immer so viel Wind um seinen Nachnamen, weil er seinen Vornamen nur nannte, wenn es unbedingt sein musste. Gewöhnlich ließ er sich auch von guten Bekannten nur mit dem Nachnamen anreden, denn als sein Vater seine hochgradig frankophile Mutter noch liebte, hatten seine Eltern ihn Claude getauft. Immer hatte es Ärger gegeben mit diesem Namen, schon sein Vater hatte ihn nie richtig aussprechen können und ihn Klott gerufen, und in der Schule hatten sie ihn abwechselnd Kloß und Claudi Zwo genannt, weil es auch eine Claudi Eins gab, die dralle Claudia. Es gab nur eine einzige Situation, in der ihm dieser Vorname nützen könnte, das war bei seiner Arbeit als Friseur, wenn diese spezielle Art Kundin kam, die gestikulierend seinen Namen rief. »Ach Claude, du weißt nicht, wie ich mich fühle, sei ein Schatz und mach mir einen Superschnitt, ja?«
Aber diese spezielle Art Kundin hatte er nicht. Manchmal bekam er Post von PR-Abteilungen, die ihren Müll an Frau Claude Czerny adressierten. Er hasste seinen Namen.
»Ihren Ausweis«, sagte der Polizist, und als Czerny ihn aus seiner Hosentasche zog, fing er an zu überlegen, ob das vielleicht Brandstiftung gewesen war, im Unglückshaus Nummer 13. Er hatte sich vorgestellt, es wäre jemand mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen.
»Ach«, sagte der Polizist. Er war immer noch so nervös, doch wollte er es wohl nicht zeigen und versuchte es auf Teufel komm raus mit Konversation. »Sie kommen ursprünglich aus Frankreich?«
»Nein. Ursprünglich nicht.«
»Aus Tschechien«, sagte der Polizist matt.
»Ich bin von hier.« Czerny blinzelte. »Ein Vorfahre kam aus Österreich.«
Noch immer wirbelten die Lichter der Einsatzfahrzeuge, rot und blau, rot und blau.
Er fand, die Sache sei für ihn erledigt.
Am nächsten Morgen wachte Czerny früh auf, im Kopf die Bilder vom Brand. Er rieb sich die Augen und erinnerte sich an die Rauchschwaden, die über die Straße wehten, und an die brennenden Vorhänge im Wind. Er hatte schlecht geschlafen, doch als er merkte, dass er halbwegs laufen konnte, besserte sich seine Laune. Im Krankenhaus hatten sie ihm das Knie geschient und gesagt, dass sie ab heute das Laufen mit ihm üben wollten, doch dazu brauchte er die Orthopäden nicht. Seine Wohnung war so klein, dass er sich überall festhalten konnte, auch beim Waschen, und als er eine Weile mit seinem Stockschirm auf und ab gehumpelt war, fühlte er sich fit für die Straße.
Unten im Hausflur gab es Ärger, da stand der Krankenfahrstuhl und versperrte den Weg. Und Moritz Blume war auch da, der Nachbar versuchte seinen Dobermann namens Chef an dem Gefährt vorbeizubugsieren, doch der Hund scheute zurück.
»Wäre besser, wenn der nicht hier steht«, sagte Blume.
Czerny klopfte mit dem Stockschirm auf den Boden. »Man kommt ja vorbei. Bloß der blöde Hund will nicht.« Er sah den Dobermann gähnen und erzählte Blume von dem Brand im Nordend und von den vielen Polizisten, die da herumgelaufen waren, was nur den Schluss zuließ, dass es wohl Brandstiftung gewesen war.
»Brandstiftung passiert unten« war alles, was Blume dazu zu sagen hatte.
»Wieso?«
»Weil die sich kaum die Mühe machen, bis nach oben zu laufen, zu zündeln und wieder runterzurennen. Dauert länger, ist gefährlicher für sie, und sie werden schneller erwischt.« Blume rüttelte an dem Rollstuhl. »Meistens wird ja Gerümpel angezündet, das im Hausflur steht. Ich brauche einen Termin bei dir.«
Czerny starrte auf Blumes strähniges Haar. Männer zu frisieren war ein unergiebiges Unternehmen. Brauchte man gar nicht erst anzufangen. In seinen Laden kamen Männer aus der Umgebung, die »Beischneiden«, murmelten, und wenn er damit fertig war, man wollte sie ja nicht gleich als Kahlköpfe entlassen, brummten sie, das sähe nun aber bald wie vorher aus. Sinnlos. Moritz Blume, der unter ihm wohnte, kam gewöhnlich mit nassen Haaren in den Salon, um das Geld fürs Waschen zu sparen.
Czerny bot ihm einen Termin am Mittag an, Blume sagte: »Da kann ich nicht.«
»Was willst du denn vorhaben?« Czerny schüttelte den Kopf. Blume hatte immer irgendetwas vor, aber kein Mensch wusste, was er eigentlich trieb. Fragte man ihn nach seinem Job, antwortete er, dass er Freiberufler sei, und wollte man wissen, was er da tat, pflegte er zu sagen: alles Mögliche. Vermutlich war er arbeitslos und schämte sich.
»Ich will mit dem Chef zu einem Hundeturnier«, sagte Blume.
»Was machen die da?«
Blume zog die Schultern hoch. »Die kriechen unter was durch und springen über was drüber.«
»Der blöde Hund kommt ja noch nicht mal an dem Rollstuhl vorbei«, sagte Czerny.
Jeden Morgen sah man Moritz Blume mit Chef durch die Straßen spazieren, Frühsport für Herr und Hund. Die streunenden Schläger ließen ihn in Ruhe, weil sie wohl dachten, der Hund würde beißen, doch zum Beißen musste dieser Dobermann getragen werden. Sie wohnten in der Battonnstraße, was recht praktisch war, da sie in der Innenstadt lag, doch an ihrem Eckhaus strich niemand mehr die Fassaden, als wären sie vergessen worden und müssten klarkommen, bis alles zerfiel. Das eigentliche Problem war aber die benachbarte Stoltzestraße, in der es immer wieder Randale gab. Es war laut, ganze Banden brüllten sich durch die Nacht und kamen mit sich selber nicht ins Reine, Fensterscheiben wurden eingeworfen und Leute schlugen aufeinander ein. Das Schönste an dieser Ecke war sein kleiner Laden unten im Haus mit seinem blau schimmernden Schild und den Worten Czerny. Friseur. Auf den Punkt in der Mitte hatte er Wert gelegt, weil ein Punkt in der Mitte dem Betrachter ein ganz anderes Gefühl vermittelte als ein Punkt am Schluss. Aber Czerny wollte hier weg, in eine ruhigere Gegend. Er wollte einen neuen Salon eröffnen, sobald er mehr verdiente, einen mit Kaffeebar, an dessen Wänden die Werke junger Künstler hingen, er hatte Großes vor.
Auf seine Stockschirm-Krücke gestützt, sperrte er den kleinen Raum auf, in dem er arbeitete. Für Angestellte war es viel zu eng, die konnte er sich auch nicht leisten. Ein Kunde kam, ein wortkarger Mann um die sechzig, der seufzte, es müsse halt sein. Czerny, das geflickte Bein auf einem Schemel, geriet aus dem Gleichgewicht, wenn er zu schnelle Bewegungen machte, und einmal guckte der Kunde ihn etwas länger an und fragte: »Haben Sie was?«
»Ja«, sagte Czerny, »mein Knie ist behindert, ich stehe etwas schlecht.«
»Dann machen Sie doch krank.«
»Das kann ich mir nicht leisten«, sagte Czerny.
»Ich schmeiß mich fort«, sagte der Kunde. »Bei Ihren Preisen müssten Sie sich sonstwas leisten können.«
Kurz vor zwölf sah er den Chef vor der Tür. Stoisch glotzte der Dobermann in den Laden, bevor er sich gottergeben von Moritz Blume anbinden ließ. Moritz setzte sich mit tropfenden Haaren hin und murmelte: »Jetzt sind wir doch nicht zum Turnier.«
Czerny starrte auf Blumes Haar, als erspähe er Mäuse im Keller. »Hast du sie gewaschen?«
»Ich hab sie nass gemacht.«
»Das sehe ich. Hast du sie gewaschen?«
»Heute Morgen«, sagte Blume. »Jetzt hab ich sie noch mal nass gemacht.«
Czerny griff sich eine Strähne und zog daran. »Sie quietschen nicht.«
»Das wäre ja auch noch schöner«, sagte Blume.
»Frisch gewaschene Haare quietschen.«
»Meine nie.« Blume lehnte sich zurück und sagte »Rundum«, dann starrte er schweigend in den Spiegel. So war das meistens mit ihm, er guckte und schwieg, weshalb ja auch kein Mensch wusste, was er eigentlich trieb. Er lebte in einer bescheidenen Wohnung, wie Czerny auch, und er hatte keine Freundin, er hatte nur den Hund. Chef war genauso wie er, was die Theorie bestätigte, wonach Herr und Hund eine Einheit wurden mit den Jahren, auch Chef hockte meistens nur herum und glotzte. Blume fing erst wieder an zu reden, als Czerny den Föhn einschaltete, und da musste er gleich schreien. Er erzählte von dem Unfall, der sich am vergangenen Abend in der U-Bahn-Station zugetragen hatte, als ein Mann auf die Gleise gestoßen worden war, drei Meter tief, mit all seinen Taschen. Es hatte Streit gegeben, zwei Kerle hatten Zigaretten schnorren wollen, aber vermutlich war der Mann Nichtraucher.
»Schrecklich«, murmelte Czerny. Die Leute hatten kein Benehmen mehr, überall wurde man angebrüllt; es wurde immer schlimmer, und wenn man irgendwo warten musste, bekam man einen Stoß ins Kreuz.
»Hast du im Krankenhaus etwas über Nieren gehört?«, fragte Moritz.
»Dauernd.« Czerny ließ den Föhn sinken. »Das war das Gesprächsthema Nummer eins. Macht ja auch Spaß, über Nieren zu reden.«
»Überall suchen sie welche«, sagte Blume. »Für Transplantationen. Ich denke, ich verkaufe eine meiner Nieren für fünfzigtausend. Man kann mit einer Niere leben.«
»Du spinnst«, sagte Czerny. »Die muss man spenden, nicht verkaufen. Und man spendet sie erst, wenn man nicht mehr ist.«
Blume schüttelte den Kopf. »Ich nicht.« Übergangslos sagte er: »Du hast mir nicht gesagt, dass es in der Melemstraße gebrannt hat.«
»Im Nordend«, sagte Czerny. »Habe ich wohl.«
»In der Melemstraße«, murmelte Blume.
Als er weg war, fegte Czerny den Boden, dann machte er den Laden wieder zu. Es war zu anstrengend, hier herumzuhüpfen, er hatte sich ein wenig überschätzt. Als er den Laden verließ, sah er zwei Männer aus einem dunklen Wagen steigen. Er sah nur flüchtig hin, doch wie immer registrierte er, ob sie Friseurtermine nötig hatten oder nicht. Bei beiden war das nicht der Fall, der Jüngere präsentierte eine tadellose Glatze, während der Ältere ein akkurater Mittfünfziger war, dem die Gattin zuraunte, du musst mal zum Friseur, mein Lieber, und der das dann gewissenhaft erledigen ließ. Offensichtlich war es gerade erledigt, und Czerny beachtete sie nicht weiter. Er war keine zwei Minuten in der Wohnung, als sie vor seiner Tür standen.
»Herr Czerny?«, fragte der jüngere Glatzkopf. »Herr – ehm – Claude Czerny?« Er hatte Schwierigkeiten, Vor- und Nachname hintereinander auszusprechen, doch sagte er wenigstens nicht Klott.
Czerny nickte flüchtig. »Und?«
Er zog einen Wisch aus der Hosentasche. »Sie haben gestern einen elektronisch betriebenen Rollstuhl aus dem Krankenhaus entwendet, den möchten die gerne zurück. Wir nehmen an, das ist das Monstrum da unten im Flur?«
»Sind Sie etwa Kriminalpolizisten?«, fragte Czerny.
Beide nickten, doch nur der Ältere zeigte seinen Ausweis. Dazu nannte er freundlich seinen Namen, Karl Niklas, und stellte den Glatzkopf als Herrn Potofski vor.
»Was für ein Aufstand«, sagte Czerny.
»Wir kommen nicht wegen dem Stuhl«, sagte der akkurate Herr Niklas. »Das heißt, den nehmen wir gewissermaßen mit.« Er räusperte sich. »Das heißt, wir nehmen ihn natürlich nicht mit, wir erledigen das nur gerade mal für die Kollegen, können Sie mir folgen?«
Czerny schüttelte den Kopf.
»Die Anzeige liegt vor«, sagte Niklas. »Bloß dass Sie es wissen. Das sollten Sie regeln. Wir möchten mit Ihnen über den gestrigen Brand sprechen.«
Czerny führte sie in die Küche, wo der Glatzkopf »Oh« sagte, als er das eingerahmte Poster über dem kleinen Esstisch sah.
»Wer ist das?«, fragte Niklas.
»Angelina Jolie«, sagte der Glatzkopf, worauf Herr Niklas zwar nickte, aber kein bisschen klüger aussah.
»Das habe ich alles schon dem anderen Polizisten gesagt.« Czerny humpelte zum Fenster. »Ich wollte nur deswegen durch die Melemstraße durch, weil da kaum Verkehr ist. Wie ich da also so entlangfahre, denke ich noch, irgendwoher kommt ein komisches Licht, und dann höre ich Fensterscheiben zerplatzen und sehe das Feuer da oben im Haus. Das war alles.«
Aber der Brand selber schien die Polizisten kaum zu interessieren. Immer wieder fragten sie nach Leuten, die er vielleicht gesehen hatte, jemand vor dem Haus Nummer 13, jemand am Anfang der Straße, vor einem anderen Haus, jemand, der die Straße überquert hatte, irgendjemand? Sie ließen nicht locker, aber Czerny konnte nicht helfen. In der Melemstraße war nichts los gewesen, außer dem Feuer.
»Kennen Sie Ellen Rupp?«, fragte der Glatzkopf.
Czerny schüttelte den Kopf, hielt dann aber inne, mittendrin, weil er ihn doch schon gehört hatte, diesen Namen. Die Polizisten starrten ihn an, alle beide sehr angespannt, so wie der Polizist letzte Nacht.
»Ellen Rupp«, wiederholte der Glatzkopf. »Von der Bürgerinitiative Sichere Stadt. Anwältin, sitzt auch im Stadtparlament.«
»Ach die«, sagte Czerny, »diese –«
»Ja«, sagte der Glatzkopf.
Czerny nickte. »Die will doch hier überall Videokameras haben. Für die Sicherheit.«
»Tja«, murmelte der Kommissar Niklas.
»Ich habe hier einen Friseurladen«, sagte Czerny. »Eine Kundin hat mal erzählt, die Rupp will sie zwangssterilisieren.«
»Nein«, sagte Niklas ernsthaft.
»Die hat fünf Kinder«, sagte Czerny. »Die Kundin, meine ich. Und sie kriegt Sozialhilfe. Aber ein bisschen durchgreifen kann ja nicht schaden, ich meine, hier passiert so allerhand in der Nacht, da sind schon Leute überfallen worden, und es wird mit Flaschen geworfen. Aber eigentlich möchte ich mich nicht filmen lassen, obwohl ich ja nicht mit Flaschen werfe.« Czerny seufzte. »Ja, und jetzt? Wollte die Frau Rupp ein Zeichen setzen, hat sie das Feuer gelegt?«
»Sie ist darin verbrannt«, sagte der Glatzkopf.
Czerny senkte den Kopf.
»Nun.« Niklas stand auf. »Wenn Sie nachher die Nachrichten hören – also, Frau Rupp ist bei diesem Brand ums Leben gekommen.«
Czerny stützte sich auf seinen Schirm. Er stellte sich vor, ohne es sich wirklich vorstellen zu können, wie ein Mensch verbrannte, was da geschah.
»Hat sie im Bett geraucht?«, fragte er.
Darauf sagten sie nichts. Als sie gingen, warf der Glatzkopf noch einen Blick auf Angelina Jolie. Ein Herr Potofski; als er die Tür hinter sich schloss, fiel Czerny der Name wieder ein.
3
Niklas sah Potofski lächeln. Er wisse jetzt, sagte Niklas, was gemeint war, wenn sie manchmal in den Nachrichten erzählten, dieser oder jener Politiker müsse ohne Gesichtsverlust aus einer Sache herauskommen. Nun, sagte Hauptkommissar Niklas, Frau Rupp hatte ihr Gesicht verloren.
Potofski lächelte, aber der war ja nicht vor Ort gewesen.
Brandleichen, da ging man nämlich in die Knie. Die Sinne spielten verrückt, es stank und man glaubte, nicht richtig zu sehen. Da musste man x-mal hinschauen, um überhaupt etwas zu erkennen, und dann versuchte man sich selber zu beruhigen, indem man sich der Vorstellung hingab, dass es gar kein Mensch war, über den man sich beugte, sondern eine Figur, eine Skulptur, eine Skulptur aus Kohle.
»Grinsen Sie nur«, sagte Niklas, als er Potofski lächeln sah. »Ich hatte Bereitschaft, ich hätte das lieber nicht gesehen.«
Die Hauptkommissare standen ganz hinten, als die Soko Rupp sich im Besprechungsraum versammelte. Potofski war vom LKA, Niklas von der Mordkommission, sie kannten einander kaum.
»Ich habe noch zehn Jahre bis zur Pension«, sagte Niklas, »und habe gedacht, was soll da noch kommen?« Schuldbewusst senkte er den Blick, als Urban, der Leiter der Sonderkommission, zu ihm herüberblickte. Auch ihn hatte das LKA geschickt.
Urban trug den Fall mit lauter Stimme vor. Die 43-jährige Rechtsanwältin und Stadtverordnete Ellen Rupp war bei einem Brand in ihrer Wohnung, Melemstraße 13, ums Leben gekommen. Er pinnte sechs großformatige Fotos an die Magnettafel und ignorierte das Stöhnen, das durch die Menge der Polizisten ging. Potofski hatte aufgehört zu lächeln.
Niklas sagte: »Sehen Sie?«
»Es sind zwei.« Urban tippte gegen jedes Foto. »Zwei Personen, Frau Rupp und eine männliche Person, die noch nicht identifiziert werden konnte. Frau Rupp selbst wurde in den Morgenstunden anhand ihres Zahnschemas identifiziert.« Er klopfte gegen die Magnettafel und berichtete, dass Ellen Rupp alleine lebte und gewöhnlich sehr spät nach Hause kam, weshalb ihre Nachbarn sie kaum kannten. Manchmal war Musik zu hören gewesen, etwas Krudes, wie der eine Nachbar sagte, und das der andere als Jazz identifizierte. In der Brandnacht hatte sie Badewasser eingelassen, auch das war den Nachbarn aufgefallen, gut eineinhalb Stunden vor Ausbruch des Feuers.
Urban drehte den Fotos den Rücken zu. »In unmittelbarer Nähe der Personen, vermutlich auf Möbelstücken und Kissen, ist brennbare Flüssigkeit ausgeschüttet und entzündet worden, es wird sich wohl um Benzin handeln. Frau Rupp fand man auf dem Sofa sitzend, die andere Person auf dem Boden, ebenfalls sitzend und gegen die Wand gelehnt. Aber trotz akribischer Suche hat man nicht ein einziges Faserchen von einem Seil finden können oder etwas anderes, das darauf hindeuten könnte, dass sie fixiert wurden.« Er trank einen Schluck Wasser und stellte das Glas geräuschvoll auf den Tisch zurück. »Aber haben die beiden Personen stillgehalten? Wie ist das gelaufen?«
Urban schien auf eine Reaktion zu warten, doch niemand sagte etwas. Er stützte die Arme auf den Tisch. »Das alles berücksichtigend, sollten wir von mindestens zwei Tätern ausgehen. Die Obduktion dauert an. Beschränken wir uns auf die bisherigen Fakten.« Seine Stimme wurde lauter, als begebe er sich auf sicheren Grund. Ellen Rupp hatte ihren letzten Abend im Restaurant Koppelmann verbracht, zusammen mit Bekannten. Den Tag über war sie beruflich in Berlin gewesen, kam erst am Abend zurück. Gegen 22 Uhr war sie aufgebrochen, kurz nachdem sie einen Anruf erhalten hatte. Die Bekannten waren der Ansicht, dieser Anruf hätte sie gefreut, zumal sie vorher nicht bei allerbester Laune war, wortkarg und zerstreut. Das halbe Essen hatte sie auch zurückgehen lassen.
»Schande«, murmelte ein Beamter. »Das hätte ich mir für den Hund einpacken lassen.«
»Sie hatte keinen«, sagte Urban. »Familienstand: geschieden, kinderlos. Was den Anruf betrifft: Rupps Verbindungsdaten für die vergangene Nacht sind überprüft worden. Der letzte Anruf ist kurz vor 20 Uhr eingegangen, der kam von ihrer Schwester, die lebt in Rom. Sie muss also zwei Handys gehabt haben, eines davon als sehr privates. Es wurde nichts gefunden. Ihr Freundeskreis ist vorläufig befragt worden, niemand kennt eine zweite Handynummer.«
»Sie hatte Freunde?«, fragte einer.
»Nehmen Sie sich zusammen«, murmelte Urban. »Bedenken Sie, dass wir unter Beobachtung stehen, die Frau war eine Nummer in der Stadt, und überhaupt, die hiesigen Medien –«
»Die wundert das nicht«, sagte Potofski.
»Was?«, fragte Urban.
Potofski zuckte mit den Schultern. Dass einer durchdrehte zum Beispiel. Dass einer auf Rächer der Enterbten machte und sie richten wollte. Er hielt die beiden Zettel in die Luft, die den Beamten ausgehändigt worden waren. Bitte vertraulich behandeln, hatte es geheißen, obwohl sie nur bekannte Tatsachen enthielten. Potofski trug sie vor, Ellen Rupp, die man die Ruppige nannte, war nicht zimperlich gewesen. Als Vorsitzende der Bürgerinitiative Sichere Stadt hatte sie es auf einer freien Liste bis ins Stadtparlament geschafft. Sie war Wirtschaftsanwältin, aber sie hatte auch Firmen- und Personalchefs gegen Vorwürfe entlassener Mitarbeiter verteidigt, wobei es ihr gelungen war, gegen das klagende Personal alles Mögliche herauszufinden – mit Hilfe eines Privatermittlers, wie man vermutete. Sie hatte die Zwangsunterbringung von Bettlern, Randalierern und Drogendealern gefordert und für Langzeitarbeitslose, die einen Job verweigerten, 30 Stunden gemeinnützige Arbeit pro Woche vorgeschlagen, überwacht durch elektronische Fußfesseln. »Ich fordere keinen elektronisch überwachten Hausarrest wie bei Straftätern auf Bewährung«, hatte sie im Stadtparlament gesagt, »ich möchte diese Leute eher von zu Hause aussperren – die Fußfessel-Träger werden zu einer für ihre Verhältnisse hohen Selbstdisziplin und zur Erfüllung des ihnen vorgegebenen Wochenplans angehalten. Die elektronische Fußfessel bietet damit auch Langzeitarbeitslosen und therapierten Suchtkranken die Chance, zu einem geregelten Tagesablauf zurückzukehren.«
Sie wurde auch Rübe-ab-Rupp genannt, was sie sich immer verbeten hatte. So entschieden sie gegen die Todesstrafe sei, hatte sie gesagt, so radikal setze sie sich für die Menschenrechte ein, und es gehöre zu den Menschenrechten, in Sicherheit zu leben. Dafür habe der Staat zu sorgen, aus allem anderen, insbesondere der Wirtschaft und dem Markt, habe er sich herauszuhalten.
Potofski legte die Zettel beiseite. »So schaut’s aus.«
»Sie verkürzen.« Urban holte einen Zeitungsausschnitt aus seiner Brusttasche und setzte eine Brille auf. »Law and order als Prinzip hat sie nicht interessiert, nur die wirtschaftliche Entwicklung. Hier sagt sie:« – er rückte seine Brille gerade und blinzelte dennoch – »Eine hohe Kriminalitätsbelastung und ein hoher Anteil von Sozialhilfeempfängern sind Schwächen im Standortwettbewerb.« Er nahm die Brille wieder ab und sah aus, als hätte er den Satz nicht verstanden.
»Na also«, sagte Potofski.
Urban wedelte mit einem Finger. »Glauben Sie etwa, so ein Dings, ein Arbeitslosen-II – also er klingelt an ihrer Tür, kennt ihre Privatadresse, die natürlich nicht im Telefonbuch steht, wird auch noch eingelassen und darf dann in aller Ruhe zündeln?«
»Es hat offensichtlich keinen Kampf gegeben«, sagte Hauptkommissar Niklas. »Die Möbelstücke, beziehungsweise die Reste davon, standen alle sehr ordentlich da.«
Er setzte sich, starrte immer wieder auf die Magnettafel, wie zur Erinnerung. In der ausgebrannten Wohnung hatte ihm ein Feuerwehrmann gesagt, dass das Feuer etwas Besonderes war, etwas endgültig Böses. Das haben Sie auch nicht alle Tage, hatte er gesagt.
»Das ist alles höchst brisant«, sagte Urban laut. »Da kann man sich ganz schnell die Finger verbrennen.« Er stutzte und räusperte sich verlegen, um dann noch lauter fortzufahren. »Was da alles drinsteckt, das mit ihren politischen Aktivitäten ist nämlich nichts gegen ihre eigentliche Arbeit. Gehen Sie mal in die Kanzlei, da steht Ihnen der Mund offen. Wirtschaftsanwältin, da gibt es zu stochern, alle möglichen Firmen haben ihre Geschäfte über sie laufen lassen, da geht’s um Geld, Geld und Geld.«
Eine Beamtin hielt ihren Stift in die Luft. »Wir haben Rupps letzten Tag rekonstruiert, in Berlin ist nichts vorgefallen. Gespräche mit Mandanten, die Liste habe ich hier. Rückflug von Berlin Tegel, 19 Uhr 25. Ihre Sekretärin sagt, in der Kanzlei lief alles rund, die letzten Drohbriefe sind auch ein paar Monate her. Wir haben auch kurz mit der Sozi… mit Frau Westheim gesprochen, ihrer Sozi… also, der Partnerin.«
»Mit wem?«, fragte Urban.
»Die Frau, mit der sie die Anwaltskanzlei führt«, sagte die Beamtin. »Sie haben eine gemeinsame Kanzlei, eine Sozietät.«
»Dann ist sie der Sozius«, sagte Urban.
Hauptkommissar Niklas schüttelte den Kopf. »Sozia.«
»Egal«, sagte Urban. »Was ist mit der?«
»Nichts«, sagte die vortragende Beamtin. »Sie konnte nichts Außergewöhnliches berichten.«
»Alle beide zusammen sind Sozii«, sagte Niklas.
»Was ist mit dem Zeugen auf der Straße?«, fragte Urban.
Niklas stand wieder auf. »Der hat auch nicht viel gesehen, der fuhr da im Rollstuhl herum, nachdem er aus dem Krankenhaus ausgebüchst ist. Ich will sagen, der humpelt wirklich, wenn er nicht im Rollstuhl sitzt, die Klinik hat auch bestätigt, dass er noch nicht laufen kann. Können Sie mir folgen? Der kann das da oben nicht angerichtet haben.«
»Was ist mit ihrem Ex?«, fragte jemand.
»Der lebt auch in Rom, wie ihre Schwester«, sagte Urban. »Ja, Kunststück, der lebt mit ihrer Schwester. Bekannte wissen nichts von einer festen Beziehung, Frau Rupp hat einfach zu viel gearbeitet, sagen sie.« Er räusperte sich. »Lockere Beziehungen soll es allerdings genug gegeben haben. Wir müssen wissen, wer dieser Besucher war. Der Bekanntenkreis hat sich gegenseitig abtelefoniert, es fehlt keiner. Ich hoffe, die Obduzentin kann noch helfen. Eine Frau Dr. Becker«, fügte er düster hinzu.
»Das ist ein ähnlicher Typ«, flüsterte Niklas, worauf Potofski meinte, wenn es ein Serienkiller war, müsse Frau Dr. Becker sich aber in Acht nehmen.
»Persönlich kannte ich die Rupp ja nicht«, sagte Niklas. »Nur in den Lokalnachrichten habe ich sie manchmal gesehen. Nette Frau, jetzt mal vom Äußeren her. Aber sie war mir etwas unheimlich.«
»Vorzugsweise letzte Nacht«, sagte Potofski.
»Ja«, sagte Niklas und sah Potofski wieder lächeln. Nicht wenige hatten die Rupp zur Hölle gewünscht, und dort war er ihr begegnet, letzte Nacht.
4
Blume öffnete das Fenster. Draußen gab’s wieder Geschrei, Kerle mit ins Gesicht gezogenen Kapuzen. Breitbeinige Schritte, die mussten Reviere abstecken, um ihre Welt in Ordnung zu halten. Sie rannten immer in die Stoltzestraße. Manchmal zündeten sie Mülltonnen an, manchmal kam Verstärkung, andere Kerle, die es schlimmer trieben und Steine in die Fenster warfen. Jetzt prügelten sie sich, aber das ging vorbei, es ging alles vorbei. Er schloss das Fenster und wandte sich wieder dem Fernseher zu.
In den Lokalnachrichten wurde eine Großaufnahme von dem Haus in der Melemstraße gezeigt. Unter dem Dach war nur Schwärze, Ruß und Dunkelheit zu sehen. Hier hatte Ellen Rupp gelebt, und hier war sie nun gestorben, und was Blume jetzt einfiel, war das wirre, bunte Bild, das über ihrem Esstisch hing. Da kann ich nichts erkennen, sagt er, und sie meint, Bilder könne man nicht erklären, genauso wenig wie Musik.
Die Wohnung war ihr zum Grab geworden. Eine junge Reporterin erzählte mit atemloser Stimme, dass bei einer Tageszeitung mehrere Bekenneranrufe eingegangen waren. »Jeder dieser Anrufer«, haspelte sie herunter, »möchte die Tat – ehm – übernimmt die Verantwortung für die Tat, also den Brand, den Mord an Ellen Rupp und ihrem – ehm, man muss aber auch sagen, dass die Polizei sich dazu offiziell noch nicht geäußert hat. Hinter vorgehaltener Hand sagt die Polizei – also, bezweifelt sie die Echtheit.« Dann ging sie auf einen herumstehenden Gaffer zu und fragte, ob er Ellen Rupp gekannt habe, und der Mann sagte, jawohl, aus der Zeitung, und dass sich das Pack jetzt gerächt habe. Hatte die Frau dem Pack nicht den Kampf angesagt? Schnapp dir mal das Pack, sagte er in die Kamera, und wirf es in einen großen Topf. Deckel zu. Gas an. Und überhaupt muss man –
»Ja, danke«, sagte die Reporterin. Moritz Blume schaltete den Fernseher wieder aus.
Eine Weile saß er reglos da, den Blick zu Boden gerichtet. In der Wohnung über ihm trampelte der verrückte Friseur mit seiner Behelfskrücke herum und machte den Hund nervös. Chef wackelte mit den Ohren, was seine kleine Grille war, wenn er eine Situation nicht überblickte. Oben fiel Czerny die Krücke aus der Hand, und weil Wände und Decken derart dünn waren, hörten sie ihn fluchen. Blume saß da. Endlich zog er den Umschlag zu sich heran, ein paar Blätter und eine Karteikarte, auf der Karte eine Telefonnummer. Der Mann, der sich nach dem achten Klingeln meldete, brüllte seinen Namen wie eine Drohung.
»Guten Tag, Herr Westheim«, sagte Blume und nannte seinen eigenen Namen. Einen Moment lang überlegte er, ob er dem Mann jetzt sein Beileid aussprechen sollte, doch wusste er nicht genau, in welchen menschlichen Konstellationen man Anteilnahme bekundete, also versuchte er so geschäftsmäßig wie möglich zu klingen. »Ich habe gewissermaßen für Sie gearbeitet. Die Sache Langenau. Ich wollte Frau Rupp meine Ergebnisse mitteilen, aber im Grunde sind die Ergebnisse ja für Sie gedacht.«
Nach einer langen Pause klang die Stimme des Mannes fast schüchtern, als er fragte: »Sind Sie dieser – wie nennt man das –?«
»Ja«, sagte Blume. »Recherche und Ermittlung.«
»Gibt es denn Ergebnisse?«, wollte der Mann wissen. »Sie sagte, sie hätte wenig Zeit. Frau Rupp war meine Anwältin, aber was sie da genau gemacht hat, weiß ich nicht.«
»Meine Ergebnisse sind für Sie gedacht«, sagte Blume.
»Das erwähnten Sie schon.« Blume hörte ein Seufzen, dann sagte der Mann: »Sie können heute noch kommen, dann haben wir es hinter uns.«
»Gut.«
»In mein Büro.« Der Mann nannte ihm die Adresse und fügte hinzu: »Etwa gegen sieben.«
Etwa gegen – Blume schüttelte den Kopf. Ellen Rupp war präzise gewesen, sie hätte neunzehn Uhr gesagt und dass sie Pünktlichkeit erwarte, sie hätte auch neunzehn Uhr zehn gesagt und immer noch Pünktlichkeit erwartet. Sie hatte ihn Leo genannt, nicht Moritz, weil es in ihrem Lieblingsbuch angeblich einen Bloom gab, nicht Blume, einen Leo oder Leopold, er kriegte es nicht mehr zusammen. Der besaß auch keinen Hund, hatte sie gesagt, sondern eine Katze.
»Bis dann, Herr Westheim«, sagte Blume sanft. Da blieb noch Zeit bis zum Treffen. Er leinte Chef an und zog ihn hinter sich her. Der Hund war ein schlechter Treppenhaus-Geher, der mochte die Stufen nicht. Er war überhaupt etwas blöde, was sein Nachbar, der Friseur, schon richtig erkannt hatte, aber Blume hatte ihn als halbverhungertes Bündel hinter einer Mülltonne gefunden und großgezogen. Zuerst hatte er ihn für einen missglückten Pudel gehalten, um dann mitanzusehen, wie er sich zu einem astreinen Dobermann entwickelte, was schlecht für seine Wohnung, aber gut für ihn selber war, weil so ein Bursche ihm hier Respekt verschaffte.
Sie gingen zu Fuß, Chef schnappte nach Tauben. Vor dem Baumarkt wies ein großes Schild auf billige Bohrmaschinen hin, aber die konnte Blume nicht gebrauchen, weil in den Wänden seiner Wohnung keine Dübel hielten. Auch lange Nägel, die er in seine Wand schlug, kamen in der Nachbarwohnung wieder heraus. Er betrat den Baumarkt, hob ein paar Kästchen mit Schrauben an, ging zu den Armaturen und schob eine Handbrause hinter seinen Gürtel. Langsam ging er weiter, sah Zangen und Schlüssel, von denen er nicht wusste, wozu man sie brauchte, und ließ einen schweren Hammer in die Innentasche seiner Jacke gleiten. Mit zwei Packungen Klebeband ging er zur Kasse und legte sie auf das Band. Nette Kassiererin. Sie lächelte ihn flüchtig an, als er das Klebeband bezahlte, die meisten guckten ja nicht einmal hoch. Rotes Haar, arg rot, selber gefärbt, denn hinten, wo sie schlecht hingucken konnten, wenn sie es selber machten, war es ungleichmäßig. Das hatte ihm Czerny, der Friseur, einmal erklärt, dass Selberfärben immer in die Hose ging.
Draußen gab er dem Hund ein Zuckerstückchen und ging gleich wieder zurück, marschierte durch den halben Baumarkt und öffnete eine graue Tür. Da saß der Betriebsleiter, der sah auch ziemlich grau aus.
Er hob einen Stapel mit Prospekten an, als er Blume sah. »Das ist die Konkurrenz. Die Schweine verkaufen wieder unter Einkaufspreis.«
»Guten Tag«, sagte Blume, weil etwas Höflichkeit nicht schaden konnte. Er zog die Handbrause hinter seinem Gürtel hervor, nahm den Hammer aus seiner Jackentasche und legte beides auf den Tisch.
»Ah«, sagte der graue Mann und guckte sehr lange auf die Gegenstände, als müsse er sich damit abfinden, dass dies hier sein Leben war, Handbrausen, Hämmer, Schrauben, Bohrmaschinen, Prospekte. Schließlich fragte er: »Welche Kasse?«
»Eins«, sagte Blume.
»War Betrieb?«
»Nein. Nur ich.«
Der graue Mann drückte den Knopf einer Sprechanlage und rief einen Namen. Die rothaarige Kassiererin sah verstört aus, als sie in der Tür stand und der Betriebsleiter ihr einen Kunden als engagierten Ladendieb vorstellte. Überreizter Mann, er fuchtelte mit der Brause und dem Hammer vor ihren Augen. Beinahe schon mit dem Diebesgut jonglierend, erzählte er ihr, dass so ein Baumarkt sich Träumer nicht leisten konnte, kein Betrieb konnte sich Träumer leisten, und dass sie zu Hause träumen sollte, bis die Rente kam, falls die denn kam. Blume hörte ein Wimmern, aber er sah nicht hin, und als er die Tür hinter sich schloss, hörte er sie stammeln und weinen, sie war noch sehr jung. Dreimal war er hier gewesen und hatte dreimal klauen können, denn seine Welt bestand aus Träumern.
Ellen war anderer Ansicht gewesen. In was für einer abscheulichen Welt er sich bewege, hatte sie gesagt, doch sie hatte es mit einem Lächeln gesagt, jenem unfrohen Lächeln, das sie meistens aufsetzte, wenn sie ihm den Auftrag gab, hinter Leuten herzuschnüffeln. Sie war seine beste Auftraggeberin gewesen, hatte besser gezahlt als graue Männer in grauen Betrieben. Auf dem Weg zu Westheim machte er sich im Geist Notizen, was wohl von ihr blieb, falls er in ein paar Jahren noch an sie denken würde. Das glänzende Haar vielleicht, das sie oft im Nacken zusammengebunden trug, oder die Art, wie sie sich auch auf Kaffeehaus-Stühlen drehte, als säße sie telefonierend am Schreibtisch. Er stellte sich das nur vor, er war nie in ihrer Kanzlei gewesen. Wie sie mit zwei Fingern auf den Tisch klopfte, auch wenn sie ganz harmlose Worte sprach, das Lachen in ihren Augen, das aufblitzte und schnell wieder verschwand. Ihre Farben, rot und schwarz, ihre Eleganz. Sie hatte sich gut gekleidet, das musste alles sehr teuer gewesen sein. Die merkwürdige letzte Begegnung im Café Laumer, als sie ihm ein Gedicht aufsagt und er in ihren Augen etwas Fremdes sieht, keine Tränen, aber etwas Ähnliches, eine Vorstufe von Tränen. Das passte nicht, war ein Ausrutscher gewesen und vielleicht das Einzige, was von ihr blieb, falls er eines Tages wieder an sie denken würde. Als er Westheims Büro betrat, fiel ihm das mit dem Feuer noch ein, sie sagt, mach uns mal Feuer. Sie meint die Kerze auf dem Tisch des Cafés.
Florian Westheim war Unternehmensberater und besaß eine Firma, deren Aufgabengebiet Blume nicht klar wurde, als er auf das Firmenschild guckte: Coaching & Consult. Er lief an hell möblierten Büros vorbei, bis er zu einer Sekretärin kam, die ihm tadelnd erklärte, sie hätte ihn nicht eingetragen.
»Aber Herr Westheim erwartet mich«, sagte er.
»Der ist gar nicht da, der ist draußen.«
»Ich warte«, sagte Blume.
»Es wird Ihnen auch nichts anderes übrig bleiben.« Die Sekretärin war immerhin so freundlich, ihm einen Stuhl anzubieten, und so saß er da, guckte auf seine Füße und hörte zu, wie sie am Telefon jemandem erklärte, wo er die Nudeln fand – »doch nicht im Besenschrank, du Heini.«
Besenschrank. Ein Schrank nur für Besen? Wozu?
Westheim sah gezielt an ihm vorbei, als er endlich die Tür aufstieß. Groß und blond, gefiel wohl den Frauen. In Ellens Alter, Mitte vierzig, hielt sich gut. Sicher war ihm Kleidung wichtig und Sport, aber zum Golfspielen war der zu nervös, der bewegte sich viel. Der hüpfte beim Squash herum und würde irgendwann, trotz aller Mühe, an sein Herz denken müssen. Sein Händedruck, zu dem er sich zögernd entschloss, war schlaff, und er blinzelte ständig, als leide er an einem Tick. Nachdem er Blume einen Cognac eingeschenkt hatte, lehnte er sich in seinem Stuhl zurück und betrachtete ihn mit einem Ausdruck, mit dem man auch Betrunkene musterte, auf Straßen und Plätzen, bevor man schnell weiterging.
»So, ich habe also die Unterlagen«, fing Blume an.
»Ich war mit Ellen befreundet.« Westheims Stimme war jetzt so schlaff wie sein Händedruck. Er beugte sich vor und presste die Fingerspitzen aneinander. »Ich habe sie seit meiner Kindheit gekannt. Und meine Frau ist ihre Partnerin – in der Kanzlei.« Ruckartig lehnte er sich wieder zurück. »Aber meine Frau macht andere Sachen, sie macht Familie, also Scheidungen.«
Blume nickte nur.
»Entsetzlich«, sagte Westheim, und es war nicht klar, was er meinte, Ellen Rupps Ermordung oder die Tatsache, dass seine Frau Scheidungsanwältin war. Vielleicht meinte er auch Blumes Tätigkeit, weil er nach einer Weile murmelte: »Sie sind ein Schnüffler. Ellen sagte, sie hätte einen Schnüffler an der Hand, der ihr die kleinen, miesen Jobs macht.«
Blume nickte. »Ich habe auch für Sie gearbeitet. Vor einem Jahr gab es die Klage einer Ihrer Angestellten gegen ihre Entlassung, ich habe den Namen vergessen. Ich konnte nachweisen, dass ihre Krankmeldung getürkt war.«
»Ja, ja«, sagte Westheim nur. »Haben Sie das eigentlich gelernt? Braucht man eine Ausbildung oder sind Sie ehemaliger Polizist?«
»Nein, ich habe nichts gelernt.«
Westheim lächelte ihn an.
»Die aktuelle Sache jetzt –«, Blume blätterte in seinen Notizen. Er fürchtete, Westheim würde gleich dasselbe wie Ellen sagen, dass die verdammte Sache nämlich gar nicht mehr aktuell war, zumindest nicht für ihn. Das hatte dann Konsequenzen für sein Konto. »Sie möchten Anzeige erstatten«, sagte er schnell. »Gegen einen Jörg Langenau. Es fehlten Ihnen die Indizien.«
»Ein Rufmörder«, sagte Westheim. »Mit diesem Kerl habe ich überhaupt nichts zu tun. Er war Angestellter einer Firma, die wir beraten und saniert haben. Ein Versicherungsunternehmen. Da sind viele Arbeitsplätze erhalten worden, allerdings mussten auch Stellen gestrichen werden.«
»Arbeitskosten senken«, sagte Blume.
»Sie gucken Talkshows.« Westheim zog sein Jackett aus. »Langenau, den kenne ich persönlich überhaupt nicht, aber der gehörte zu den betriebsbedingt Entlassenen. Jetzt gibt er mir die Schuld, dem Unternehmensberater, und nicht etwa seinem ehemaligen Vorgesetzten, jetzt läuft der herum und verbreitet Lügen über mich. Das tut er doch?«
»Ja«, sagte Blume.
Westheim nickte zufrieden. »Ellen hat mal Paragraf 164 Strafgesetzbuch erwähnt, Falsche Verdächtigung, und Paragraf 187, Verleumdung. Plötzlich hatte ich ja das Finanzamt auf dem Hals, anonyme Anzeige wegen Steuerhinterziehung. Nichts dran, aber der Ärger.«
»Langenau hat in einer Kneipe verbreitet, dass Sie Steuern hinterziehen und Schwule verprügeln lassen«, sagte Blume. »Dann erzählt er herum, Sie hätten eine junge Polin illegal für sich putzen lassen und vergewaltigt.«
»Was?« Westheim starrte ihn an. »Der muss mich beobachten. Nein, das heißt, das stimmt ja nicht mit der Vergewaltigung, natürlich stimmt das nicht, aber die Polin, die putzt.«
»Und sie kennt ihn nicht«, sagte Blume. »Ich habe ihr Langenaus Foto gezeigt, sie will ihn nie gesehen haben. Sie misshandeln auch Ihre Frau, erzählt er.«
Westheim lachte auf und schüttelte den Kopf.
»Dass Sie ein Killer sind, hat er auch mal –«
»Es gibt Grenzen!« Westheim schlug mit der Faust auf den Tisch. »Da hört es nämlich auf. Auch wenn der sich nur in seinen Kreisen herumtreibt, das muss ich mir nicht bieten lassen. Was mache ich denn jetzt?« Er starrte Blume an. »Ich muss den doch anzeigen. Ellen wollte ihm einen Brief schreiben und mit rechtlichen Schritten drohen, aber ich weiß nicht, ob« – er rang nach Luft – »ob sie noch dazugekommen ist. Ich glaube nicht, sonst hätte sie es mir mitgeteilt.«
Blume wusste es auch nicht. Wurde ein Rufmörder zum Mörder, wenn er in dem Brief einer Anwältin die Aufforderung las, den Rufmord an ihrem Mandanten zu unterlassen? Aber warum die Anwältin und nicht den Mandanten? Warum mit Feuer? Das war riskant mit Feuer. Man musste schnell verschwinden, setzte sein eigenes Leben aufs Spiel. Langenau war ein Jammerlappen, der Zuhörer brauchte. Einer wie Langenau würde kurz zuschlagen und rennen, der würde sich noch umgucken, ob er tatsächlich getroffen hatte.
»Ellen hatte wenig Zeit«, murmelte Westheim, »und hat die Angelegenheit, wie soll ich sagen, etwas schleifen lassen.« Er sackte ein bisschen in sich zusammen, und Blume fiel auf, wie schwer die Leute sich taten, Verstorbenen ihre kleinen Rügen zu erteilen.





























