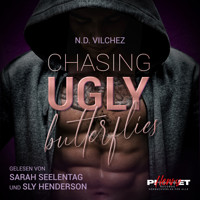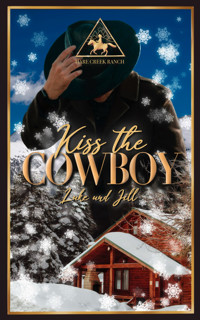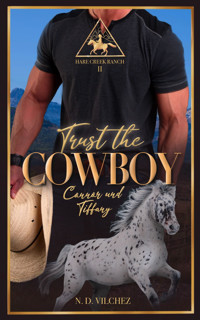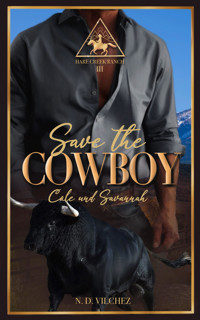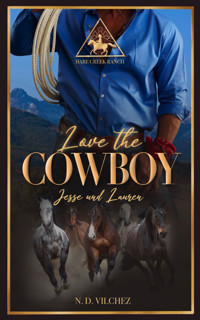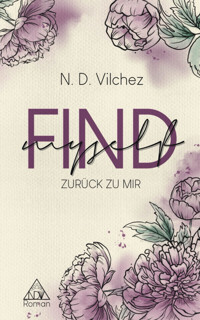
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal braucht es ein ganzes Leben, um den Mut zu finden, dem eigenen Herzen zu folgen. Victoria scheint alles zu haben: Erfolg, Status, ein Leben im pulsierenden Manhattan. Doch hinter der glänzenden Fassade fühlt sie sich leer. Den Glauben an das große Glück hat sie schon lange verloren. Ein Fund aus der Vergangenheit und die Begegnung mit der freiheitsliebenden Künstlerin Zoey stellen ihre Welt auf den Kopf. Als ihr Misstrauen gegenüber ihrem Ehemann zur bitteren Gewissheit wird, steht Victoria am Scheideweg: Will sie weiterhin ein Leben führen, das sie innerlich leer zurücklässt? Der verschollene Liebesbrief von Graham, ihrer ersten großen Liebe, öffnet alte Wunden und neue Möglichkeiten. Hat sie den Mut, sich dem zu stellen, was sie wirklich will? Eine emotionale Reise über zweite Chancen, große Träume und die Kraft, sich selbst treu zu bleiben. Für alle, die wissen: Wahre Liebe kennt kein Alter. Für Fans von Liebesromanen mit Tiefe, authentischen Frauen und bewegenden Neuanfängen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Find myself
ZURÜCK ZU MIR
N.D. VILCHEZ
Inhalt
Vorwort zur Neuauflage
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Danksagung
Die Songs auf deutsch
Content-Warnung
Bücher von N.D. Vilchez
Über die Autorin
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ASIN: B0CFHQJRNZ
© 2023 N.D. Vilchez
Coverdesign: KG Buchdesign
Innendesign und Buchsatz: KG Buchdesign
Alle Rechte vorbehalten
Nadine Domingues Vilchez
c/o Kleines Glück
Am Vorderflöß 48
33175 Bad Lippspringe
Für alle, die Träume haben (oder hatten): Es ist nie zu spät, um glücklich zu sein.
Vorwort zur Neuauflage
Liebe Leserinnen und Leser,
Ihr haltet die überarbeitete Version meines Erstlingswerks in Händen und ich freue mich, dass ihr der Geschichte eine Chance gebt. Mir bedeutet die Aussage dahinter wirklich viel und ich hoffe, sie gefällt euch ebenfalls.
Um das bestmögliche Leseerlebnis zu erzeugen, habe ich einiges umformuliert und gestrichen, der Kern der Geschichte ist aber derselbe.
Es gibt an zwei Stellen Passagen, die in englisch verfasst sind, weil es besser passte. Für alle, denen es nicht liegt, auf englisch zu lesen, habe ich die Übersetzung dieser Texte im Anhang angefügt.
Auch die möglicherweise triggernden Themen könnt ihr dort nachlesen. Ich muss an dieser Stelle allerdings darauf hinweisen, dass diese Liste euch spoilern könnte.
Außerdem habe ich auf Verhütungsmittel verzichtet. Ich bin sicher, ihr wisst, wie wichtig das ist.
Danke für eure Zeit. Viel Spaß und liebe Grüße
Nadine
Prolog
AUGUST 1990
„Bitte sei da.“
Mit geschlossenen Augen erklomm ich Sprosse für Sprosse. Nur nicht nach unten sehen. Ich konnte das auch ohne ihn schaffen. Anders als die bisherigen Male, wenn ich diese Leiter hinauf geklettert war, rührte mein Herzrasen jedoch nicht von meiner Höhenangst her. Heute hatte ich viel größere Angst davor, was mich im Inneren des Hochsitzes erwartete.
Ich tastete blind nach der Tür über mir und zog sie mit einem Ruck auf. Nachdem ich mich über die Kante gezogen hatte, wagte ich es, die Augen zu öffnen. Und erstarrte.
Der kleine Raum lag im Halbdunkeln, doch auch das wenige Dämmerlicht, das durch die offene Tür hereinfiel, reichte aus, um zu erkennen, dass es nichts zu sehen gab. Die Hütte war vollkommen leer.
Keine Decke, kein Schlafsack und kein Notizbuch. Nicht einmal die Lampe hatte er da gelassen.
Ich sackte zur Seite, wo ich mit der Schulter gegen das raue Holz stieß und schlug mir die Hand vor den Mund, um mein Schluchzen zu unterdrücken. Die Tränen, die mir seit Stunden in den Augen brannten, ließen sich nicht mehr aufhalten. Langsam rutschte ich an der Wand hinunter und rollte mich auf dem Boden zu einer Kugel zusammen.
In der Zeit, die ich in der Ruine auf ihn gewartet hatte, war das Gefühl, dass etwas nicht stimmte immer stärker geworden und hatte sich irgendwann nicht mehr ignorieren lassen. Jetzt hatte ich die Bestätigung, vor der ich mich auf dem Weg hierher so gefürchtet hatte:
Graham war nicht mehr da.
KapitelEins
FEBRUAR 2018
Ich umklammere das Lenkrad mit beiden Händen und stöhne auf. Leise und melancholisch erklingen die ersten Gitarrenklänge von ‚Tears in Heaven‘ im Radio. Eine Träne löst sich aus meinem Augenwinkel und ich wische sie hastig weg. Ich habe es geschafft, auf der Beerdigung meiner Eltern nicht zu weinen, warum muss ich jetzt damit anfangen? Dieses verdammte Lied lockt die ganze Trauer hervor, die ich in den letzten Tagen erfolgreich unter Verschluss gehalten habe. Inzwischen laufen mir die Tränen in kleinen Sturzbächen unaufhaltbar an den Wangen hinab.
Seit ich die Nachricht von ihrem tödlichen Segelunfall bekommen habe, befinde ich mich in einer Art Schwebezustand. Absolut im Unklaren über meine Gefühle dachte ich, diese Leere wäre darauf zurückzuführen, dass wir in den vergangenen Jahren kein inniges Verhältnis hatten.
Doch jetzt überrollt mich eine Welle aus Traurigkeit, die mich kalt und hart trifft. Ich halte am Straßenrand, weil meine Sicht zu sehr verschwimmt, um die Fahrbahn zu erkennen. Hoffentlich sieht mich niemand wie ein Häufchen Elend heulend in einem Mietwagen hocken.
Bei dem Gedanken, wie mein Vater diese Situation bewertet hätte, muss ich unwillkürlich über die Schluchzer hinweg lachen.
Absolut unangebracht, Victoria. Werde jetzt bloß nicht hysterisch.
Hektisch krame ich mit der rechten Hand nach Taschentüchern, während die linke sich so fest ans Lenkrad krallt, dass die Knöchel weiß hervortreten. Ich schließe die Augen, und versuche, gleichmäßig zu atmen. Das Lied ist inzwischen vorbei. Besser so.
Gerade als ich mich fertig geschnäuzt und so weit wieder beruhigt habe, dass ich glaube, weiterfahren zu können, ertönt der Klingelton meines Handys über die Lautsprecher des Wagens und ich zucke erschrocken zusammen. Muss das so laut sein? Ein Blick auf das Display bestätigt die Vermutung, dass es sich bei dem Anrufer um meinen Mann handelt. Ich tippe auf den Knopf am Lenkrad und setze ein künstliches Lächeln auf, obwohl er es nicht sehen kann.
„Hallo Andrew. Bist du gut in Frankreich angekommen?“
„Selbstverständlich“, ertönt seine raue Stimme aus den Boxen, „ich bin gestern gelandet. Wenn etwas passiert wäre, wüsstest du wohl schon davon.“
Ich kann mir ein Augenrollen nicht verkneifen. Er ist noch am Abend der Beerdigung zu einem angeblichen Geschäftstermin nach Europa aufgebrochen und hat es bis jetzt – zwei Tage später – nicht für nötig gehalten, sich bei mir zu melden. Geschweige denn danach zu fragen, wie es mir geht.
Ich verkneife mir das ärgerliche Schnauben und biege in die Allee ein, die ich von früher noch so gut kenne.
„Ich bin gerade auf dem Weg zum Haus meiner Eltern, um mich um den Nachlass zu kümmern. Wie kann ich dir helfen?“ Mir entgeht nicht, dass ich wie bei einem Gespräch unter Geschäftspartnern klinge. Aber so ist das inzwischen bei uns.
Er schlägt bei der Antwort einen ähnlich geschäftsmäßigen Ton an, während ich das Auto vor dem Haupteingang meines Elternhauses parke: „Das trifft sich gut. Genau deswegen rufe ich an. Denk daran, mit dem Personal zu sprechen. Es ist notwendig, die Villa von oben bis unten auf Hochglanz zu bringen, damit die Maklerin nächste Woche direkt ansprechende Bilder für das Exposee machen und das Haus schnellstmöglich verkaufen kann. Je schneller das geklärt ist, desto besser.“
Ich unterdrücke ein Schnauben und lege meine Stirn auf das Lenkrad.„Okay, Andrew, ich bin angekommen und werde jetzt auflegen. Wir sehen uns nächste Woche in New York. Viel Erfolg noch bei deinen Verhandlungen.“
Ich lege auf, ohne eine Antwort abzuwarten. Über Höflichkeiten sind wir schon lange hinaus. Ich weiß, dass sein „Geschäftstermin“ an der Côte d´Azur etwa 25 Jahre alt ist und auf den Namen Cindy hört.
Ja, wirklich: Cindy.
Und er weiß vermutlich, dass ich es weiß. Wir sprechen nur nicht darüber.
Als ich das erste Mal eine Frauenstimme hörte, nachdem ich seine Nummer gewählt hatte, hat es mich verletzt. Die Bestätigung auf der Kreditkartenabrechnung zu sehen, löste Wut in mir aus. Ich habe mich erniedrigt gefühlt, weil er mich belog. Aber nach einiger Zeit habe ich eingesehen, dass sein Verhalten womöglich nur eine logische Konsequenz der Entfremdung ist. Wir haben uns nicht allzu viel zu sagen und sexuell läuft schon seit Jahren nichts, nachdem er mir in einer Whiskeylaune einmal mitgeteilt hat, wie sehr ich ihn langweile. Seitdem habe ich keinen Versuch mehr unternommen, ihm auf diese Weise zu gefallen.
Ich vertreibe die Gedanken mit einem Kopfschütteln und seufze. Über den Spiegel in der Sonnenblende kontrolliere ich mein Make-up und ordne die roten Locken.Kein bisschen bereit für die Aufgabe, die vor mir liegt, greife ich nach meiner Tasche und steige aus dem Wagen. Kurz halte ich inne und betrachte die weiße Fassade der typischen Südstaatenvilla, die so weit von einem Zuhause entfernt ist wie ein Museum.
Von außen wirkt alles genauso wie gewohnt: gepflegt und einschüchternd. Im Teenageralter ist mir einmal bei einem Fernsehabend mit Mom aufgefallen, dass unser Haus erstaunliche Ähnlichkeit zu „Tara“, der Plantage aus ‚Vom Winde verweht‘, aufweist. Ich habe mich immer gefragt, ob mein Vater sich darüber ebenfalls im Klaren war.
Mit entschlossenen Schritten mache ich mich auf den Weg zur Haustür, die sich in dem Augenblick wie von selbst öffnet, als ich die letzte Treppenstufe erklimme. Im Durchgang erscheint Sophie, die Haushälterin der Familie, die schon in meinen Kindertagen hier arbeitete. Damals war sie Anfang zwanzig und erzeugte durch ihre aufrechte Haltung einen ebenso selbstbewussten Eindruck, wie jetzt kurz vor dem Ruhestand.
Mit traurigen braunen Augen lächelt sie mir entgegen. „Hallo Victoria“, grüßt sie mit ihrer vertrauten, rauen Stimme, „komm herein.“ Sie tritt einen Schritt zurück, um mich einzulassen.
Ich fühle mich wie ihr Gast, als ich mit einem Nicken an ihr vorbei in die Eingangshalle trete. Vermutlich liegt es an der emotionalen Distanz zu diesem Haus. Seit mein Vater sich aus gesundheitlichen Gründen aus seiner Kanzlei zurückgezogen hat, war ich nicht mehr häufig hier. Andrew hatte engeren Umgang mit ihm als ich, was mir durchaus recht war. Um den Kontakt zu meiner Mutter tut es mir allerdings leid. Wir haben hin und wieder telefoniert, über oberflächliches Geplänkel sind wir jedoch nie hinausgekommen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist es bedauerlicherweise zu spät, etwas daran zu ändern.
Mit zusammen gepresstem Kiefer blicke ich in der Eingangshalle umher und mir bildet sich ein Kloß im Hals. Es sieht alles genauso aus, wie immer. In der Vase auf dem runden Tisch in der Mitte des Raums stecken frische Blumen.
Sophie stellt sich neben mich und scheint zu bemerken, woran mein Blick haftet. „Alte Gewohnheit“, sagt sie mit einem Schulterzucken. „Deine Mutter hat weiße Lilien so geliebt.“
Ich höre die Traurigkeit in ihrer Stimme und drehe ihr den Kopf zu. Sie fixiert mit feuchten Augen die Pflanzen. Moms Tod nimmt sie eindeutig mit. Aus der Nähe sehe ich die dunklen Augenränder und die eingefallenen Wangen, die mir vor der Tür nicht aufgefallen sind.
Ich glaube, zwischen den beiden hat sich über die Jahre eine heimliche Freundschaft entwickelt. Früher habe ich oft beobachtet, wie sie die Köpfe zusammen steckten. Allerdings nur in Dads Abwesenheit. Er hätte diese Vertraulichkeiten mit dem Personal nie gutgeheißen. Vermutlich hat Sophie meine Mutter besser gekannt als wir beide, überlege ich und senke den Blick zu Boden. Um nicht nochmal einen Gefühlsausbruch zu erleiden, atme ich tief durch.
„Also“, durchbricht sie die entstandene Stille, „die Mädchen und ich haben die persönlichen Gegenstände deiner Eltern in Kisten verstaut und sie in die Bibliothek geräumt, damit du sie in Ruhe durchsehen kannst. Sicher möchtest du einige Andenken behalten.“
Ich räuspere den Kloß aus meinem Hals, bevor ich antworte. „Danke sehr, Sophie. Dann fange ich am besten gleich an.“ Sie sieht ernst zu mir herüber und nickt.
Ein weiteres Mal atme ich tief durch und gehe schließlich den Flur hinunter. Zur Bibliothek meines Vaters.
* * *
Ohne ihn selbst wirkt der Lieblingsraum des Hausherren deutlich weniger imposant und einschüchternd, als ich ihn damals erlebt habe, wenn ich für Standpauken und ‚ernste Gespräche‘ hierher zitiert wurde. Das letzte Mal war der Tag, an dem er mir mitteilte, dass meine depressiven Eskapaden jetzt ein Ende hätten und mich über den genauen Ablauf der kommenden fünf Jahre in Kenntnis setzte, die er bereits durchgeplant hatte. Das ist schon siebenundzwanzig Jahre her. Ich fühle mich dennoch nicht wohl. Warum hat sie die Sachen ausgerechnet hier hinbringen lassen?
Ich schließe die Lider und atme tief durch. Der Geruch von altem Leder, Staub und einem Hauch von Zigarre, der in den Wänden steckt, ist noch immer der gleiche wie damals. Nachdem ich die Augen wieder geöffnet habe, drehe ich mich einmal im Kreis. In diesem Teil des Hauses hat sich seit bestimmt dreißig Jahren nichts verändert. Es sieht aus wie in einem Herrenclub. Ich verdrehe die Augen und wende mich nach links in Richtung des wuchtigen Mahagoni-Schreibtischs, der jetzt mit etwa einem Dutzend Kisten beladen ist. Das Gefühl, das mich bei dieser Aufgabe überkommt, ist schwer in Worte zu fassen. Einerseits bin ich bedrückt und traurig und würde mich am liebsten abwenden und nach Hause fahren. Andererseits bin ich gespannt, was für Erinnerungsstücke es hier zu entdecken gibt.
* * *
Die meisten der Kartons sind mit gerahmten Fotos von Urlauben, Weihnachtsfeiern und ähnlichen Anlässen gefüllt. Allesamt wirken sie gestellt und kein bisschen authentisch.
Leicht gelangweilt ziehe ich eine rosa gepunktete Box zu mir, die mein Aufsehen erregt, weil sie überhaupt nicht zu den anderen passt. Mit gerunzelter Stirn hebe ich den Deckel herunter und erstarre.
Die Kiste ist ein Sammelsurium aus Erinnerungsstücken meiner Kindheit und Jugend. Auf den ersten Blick entdecke ich das Plastikpferdchen, mit dem ich als Sechsjährige immer Ausritte durch Haus und Garten unternommen habe. Letzteres sehr zum Missfallen der Nanny, die sich ewig über die grünen Flecken an den Knien auslassen konnte. Das hielt mich aber nicht davon ab, am nächsten Tag wieder auf Streifzug zu gehen. Auf meinem Gesicht breitet sich ein Lächeln aus, als ich daran zurückdenke, und ich muss einfach mit dem Finger über die Mähne des Pferdchens streicheln.
Mein Blick bleibt an einem Stapel Fotos hängen, der an der kurzen Wand der Kiste klemmt. Ich ziehe sie heraus und lache sofort lauthals auf, als ich das erste unscharfe Bild sehe. Es zeigt mich, breit grinsend, Arm in Arm mit Mitch Adams, im Hintergrund ein Lagerfeuer. Unsere Gesichter sind schrecklich überbelichtet. Ich bin darauf schätzungsweise 14 Jahre alt. In diesem Sommer hat Mitch mir meinen ersten Kuss gegeben. Ich hatte bis dahin kein großes Interesse an Jungs im Allgemeinen und eigentlich auch nicht an diesem einen Jungen im Besonderen, aber er zeigte offensichtlichen Gefallen an mir. Meine Freundinnen machten damals riesigen Wind ums Küssen. Dalia redete auf mich ein, ich solle es mit Mitch versuchen, weil er ein gutaussehender, begehrter Typ war, und wir schlossen daraus, dass er sicherlich gut küssen konnte, weil er Übung haben musste.
Nun ja, so war es nicht. Der erste Kuss meines Lebens war grauenhaft. Nass und eklig. Einen weiteren Versuch sollte Mitch bei mir nicht bekommen.
Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Er war nur diesen einen Sommer hier auf Familienurlaub. Er brach einige Herzen, verteilte feuchte Küsse und verschwand wieder. Ich habe ihm nicht nachgeweint und das mit den Jungs hatte sich für mich erstmal erledigt. Ich fand es überbewertet und hatte keine Ahnung, warum meine Freundinnen so ein Theater um das Geknutsche machten. Das verstand ich erst, als ich meinen ersten richtigen Kuss bekam. Von dem einen Jungen, der mich wirklich interessierte. Und der mir schließlich mein Herz brach.
Oder wohl eher zerfetzte.
Ich schüttele entschlossen den Kopf. Darüber will ich jetzt nicht nachdenken. Um mich abzulenken, blättere ich weiter durch die Fotos und schmunzle bei den Erinnerungen an diese unbeschwerten Sommer, die meine Freunde und ich hier verbracht haben und in denen wir uns frei und unbesiegbar fühlten.
Ich hatte keine Ahnung, dass Mom all diese Dinge für mich aufbewahrt hat, und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so etwas Sentimentales tun würde. Dennoch bin ich froh darüber. Es macht Spaß, durch diese Andenken zu stöbern und die Bilder von früher zu betrachten. Zu sehen, wie ich auf jedem dieser Fotos strahle.
Ich war damals ein richtiger Sonnenschein.
Auf der Suche nach weiteren Schätzen schiebe ich den Inhalt der Kiste mit den Fingern herum und bleibe mit dem Nagel an der Ecke eines Umschlags hängen, der unter dem Plastikpferd am Boden des Kartons liegt. Ich ziehe ihn vorsichtig hervor und stutze. Auf der Vorderseite steht: „Victoria Lancaster“ in einer krakeligen Handschrift.
Es ist ein merkwürdiges Gefühl, meinen Mädchennamen zu lesen. Ich trage Andrews Nachnamen inzwischen seit 20 Jahren.
Ich bin Victoria Davis.
Victoria Lancaster gibt es schon lange nicht mehr. Sie war ein anderer Mensch, als ich es bin. Sie war das Mädchen auf den Fotos. Mit einem Lächeln im Gesicht und Flausen im Kopf, auf der Jagd nach dem großen Glück. Ich bin die, die sich mit kleinen Glücksmomenten zufrieden gibt, weil ich realistisch genug bin, um zu wissen, dass das große Glück nicht für jeden zu haben ist.
Ein paar Mal drehe ich den Umschlag hin und her. Kein Absender. Und er ist verschlossen.
Was soll das? Woher kommt dieser Brief und warum liegt er ungelesen in dieser Erinnerungskiste, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe?
Mit gerunzelter Stirn schiebe ich entschlossen den Zeigefinger unter die Lasche des Umschlags und öffne ihn. Darin steckt eine mit der gleichen zackigen Handschrift eng beschriebene Seite. Ich halte den Atem an, während ich sie langsam herausziehe und auf das Datum in der oberen rechten Ecke blicke:
25. September 1992
Ich stoße die angehaltene Luft aus. Dieser Brief ist 25 Jahre alt. Wie kann das sein? Mein Blick zuckt nach links und als ich die Vermutung bestätigt sehe, entfährt mir ein lautes Schluchzen.
Liebe Vicky …
Ich weiß, von wem dieser Brief geschrieben wurde. Zittrig schlage ich mir die Hand vor den Mund, um ein weiteres Schluchzen zu ersticken.
Schlagartig prasselt ein ganzer Schwall Erinnerungen auf mich ein, an die ich nie wieder denken wollte.
Erinnerungen an die glücklichste Zeit meines Lebens.
KapitelZwei
MAI 1990
Als ich Graham Williams zum ersten Mal sah, dachte ich, das kann nur ein schlechter Scherz sein.
Es war einer der ersten Tage der Sommerferien und mein Vater und ich hatten direkt an unser letztes Treffen angeknüpft und uns in den Haaren gelegen. Er hatte mitbekommen, dass ich über den Sommer einen Kurs für kreatives Schreiben belegt hatte, und teilte mir mit, dass er nicht gewillt sei, mich bei diesen „Fantastereien“ zu unterstützen.
Leider hatten wir gegensätzliche Vorstellungen von meiner Zukunft und fochten diesen Streit seit einiger Zeit immer wieder aus. Noch war es nicht so weit, aber wenn ich, seinem Plan entsprechend, an eins der Ivy League Colleges wollte, musste ich die Kurse im kommenden Jahr bereits dementsprechend belegen und nach Möglichkeit für ein paar vorzeigbare außerschulische Aktivitäten sorgen. Ein Sommerkurs für kreatives Schreiben zählte in den Augen meines Vaters nicht zu den prädestinierten Beschäftigungen, die die Jura-Fakultät einer Elite-Uni beeindrucken konnten. Dass Jura so ziemlich das Letzte war, das ich studieren wollte, spielte für ihn keine Rolle. Seine Meinung spielte für mich keine Rolle. Das behauptete ich zumindest. Denn natürlich war mir klar, dass ich ohne die finanzielle Unterstützung meiner Eltern aufgeschmissen wäre.
Es wäre nicht unmöglich, meinen Weg allein zu gehen, aber die Aussicht machte mir mehr Angst, als ich zugeben wollte. Dennoch hielt ich eisern dagegen, was meist zu einem Krach führte, der sich gewaschen hatte. So auch heute.
Daher rannte ich wütend durch den Wald, auf dem Weg zu einer Kirchenruine, die ich im Jahr zuvor bei einem ähnlichen Streifzug entdeckt und zu meinem persönlichen Rückzugsort auserkoren hatte.
Wenn ich so frustriert war, musste ich für mich allein sein und meine Gedanken schweifen lassen, um sie zu beruhigen.
An diesem Tag ging der Plan nicht auf.
Als ich um die Ecke des alten Gemäuers herum gestapft kam, blieb ich ruckartig stehen und blinzelte. Vor mir, auf einem der umgestürzten Steinsockel, hockte ein Junge.
Das konnte doch nicht wahr sein.
Auf den ersten Blick war er das Stereotyp des Badboys aus einem meiner Liebesromane: Mit zerrissener Jeans, groben Stiefeln und schwarzem Shirt, das an den Oberarmen spannte, saß er halb abgewandt von mir da. Eine Gitarre lag auf seinen an den Knöcheln gekreuzten Beinen. Er beugte sich über das Instrument und beobachtete seine Finger, die sich entlang der Saiten bewegten, sodass ihm sein langes, dunkles Haar ins Gesicht fiel.
Wer war dieser Typ?
Ich war mir absolut sicher, ihn noch nie gesehen zu haben. Was machte er also hier? Meine Wut war zurück und verdrängte die Verwirrung.
Das hier war mein Ort. Und ich würde ihn mir nicht von irgendeinem dahergelaufenen Johnny Cash für Arme streitig machen lassen. Auf gar keinen Fall!
Bereit für den Kampf straffte ich meine Schultern und stapfte ich entschlossen auf ihn zu, um erst kurz vor ihm stehenzubleiben.
„Wer bist du? Und was machst du hier?“, fragte ich fordernd.
Er war nicht von hier. Also musste ich nur glaubhaft meinen Anspruch auf diesen Ort klarmachen. Dann würde er schon gehen.
Der Fremde hob langsam den Kopf, ließ seinen Blick an mir auf und abwandern und zog eine Augenbraue hoch. „Na Hallo auch“, sagte er völlig unbeeindruckt.
Mir klappte der Mund auf. Was für ein arroganter Idiot.
Sein Mundwinkel hob sich zu einem schiefen Lächeln. In seiner Wange bildete sich ein Grübchen. Und ich stellte fest, dass er dabei verdammt gut aussah, was mich noch mehr auf die Palme brachte.
Mit zusammengekniffenen Augen starrte ich ihn grimmig an. „Ich habe dir eine Frage gestellt.“
Doch statt einer Antwort brach er in schallendes Gelächter aus und schüttelte den Kopf.
„Wohl nicht dein Tag, Rotkäppchen?“, fragte er, während er seine Gitarre neben sich ins Laub legte, die Unterarme auf die angewinkelten Knie stützte und mich – inzwischen mit Grübchen auf beiden Seiten – breit angrinste.
Empört riss ich die Augen auf. „Rotkäppchen?“, knurrte ich. „Hältst du dich etwa für lustig? Ich hab schon so ziemlich jeden Witz über meine Haare gehört. Nicht besonders einfallsreich und ganz sicher nicht cool.“
Mit einem Stirnrunzeln hielt er inne und legte den Kopf schräg.
„Keine Ahnung, was mit deinen Haaren nicht stimmt“, sagte er und deutete mit dem Kinn hoch zu meinem Schopf. „Aber die Kappe da, ist eindeutig rot. Und irgendwie muss ich dich ja nennen.“ Wieder erschien das selbstgefällige Grinsen auf seinem Gesicht.
Verwirrt griff ich mir an den Kopf und ertastete die Kapuze meines Hoodies, meines roten Hoodies. Langsam begreifend verdrehte ich die Augen und kam mir dumm vor. Die Runde ging eindeutig an ihn. Mist.
Er schien keine Erwiderung zu erwarten, denn er zuckte nur mit den Schultern und griff nach seiner Gitarre. Ohne mich weiter zu beachten, begann er eine Melodie zu zupfen. Einige Momente stand ich nur da und starrte ihn an. Ich wusste nicht, was ich von dieser merkwürdigen Situation und diesem fremden Jungen halten sollte.
Er schien meine Anwesenheit nicht mehr wahrzunehmen.
Gerade als ich entschied, dass ich gehen und ihm den Platz für heute überlassen sollte, sprach er mich wieder an: „Steh da nicht so rum, Rotkäppchen. Setz dich hin und tu das, was du hier tun wolltest.“ Seine Stimme klang dabei fast gleichgültig.
Ob es ihm wirklich egal war? Unschlüssig trat ich von einem Bein aufs andere. Die Vorstellung von dem, was mich zu Hause erwartete, gab den Ausschlag. Also setzte ich mich ihm schräg gegenüber auf einen großen Stein und schlang die Arme um meine Knie. Mit geschlossenen Augen lauschte ich eine Weile auf die sich immer wiederholende Melodie, die er spielte, und ließ mich davon einlullen.
Eine merkwürdige Ruhe legte sich über mich wie eine Decke und ich genoss dieses Gefühl.
So saßen wir eine Weile da. Zwischen uns nichts als das Geräusch der schwingenden Saiten.
„Ich bin übrigens Graham. Oder Gray … wie du willst“, unterbrach er das Schweigen so plötzlich, dass ich aufschreckte.
Ich sah ihn überrascht an, antwortete aber nicht.
Abwartend betrachtete er mich, wobei sich sein rechter Mundwinkel langsam wieder hob.
„Das ist eigentlich die Stelle, an der du mir im Gegenzug deinen Namen verrätst, Rotkäppchen.“
Ich zog die Nase kraus und überlegte. Sollte ich diesem Fremden sagen, wie ich heiße? Gerade gefiel es mir sogar irgendwie, dass er mich Rotkäppchen nannte. Aber das war natürlich albern. Daher räusperte ich mich und antwortete: „Mein Name ist Victoria.“
Wieder legte er den Kopf schräg und musterte mich interessiert.
„Kein Spitzname?“
„Kein Spitzname“, antwortete ich und dachte an meinen Vater, der jegliche Verniedlichungen und Abkürzungen von frühster Kindheit an unterbunden hatte. Wenn man ernst genommen werden wolle, benötige man einen entsprechenden Namen. Koseworte seien ein Witz, nichts weiter.
„Okay“, unterbrach Graham meine Gedanken. „Aber ich nenne dich Vicky.“
Ich verbesserte ihn nicht. Mir gefiel das.
Bis heute war Graham der Einzige, der mich jemals Vicky genannt hat.
KapitelDrei
FEBRUAR 2018
Ich werde durch ein Klopfen am Türrahmen in die Realität zurück katapultiert und finde mich am Schreibtisch sitzend wieder, den Blick starr auf den Brief in meinen Händen gerichtet.
Den Brief von Graham.
Ich schüttele leicht den Kopf, um die Verwirrung zu vertreiben, und richte meine Aufmerksamkeit zur Tür, in der Sophie steht und mich ernst ansieht.
„Ist alles in Ordnung?“, fragt sie mit ehrlich besorgtem Ton. „Du siehst aus, als hättest du einen Geist getroffen.“ Sie lässt den Blick zu dem Brief gleiten und kurz weiten sich ihre Augen ein Stück. War das Wiederkennen? Hat sie diesen Umschlag schon einmal gesehen?
„So fühle ich mich auch. Ich hatte keine Ahnung von dieser Erinnerungskiste, die Mama angelegt hat. Weißt du etwas hierüber?“ Ich hebe das Papier leicht an, um zu zeigen, worum es mir wirklich geht.
„Nicht allzu viel“, seufzt sie und macht eine unbestimmte Bewegung mit der Hand. „Komm, ich mache dir einen Tee.“ Und schon ist sie in den Flur verschwunden und erwartet offenbar, dass ich ihr folge.
Hat sie gerade zugegeben, dass sie etwas weiß?
Mein Herz beschleunigt sich und ich stopfe den Umschlag hektisch in meine Tasche, während ich aufspringe und ihr nachlaufe.
Ich folge Sophie in die Küche, wo sie bereits heißes Wasser in zwei Tassen gießt. Als sie mich hereinkommen hört, hebt sie den Kopf und sieht mir entgegen.
„Setz dich doch.“ Sie schiebt einen der Becher zu und wieder werde ich zum Gast im eigenen Haus.
Auch diesmal macht es mir nichts aus. Ich erklimme den nächststehenden Hocker so elegant, wie es mit dem Bleistiftrock möglich ist. Ich sollte öfter Hosen tragen.
„Danke“, murmele ich und hebe die Tasse an die Nase, um den Duft einzuatmen. Pfefferminz. Wie früher.
Erwartungsvoll sehe ich sie direkt an, was sie offenbar als Aufforderung versteht.
„Ich weiß tatsächlich nicht viel über diesen Brief“, beginnt sie leise. „Nur, dass er von dem Jungen ist, der dir damals das Herz gebrochen hat.“
Ich schnappe nach Luft. Tausend Fragen zischen durch mich hindurch wie eiskalte Klingen. Er war nochmal hier? Was wollte er? Warum weiß ich nichts davon? Weshalb hat sie es mir nicht erzählt? Woher wusste sie überhaupt, wer er ist?
Keine dieser Fragen spreche ich aus. Es ist mir nicht möglich. Mein Kopf schmerzt plötzlich. Es fühlt sich an, als wäre der Schädel zu klein für mein überschäumendes Gehirn. Ich kann die Frau mir gegenüber nur anstarren. Sie stößt ein lautes Seufzen aus und weicht meinem Blick aus, indem sie in ihre Tasse starrt.
„Du warst erst seit einem Semester am College und schienst dich dort gut zurechtzufinden. Eines Abends fand ich deine Mutter im Wintergarten. Dein Vater war auf einer seiner Geschäftsreisen. Sie saß völlig aufgelöst in einem der Korbstühle und hielt den Brief in ihren Händen. Auf dem Tisch standen ein Weinglas und eine fast leere Flasche. Du weißt selbst, wie selten Deine Mutter trank. Sie war komplett neben der Spur.“ Sie greift sich an die Stirn, die Augen noch immer auf die Tasse gerichtet, aber ihr Blick zielt in die Ferne, als könnte sie die Szene vor sich sehen.
„Ich setzte mich zu ihr“, erzählt sie dann weiter, „fragte, was passiert sei. Es dauerte ewig, bis ich ihr etwas halbwegs Verständliches entlocken konnte. Sie sagte, ein junger Mann sei da gewesen. Derjenige, wegen dem du zwei Jahre zuvor so am Boden zerstört warst. Er wollte dich sehen, aber du warst ja nicht da. Darum ließ er einen Brief für dich hier ... Mehr weiß ich nicht. Deine Mutter weinte und sagte, es täte ihr alles so leid und dass sie dir den Brief nicht geben könne. Ich habe nicht verstanden, warum sie das meinte, und sie hat es mir auch nicht erklärt. Den Brief habe ich heute zum ersten Mal seit diesem Abend gesehen. Es tut mir leid, Victoria.“
Das glaube ich ihr. Das Gefühl steht ihr deutlich ins Gesicht geschrieben.
Ich fühle nichts. Bin wie betäubt. Bis auf den Kopfschmerz. Meine Mutter hat mir 25 Jahre lang verheimlicht, dass Graham hier war und mich sehen wollte.
Ich muss hier raus.
* * *
Wenn ich wieder klar denken können will, brauche ich einen Drink.
Auf keinen Fall kann ich mit dem Brief, der mir ein Loch in die Tasche zu brennen scheint, in meinem Hotelzimmer sein. Allein unter Menschen mit einem Glas Gin in der Hand, das ist jetzt genau das Richtige. Ich strebe auf direktem Weg die Hotelbar an und erklimme ähnlich wenig grazil wie vorhin einen der Hocker an der Bar.
Nicht im Haus meiner Eltern zu übernachten, war die beste Entscheidung. Ich habe das Hotelzimmer gebucht, weil ich davon ausging, dass es mir in der Villa zu still und traurig werden könnte. Nur ist Trauer jetzt nicht mehr die vorherrschende Emotion, wenn ich an zu Hause denke. Und an meine Mutter.
Auf der Fahrt hierher habe ich alles wieder und wieder durchgespielt und versucht, meine Gedanken zu ordnen. Das Taubheitsgefühl ist Wut und Enttäuschung gewichen. Der Druck im Schädel ist gleichbleibend da. Mein Gehirn ist dem Chaos aus Fragen, die wie Flipperkugeln in ihm herum schießen, offenbar nicht gewachsen. Aber ich bin inzwischen ruhiger und bewahre wenigstens nach außen hin wieder Haltung.
Der Barkeeper lächelt mir zu und ich bestelle. Meine Ausstrahlung sagt ihm scheinbar, dass ich nicht für Smalltalk aufgelegt bin, denn er stellt wortlos das Getränk vor mir auf einer Serviette ab und zieht wieder seiner Wege.
So sitze ich stumm und alleine da, wie ich es geplant habe, starre auf das Glas in meiner rechten Hand, nippe ab und zu daran und brüte vor mich hin.
Doch so sehr ich auch die wenigen Informationen, die ich habe, hin und her wälze, die ganze Geschichte ergibt einfach keinen Sinn. Nichts davon.
Es ist völlig unlogisch, dass Graham zwei Jahre nach der Trennung – wenn man das Ende so nennen kann – plötzlich vor unserer Tür auftaucht. Mir war nicht einmal klar, dass er eine Ahnung hatte, wo ich wohnte. Außerdem hatten Mom und Dad nie von uns erfahren.
Woher also wusste meine Mutter, wer er war? Wie konnte sie ahnen, dass er derjenige gewesen ist, wegen dem es mir zwei Jahre zuvor so miserabel gegangen war? Und warum zum Geier hatte sie zwar angeblich ein schlechtes Gewissen, konnte mir jedoch all die Jahre nichts davon erzählen?
Möglicherweise erklärt Graham etwas in seinem Brief, aber ich kann ihn nicht lesen. Nicht jetzt. Nicht heute. Ich habe zu viel Angst davor, was es mit mir anstellen könnte. Denn in einem Punkt hat Sophie richtig gelegen: Graham Williams hat mir das Herz gebrochen. Bis heute hätte ich gesagt, er hat es mir herausgerissen und mitgenommen, denn ich habe seitdem keine so tiefen Gefühle mehr für jemanden zulassen können. Auch nicht für Andrew.
Aber ich stelle fest: Mein Herz ist noch da. Denn es tut wieder weh.
Ich fasse mir an die Stirn und seufze. Werde jetzt nicht melodramatisch, Victoria!
Ich gebe dem Kellner ein Zeichen, deute auf mein inzwischen leeres Glas. Er versteht und beginnt direkt, ein neues Getränk zuzubereiten. Wenn doch nur alles so einfach und selbsterklärend wäre!
Als das frisch gefüllte Glas vor mir auftaucht, bemerke ich, dass mein Kopf noch immer auf die Hand gestützt ist, und frage mich augenblicklich, welchen Eindruck ich auf Außenstehende mache. Um wenigstens etwas Höflichkeit zu zeigen, richte ich den Rücken auf und will dem Kellner danken, als mein Blick den einer Frau trifft, die hinter mir steht und mich über den Spiegel in der Bar mit schräg gelegtem Kopf mustert.
Ich fühle mich ertappt, wie ein Kind in der Schule und richte den Körper kerzengerade auf. Sie beginnt zu lächeln und stellt sich neben mich. Wir drehen synchron wie in einer Choreographie die Köpfe und sehen uns direkt an. Sie ist klein und zierlich, etwa in meinem Alter und wirkt auf den ersten Blick … unkonventionell. Ihr blondes Haar trägt sie in einem verstrubbelten Pixie-Cut, sodass ihre winzigen Ohren frei liegen, an denen große, verschnörkelte Creolen hin und her schwingen. Zu ihrer schwarzen Jeans trägt sie eine ebenfalls schwarze Bikerjacke über einem leuchtend orangenen Shirt mit der Aufschrift:
I´m a witch.
Get over it!
Sie lässt meine Musterung lächelnd über sich ergehen und fängt dann an, zu lachen.
„Sie sehen aus wie ein lebendes Klischee, wissen Sie?“, kichert sie und schüttelt leicht den Kopf.
Mit aufgerissenen Augen starre ich sie an. Damit habe ich nicht gerechnet.
„Wie bitte?“
Wieder lacht sie laut auf, als hätte ich einen Scherz gemacht. Was bitte stimmt denn nicht mit dieser Frau?
„Nichts für ungut“, meint sie und tätschelt mir die Schulter. „Es ist quasi mein Job, nach ausdrucksstarken Gesten Ausschau zu halten und diese Denkerpose über dem Glas war einfach großartig!“ Bei den letzten Worten bekommt ihr Gesicht einen regelrecht verträumten Gesichtsausdruck.
Ich blicke auf ihre Hand hinab, die sich weiter über meine Schulter bewegt und dabei die weiße Seidenbluse hin und her schiebt.
Sie tätschelt mir allen Ernstes die Schulter.
Ich bin zu schockiert, um zu reagieren. Ich hasse es generell, wenn Menschen ungefragt Körperkontakt suchen, und diese Frau ist fremd und scheint außerdem übergeschnappt zu sein.
Sie lächelt mich fröhlich an, bevor sie sich abwendet und auf den nächsten Barhocker klettert. Mit Genugtuung stelle ich fest, dass sie dabei keine bessere Figur macht als ich.
„Ich weiß, was ich jetzt sagen werde, ist ein bisschen gruselig“, sagt sie grinsend.
Mir schwant Böses.
„Ich werde Sie malen!“ Diese Ankündigung unterstreicht sie mit einer ausladenden Geste. Ist sie womöglich betrunken?
Ich starre sie äußerst undamenhaft mit offenem Mund an. Ich bin überfordert von dieser Situation. Ich weiß nicht so recht, was ich genau empfinde, oder was ich darauf antworten soll.Mich malen? Bitte was?
Sie winkt dem Barkeeper zu und dreht sich zu mir. Sie scheint meine Mimik richtig zu deuten, denn sie schiebt die Unterlippe vor und sieht mich mitleidig an.
„Oh je, jetzt habe ich Sie erschreckt“, sagt sie. „Eigentlich bin ich ganz harmlos.“ Jetzt lacht sie wieder.
Das gilt es noch zu beweisen.
„Kommen Sie. Ich gebe einen aus.“ Sie wendet sich dem Barmann zu, der inzwischen vor ihr steht und bestellt: „Zweimal das, was sie hat.“ Gleichzeitig deutet sie mit dem Kopf auf mich. Das nehme ich zum Anlass, einen großen Schluck aus meinem Glas zu trinken.
Was für ein merkwürdiger Tag!
Gedanklich hänge ich immer noch an Ihrer ersten Aussage. „Was meinten Sie damit? Ich sehe aus, wie ein Klischee?“, frage ich stirnrunzelnd.
Erstaunt dreht sie sich zu mir, zuckt mit den Achseln und lächelt wieder. „Na ja, Sie wissen schon. Trauriger, nachdenklicher Mensch sitzt an der Bar und starrt in sein leeres Glas, als würde sich die Antwort auf all seine Fragen auf dessen Grund befinden“, erklärt sie in heiterem Ton. Dann hält sie sich eine Hand wie einen Trichter an den Mund, beugt sich vor und flüstert: „Funfact: Bisher hat noch niemand die Lösung auf nur ein einziges Problem auf dem Boden eines Glases gefunden.“ Mit einem weiteren Schulterzucken lehnt sie sich zurück.
Ich blicke wieder auf mein Getränk und stelle mir das Bild vor, das sie gesehen hat. Habe ich wirklich so ausgesehen? Ich bin froh, dass wir uns nicht kennen, andernfalls wäre mir diese Außenwirkung vermutlich unangenehm. Vielleicht bin ich auch zu erschöpft, um mich zu schämen. Oder sie ist nicht der Typ Mensch, vor dem man sich für irgendetwas schämt. Sie scheint durchgeknallt zu sein. Da sie davon sprach, die Szene zu malen, nehme ich an, sie ist Künstlerin. Das würde passen.
„Wer war es?“, fragt sie dann völlig unvermittelt und ich schrecke regelrecht aus den Gedanken hoch.
„Wer war was?“, frage ich verwirrt und sehe sie wieder an.
Sie macht eine unbestimmte Geste in meine Richtung und antwortet immer noch gut gelaunt: „Ich meine, wer hat Ihnen heute so dermaßen die Stimmung verhagelt?“
Unsere neuen Getränke werden gebracht und ich stürze den Rest von dem zweiten Gin in einem Zug herunter.
„Genau das meine ich“, lacht sie, nimmt ihr Glas und stößt es vorsichtig gegen meins. „Auf Verbesserung!“, verkündet sie mit Inbrunst und richtet sich dabei auf.
Diesmal muss ich leise lachen. Die Frau ist speziell, aber ich finde es gut, dass sie da ist. Auf ihre verrückte Weise scheint sie nett zu sein.
Allerdings ist sie hartnäckig. Denn sie sieht mich mit hochgezogenen Augenbrauen eindringlich an.
„Also?“, fragt sie, lässt mir aber gar nicht die Möglichkeit, zu antworten. „Ich bin Zoey McIntosh, 47 Jahre alt, aufgewachsen in San Diego, derzeit wohnhaft in Manhattan“, zählt sie in leierndem Ton auf und verdreht bei der Erwähnung von Manhattan die Augen.
Das macht sie mir direkt sympathischer. Die meisten Menschen, die ich in New York kennen gelernt habe, seit ich selbst dort lebe, sind stolz auf ihren Wohnort und einige sind fürchterliche Snobs. Aber an diese Gattung bin ich gewöhnt, daher fällt es mir nach den vielen Jahren nicht mehr so auf. Zoey rattert unterdessen weiter ihren Lebenslauf herunter. Wie ich vermutet habe, ist sie Künstlerin. Da sie keinen anderen Beruf erwähnt, frage ich mich, ob sie davon leben kann. Dann muss sie talentiert sein und sich einen Namen erarbeitet haben.
Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf ihren Monolog, der gerade zum Abschluss kommt. Sie senkt die Stimme und lehnt sich mir entgegen, als würde sie gleich ein Geheimnis verraten.
„Ich bin seit sechs Monaten geschieden und seit einem Monat schlafen wir wieder miteinander“, flüstert sie. Zum ersten Mal zeigt sie ihr ernstes Gesicht. „Das ist auch der Grund, warum ich hier bin“, sagt sie wieder in normaler Lautstärke und richtet sich auf. Dann verdreht sie die Augen. „Wir wollten uns hier treffen. Sein Flug wurde wegen eines Unwetters gestrichen. Jetzt sitze ich hier. Bestellt und nicht abgeholt, im buchstäblichen Sinn.“ Sie greift sich ihr Glas und trinkt es bis zur Hälfte aus. „Ich sollte nicht enttäuscht sein“, sagt sie schulterzuckend. Jetzt ist sie diejenige, die in ihr Getränk starrt. Aber sie fasst sich schnell wieder, setzt ihr Lächeln auf und richtet ihre Aufmerksamkeit zurück auf mich.
„So, jetzt du!“, ruft sie begeistert und deutet mit Ihrem Glas zu mir. „Jetzt, wo wir beste Freundinnen sind, kannst du mir deinen Namen verraten. Und auf wen wir sauer sind.“
Ich lache prustend los. Das hat sich gerade einfach zu sehr nach Highschool angehört. Mit der Hand vor dem Mund versuche ich, das Geräusch zu unterdrücken. Ist das der Alkohol? So laut habe ich seit Jahren nicht mehr gelacht. Aber es ist niemand hier, den es stören könnte, also entscheide ich, es laufen zu lassen. Zoey kichert ebenfalls kurz, setzt dann jedoch einen fragenden Blick auf.
„Ich bin Victoria, wohne auch in New York und wir sind sauer auf meine kürzlich verstorbene Mutter.“
„Ooooh“, macht sie gedehnt und schüttelt den Kopf. „Ich weiß nicht, ob das geht.“ Sie lehnt sich wieder zu mir und legt ihre Hand auf mein Knie.
Diese Frau hat offenbar keinerlei Berührungsängste. Inzwischen macht es mir komischerweise nichts mehr aus. „Also, die New York Sache finde ich natürlich super“, stellt sie klar, „aber auf tote Mütter böse sein, ist schwierig.“ Sie legt den Kopf schräg und erinnert mich dabei an einen Vogel.
„Ja, das ist es“, erwidere ich nachdenklich. Und es stimmt. Die ganze Geschichte kommt mir schwierig vor. Das ist ein treffendes Wort.
Zoey stößt mir freundschaftlich mit der Faust gegen die Schulter. „Na los, Kumpel, erzähl´s mir.“
Diese saloppe Art von ihr bringt mich erneut zum Lachen. Ich mag sie, und wir hätten wirklich die besten Freundinnen sein können, wenn wir uns auf der Highschool gekannt hätten. Aus diesem Grund berichte ich ihr von dem Brief.
„Du musst ihn lesen!“, konstatiert Zoey, dreht den Umschlag in ihren Händen und sieht ihn fast ehrfürchtig an. Das tut sie jetzt seit ungefähr zehn Minuten durchgehend. Sie hat das ‚Objekt des Aufruhrs‘ unbedingt sehen wollen, also habe ich ihn aus der Tasche gezogen und ihr gereicht. Das bereue ich inzwischen und beobachte regelrecht eifersüchtig, wie er sich zwischen ihren Fingern bewegt.
Ich will ihn zurück.
Kopfschüttelnd versuche ich, diese irren Gefühle loszuwerden. Das ist nur beschriebenes Papier.
Beschrieben von Graham.
Okay, das reicht! Ich greife nach dem Umschlag und pflücke ihn vorsichtig aus ihren Fingern.
„Ja, vielleicht mache ich das“, bestätige ich nickend, während das Objekt des Gesprächs wieder in meiner Tasche verschwindet.
„Wunderbar.“ Zoey springt mit Elan von ihrem Barhocker und schwankt leicht. „Ich werde jetzt zu Bett gehen, wie es sich in meinem Alter gehört“, kichert sie, „und morgen um neun sehen wir uns beim Frühstück und du erstattest Bericht, was drinsteht.“ Sie strahlt über das ganze Gesicht. Ihre Wangen sind leicht gerötet. So sieht sie richtig niedlich aus.
„Neun Uhr Frühstück passt.“, weiche ich aus und sie lässt mich damit durchkommen.
* * *
Als ich aus der Dusche steige, fällt mein Blick durch die offene Badezimmertür auf die Handtasche, die auf dem Bett liegt. Wie um mich zu verhöhnen, lugt eine Ecke des Umschlags aus der Öffnung hervor. Ich seufze laut auf.
Ja, natürlich will ich wissen, was in dem Brief steht. Ich will wissen, was Graham mir zu sagen hatte. Warum er zwei Jahre später plötzlich wieder auftauchte.
Ich werfe mir einen Bademantel über und setze mich neben die Tasche aufs Bett. Mit spitzen Fingern, als könnte er beißen, ziehe ich den Brief hervor und betrachte ihn zum gefühlt hundertsten Mal an diesem Tag.
‚Los jetzt, es wird dich schon nicht umbringen‘, höre ich Zoeys Stimme in meinem Kopf und muss lächeln.
Noch einmal tief durchatmend hole ich die beschriebene Seite aus dem Umschlag, falte sie auf, und fange an, zu lesen.
KapitelVier
25. September 1992
Liebe Vicky,
ich schreibe Dir diesen Brief aus dem Haus deiner Eltern (wobei ich anmerken möchte, dass die Bezeichnung „Haus“ in diesem Fall völlig fehl am Platz ist, aber das weißt du sicher selbst.)
Ich weiß gar nicht, warum ich in dieser Situation Witze mache. Vergiss den Anfang. Ich habe kein neues Blatt, um von vorn anzufangen. Scheiße. Ich sollte nicht scherzen, denn ich bin hier, weil ich mit Dir sprechen wollte. Dich um Verzeihung bitten. Dir sagen, wie sehr es mir leidtut. Ich habe zu schnell aufgegeben und es jeden Tag aufs Neue bereut.
Das klingt scheiße, das weiß ich, aber ich hätte an das denken sollen, was ich will, weil ich sicher bin, dass es auch das war, was du wolltest. UNS.
Ich vermisse Dich so schrecklich. Wir waren perfekt zusammen. Daran denke ich ständig. Und ich glaube, ich bin hier, weil ich sehen wollte, ob Du auch manchmal noch daran denkst. Tust Du es?
Es zerreißt mir das Herz, nicht zu wissen, wo Du jetzt bist und ob Du vielleicht noch an mich denkst.