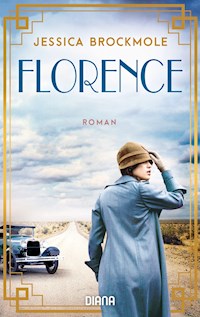
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Los Angeles, 1952. Louise Wilde hat das Vermögen von Florence Daniels geerbt, einer Drehbuchautorin, die sie kaum kannte. In Florences Haus findet sie alte Fotos von ihrer eigenen Mutter Ethel. Den Kopf voller Fragen macht Louise sich auf den Weg zu ihrem Vater ... Fast dreißig Jahre früher bricht Florence mit ihrem alten Modell T auf. Für einen Job fährt sie von New Jersey quer durch die USA nach Hollywood. Auf dem Beifahrersitz ist ihre beste Freundin Ethel. Sie muss dringend zu ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter: Ethel fürchtet, dass ihre Ehe zerbricht. Während Florence fürchtet, dass Ethel sie retten kann ... Werden die drei Frauen entdecken, dass nicht jede Reise einer genau gezeichneten Landkarte folgt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Nichts ist so viel Wert wie die Freiheit im Herzen
Los Angeles, 1952. Louise Wilde hat das Vermögen von Florence Daniels geerbt, einer Drehbuchautorin, die sie kaum kannte. In Florences Haus findet sie alte Fotos von ihrer eigenen Mutter Ethel. Den Kopf voller Fragen macht Louise sich auf den Weg zu ihrem Vater … Fast dreißig Jahre früher bricht Florence mit ihrem alten Modell T auf. Für einen Job fährt sie von New Jersey quer durch die USA nach Hollywood. Auf dem Beifahrersitz ist ihre beste Freundin Ethel. Sie muss dringend zu ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter: Ethel fürchtet, dass ihre Ehe zerbricht. Während Florence fürchtet, dass Ethel sie retten kann … Werden die drei Frauen entdecken, dass nicht jede Reise einer genau gezeichneten Landkarte folgt?
Zur Autorin
Jessica Brockmole hat seit jeher eine große Leidenschaft für historische Romane. Nach ihrem Debüt, dem internationalen Bestseller Eine Liebe über dem Meer, und Ein französischer Sommer ist Florence ihr drittes Buch. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern in Indiana, USA.
JESSICA BROCKMOLE
FLORENCE
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Uta Rupprecht
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 01/2019
Copyright © 2017 by Jessica Brockmole
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Woman Enters Left bei Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC, New York.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Nina Lieke
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
Umschlagmotiv: © Richard Jenkins; Rusya007, Oxy_gen, Toscanini, Ethan Quin/Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-21838-6V002
www.diana-verlag.de
Besuchen Sie uns auch auf www.herzenszeilen.de
Für Ellen und Owen,
die noch viele Reisen vor sich haben
KAPITEL 1
1952
Filme fangen oft mit einem Panoramablick an.
Eine Skyline. Ein Strand. Eine Wüste mit Kakteen. Paris, Rom, Honolulu, New York City.
Dieser Film beginnt in Los Angeles.
Im Jahr 1952 hat die Stadt eigentlich noch keine richtige Skyline. Niedrige Häuser breiten sich vor den Santa Monica Mountains aus. Ein paar davon erkennt man: den langweiligen Kasten des United Artists Theatre, das Eastern Columbia Building mit seiner türkis gekachelten Fassade. Einzig der Umriss des höchsten Gebäudes der Stadt, die City Hall mit ihrer goldenen Spitze, zeichnet sich deutlich vor den dunklen Bergen ab.
Wir zoomen näher. Ohne das Eröffnungspanorama könnte es sich um eine beliebige amerikanische Stadt Mitte Dezember handeln, mit Cafés, Hotels, Kinos und protzigen Bürogebäuden. Die Schaufenster dekoriert mit Flitter und Kunstschnee. Es könnte New York oder Chicago sein. Oder die Hintergrundkulisse eines Filmsets. Schöne Menschen eilen geschäftig durch die Straßen. Sie winken Taxis herbei, steigen aus Straßenbahnen, drängen sich an den Eingängen der Gebäude. Sie sind beladen mit Einkaufstüten und unhandlichen Paketen. Sie werfen Kleingeld in die roten Sammelbüchsen der Heilsarmee. Alle haben sie etwas vor, verfolgen ein bestimmtes Ziel. Geschäftsleute mit Filzhüten und gefalteten Zeitungen. Junge Frauen mit geschminkten Lippen und schmal geschnittenen Kleidern. Ältere Frauen mit Handtaschen, die in der Armbeuge baumeln. Es könnten beliebige Archivaufnahmen von städtischem Weihnachtstrubel sein.
Aber dann entdecken wir zwischen den Girlanden und Lichterketten Palmen und Sonnenschein. Wir sehen die Leuchtschriften der Kinopaläste – das Pantages, das Paramount, die unverwechselbaren Bauten des Egyptian und des Chinese Theatre. Wir erkennen das Knickerbocker Hotel und das Garden of Allah, die Türme des Shoppingcenters Crossroads of the World und diese neun riesigen weißen Buchstaben, die sich so hell vor den Hügeln abzeichnen, und wir wissen: Das sind keine Archivaufnahmen. Das ist Hollywood.
Eine Frau kommt ins Bild.
Sofort wissen wir, dass es sich um unsere Hauptdarstellerin handeln muss. Inmitten der ähnlich gekleideten Büroangestellten, der geschminkten Frauen fällt sie auf. Sie schwingt nicht die Hüften, lächelt den entgegenkommenden Männern nicht zu. Sie überprüft nicht unauffällig ihr Aussehen in den Schaufenstern. Hübsch ist sie nicht, wenn wir ehrlich sind, aber beeindruckend. Sie verfügt nicht über die üppige Schönheit einer Lana Turner oder einer Rita Hayworth, nicht über die Frische einer Doris Day. Aber ihre Art zu gehen, Augen geradeaus, Schultern zurück, strahlt eine Sicherheit aus, die unendlich viel attraktiver ist.
Sie ist gepflegt gekleidet, dunkelblaues Kostüm, gestärkte weiße Bluse. Der Rock weder zu lang noch zu kurz, die Jacke weiblich, aber nicht verspielt. Unter dem hochgestellten Kragen trägt sie einen schmalen narzissengelben Schal mit einem flachen, eckigen Knoten, der an eine Krawatte erinnert. Möglicherweise ist das beabsichtigt.
Sie könnte eine Abteilungsleiterin sein, die gerade aus einer Sitzung kommt. Oder eine Geschäftsfrau, die soeben einen lukrativen Vertrag abgeschlossen hat. Bei sich trägt sie eine Aktentasche aus weichem braunem Leder mit deutlichen Gebrauchsspuren an den Ecken. Ohne ihren Beruf zu kennen, wissen wir, sie ist eine Frau, die es gewöhnt ist, in einer Männerwelt zurechtzukommen.
Ihre Schritte sind entschlossen, kraftvoll, zuversichtlich – bis sie an eine Kreuzung kommt. Dort bleibt sie stehen und schaut in alle vier Richtungen. Unter einer Straßenlaterne, auf der ein dekorativer Weihnachtsbaum aus Metall befestigt ist, schließt sie kurz die Augen, als gleiche sie die beiden sich kreuzenden Straßen mit einem inneren Stadtplan ab. Dann nickt sie zufrieden und geht weiter.
Schließlich biegt sie von der Hauptstraße ab. Nun sind die Gehsteige weniger belebt, es ist eine Wohngegend, weiß verputzte Häuser mit roten Ziegeldächern. Keine Villen von Filmstars, von Produzenten mit dicken Zigarren, die auf einem dieser »Hier wohnen die Stars«-Pläne verzeichnet sind. An der Straßenfront reihen sich ruhige Mietshäuser an einfache Hotels.
Ein paar Querstraßen weiter bleibt sie vor einem leuchtend blau gestrichenen Gebäude stehen, das sich hinter einem schattigen grünen Innenhof verbirgt. Es ist ein Apartmenthaus, das in der Gegend der »Blaue Engel« genannt wird, obwohl die Dietrich hier nie gewohnt hat. Keine so berühmte Adresse wie das El Greco oder der Hollywood Tower, aber die Wohnungen stehen nie lange leer.
Sie stellt die Aktentasche auf dem Gehsteig vor dem Blauen Engel ab, öffnet ihre große Lederhandtasche und beginnt zu suchen. Ein Mann mit Einkaufstüte muss um sie herumgehen, genau wie eine Frau mit einem kleinen, wild kläffenden Hündchen. Der Mann wirft ihr über die Schulter hinweg einen aufmerksamen Blick zu, aber sie, vertieft in den Inhalt ihrer Handtasche, bemerkt es nicht. Endlich zieht sie ein spitzengesäumtes Taschentuch hervor und tupft sich damit die Stirn ab. Es ist nicht besonders warm. Vielleicht tupft sie sich Kopfschmerzen oder einen unangenehmen Tag weg. Dann faltet sie das feuchte Tuch wieder zusammen und schaut auf eine kleine goldene Armbanduhr. Es ist eine schmale, kupferrot glänzende Longines. Wie sie das Handgelenk zu sich dreht und in einer routinierten Bewegung den Ärmel zurückschüttelt, zeigt, dass sie eine Frau mit Terminen ist. Sie lässt das Taschentuch wieder in die Handtasche fallen, greift nach der abgeschabten Aktentasche und geht auf den Torbogen zu, der in den Innenhof führt.
Im Hof wachsen Laubbäume und üppige Bougainvilleen, ein farbenfroher, wild wuchernder Hintergrund für diese Frau in ihrem strengen Kostüm mit dem geknoteten Schal. Ein Mann in einer abgetragenen schwarzen Jacke blickt von einem Geranientopf auf.
»Louise Wilde«, sagt sie, ehe er fragen kann.
Der Mann in der Jacke wischt sich die Hände ab. Er mustert sie, scheint sie aber nicht zu erkennen.
Seit 1939 arbeitet sie als Filmschauspielerin. Zwei Dutzend Filme hat sie schon gedreht, fast zwei pro Jahr, um genau zu sein. Aber mit Sicherheit keine Filme, die er sich ansehen würde. Dieser alte Mann mit Erde unter den Fingernägeln mag keine seichten Streifen über Showgirls und ihre Romanzen. Die Betsey-Barnes-Serie, Stepptanz ins Glück, Heißblütige Rita oder dieser neue Film, der in der High Society spielt. Alle drehen sich um »ein Kleinstadtmädel, das von der großen Stadt träumt«, wie es das Studio gerne beschreibt, in jedem wird aus dem hässlichen Entchen ein hübscher Schwan, der am Ende einen Ehemann findet. Er hat keinen davon gesehen, das weiß sie genau.
Der Mann in der schwarzen Jacke wartet immer noch neben seiner Geranie.
»Ich bin mit Mr. French verabredet«, fügt sie hinzu.
Er tippt sich an den Kopf. »Diesem Rechtsanwalt? Er hat nicht gesagt, dass er ein Mädel erwartet.«
Sie umklammert die schwarze Handtasche fester.
»Na ja, er ist oben.« Der Mann stößt die Eingangstür auf und deutet auf eine Metalltreppe. »Nummer zwölf.«
Ohne Begleitung steigt Louise die Treppe hinauf. Der Mann hat sich schon wieder seiner Geranie zugewandt. Sie findet die Tür, auf der »12« steht, sie ist mit einem dürren Kranz geschmückt. Und natürlich ist sie blau.
Einen Moment lang bleibt sie vor dieser blau gestrichenen Tür stehen. Es war ein langer Tag, und sie wäre jetzt lieber in ihrem Bademantel zu Hause als hier. Den ganzen Vormittag hat sie im Studio verbracht und Einwände gegen das neue Drehbuch vorgebracht. Ohne jeden Erfolg. Sie haben genickt, gelächelt und ihr erklärt, sie solle einfach am Montag ans Set kommen. Und dann findet sie in ihrer Garderobe einen Stapel Nachrichten von einem Rechtsanwalt mit der Bitte, ihn im Blauen Engel aufzusuchen. Wie gerne hätte sie jetzt einen Manhattan.
Ehe sie sich entscheiden kann, ob sie anklopfen soll oder nicht, geht die Tür auf.
Mr. French sieht aus, wie ein Rechtsanwalt auszusehen hat, er trägt einen dreiteiligen Wollanzug und hat unnatürlich weiße Zähne. Sein Haar ist gefärbt und mit einer zentimeterdicken Schicht Frisiercreme überzogen. Er dürfte mindestens fünfzig, wenn nicht sechzig sein, darüber kann auch das unter die Augen gekleisterte Make-up nicht hinwegtäuschen. Er ist mehr Hollywood als sie selbst.
»Mrs. Wilde?«
Sie streckt den Rücken durch. »Miss.« Ihre Selbstsicherheit ist wieder da. »Miss Wilde.«
»Sie bekommt man ja nicht leicht zu fassen.« Er späht über ihre Schulter. »Ist Ihr Ehemann nicht mitgekommen?«
»Steht er denn auch im Testament?«
»Haha!« Mr. French schenkt ihr ein blitzendes Lächeln. »Natürlich nicht. Aber ich dachte …«
»Für meine Ehe mit ihm gab es viele Gründe. Seine juristische Sachkenntnis gehörte nicht dazu.« Sie stellt die Füße nebeneinander. »Wollen wir dann zum Geschäftlichen kommen?«
Einen Moment lang starrt er sie an, als wolle er herausfinden, ob das nun eine Beleidigung war oder nicht. »Natürlich. Ja. Wenn Sie bitte eintreten möchten?«
Die Wohnung ist klein und ordentlich, mit hellgelb gestrichenen Wänden und einem sauber gewischten Fliesenboden. Auf einem Eckregal steht ein kleiner, mit Lametta überladener Weihnachtsbaum, das einzige Zugeständnis an das bevorstehende Fest. Beim Eintreten streift sie sich die Handschuhe ab. »Das überrascht mich alles sehr. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich zu der Ehre komme, in Miss Daniels’ Testament erwähnt zu werden. Wie ich bereits am Telefon sagte, ich habe sie kaum gekannt.«
»Sind Sie sicher?« Mr. French schließt hinter Louise die Tür und geht zu einem winzigen Esstisch, auf dem ein Papierstapel und eine Lesebrille mit Horngestell liegen. »Ich dachte, sie wäre eine Freundin der Familie.«
Louise ist in Newark, New Jersey, bei ihrem verwitweten Vater aufgewachsen, mit dem sie viel zu oft Schach spielen musste. Außer Onkel Hank, einem fast glatzköpfigen Mann mit ständig fleckiger Krawatte, der zusammen mit ihrem Vater die Metzgerei führt, kam nie jemand zu Besuch. Fast jeden Sonntag erschien Onkel Hank zum Abendessen und brachte stets einen Kuchen mit Meringehaube mit. Er war der Einzige. Andere Freunde oder Freundinnen der Familie gab es nicht, und ganz bestimmt niemand so Aufregenden wie eine Drehbuchautorin aus Hollywood.
»Ich habe sie erst kennengelernt, als ich hierher gezogen bin.« Louise legt ihre weißen Handschuhe und die Handtasche auf den Tisch. Die Aktentasche verstaut sie unter dem Stuhl. »Aber so richtig gekannt habe ich sie nicht. Wir sind uns lediglich auf ein paar Partys begegnet. Einmal beim Essen im Brown Derby. Und in den Gängen von MGM haben wir uns ein paarmal gegrüßt. Ich wusste bis heute nicht einmal, dass sie im Blauen Engel wohnt.«
Er hat drei Pappbecher mit Kaffee besorgt. Offensichtlich hat er tatsächlich damit gerechnet, dass Arnie mitkommt. Und das ist auch nicht verwunderlich. Movieland hat sie einmal »die überschäumende Muse des Genies Arnold Bates« genannt, und Modern Screen meinte, sie bringe »Schwung und Glanz« in seine Drehbücher. Als wäre sie lediglich eine hübsche, lustige Dreingabe zu Arnolds solider Arbeit. Als wären ihre Karrieren durch das Eheversprechen unweigerlich miteinander verknüpft. Wenn die Scheinwerfer ausgeschaltet sind, ist sie nie überschäumend, aber das kann Mr. French nicht wissen. Denn wenn man den Hollywoodgazetten nicht glauben kann, wem dann?
Einer der Becher ist halb leer, die anderen beiden sind mit Pappdeckeln verschlossen. Sie fragt sich, wie er sie alle drei vom Diner weiter unten an der Straße sicher bis in die Wohnung gebracht hat. Er macht beide Becher auf, um den mit der Milch zu finden, der eindeutig für sie vorgesehen ist. Aus einer verknoteten Serviette will er noch zwei Stück Zucker holen, doch sie erspart ihm die Mühe und greift nach dem anderen Becher.
Verwundert zieht er die dichten Augenbrauen hoch. »Sie trinken ihn schwarz?«
Der Kaffee ist lauwarm und bitter, aber sie gibt nicht nach. »Wer tut das nicht?«
Sie setzt sich und legt einen Fuß über den anderen. Das ist die Haltung, die diese Szene verlangt. Der Hauptdarsteller, mit seinen wichtigen Papieren und den Neuigkeiten, steht im Zentrum. Die Hauptdarstellerin – sie lässt sich zusammensinken, schlägt die Beine übereinander, senkt die Schultern, blickt hinab auf ihre Finger, die den Pappbecher umfassen. Der Kaffee schmeckt scheußlich, aber wenigstens hat sie etwas zum Festhalten.
Mr. French spielt den Helden sehr gut. Das ist bei seinem kunstvoll gelegten Haar auch nicht anders zu erwarten. »Wie ich bereits am Telefon sagte, bin ich Florence Daniels’ Testamentsvollstrecker. Sie werden im Testament erwähnt.«
Louise war die Todesanzeige in der Zeitung nicht aufgefallen, aber nach Mr. Frenchs Anruf hatte sie sie herausgesucht. Sie war kurz und knapp.
DANIELS, Florence verstarb am 13. Dezember 1952 im Mount Sinai Hospital. Sie kam am 12. Juni 1898 in Orange, New Jersey, zur Welt. Statt Blumen wird um Spenden an die Screen Writers Guild gebeten. Gottesdienste finden statt in der Blessed Sacrament Church am Sunset Boulevard.
»Darf ich fragen, woran Miss Daniels gestorben ist?«
»Es war Krebs, glaube ich.« Er klappt seine Lesebrille auf. »Als sie den Termin für ihr Testament machte, sagte sie, das sei das zweite Mal, dass der nahe Tod auf ihrem Terminplan stehe, und vielleicht werde sie es dieses Mal einfach durchziehen.«
Unwillkürlich entschlüpft Louise ein halbes Lachen. Mr. French sieht angemessen schockiert aus. Sie schäumt nicht über? Von wegen.
»Sie hat das Testament persönlich geschrieben. Gegen Ende konnte sie nicht mehr viel tun, aber es stammt aus ihrer eigenen Hand.« Er schiebt sich die Brille auf die Nase. »Ich, Florence Jane Daniels, verfasse im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und meines mehr oder weniger vollständigen Körpers (von einem völlig überflüssigen Blinddarm und zwölf Zähnen mal abgesehen) meinen letzten Willen, mein Testament, die letzte Szene im Drehbuch meines Lebens.«
Dieses Testament ist besser als die meisten Drehbücher, die Louise vorgelegt bekommt. »Auch wenn ich sie nicht gut gekannt habe – ihr Sinn für Humor war berühmt«, sagt sie.
Mr. French legt das Blatt auf den Tisch. »Ich habe Sie in Miss Daniels’ Wohnung gebeten anstatt in mein Büro, weil … Nun ja, Sie werden nicht nur einfach in dem Testament erwähnt, Sie sind die Alleinerbin von Florence Daniels.«
Louise schüttet sich einen Schwall lauwarmen Kaffees über den Handrücken.
Er springt rechtzeitig auf, um das Testament in Sicherheit zu bringen, aber der Kaffee fließt über den Tisch zu ihren weißen Handschuhen. Während er in der Küche etwas zum Aufwischen sucht, spricht er weiter. »Ich habe die gerichtliche Testamentseröffnung bereits eingeleitet. Aber es wird keinen Einspruch geben. Das bedeutet …«
»Ich weiß, was das bedeutet.«
»Natürlich.« Mit einer Handvoll Papierservietten kommt er zurück ins Zimmer und reicht sie ihr. »Wie ich schon sagte, das Testament wird nicht angefochten werden. Sie hatte keine lebenden Eltern oder Geschwister und, wie Sie wissen, keinen Ehemann und keine Kinder. Dafür hatte sie bei all der Filmerei vermutlich keine Zeit.«
Louise tupft ihre Hand, den Tisch und die durchweichten Handschuhe ab. Noch immer versucht sie zu begreifen, was Mr. French ihr eröffnet hat. Eine Frau, die sie bewunderte, ohne je mehr als zwei Dutzend Worte mit ihr gewechselt zu haben, hinterlässt ihr ihren gesamten Besitz.
»Es sind nur noch ein paar Dinge zu verteilen, dann gehört Ihnen der Rest der Habe. Die Wohnung hier und alles, was sich darin befindet, ihre Ersparnisse und ein Schwinn-Fahrrad, das im Schuppen des Gärtners steht.« Er nimmt einen Schluck Kaffee, kratzt sich am Kinn und greift wieder nach dem Testament. »Dem Hollywood Studio Club hat sie einen Tausender hinterlassen, und jeweils hundert Dollar gehen an die Blessed Sacrament Church, die Entertainment Industry Foundation, die Los Angeles Public Library und den Besitzer von Chen’s Dragon Café. Sechsundzwanzig Jahrgänge der Variety bekommt ein gewisser Howard Frink. Sie hat außerdem drei Dollar und …« Er kneift die Augen zusammen und rückt die Brille zurecht. »Drei Dollar und einen orangefarbenen Sombrero Miss Anita Loos hinterlassen, ›als Dank für diese Rumba‹.«
»Miss Loos bin ich schon einmal vorgestellt worden. Ich glaube, das war, als sie gerade an When Ladies Meet gearbeitet hat.« Sie nimmt noch einen Schluck von dem Kaffee in ihrem Becher und verzieht das Gesicht.
»Ist der Kaffee so schlecht?«, fragt er.
Das ist er, aber sie will nicht unhöflich sein. »Das ist nicht der Grund. Es ist nur alles so seltsam.«
Mit einer Hand nimmt Mr. French seine Brille ab und reibt sich mit der anderen den Nasenrücken. »Auch wenn Sie Miss Daniels kaum kannten, sie scheint Sie durchaus gekannt zu haben und hat offenbar viel von Ihnen gehalten. Howard Frink war siebzehn Jahre lang ihr Nachbar, und alles, was er bekommt, ist ein Haufen alter Zeitungen.«
Als sie wieder nach ihrem Kaffeebecher greift, sieht sie, dass er einen kreisförmigen Fleck auf dem Tisch hinterlassen hat. Auch wenn der Tisch jetzt, technisch gesehen, ihr gehört, fühlt sie sich doch schuldig. Während sich Mr. French wieder seinem Papierstapel zuwendet, verreibt sie den Fleck mit dem Daumen.
»Ich glaube, ich habe vor Kurzem etwas über Ihren Gatten gelesen.«
Hoffentlich meint er nicht diesen Artikel im American Legion Magazine über Drehbuchautoren in Hollywood und ihre »roten« Neigungen. Mr. French scheint ihr genau der Typ für die American Legion zu sein.
»Es muss irgendetwas über Korea gewesen sein.« Sie zwingt sich zu einem Lächeln. »Er ist gerade heimgekommen, wissen Sie.«
»Das muss es gewesen sein.« Er spricht, ohne sein Lesen und Paraphieren zu unterbrechen. »Na, bestimmt ist er froh, wieder hier zu sein. Das Essen zu Hause ist mit Sicherheit um Längen besser als der Fraß in der Army. Oder war er in der Navy?«
»Weder noch. Er ist als Journalist gefahren.«
»Tatsächlich? Na, das hört sich besser an als das ewige Marschieren durch den Dschungel. Als ich auf den Philippinen war, habe ich die ganze Zeit von den Sahnetorten meiner Frau geträumt. Backen Sie?«
»Selten.«
Jetzt blickt er auf und zwinkert ihr zu. »Dann wäre jetzt vielleicht ein passender Moment, um damit anzufangen.«
Sie weiß nicht, was sie darauf antworten soll, daher behält sie das Lächeln einfach bei.
»Ich muss die Dinge sichten, die nicht hierbleiben.« Er sieht sich im Zimmer um. »Und ich muss einen orangefarbenen Sombrero finden.«
»Ich kann Ihnen beim Suchen helfen.«
In Wahrheit möchte sie sich umschauen, das Leben sehen, das sie geerbt hat.
Er nickt, offenbar ist er erleichtert.
Sie bringt den Kaffeebecher in die enge Küche und leert ihn ins Spülbecken. Ein einsamer Stieltopf liegt umgekehrt auf einem Geschirrtuch. Nach dieser Kombüse zu urteilen, hat Miss Daniels von Salzgebäck, Erdnussbutter, Rosinen und unendlich vielen Dosen Tomatensuppe gelebt. Ein ganzes Regalbrett enthält nichts anderes als rot-weiße Campbell-Dosen. Der Kühlschrank bietet nicht viel mehr – Mineralwasser, ein halbes Glas Silberzwiebeln und ein in Papier gewickeltes Stück Schokoladenkuchen, von dem der Zuckerguss abgekratzt wurde.
Vielleicht hat Miss Daniels sich wirklich so ernährt. Eine klassische Hollywooddiät, wie von den Frauenzeitschriften empfohlen. Louise kann das gut verstehen, sie hält sich seit fünfzehn Jahren daran. Geschlagenes Eigelb zum Frühstück, zum Mittagessen einen Schlag Thunfischsalat, angerichtet auf einem einzelnen grünen Salatblatt, und am Abend Kalbfleisch.
Oder Miss Daniels hatte einfach keine Lust zu kochen. In den Schränken findet Louise nichts außer Salz und Pfeffer, was nicht gerade für gehobene Kochkunst spricht. Die Kochbuchbibliothek beschränkt sich auf ein maschinengeschriebenes Rezept für Hühnerkroketten, das an der Innenseite einer Schranktür befestigt ist.
Das Wohnzimmer wurde wohl häufiger benutzt als die Küche. Nahe der Tür befindet sich der kleine Esstisch mit zwei Stühlen, den die Papiere des Rechtsanwalts fast vollständig bedecken. Ein niedriges Sofa voller Samtkissen steht gegenüber einer Reihe von Bücherregalen und einem gerahmten Plakat von Dämon Weib. Louise fragt sich, ob das ein Lieblingsfilm von Miss Daniels war oder ob sie daran mitgearbeitet hat. Schließlich begann ihre Karriere in den Zwanzigerjahren, in denen sie sich vom Skriptgirl bis zur Drehbuchautorin hocharbeitete.
Über dem Sofa hängt ein kleines Gemälde in Orange, Blau und Moosgrün. Vor einem Pueblo sitzen zwei Frauen, eine kämmt der anderen die Haare. Es ist ein stilles kleines Aquarell, nichts Besonderes. Auf dem Papier kann man noch die feinen Striche der Vorzeichnung erkennen. Doch irgendwie passt es zu dieser unprätentiösen Wohnung.
Ein kleiner, auffällig unordentlicher Schreibtisch klemmt in der Ecke am Fenster. Beherrscht wird er von einer Underwood-Champion-Schreibmaschine, um die mehrere Stapel weißes Papier verteilt sind. Auf den Blättern stehen hier und da gerahmte Fotos. In der Wohnung gibt es weder einen Fernseher noch einen Radioapparat, dafür einen alten Kurbelplattenspieler und einen bescheidenen Stapel Schallplatten. Hauptsächlich alter Jazz, Bessie Smith und Ethel Waters.
Mit dem Zeigefinger fährt Louise an den Reihen der Bücher entlang. Wenige Romane, auch wenn Miss Daniels alles von Elinor Glyn und Radclyffe Hall zu besitzen scheint. Mit dem Titelbild nach vorne lehnt eine nagelneue Ausgabe von Salz und sein Preis von Patricia Highsmith im Regal, irgendwo in der Mitte steckt ein Lesezeichen.
Den meisten Platz nehmen natürlich schwarz gebundene Drehbücher ein. Eins nach dem anderen zieht Louise die Manuskripte aus den Fächern und blättert darin. Einige kennt sie. Das da, Miss Daniels Adaption von Halls Roman Miss Ogilvy finds herself. Mit diesem Film hat sie zum ersten Mal Aufsehen erregt. Und ihre Drehbücher zu Im Sturm und So ist die Liebe. Louise erinnert sich, dass sie Im Sturm als Mädchen an einem verregneten Nachmittag gesehen hat und sich danach leidenschaftlich schwor, eines Tages selbst zu einem solchen Abenteuer aufzubrechen. Ihr eigenes Abenteuer hatte sie zwar nicht nach Afrika geführt, aber Hollywood war für eine Achtzehnjährige mit gerade mal dreißig Dollar in der Tasche und sehr viel mehr Entschlossenheit schon weit genug.
Von anderen Manuskripten im Regal hat sie noch nie etwas gehört. Florence Daniels war bekannt für ihre Adaptionen von Frauenromanen, der Art von Filmen, bei denen George Cukor oder Edmund Goulding Regie führten und die Frauen zuhauf in die Kinos lockten. Aber nicht alle dieser Manuskripte stammen von ihren bekannten Adaptionen.
Louise schlägt Originaldrehbücher auf, unbekannte, unveröffentlichte, nie produzierte Drehbücher. Sie überfliegt die Titelseiten, blättert darin. Die Seiten sind sehr weiß – offenbar hat sie noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Keine braunen Ringe von Kaffeetassen, keine schwarzen Fingerabdrücke. Diese Manuskripte wurden nie an die Studios geschickt.
Es sind Geschichten über Frauen, starke und erfolgreiche Frauen, die in einer sie zu vergessen entschlossenen Welt ihre Spuren hinterlassen. Frauen, die sich nicht so sehr von Louise und Florence Daniels unterscheiden. Eine handelt von einer Schauspielerin, die während einer nicht sehr befriedigenden Ehe weiterarbeitet, eine andere von einer jungen Mutter, die sich an eine schon fast vergessene Leidenschaft aus ihrer Jugend klammert, eine dritte von zwei Freundinnen, die langsam an einer Radiumvergiftung sterben und dennoch ihr Leben leben. Es sind genau die Geschichten, die Louise im Kino gerne sehen würde. Sie überlegt bereits, wer in diesen Filmen mitspielen könnte, stellt sich die einzelnen Szenen, die Gesten, die Wendepunkte, die Kameraeinstellungen vor. In dieser Rolle sieht sie Gene Tierney. Vielleicht auch Constance Bennett. In der da die zarte und kraftvolle Pier Angeli. Und diese hier, findet sie, könne man einzig und allein mit Lauren Bacall besetzen.
Die Blätter auf dem Schreibtisch enthalten Skizzen für weitere Drehbücher, Ideen, die auf die Ausarbeitung einer Geschichte warten. Sie wühlt in den Papieren, aber dann wecken die gerahmten Fotos ihre Aufmerksamkeit. Miss Daniels auf einer Premiere neben Anderson Lawler. Auf einer Kostümparty mit Sonya Levien, beide als biblische Königinnen in herrschaftlichen Gewändern. Mit anderen Leuten am Pool von George Cukors Villa, in weiten geblümten Hosen und einem Sonnenhut. Miss Daniels war eine attraktive Frau.
Aber auf einem der Fotos sind keine Hollywoodberühmtheiten zu sehen, und auch nicht Florence Daniels selbst. Es ist etwas älter als die anderen und ein bisschen unscharf, wie mit einer alten, billigen Brownie aufgenommen. Der Schnappschuss zeigt eine junge Frau, die in die Sonne blinzelt, neben einem Felsen in der Wüste. Dunkles, kinnlanges Haar schaut hervor unter einem Schal, den sie um den Kopf geschlungen hat. Sie ist blass, weil ihr die Sonne direkt ins Gesicht scheint, weil der Film schlecht entwickelt wurde oder weil die Reise anstrengend war, aber sie lächelt. Was auch immer das für ein Felsen sein mag, was für eine Wüste, sie freut sich, dort zu sein.
Louise erkennt die Frau, obwohl sie nicht berühmt ist. Sie kennt sie von einem anderen Foto, einem steifen Studioporträt, das sie sehr oft betrachtet hat. Kein Wunder, denn das Bild von einem Paar in bescheidenen Hochzeitsgewändern stand in den letzten zweiunddreißig Jahren auf dem Klavier ihres Vaters.
Tausend verschiedene Gedanken schießen ihr durch den Kopf, vor allem aber verspürt sie ein Gefühl der Erleichterung. Das ist die Verbindung. Florence Daniels kannte ihre Mutter.
Vielleicht ist das gar nicht so überraschend. Dad hat immer erzählt, dass Mom nach Kalifornien unterwegs war. Dass sie den weiten Weg durch das ganze Land zurückgelegt hatte, nur um irgendwo zwischen zu Hause und Kalifornien zu sterben. Vielleicht war sie doch bis nach Los Angeles gekommen. Vielleicht hatte sie in den letzten Tagen ihres Lebens eine junge Drehbuchautorin kennengelernt.
Sobald Louise die Schreibtischschublade aufzieht, weiß sie, dass es nicht so war. Darin liegt ein großer, schwerer Umschlag, in dem sich weitere Fotos befinden.
Sie verteilt die Bilder vor sich auf der Schreibmaschine und den Manuskriptstapeln. Ihre Mutter, die in ihrer Erinnerung immer jung sein wird, ist darauf zu sehen, aber auch eine junge Florence Daniels. Arm in Arm posieren die beiden Frauen vor Bäumen, Bergen, Seen und einem alten Ford Model T, es sind Schnappschüsse von einem Abenteuer, das vor sehr langer Zeit stattgefunden hat. Auch ohne die verschmierten Beschriftungen auf den Rückseiten zu lesen, weiß Louise, dass die Fotos ihre Mutter auf ihrer letzten Reise zeigen.
Die beiden Gegenstände, die zuletzt aus dem Umschlag fallen, bestätigen das.
Der erste ist ein liniertes Heft, wie es Schulmädchen für Aufsätze verwenden. Es ist mit Bleistift vollgeschrieben, manchmal sauber und fließend, manchmal verkrampft und voller Emotionen. Ein notdürftiges Reisetagebuch aus dem Jahr 1926. Sie blättert es durch, um herauszufinden, wann es endet. Die Tagebucheinträge nehmen etwa ein Drittel des Heftes ein, das zweite Drittel enthält ein skizziertes Drehbuch. Der Titel lautet Als sie König war, genau wie bei einem der Drehbücher auf dem Regal. Und ganz hinten im Heft, nach Dutzenden leerer Seiten, steht eine einzige, einsame Zeile: »Als ich deine Hand hielt, hatte ich plötzlich nicht mehr so viel Angst.«
Der zweite Gegenstand ist ein Büchlein mit Pappumschlag, ein Werbegeschenk. Ein kleines Haushaltsbuch mit dem Aufdruck »Feldman-Apotheke – Wir verkaufen Vitamin-A-Milch«. Es hat vorgedruckte Seiten, damit man den Überblick über die wöchentlichen Ausgaben behält, und eine Jahresübersicht. In den Tabellen stehen tatsächlich Dinge, die den Haushalt betreffen: Lebensmitteleinkäufe, sonstige Ausgaben, Ideen für Mahlzeiten, alles in winzigen Druckbuchstaben. Auf manchen Seiten finden sich in den Ecken kleine Strichzeichnungen, Bäume und Autos, das Gesicht eines kleinen Mädchens, Windmühlen und Kakteen.
Beim Weiterblättern entdeckt Louise noch mehr als Listen und Pläne. Da gibt es private Bemerkungen, die an die Grenzen des knappen Formats eines Haushaltsbuches gehen oder es gar sprengen. Manchmal nur ein paar Worte, ein kurzer Absatz, aber sie erlauben einen Blick auf die Frau hinter der Hausfrau.
Die Einkaufslisten, die Alltagsnotizen zu Tomatendosen oder Brathühnchen sind in der gleichen Schrift geschrieben wie Louises Geburtsdatum vorne in der Familienbibel. Unerwartet treten ihr Tränen in die Augen.
»Ist alles in Ordnung mit Ihnen?« Einen orangefarbenen Sombrero in der Hand, kommt Mr. French aus dem Schlafzimmer.
Louise blinzelt und sammelt schnell die Fotos ein. Sie hat ganz vergessen, dass sie nicht allein in der Wohnung ist. Eine Schauspielerin steht immer vor der Kamera. »Ja.« Sie schüttelt den Kopf, um den Nebel daraus zu vertreiben. »Und Sie haben fast alles gefunden?«
»Ja, auch diese Jahrgänge von Variety habe ich entdeckt. Ich gehe mal schnell zum Hausmeister und bitte um ein paar Kartons.«
»Sehr gut.« Sie dreht den Umschlag um, weil sie die Fotos hineingleiten lassen will. Es ist ihr vorhin nicht aufgefallen, aber der Umschlag ist an sie adressiert, in den gleichen kleinen Tintenbuchstaben. Adressiert, aber nie abgeschickt. »Für A.L., die noch viele Reisen vor sich hat«, steht auf der nicht zugeklebten Klappe.
Abgesehen von dem Hochzeitsfoto und ihrem frühen Tod weiß Louise fast nichts von ihrer Mutter. Dieser Umschlag mit den Fotos und dem improvisierten Tagebuch, versteckt in der Wohnung einer Fremden, enthält mehr über das Leben ihrer Mutter, als sie jemals erfahren hat.
Während sie darauf wartet, dass Mr. French zurückkehrt, gießt sie sich ein Glas Mineralwasser ein, Gin findet sie nicht. Mit dem Glas in der Hand setzt sie sich an den Tisch und öffnet ihre Aktentasche, zieht mit zwei Fingern das Drehbuch heraus. Die Prinzessin vom Las Vegas Boulevard. Vorhin bei der Sitzung hat sie es nur angeblättert. Es war so kitschig und pubertär, dass sie eigentlich ein paillettenbesetztes Titelblatt erwartet hätte. Sie blättert weiter und wünscht, sie hätte es nicht getan. Nichts als gekünstelte Dialoge.
Sie legt das Drehbuch neben das Glas, steht auf und geht zurück zum Regal.
Was würde sie darum geben, bei einem dieser Drehbücher eine Hauptrolle zu bekommen. In einem Film über kluge, mutige, tatkräftige Frauen, die mehr tun dürfen, als zu erröten und den männlichen Helden anzuseufzen. Ihre Sehnsucht nach einer derartigen Rolle ist so stark, dass sie die Süße fast auf der Zunge schmecken kann. Angezogen von dem Titel Als sie König war, nimmt Louise das Drehbuch vom Regal. Ihr gefällt das Paradoxe des Titels und die Tatsache, dass das Wort »Prinzessin« darin nicht vorkommt.
Es fesselt sie sofort.
Klar und knapp, mit amüsanten Dialogen. Die Figuren so lebendig, dass man ihnen fast die Hand schütteln kann. Soweit sie es beim Überfliegen mitbekommt, geht es um zwei Frauen, die auf einer Fahrt durch das ganze Land ihre Freundschaft wiederbeleben. Campingplätze, Kartenspiele und ein unverwüstlicher Ford Model T. Tränen, Reue und geheimes Verlangen. Sie hätte gerne gewusst, ob das Vorbild dafür die letzte Reise ihrer Mutter war. Vielleicht hatte Florence Daniels deshalb auf den letzten Seiten ihres Reisetagebuchs daran zu schreiben begonnen.
Von draußen hört sie Mr. Frenchs Stimme und schiebt das Drehbuch schnell in ihre leere Aktentasche. Dann nimmt sie ein weiteres Buch vom Regal und noch eines, bis ihre Tasche voll ist.
Diese wenigen Seiten von Als sie König war haben in ihr heftigen Trotz wachgerufen. Zwei Frauen, die durchs Land fahren, so entschlossen wie Louise, als sie vor so vielen Jahren nach Hollywood ging. Bis zu diesem Moment hatte sie fast vergessen, wie stur sie damals war. »Genau wie deine Mutter«, hat ihr Vater immer gesagt. Sich auf solch eine Reise zu begeben, mit nichts als einem Ford Model T zwischen einem selbst und den ungepflasterten Straßen der Vereinigten Staaten, dazu gehört einiges.
Mr. French kommt mit einem Karton in der Hand zurück, und Louise schließt ihre Aktentasche. Auch wenn das alles jetzt ihr gehört, darf sie bestimmt noch nichts mitnehmen; Rechtsanwälte leben von Bürokratie und Formularen. Sie weiß nicht einmal genau, warum sie eine Aktentasche voller Drehbücher aus der Wohnung schmuggeln will. Vielleicht, weil die Lektüre sie an ihre Mutter und deren Mut erinnert. Und weil sie sich wünscht, selbst ebenfalls so mutig zu sein, im Drehbuch und im wirklichen Leben.
Sie greift nach ihren kaffeefleckigen Handschuhen und der Handtasche, verabschiedet sich von Mr. French mit den üblichen Höflichkeiten und hofft, dass ihm die Lücke im Regal nicht auffällt. Er bemerkt sie nicht.
Erst als sie draußen auf dem Bürgersteig steht, fällt ihr ein, dass sie den Umschlag mit den beiden Tagebüchern auf dem Schreibtisch liegen gelassen hat.
KAPITEL 2
1952
Es hat zu regnen begonnen.
Louise nimmt ein Taxi. Mit ihrer vollgestopften Aktentasche fühlt sie sich beinahe so, als wollte sie verreisen. Der Taxifahrer erkundigt sich sogar, ob sie zum Flughafen möchte. Sie legt die Tasche neben sich auf den Sitz, wischt sich die Regentropfen von den Ärmeln ihres Jacketts und nennt ihm eine Adresse am Rodeo Drive.
In der Stadt gehen bereits die Lichter an. Der Hollywood Boulevard ist ein Meer aus Neonschriften und Weihnachtsbeleuchtung. An jedem Laternenmast hängt ein Metallbaum mit farbigen Lichtern. Quer über die Straße sind Girlanden mit Glocken, Adventskränzen und hell leuchtenden Sternen gespannt. Louise lehnt ihren Kopf gegen das Fenster.
Die Menschen, die unter Regenschirmen nach Hause eilen, werden weniger, als das Taxi in den Rodeo Drive einbiegt. Statt der strahlenden, glitzernden Kinopaläste leuchten hier gelbe Verandalampen. Schnee aus weißem Filz und Lichterketten zieren die Dachkanten. Sie liebt den Rodeo Drive mit seinen ruhigen Bungalows und dem alten Saumpfad, der in der Mitte der Straße immer noch sichtbar ist. In den Vierecken der erleuchteten Fenster stehen Frauen mit Schürzen in Einbauküchen, Kinder beugen sich über Hausaufgaben und Männer gießen sich Whiskey ein.
»Sie kommen zu spät zum Abendessen, stimmt’s?«, bemerkt der Taxifahrer, und einen Moment lang wünschte Louise, sie könnte ihm eine andere Adresse nennen. Könnte auf eines dieser warm erleuchteten Häuser deuten, und wenn sie hineinginge, bekäme sie Kotelett oder Eintopf serviert oder was sonst gerade auf dem Herd steht.
Aber sie antwortet nicht. Der weiß gestrichene Bungalow, vor dem sie anhalten, ist dunkel. Keine Lichterketten. Kein glitzernder Weihnachtsbaum im Fenster. Früher wuchsen Nachtkerzen und hellgelbe Pelargonien im Vorgarten. Selbst in der Dämmerung sieht man, dass die Veranda gestrichen werden müsste. Der Taxifahrer dreht sich zu ihr um und will noch eine Bemerkung machen, doch Louise gibt ihm schnell sein Geld und steigt aus.
Es ist still im Haus. Sie legt die Aktentasche auf den Teppich an der Eingangstür und steigt aus ihren hohen Schuhen. Auf Strümpfen geht sie in die Küche und lässt dabei Regentropfen wie Brotkrumen hinter sich fallen. Sie löst die Hutnadeln aus ihrem weißen Hut – das nasse Leinen ist völlig durchweicht – und wirft ihn zusammen mit der Handtasche und dem dunkelblauen Jackett auf einen Küchenstuhl. Ihre Arme sind mit Gänsehaut überzogen. Erst jetzt schaltet sie das Küchenlicht ein.
Der Raum sieht so aus, wie sie ihn am Morgen verlassen hat. Die nassen Vorhänge schlagen gegen das offene Fenster, ihre Schüssel vom Frühstück steht noch auf der Theke, auch sie nass vom Regen. Auf dem Herd steht ein kleiner Topf mit geronnenem Fertiggrießbrei. Louise stößt einen leisen Fluch aus, einen dieser verlegenen Flüche, die ihr Vater immer vor sich hingemurmelt hat. Dann leert sie den Brei in den Abfalleimer und stellt den Topf zum Einweichen ins Spülbecken. Als sie sich über die Spüle beugt, um das Fenster zu schließen, fällt ihr geknoteter Schal in den Strahl des Wasserhahns. Sie tritt zurück, wischt sich die Tropfen von der Bluse und bemerkt ein rotes Lämpchen. Der Kaffeeperkolator ist noch immer eingesteckt. Sie zieht das Kabel heraus und verbrennt sich die Hand an der heißen Kanne. Mit einem Geschirrtuch hebt sie den Deckel an, der Kaffee hat sich in Schlamm verwandelt. Auf einmal würde sie am liebsten heulen.
»Wo bist du gewesen?«
Louise dreht sich nicht um, sondern schüttet den abgestandenen Kaffee ins Spülbecken. »Das könnte ich dich auch fragen.« Während sie den Hahn hin und her bewegt, sieht sie zu, wie der Kaffee im Abfluss verschwindet. »Warum hast du das Licht nicht eingeschaltet?«
»Ich habe nicht gemerkt, dass es schon dunkel ist.«
Sie hofft, der Grund dafür ist, dass er geschrieben oder getippt oder wenigstens Zeitung gelesen hat.
»Hast du Hunger?«, fragt sie, dreht den Hahn zu und greift nach dem Geschirrtuch. »Ich wollte gerade …«
Aber nun hat sie sich umgedreht und sieht Arnie im Türrahmen. Um sechs Uhr abends ist er noch im Schlafanzug.
»Hast du dich heute überhaupt nicht angezogen?« Sie wirft das Geschirrtuch auf die Arbeitsfläche. »Du hast dein Frühstück nicht gegessen, hast das Fenster offen gelassen, hast dich nicht mal angezogen.«
Er antwortet nicht, wendet lediglich den Blick ab.
Louise hat den Tag damit verbracht, sich mit Männern auseinanderzusetzen, die sie »Süße« nennen und ihr eine tolle Rolle mit Bikini und Ukulele versprechen. Und was hat Arnie währenddessen gemacht? Sein Schlafanzugoberteil hat braune Flecken. »Offensichtlich hast du es wenigstens kurz aus dem Bett geschafft, um dir einen Kaffee zu holen.«
Für einen Moment glaubt sie, in seinen Augen einen Funken Verletzung aufblitzen zu sehen. Einen Funken Wut. Aber sofort ist seine Miene wieder ausdruckslos. Als er sich ins Schlafzimmer zurückzieht, sinkt Louise an der Spüle in sich zusammen.
Sie hätte das nicht sagen sollen. Das weiß sie doch genau.
Am Tag vor Arnies Rückkehr hat ihre Nachbarin Pauline einen Hackbraten vorbeigebracht. Pauline ist mit einem nicht sonderlich erfolgreichen Schauspieler verheiratet, der Westernfilme aufgegeben hat, um zur Army zu gehen. Von nachbarschaftlichen Abendessen oder Bridgepartien hält sich Louise weitgehend fern, aber Pauline ist jung und einsam und fest entschlossen, nett zu ihr zu sein.
»Als Bert aus Korea heimkam, war er eine Zeit lang ziemlich verändert«, erzählte sie Louise. Sie standen auf der Veranda neben der mit einem Geschirrtuch abgedeckten Reine mit dem Hackbraten. »Nicht nur, dass er nicht mehr gut hören konnte, er war einfach nicht mehr derselbe wie zuvor.«
Über Paulines Schulter hinweg konnte Louise Bert zum Auto gehen sehen. Er war seit ein paar Monaten wieder da und sah eigentlich nicht viel anders aus. Nur wenn er einen darauf hinwies, merkte man, dass er auf einem Ohr taub war.
»Aber jetzt ist alles wieder gut«, sagte Pauline, vielleicht ein bisschen zu fröhlich. »Wirklich prima.«
»Das freut mich.«
»Haben Sie Geduld mit Arnie.« Sie reichte ihr den Hackbraten. Die Form war noch warm. »Am Anfang wird er Ihnen vielleicht fremd vorkommen. Aber er ist noch er selbst, tief im Inneren ist er genauso wie früher.«
Hab Geduld. Das sagte sich Louise auf der gesamten Fahrt zum Flughafen vor. Sie wiederholte es während des ersten verlegenen Abendessens, bei dem es Hackbraten in Scheiben, eine dünne Tomatensoße und Salzkartoffeln gab. Und auch noch, als sie in der ersten Nacht neben ihm im Bett lag. Sie hielten beide den Atem an und taten so, als würden sie schlafen. Hab Geduld.
Louise sagt es auch jetzt wieder zu sich selbst, während sie in der kalten Küche an der Spüle lehnt. Geduld. Auch wenn seine Rückkehr mittlerweile schon Wochen zurückliegt. Sie hat zehn Pfund abgenommen, was die Leute vom Studio toll finden, und Ringe unter den Augen bekommen, was überhaupt nicht auf Begeisterung stößt. Sie ist so vorsichtig mit Arnie umgegangen, hat so aufgepasst, was sie sagt. Aber es hatte nicht mehr als einen langen Tag gebraucht, bis sie Paulines Rat vergessen hatte.
Nun holt Louise tief Luft, legt die Hand an die Brust und zählt im Rhythmus ihres Herzschlags bis zehn. Das hat ihr Vater ihr beigebracht, als sie jung und trotzig war und zu zornigen Wutausbrüchen neigte.
Tief durchatmen. Sie steuert die gedrungene Hausbar im eleganten, modernen Wohnzimmer an. Das ist ihr liebster Raum. Ein niedriges Sofa, in der Farbe des Pazifiks und geschwungen wie eine Welle. Zwei runde orangefarbene Stühle, die wie umgedrehte Eimer aussehen. Ein breiter Couchtisch mit Glasplatte, auf dem mit großer Sorgfalt zwei weiße Vasen und ein Buch über die Bilder von Jackson Pollock arrangiert sind. Die Wände waren früher hellbraun, jetzt sind sie in einer Farbe gestrichen, die sich Columbiagrün nennt. Zur Feier von Arnies Rückkehr hat sie das Zimmer vollständig renovieren lassen; als er ankam, roch es noch nach frischer Farbe. Sie hat ihm sogar einen silbernen Googie-Aschenbecher gekauft, der aussieht wie eine fliegende Untertasse, obwohl sie es nicht ausstehen kann, wenn er im Haus raucht. Und dennoch hat er sich, seit er wieder daheim ist, insgesamt kaum länger als eine Stunde im Wohnzimmer aufgehalten.
Obwohl es nicht einmal mehr zwei Wochen bis Weihnachten sind, hat Louise noch keine Weihnachtsdekoration angebracht, weder die elektrischen Lichterketten noch die Stechpalmenschnüre aus Plastik. Es gibt keine Schüssel mit kunstvoll gestalteten Glaskugeln und keinen einzigen Mistelzweig. Sie hat noch keine Schallplatten mit Weihnachtsliedern aufgelegt und die Weihnachtskarten ungeöffnet weggeworfen. Der Ebenezer Scrooge vom Rodeo Drive. Eigentlich ist ihr Weihnachten zurzeit ziemlich egal.
Louise schaltet die Lampe an, die einer aus dem Boden wachsenden Blume nachgebildet ist. Sie holt Whiskey, süßen Wermut und Angostura aus dem Barschrank und gießt die Zutaten für einen Manhattan in ein Glas. Auf dem Weg zur Küche trinkt sie so viel, dass noch Platz für zwei Eiswürfel aus dem metallenen Eiswürfelbereiter ist. Die Schlafzimmertür ist geschlossen, aber durch den unteren Spalt ist Licht zu sehen.
Der Manhattan zeigt seine Wirkung, und sie entspannt sich allmählich. Wärme fließt ihr durch die Schultern in die fröstelnden Arme. In der Küche schaltet sie das kleine grüne Radio an und dreht so lange an den Knöpfen, bis sie Jo Stafford singen hört. Sie nimmt einen weiteren Schluck. Aus der Speisekammer und dem Kühlschrank holt sie Dosen, Päckchen und Flaschen. Regen trommelt gegen das Fenster. Sie lässt Butter schmelzen, schneidet Zwiebeln und getrocknetes Rindfleisch, gießt viel zu viel Milch dazu. Der Toaster wirft Brotscheiben aus. Als sie ihren Cocktail ausgetrunken hat, sind zwei Teller mit Rindfleisch in weißer Soße auf Toast servierfertig. Die Diät kann ihr gestohlen bleiben.
Louise mixt noch einen Manhattan und stärkt sich mit einem herzhaften Schluck, ehe sie mit einem der Teller zur Schlafzimmertür geht. Erst will sie anklopfen, dann überlegt sie es sich anders. Es ist auch ihr Schlafzimmer. »Arnie, ich habe dir etwas zu essen gemacht.« Sie öffnet die Tür.
Er sitzt in seinem Rollstuhl neben der Frisierkommode, das verschlungene Schlafanzugoberteil halb über dem Kopf, und stößt einen unverständlichen Fluch aus.
»Ach, Arn!« Schnell betritt sie das Zimmer und stellt den Teller auf der Kommode ab. »Warte.«
Sie fasst an seine Brust, wo sich die Pyjamajacke verdreht hat, aber er zuckt zusammen, als hätte sie ihn mit einem heißen Bügeleisen berührt. Sie beißt sich in die Innenseite der Wange. Vorsichtig, ohne seine Haut zu berühren, zieht sie ihm das Oberteil über die Schultern.
Er nimmt ihr das Kleidungsstück aus der Hand. »Das hätte ich auch allein geschafft.«
Früher war Arnie bis zum Roxbury Park und zurück gerannt, ohne einen einzigen Schweißtropfen zu vergießen. Jetzt sitzt er, über ein Schlafanzugoberteil gebeugt, atemlos im Rollstuhl.
Im grauen Licht, das durchs Fenster fällt, zeichnen sich die Rippen an seinem Brustkorb ab. Seit dem Unfall nimmt er fast nichts außer Kaffee und Salzcracker zu sich. Obwohl Louise nicht gerne kocht, hat sie sich von Pauline Kochbücher ausgeliehen und bereitet Schüsseln mit Grießbrei, töpfeweise Vanillepudding oder Austernsuppe und Platten voll Leber mit Zwiebeln oder gebratenen Koteletts zu. Was immer der Doktor empfiehlt. Nach einem Drehtag, an dem sie ständig gierige Blicke ignorieren und zwickende Finger abwehren musste, kommt sie todmüde nach Hause und spielt die Köchin. Tut so, als wäre sie eine richtige Hausfrau, die sich den ganzen Tag um ihren Ehemann kümmert. Sie wünscht sich, sie wäre in dieser Hinsicht von Anfang an besser gewesen.
Aber Arnie isst nichts von dem, was Louise auf den Tisch stellt. Sie hat sogar ein Betttablett gekauft, damit er zum Essen nicht aufstehen muss, aber er lehnt es ab. Er sitzt immer nur in seinem Sessel am Schlafzimmerfenster, bis sie klein beigibt und ihm die Dose mit den Salzcrackern bringt. Er ist so mager wie eine streunende Katze.
»Soll ich dir …«, setzt sie an und deutet auf seine Taille, aber er schüttelt viel zu schnell den Kopf.
»Die Hose ist noch in Ordnung.« Er wirft die Pyjamajacke aufs Bett.
»Du hast sie schon seit Tagen an.«
Sie kennt den Grund für seine Weigerung: Er kann es nicht ertragen, angefasst zu werden, zumindest nicht von ihr. Als er ihr gleich nach seiner Rückkehr noch erlaubt hat, ihm in die Badewanne zu helfen, musste sie das Licht im Badezimmer dimmen. Jetzt hat er eine Stange an der Fliesenwand und schafft es ohne ihre Hilfe.
»Ich habe gesagt, sie ist in Ordnung«, fährt er sie an. »Warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen?«
Sie hätte ihn gerne gefragt: Wenn ich das täte, wer würde sich dann um dich kümmern? Wer wäre dazu überhaupt bereit? In ihrem Mund breitet sich der Geschmack von Whiskey und Bitternis aus.
Er sieht sie an. »Ist noch Kaffee da?«
»Nein, aber ich habe hier Abendessen für dich. Es steht auf der Kommode.«
»Ich habe dir doch gesagt …«
»Arn, du musst etwas essen.«
»Ich habe keinen Hunger.« Er rollt hinüber zum Bett. Eine Hand auf das Bett gestützt und die andere auf den Rollstuhl, hievt er sich auf das zerknitterte Laken.
»Soll ich nicht lieber …«
Er streckt sich aus und dreht sich zur Wand. »Warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen?«, wiederholt er.
Sie versucht es ja. Jeden Tag geht sie früher als nötig ins Studio. Dann wartet sie mit einem Glas Tomatensaft und dem Drehbuch auf dem Schminkstuhl, bis um halb sieben die Maskenbildnerin mit ihren Pinseln und Schwämmchen erscheint. Nach dem Dreh bleibt sie länger. Sie schlüpft in Hosen und Pullover, geht den Text für den nächsten Tag durch und schminkt sich sehr, sehr sorgfältig ab, bis der Wagen kommt, der sie nach Hause fährt. Jeden Tag entfernt sie sich ein bisschen mehr von zu Hause.
Aber so kann es nicht weitergehen. »Sie haben mir mit einer Sperre gedroht.«
Arnie erstarrt, dreht den Kopf. Nur ein winziges Stück, aber das genügt ihr, um zu wissen, dass er zuhört.
Sie greift nach dem Teller mit dem kalt gewordenen Essen. »Fröhliche Weihnachten, Louise.« Damit verlässt sie den Raum.
Als er auftaucht, sitzt sie auf dem Boden im Wohnzimmer, den Rücken an die Wand gestützt. Sie hat den blauen Rock und die Strümpfe ausgezogen und isst das Soßenrindfleisch auf Toast, den Teller auf den nackten Knien. Eigentlich sollte sie anfangen, Die Prinzessin vom Las Vegas Boulevard zu lesen, aber aufgeschlagen vor ihr liegt Als sie König war. Auf dem Buch über Pollocks Bilder steht ihr dritter Manhattan.
»Die Soldaten nennen so etwas ›SOS‹«, sagt er und nimmt ein Streichholzheftchen aus dem Aschenbecher. »Sehr offensichtliche Scheiße.«
Louise blickt erstaunt auf. Nicht wegen der Sprache, sondern weil er zum ersten Mal den Krieg erwähnt.
Sie schluckt den letzten Bissen Toast mit Soße hinunter. »Ich weiß.«
Jetzt schaut er sie überrascht an.
»Ich habe deinen Artikel gelesen«, sagt sie. »Den darüber, dass sich die Soldaten nach dem heimischen Essen sehnen.«
»Pah!« Er wirft das Streichholzheftchen zurück in den Aschenbecher. »Da habe ich geschrieben, was sie mir diktiert haben. Was die Leute zu Hause gerne hören wollen. Was ein braver Amerikaner eben so sagen würde. Hast du tatsächlich geglaubt, das sei wahr?«
In den letzten dreizehn Jahren hat sie Showgirls und Studentinnen, Sekretärinnen und Debütantinnen gespielt. Sie war eine Prinzessin und das Mädchen von nebenan. Von Vortäuschen versteht sie etwas. Aber wenn die Artikel, die er aus Korea nach Hause geschickt hat, nicht die Wahrheit erzählen, wenn die Soldaten nicht bloß Dosenfleisch gegessen und sich nach ihren Frauen gesehnt haben, was ist dann wahr? Arnies Jeep auf der Straße nach Taegu, die Mine, die Stunden, die er unter dem Fahrzeug lag, bis ihn jemand fand. Die drei Särge, die sich mit ihm im Flugzeug befanden. Das ist wahr.
Aber darüber redet er nicht. Sie weiß nur, was sie in seinen Artikeln gelesen hat.
Plötzlich hat sie ein Loch im Magen. »Willst du wirklich nichts essen?«, fragt sie.
Er schüttelt verneinend den Kopf, und sie zieht seinen Teller zu sich heran.
Während sie isst, sitzt er schweigend da. Vielleicht wartet er, bis er reden kann oder bis sie etwas sagt. Das ist merkwürdig. Er verlässt das Schlafzimmer nur selten. Und dann geht er so gut wie nie ins Wohnzimmer. Er sieht sie auch nie so abwartend an.
Louise beugt sich über den Teller und stopft sich den Mund voll. Sie weiß nicht, wie sie ein Gespräch beginnen soll.
Als Arnie endlich etwas sagt, ist es das: »Was hast du mit dem Klimt gemacht?«
Der Kunstband, der früher auf dem Couchtisch lag, enthielt nur goldene Klimt-Gemälde. Strenge und Mythos. Sie ist sich nicht einmal sicher, ob sie Jackson Pollock mag, aber der Innenausstatter hat ihr versichert, er sei so modern wie die Einrichtung.
»Auf den Speicher getan.«
»Den haben wir in London gekauft«, sagt er, ohne sie anzusehen. »Erinnerst du dich?«
»Das war in Irland.«
»In London.«
Im Sommer 1944 war sie mit der USO-Truppenbetreuung in Europa. Alle Soldaten wollten Betsey Barnes sehen, und so kicherte und wedelte sie genau wie Betsey, während sie »A Polka in My Pocket« sang. Arnie arbeitete damals für Associated Press und befand sich weiter von der Front entfernt, als ihm recht war. Louise störte das nicht – er war in Plymouth, um sie vom Schiff abzuholen. Sie nannten es ihre verspätete Hochzeitsreise.





























