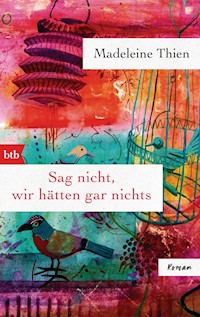8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem neuen Roman folgt Madeleine Thien den Erinnerungen, Verletzungen und Träumen ihrer Figuren aus dem Kanada der Gegenwart in den tropischen Dschungel Kambodschas in den siebziger Jahren, als dort die Roten Khmer mit brutalem Terror und der Ermordung von Millionen von Menschen eine neue Gesellschaftsordnung errichten wollten. Mit klarer, sanfter Sprache erzählt sie vom Verlust und von der Wiedergewinnung der Menschlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Madeleine Thien
Flüchtige Seelen
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Almuth Carstens
Luchterhand
Für meine Mutter
Berichte den Göttern, was mir geschieht.
Haing S. Ngor, Survival in the Killing Fields
Samstag, 18. Februar
{Fragment}
Am 29. November 2005 verließ mein Freund Dr. Hiroji Matsui um 19:29 Uhr das Hirnforschungszentrum Montreal. Seine Miene auf der Videoaufzeichnung verrät nichts. Für einen kurzen Moment fängt ihn die Kamera im Vorbeigehen ein: graue Haare, ordentlich gekämmt. Silbern gefasste Brille, buschige Augenbrauen, ein störrisches Kinn, die Weichheit eines Altmännergesichts. Er trägt trotz der Eiseskälte keinen Mantel und hat nichts bei sich, nicht einmal die Aktentasche, mit der er am selben Morgen gekommen ist. Er ging durch eine Seitentür hinaus und eine metallene Treppe hinunter. Und dann spazierte Hiroji in die Stadt und löste sich in Luft auf. Der Beamte, dem der Fall zugeteilt war, sagte mir, dass die Polizei ohne Hinweise auf ein Verbrechen nur sehr wenig tun kann. Selbst in einer Welt der ständigen Überwachung und Kontrolle ist es bemerkenswert einfach unterzutauchen. Manche Menschen geben sich große Mühe, ihre Identität hinter sich zu lassen, indem sie sich von Kreditkarten und Bankkonten trennen, von Versicherungsunterlagen, Rentenansprüchen und Führerschein. Ich hätte dem Beamten gern gesagt, was ich glaubte, dass nämlich Hirojis Verschwinden nur ein vorübergehendes sei, aber die Worte kamen nicht. Sie fielen mir nicht rechtzeitig ein, genau wie früher. Viele Vermisste, fuhr der Beamte fort, wollen nicht mehr sie selbst sein, nicht mit ihrer preisgegebenen Identität in Verbindung gebracht werden. Es geht ihnen darum, niemals gefunden zu werden.
{Ende}
Janie
SIE GEHEN FRÜHschlafen und stehen im Dunkeln auf. Es ist Winter. Die Nächte sind lang, aber draußen dringt dort, wo das Laub von den Ästen gefallen ist, schneeiges Licht durch. Es gibt eine Katze, die findet die Sonnenscheinpfützen. Sie war klein, als der Junge klein war, doch dann wurde sie erwachsen und ließ ihn hinter sich zurück. Trotzdem kauert sie nachts immer noch besitzergreifend auf Kiris Bett. Die beiden sind im Abstand von nur wenigen Wochen zur Welt gekommen, aber inzwischen ist er sieben, und sie ist vierundvierzig. Mein Sohn ist der Anfang, die Mitte und das Ende. Als er klein war, pflegte ich ihm auf Händen und Knien zu folgen, und wir krabbelten auf den Holzdielen hintereinander her, während sich die Katze zwischen unseren Beinen hindurchschlängelte. Hallo, hallo, sagte mein Sohn dann. Hallo, liebe Freundin. Wie geht es dir? So schob er sich voran, ein Elefant, ein Triumphwagen, ein glorreicher Narr.
Jetzt, Mitte Februar, sonntags, herrscht Zwielicht.
Der Eisregen der letzten Nacht hat die Zweige kristallisiert. Unsere Wohnung liegt im ersten Stock, nach Westen, und ist über eine Wendeltreppe zu erreichen, von der weißer Lack abblättert, so dass die Kanten rostig glänzen. Durch das Fenster kann ich meinen Sohn sehen. Kiri legt eine Schallplatte auf, die er behutsam aus ihrer Papphülle gezogen hat und vorsichtig zwischen seinen Fingerspitzen hält. Ich kenne die Platte, die er immer wählt. Ich weiß, dass er zusieht, wie sich die Nadel hebt und der mechanische Arm an Ort und Stelle rückt. Ich kenne das Äußere, nicht aber das Geheime, weiß nicht, wie seine Gedanken aufsteigen, drängend und vielfältig, wie sie sich entwirren oder unweigerlich ordnen.
Kiri ist in der zweiten Klasse. Er hat die dunkelbraunen Haare seines Vaters und auffällige, wunderschöne Augen in der Farbe meiner eigenen. Sein kambodschanischer Name bedeutet »Berg«. Ich würde am liebsten die Treppe hochrennen und meinen Schlüssel im Schloss drehen, so dass die Tür zu meiner Wohnung weit aufschwingt.
Als meine Angst – die Angst davor, dass Kiri aus dem Fenster schaut und dieses ihm vertraute Auto sieht, dass mein Sohn mich sieht – über meine Sehnsucht siegt, lasse ich den Motor an, schere vom Bürgersteig aus und rolle auf der leeren Straße davon. In meinem Kopf klingt noch die Musik nach, schaukelt sein Körper wie eine Glocke zu der Melodie. Ich erinnere mich daran, wie er, ein Häufchen Elend, auf dem Boden lag und verängstigt zu mir aufblickte. Ich versuche, diese Erinnerung zu verscheuchen, mich auf die verschwimmenden Lichter zu konzentrieren, auf die vereiste Fahrbahn. Mein Bett ist nicht weit entfernt, aber ein Teil von mir würde am liebsten weiterfahren, aus der Stadt hinaus und schnurstracks auf den Highway. Stattdessen drehe ich endlose Runden durch die Wohnstraßen. Vor Hirojis Wohnung, wo ich in den letzten Wochen übernachtet habe, wird ein Platz frei, und ich lenke den Wagen an den Bordstein.
Morgen kommt bald, sage ich mir. Morgen werde ich meinen Sohn sehen.
Der Wind peitscht auf mich ein und nimmt mir das bisschen Wärme, das ich habe. Ich schaffe es kaum, schnell genug die Tür abzuschließen und nach oben zu gelangen. Drinnen ziehe ich meine Stiefel aus, behalte wegen der Kälte jedoch Mantel und Schal an. Taka die Alte, Hirojis Katze, hüpft durch den langen Flur vor mir her. Das Licht auf dem Anrufbeantworter blinkt, und ich drücke so ungestüm auf den viereckigen Knopf, dass das Gerät zweimal hickst, ehe es anspringt.
Navins Stimme. »Ich habe das Auto gesehen«, sagt mein Mann. »Janie? Bist du da?« Er wartet. Im Hintergrund ruft mein Sohn. Ihre Stimmen klingen, als wäre die eine das Echo der anderen. »Nein, Kiri. Beeil dich, Kumpel. Ab ins Bett.« Ich höre Schritte, eine zufallende Tür und dann Navin, der zurückkommt. Er sagt, dass er mit Kiri für ein paar Wochen nach Vancouver fahren möchte, dass der zeitliche und räumliche Abstand uns vielleicht hilft. »Wir gehen zu Lena«, sagt er. Ich nicke, weil ich ganz und gar einverstanden bin – Lenas Haus steht leer, seit sie letztes Jahr gestorben ist –, aber ein dumpfer Kummer durchströmt mich.
Es folgt eine letzte Nachricht. Ich höre ein Klicken in der Leitung, dann das Piepen von Tasten, die gedrückt werden. Dann Stille.
Der Kühlschrank ist bemerkenswert leer. Ich mache eine rasche Bestandsaufnahme seines schimmernden Inneren: altes Brot im Eisfach, zwei Dosen gewürfelte Tomaten, eine Büchse geräucherte Muscheln und, himmlisch, drei Flaschen Wein. Ich hole das Brot und die Muscheln heraus, gieße mir ein Glas von dem schäumenden Wein ein und bleibe an der Theke stehen, bis der Toaster meine Mahlzeit ausspuckt. Gourmetkost. Ich öffne die Büchse und esse die Muscheln, eine nach der anderen. Der Wein spült das Brot zügig hinunter. Alles ist zu rasch weg bis auf den Wein, der mich zum Sofa begleitet, wo ich das Radio einschalte. Musik schwillt an und tanzt durch den Raum.
Der spritzige Wein macht mich verdrießlich. Ich trinke die Flasche schnell aus, damit ich sie los bin. »Nur Körper«, erklärte mir Hiroji einmal, »haben Schmerzen.« Er war gerade bei mir im Labor und sah dabei zu, wie ich ein Motoneuron aus einer Aplysia zog. Körper, Geist – für ihn waren sie identisch, eins ließ sich nicht ohne das andere denken.
Halb elf. Es ist zu früh zum Schlafen, doch ich fühle mich unbehaglich in der Dunkelheit. Ich würde gern Meng anrufen, meinen ältesten Freund, mit dem ich seit über zwei Wochen nicht gesprochen habe, aber in Paris ist jetzt die Stunde des Wolfs. Meine Glieder fühlen sich leicht an, und ich trudele ziellos durch die Räume. Auf der anderen Seite der Wohnung, in Hirojis kleinem Arbeitszimmer, stehen die Fenster offen, und die Gardinen scheinen sich gereizt, eigensinnig zu bewegen. Der Schreibtisch ist explodiert, vielleicht letzte Woche, vielleicht früher, aber inzwischen haben sich all die Unterlagen und Bücher zu einem ausgewogeneren Erscheinungsbild geordnet. Trotzdem wirkt der Schreibtisch noch tückisch. Auf ihn gehäuft, wie ein Gletscher, der seine Oberfläche usurpiert, sind die Seiten, an denen ich arbeite. Taka die Alte war hier: Das Papier ist zerknittert und noch ein bisschen warm.
Seit er vor fast drei Monaten verschwunden ist, habe ich keinen Kontakt mit Hiroji. Ich versuche, eine Liste anzulegen von allem, was er mir erzählt hat: von den Leuten, die er behandelt, den Wissenschaftlern, die er gekannt hat. Diese Liste füllt Blatt um Blatt – jeweils eine Erinnerung, ein Ort, ein Hinweis –, damit nicht alle Orte, alle Gedanken wie betäubender Lärm zugleich auf mich einprasseln. Auf Hirojis Schreibtisch steht ein altes Foto, das ihn und seinen älteren Bruder zeigt, hinter ihnen ein smaragdgrüner Wald. Hiroji, noch ein Kind, lächelt breit. Sie tragen keine Schuhe, und Junichiro oder James hat eine Hand in die Hüfte gestemmt, das Kinn erhoben und fordert die Kamera heraus. Er hat ein bezauberndes, trauriges Gesicht.
Manchmal scheint es in dieser Wohnung regelrecht zu wimmeln von geliebten, fremden, erdachten Menschen. Sie beschuldigen mich nicht, ziehen mich nicht zur Rechenschaft, aber ich bin unfähig, mich von ihnen zu trennen. Anfangs befürchtete ich das Schlimmste, dass Hiroji sich das Leben genommen hat. Doch ich sage mir, wenn es Selbstmord gewesen wäre, hätte er einen Brief, hätte er irgendetwas hinterlassen. Hiroji wusste, wie es ist, wenn die Vermissten endlos in uns weiterleben. Sie werden so groß und wir so leer, dass auch die kältesten Winternächte sie nicht verschlucken. Ich entsinne mich, wie ich als Kind im Meer schwamm, allein im Golf von Thailand. Mein Bruder ist nicht mehr da, aber ich schaue hinauf in den weißen Himmel und glaube, dass ich ihn irgendwie zurückrufen kann. Wenn ich nur tapfer genug oder wahrhaftig genug bin. Länder, Städte, Familien. Nichts braucht zu verschwinden. An Hirojis Schreibtisch geht mir die Arbeit schnell von der Hand. Die Stimme meines Sohnes hat sich in meinem Kopf festgesetzt, aber ich habe die Fähigkeit verloren, ihn zu beschützen. Ich weiß, dass, egal, was ich sage, was ich mache, das, was ich getan habe, nicht zu verzeihen ist. Meine eigenen Hände scheinen mich zu verspotten, sie sagen mir, je weiter ich fliehe, desto länger wird der Heimweg, den ich zurücklegen muss. Du hättest das Reservoir nie verlassen dürfen, sondern in den Höhlen bleiben sollen. Sieh dich doch um, wir sind wieder am selben Ort gelandet, oder? In den Gebäuden auf der anderen Straßenseite wird es dunkel, aber die Worte kommen trotzdem, häufen sich an wie Schnee, wie Staub, eine zarte Decke, die so leicht verweht.
Sonntag, 19. Februar
{Fragment}
Elie war achtundfünfzig, als sie anfing, ihre Sprache zu verlieren. Sie erzählte Hiroji, dass es zum ersten Mal in der St. Michael’s Church in Montreal geschah, als ihr die Worte des Vaterunsers, Worte, die sie praktisch kannte, seit sie sprechen gelernt hatte, nicht mehr über die Lippen kommen wollten. Einen kurzen Moment lang, während um sie herum die Gemeinde betete, verflüchtigte sich die gesamte Begrifflichkeit von Sprache aus ihrem Kopf. Stattdessen kam ihr das grüne Gewand des Priesters unendlich komplex vor, und die Wintermäntel der Gläubigen flimmerten wie eine Collage, das Werk eines Pointillisten, ein Seurat: Präzision, klare Abgrenzung und eine herzzerreißende Schönheit. Das Vaterunser berührte sie auf dieselbe körperliche Weise, wie es der Wind hätte tun können; sie nahm Klang wahr, aber keine Bedeutung. Sie fühlte sich erhoben und allein, Gott nahe und doch verstoßen.
Und dann war der Moment vorbei. Sie kam wieder zu sich, und auch die Worte kehrten zurück. Eine leichte Halluzination, dachte Elie. Champagner im Hirn.
Sie ging nach Hause und tat dasselbe wie immer. Sie schloss die Glastüren ihres Ateliers, entriegelte die Fenster, schob sie nach oben und malte. Es war Winter, deshalb trug sie zwei T-Shirts unter ihrer Jacke und Sweatpants aus Fleece, dicke Socken und chinesische Slipper an den Füßen und eine Wollmütze auf dem Kopf. Vor gut zehn Jahren hatte sie als Ingenieurin für Biomechanik auf dem Gebiet der motorischen Kontrolle geforscht und Vorlesungen an der McGill University gehalten, diesen Beruf jedoch im Alter von sechsundvierzig aufgegeben. Jetzt entfaltete sich Erleben für sie anders, es war fließender, transitorischer, umschloss sie wie ein wogendes Meer, das die Sonnenstrahlen bricht. Wenn sie die Augen zumachte, sah sie, wie sich die unwahrscheinlichsten Dinge an den Rändern berührten – ein Vogel und ein Mensch und ein vom Tisch eines Kindes rollender Stift –, ineinanderschlangen und zu einer einzigen Substanz verbanden. Sogar die Menschen, die sie liebte, erschienen ihr verändert, komprimierter, kompakter, wie Kompositionen, Endlosschleifen in ihrem Kopf. Die Malerei war ihr Ein und Alles. Sie malte, bis sie ihre Arme nicht mehr spürte, zehn, zwölf Stunden am Stück, jeden Tag, und sogar das genügte ihr nicht. Sie erklärte Gregor, ihrem Mann, es sei, als habe sie einen Höhepunkt erreicht, an dem alle Kräfte miteinander verschmolzen. Gregor, von Beruf Küchenchef, gewöhnte sich daran, zu den Rhythmen von Debussy und Ravel und Fauré einzuschlafen, Elies Lieblingsbegleitung. Er gewöhnte sich an den Geruch von Ölfarbe auf ihrer Haut, daran, wie sie, statt zu sprechen, mit den Händen gestikulierte, mit neuer Leidenschaft und Rechtschaffenheit in die Welt blickte. »Ich kann sehen«, rief sie ihm eines Tages zu. »Schau nur, was ich sehen kann.«
»Ich dachte«, sagte Elie zu Hiroji, als er sie schon jahrelang behandelt hatte, »meine ganze Vergangenheit sei Phantasie gewesen. Nur die Gegenwart war real für mich.«
Der Champagner kehrte in ihr Gehirn zurück, löschte die Namen von Personen, Liedtexte, Straßennamen, Buchtitel. Manchmal hatte sie das Gefühl, die Wörter selbst seien aus ihren Gedanken, ihrer Sprache, sogar aus ihrem Schreiben verschwunden. Ein Pfropf steckte in ihrer Kehle, und in ihrem Geist war ein schwarzes Loch. Beim Malen verwandelte sie Musik in Bilder, und die einzelnen Phrasen glichen Wörtern, die wiederum in geometrische Formen zerfielen, so dass ihre Gemälde all deren gesplitterte, glitzernde Fragmente erfassten. Wenn sie arbeitete, gab es keine Schranken mehr zwischen ihr und der Wirklichkeit, konnte das Bild alles sagen, was sie nicht zu sagen vermochte. Sie sprach immer weniger. Aber sie konnte mit dem Verlust der Sprache leben, wenn das der Preis war. Damals erschien er ihr niedrig.
Sie malte, als sie das Zittern in ihrem rechten Arm bemerkte.
Bei ihrem ersten Treffen mit Hiroji hatte er sie gefragt, ob sie das Sprechen mühsam finde. Das Wort war ihr vorgekommen wie das grüne Gewand des Priesters an jenem Tag in der St. Michael’s Church, ein Bild, das alle anderen Vorstellungen blockierte. Ja, sehr mühsam sei es. »Ich verfalle«, entgegnete sie Hiroji, was sie selbst überraschte.
»Was meinen Sie damit?«, wollte er wissen.
»Ich kann nicht … mit den …« Um Worte ringend, legte sie die Hände aneinander. »Es ist zu viel da.«
Hiroji schickte sie zu verschiedenen Untersuchungen. Magnetresonanztomogramme sind aufschlussreich. Das Erste, was dem Betrachter auffällt, ist die weiße Linie, der zarte Umriss des Schädels, erstaunlich dünn. Und dann, innerhalb des Schädels, die graue Masse, die sich um den aus weißer Materie bestehenden Kern faltet. Elies linke Gehirnhälfte, die dominante Seite (sie ist Rechtshänderin), verkümmert langsam – sie welkt wie eine Blume, die zu lange in der Vase steht. Diese Disintegration schreitet überall in Elies linker Gehirnhälfte voran. Die Sprache ist nur das Erste, was sie verliert. Gut möglich, dass sie eines Tages, bald, die ganze rechte Seite ihres Körpers nicht mehr bewegen kann.
Die Aufnahmen zeigen noch etwas anderes. Während die eine Hälfte abzusterben beginnt, wuchert die andere. Elies rechte Gehirnhälfte erzeugt neue graue Materie – Neurone –, und dieses zusätzliche Gewebe sammelt sich an den Stellen ihres Gehirns, wo optische Eindrücke verarbeitet werden.
»Es ist eine Art Asymmetrie«, erklärte Hiroji ihr, »eine Art Unausgewogenheit von Worten und Bildern.«
»Und was ist das dann, das ich da mache? Woher kommt es?« Elie wedelte mit den Händen, als wollte sie ihre Gemälde wie eine Armee in den Raum befehligen und auf die kahlen Wände holen.
»Es kommt aus dem Inneren«, sagte Hiroji, »aber kommt daher nicht alle Malerei?«
»Aus meinem kranken Inneren«, sagte sie. »Ich befinde mich im Krieg. Es geht bergab mit mir, oder?« Sie griff nach den MRTs auf seinem Schreibtisch. »Malen Sie, Herr Doktor?«
Er schüttelte den Kopf.
»Haben Sie je darüber nachgedacht?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Er hielt einen Moment lang inne. »Meine Mutter hat gemalt. Sie war Buddhistin, und sie hat mir immer gesagt, ich sei zu analytisch, ich hätte kein Verständnis für die vergängliche Seite der Dinge.«
»Vergänglich«, wiederholte sie zweifelnd. »Wie das Tanzen?«
Er lachte. »Ja, wie das Tanzen.«
Hiroji überwachte Elies Zustand mit fortgesetzten MRTs. Untersuchung für Untersuchung, Jahr für Jahr zeigen die Aufnahmen, wie das Ungleichgewicht zunimmt. Drei Jahre nach der Erstdiagnose begannen sich auch Elies Gemälde zu verändern. Während sie einst darin geschwelgt hatte, Musik in komplexe mathematische und abstrakte Bilder umzusetzen, die mit ihren intensiven Farben Rhythmen repräsentierten, malte sie jetzt präzise Stadtlandschaften, detailliert, nahezu fotografisch. »Ich sehe anders«, berichtete sie Hiroji. »Es erscheint mir weniger heilig als früher.« Er wollte, dass sie weitererzählte, dass sie ihm diese Heiligkeit erklärte, doch sie schüttelte nur den Kopf und goss mit zitternder rechter Hand den Tee ein.
»Das Konzeptuelle und Abstrakte«, sagte Hiroji, »ist für Sie nicht mehr so zugänglich. Ihre innere Welt hat sich verändert.«
Hiroji und ich schrieben einen Aufsatz über Elies Zustand. Er schilderte mir Elies Bilder, die bei ihr zu Hause die Wände schmückten. Er hatte das Gefühl, dass sie ihr gefielen, weil sie die Innenwelt in die Welt überführten, in der wir leben, die wir anfassen und ertasten, die wir sehen und riechen. »Bald«, sagte sie zu ihm und klopfte sich mit dem Finger auf die Brust, »wird es kein Inneres mehr geben.«
Inzwischen ist Elie fast vollkommen stumm. Wenn sie Hiroji anruft, spricht sie nicht. Sie klopft in einer Art Morse-Code zwei- oder dreimal auf die Tastatur, ehe sie wieder auflegt. Ihre Krankheit ist degenerativ, ein immer rascherer Verlust von Neuronen und Gliazellen in den anderen Teilen ihres Gehirns, der ihr zunehmend die Fähigkeit zu sprechen, sich zu bewegen und irgendwann sogar zu atmen nimmt. Da sie nicht mehr malen kann, verbringen sie und Gregor lange Tage am Flussufer, wo alles, wie sie einmal zu Hiroji sagte, in Bewegung ist, vergänglich, und nichts bleibt, wie es ist.
Vor zwei Jahren sprach Hiroji während eines Vortrags in Montreal kurz über das Bewusstsein. Er erklärte, er stelle sich das Gehirn als hundert Milliarden Flipperkugeln vor, deren Geräusche in ihrer Fülle und Geschwindigkeit jeden Gedanken und Impuls umfassten, all unsere ausgesprochenen und unausgesprochenen Wünsche, eigennützige, überlebensnotwendige und widersprüchliche. Die Zahl der möglichen Zustände des Gehirns übersteige die sämtlicher Elementarteilchen im Universum. Vielleicht könne das, was darunter liegt (Gewebe und Knochen und Zellen), und das, was darüber existiert (unser Ich, Erinnerung, Liebe), in Einklang gebracht und als Einheit begriffen werden, vielleicht sei alles dasselbe, sei der Geist das Gehirn, der Geist die Seele, die Seele das Gehirn usw. Doch das sei, als schaue man zu, wie eine Hand die andere aufschneidet, die Haut abschält und Gewebe und Knochen untersucht. Alles, was sie will, ist, sich selbst zu verstehen. Aber wäre dieses Verständnis nicht trotzdem ein begrenztes?
Ein paar Tage nach dem Vortrag erhielt Hiroji einen Brief von einem Mann, bei dem kürzlich Alzheimer diagnostiziert worden war.
Ich frage mich, schrieb er, wie ich ermessen kann, was ich verlieren werde. Wie viele Verschaltungen, wie viele Zellen müssen beschädigt werden, bevor der Mensch, den meine Kinder kennen, nicht mehr da ist? Gibt es ein Ich, das in der Amygdala oder im Hippocampus vergraben ist? Gibt es einen Funken Elektrizität, der mein Leben lang Bestand hat? Ich würde gern wissen, welcher Teil des Geistes unangetastet bleibt, unangreifbar, ob es einen Teil von mir gibt, der überdauert, der unzerstörbar ist, das absolute Zentrum dessen, der ich bin.
{Ende}
Früher schlich ich in meinen schlaflosen Nächten immer durch den Flur und stellte mich in die offene Tür von Kiris Zimmer. Mein Sohn, Sammler und Hüter kleiner Decken, schnarcht ein wenig. Das Geräusch seiner Atemzüge beruhigte mich. Wenn ich es wagte einzutreten, lauschte ich seinem Schlaf, den komischen, stotternden Lauten, die mir ganz und gar überirdisch vorkamen. Kiri, du bist ein Geschenk des Himmels, dachte ich dann. Ein Mysterium.
Taka die Alte erscheint auf der Fensterbank. Hirojis Katze beobachtet mich nervös, unruhig. Vor Stunden muss ich vergessen haben, meinen Mantel auszuziehen, also knöpfe ich ihn jetzt auf, schäle mich heraus und lege ihn ordentlich über die Rückenlehne eines Stuhls. Die Katze schlängelt sich heran. Wir sind zwei Geschöpfe der Nacht, in Gedanken verloren, nur dass sie nüchtern ist. Sie reibt ihr Gesicht an den leeren Ärmeln des Mantels, sie schnurrt in seine herunterbaumelnde Kapuze.
Ich ziehe die Vorhänge auf. Fast vier Uhr morgens, und draußen ist es märchenhaft weiß, eine scharf gezeichnete Landschaft scheint gegen das Dunkel aufzubegehren: Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist! Schneewehen und überfrorene Traufen verschmelzen mit Autos, die zentimeterhoch von Schneedecken umrissen sind. Ich kritzele kambodschanische Schriftzeichen, kambodschanische Wörter auf die vereisten Fensterscheiben, aber meine Kalligraphie ist die eines Kindes, unbeholfen, zu breit gespreizt, zu plump. Ich war elf, als ich Kambodscha verließ, und bin seitdem nie wieder da gewesen. Vor Jahren, mit meinem Mann unterwegs nach Malaysia, habe ich es aus der Luft gesehen. Seine Schönheit, unverändert, endlos, riss eine Wunde in mir auf. Ich saß am Fenster, und die kleine Maschine flog niedrig. Jetzt, in der Regenzeit, war Kambodscha versunken, ertränkt, das überschwemmte Land ein Plateau aus Licht. Von oben waren keine Autos oder Motorroller zu sehen, nur Boote, die das Wasser durchpflügten, gefolgt von der Schleppe ihrer Kielwellen.
Stille frisst sich in jeden Winkel des Raums, kriecht über die Möbel, über die Katze. Sie schreitet durchs Zimmer wie ein Löwe im Zoo. Ich spitze am Schreibtisch wie wild Bleistifte an und reihe sie nebeneinander auf.
Auf dem Boden liegt die Mappe, der ich mich immer wieder zuwende. Nach Hirojis Verschwinden fand ich sie auf seinem Küchentisch, nahm sie mit und erzählte niemandem von ihr, der Polizei nicht und nicht einmal Navin. Ich bewahrte sie in einem alten Koffer auf, als wäre sie ein Andenken, eine Reliquie, die zu hüten Hiroji mich gebeten hatte. Die Mappe enthält dieselben Dokumente und Pläne und Briefe von James, mit deren Überprüfung Hiroji mich letztes Jahr beauftragte. Ich erinnere mich, wie er die Landkarte entfaltete und seinen Finger auf Phnom Penh legte, hier, wo die Tinte verschmiert ist, die Stadt am Zusammenfluss von Mekong, Tonle Bassac und Tonle Sap. Damals war mir die Karte zu unscheinbar vorgekommen, zu abstrakt, eine Zeichnung von einem Land, die wenig Bezug zu dem Land meiner Kindheit hatte. Ich konnte nicht sehen, was er sah.
James Matsui war 1975 verschwunden. Vier Jahre zuvor hatte er sich nach seiner Assistenzzeit am St. Paul’s Hospital in Vancouver beim Internationalen Roten Kreuz verpflichtet, kurz darauf Kanada verlassen und war in Saigon gelandet, im Chaos des Vietnamkrieges. Im selben Jahr fielen amerikanische Bomben auf Kambodscha, brachen Spione in das Watergate-Gebäude ein, fanden Wissenschaftler eine Methode, die DNS zu spleißen, aber ich war zu klein, um diese Geschichten zu kennen. Ich war acht Jahre alt, ein Kind in Phnom Penh, und die Kämpfe wüteten zu der Zeit in den Grenzgebieten. Ich entsinne mich, wie ich in den Himmel starrte, fasziniert von den Flugzeugen. Sie waren allgegenwärtig über uns – Verkehrsmaschinen, Kampfjets, Frachtmaschinen, Helikopter –, ein Strom, der niemals abriss. Mein Vater erzählte mir von einer Frau namens Vesna Vulovi´c. Das Flugzeug, in dem sie als Stewardess arbeitete, war über der Tschechoslowakei explodiert und zehn Kilometer tief abgestürzt. Sie hatte überlebt. Ich nannte alle meine Puppen – drei hatte ich – Vesna. Für mich war sie wie ein Regentropfen oder ein ganz winziger Vogel, jemand, den die Götter übersehen hatten.
Ich hole James’ Briefe an Hiroji aus der Mappe. Als Junichiro Matsui geboren und als Junge Ichiro gerufen, wählte er als Teenager den Namen James. Seine Briefe an zu Hause sind kurz und voller Auslassungen, und doch kehre ich immer wieder zu ihnen zurück, überzeugt davon, dass mir ein entscheidendes Detail entgangen ist. 1972 schickte ihn das Rote Kreuz den Mekong hinauf, weg von Vietnam in die Flüchtlingslager von Phnom Penh. Kambodscha befand sich in den letzten Stadien des Bürgerkrieges, eines brutalen, zermürbenden Kampfes.
»Unsterblich«, sagte mein Vater einmal zu uns, voller Bewunderung für die Rebellen, die Roten Khmer.
»Die Unsterblichen«, erwiderte meine Mutter, »sind immer die Niederträchtigsten.«
Ab Januar 1975 kamen von James keine Briefe mehr. Drei Monate später gewannen die Roten Khmer den Krieg, und um mein Heimatland schlossen sich die Grenzen.
Mich umdrehen, zurückkehren, und da bin ich mit meinem Bruder in der Flurkammer, wir hocken auf den Schuhen meiner Mutter und verstecken uns. »Ihr werdet schon sehen«, sagt mein Vater. Durch die hölzerne Tür können wir seine Stimme hören, beschwipst und melodisch. »Die Roten Khmer werden sich doch noch als Helden erweisen.«
Meine Onkel, Großonkel und entfernten Onkel schreien wild durcheinander. »Lon Nol«, verstehe ich. »Verräter!« »Kriecht mit dem Feind ins Bett!« »Verachtenswert!« »Schlimmer als chinesische Raketen!« Die Partys meines Vaters sind immer ausgelassen und noch lauter, seit es im Krieg schlecht läuft. Nordvietnamesische Armee gegen amerikanisches Militär, Rote Khmer gegen Republikaner, Kommunismus gegen Imperialismus, jeder ergreift Partei, und manche ergreifen Partei für alle. Mein Vater sagt, dass es bei diesem Krieg um die Zukunft geht, um ein freies Kambodscha, dass wir das Land von den schlimmsten unserer eigenen Leute befreien müssen. Er sagt, unsere Führer hätten ihre moralische Orientierung verloren, seien besessen von Cognac und Sodawasser und bäuerlichem Aberglauben. Die Onkel gackern, und jemand kratzt an der Tür. Ich denke, es muss mein Cousin sein, der fröhliche Nimol, der an uns klebt wie nasses Gras.
Die Tür springt auf, und einen Moment lang wird der Raum strahlend hell. Mein Vater beugt sich herab, hebt meinen Bruder hoch. Ich sehe die blassen Sohlen von Sophams strampelnden Füßen. Mein Vater schaut nach unten, wo ich mich zu einer Kugel zusammengerollt habe. »Aha!«, sagt er. »Meine kleinen Hühner, die sich vor dem Bauern verstecken!«, und trägt uns, die wir lachen und vor Entsetzen kreischen, hinaus zu den anderen.
Jahre später erinnerte ich mich an die Geschichte von Vesna Vulovi´c und versuchte, in den Zeitungsarchiven der Stadtbibliothek von Vancouver etwas über sie zu finden. Als ich den Mikrofilm drehte, ließ mich ein Bild, unheimlich vertraut, innehalten: ein erschöpftes Gesicht, in weiße Kissen sinkend. Ich bezahlte für einen Ausdruck der Aufnahme. Vesnas Flugzeug war von zwei Boden-Luft-Raketen abgeschossen worden, abgefeuert vom tschechischen Militär, weil die jugoslawische Maschine versehentlich in eingeschränkten Luftraum geraten war. »Ich habe kein Glück gehabt«, sagte sie. »Alle finden, ich hätte Glück gehabt, aber sie irren sich. Hätte ich Glück gehabt, hätte es diesen Unfall nie gegeben.« Sie klang undankbar, doch das war sie nicht. Ich verstand sie. Ich entsann mich, wie ich mit flauem Magen in Kanada angekommen war, voller Scham, weil ich überlebt hatte, und zugleich voller Angst zu verschwinden. Das Schicksal hatte uns begünstigt, so viele andere dagegen nicht.
Zu Hause klebte ich Vesnas Bild an die Wand meines Zimmers. Ich verbrachte Stunden damit, auf dem Teppich zu liegen und sie anzustarren. Manchmal sah ich die schwachen Schatten von Lenas Füßen unter der Tür. Wie Nachrichten, dachte ich. Botschaften. Janie, Schätzchen. Darf ich reinkommen? Ich war zwölf, als ich in Vancouver eintraf und Lena meine Pflegemutter wurde. Oft saßen wir miteinander vor dem Fernseher und sahen The Nature of Things, Spielshows, die Filme der Woche, alles, was vielleicht mein Englisch verbessern konnte. Aber das Fernsehen verstörte mich mit seinem chaotischen Wirbel aus Bildern und Geschnatter, seinen jähen Zurschaustellungen von Liebe und Gewalt. Stattdessen wandte ich mich den zahlreichen Bücherregalen zu. Obwohl mir das Lesen schwerfiel, arbeitete ich mich durch Lenas Bibliothek. Biographien begeisterten sie – sie bewunderte Mathematiker wie Kurt Gödel und Emmy Noether und die Neurowissenschaftler Santiago Ramón y Cajal und Alexander Luria.
Zur Überraschung meiner neuen Mutter stibitzte ich diese Bücher ebenso oft, wie ich aus den Küchenschränken Dosen mit Lebensmitteln stahl, und ich hortete die Wörter wie einen Schatz. Mir war, als spazierten diese Menschen durch Lenas Wohnung, als gehörten sie zur Familie und wären noch am Leben.
Jedes Wochenende stieg Lena in ihr Büro hinunter. »Runter in den Keller«, sagte sie. »Runter in meinen Ballsaal.« Sie war Akademikerin und schrieb über die Geschichte der Naturwissenschaft. Ihre Welt war bevölkert von Mathematikern, Physikern, Chemikern und Biologen, von den Instituten und Salons einer anderen Ära. Todd, mein Pflegevater, lebte in Nepal, wo er für die UNICEF arbeitete, und kam einmal im Jahr, zu Weihnachten, nach Hause. An manchen Tagen verbrachte meine neue Mutter Stunden damit, auf der Jagd nach einer bestimmten Quelle Stapel von Papieren durchzusehen. »Hoffnungslos!«, sagte sie dann und wandte sich von mir ab, um ihre Traurigkeit zu verbergen. »Als würde man versuchen, eine Erdnuss zu finden, die durch den Weltraum treibt.«
Mit sechzehn fing ich ebenfalls an, im Ballsaal zu arbeiten, indem ich Lena half, ihre Dokumente zu ordnen. Nicht nur die Unterlagen, hätte sie behauptet, sondern auch ihre Gedanken. Ihr Büro war eine ganz eigene Stadt: Türme aus Forschungsnotizen, Zeitungsausschnitten, Büchern, Interviewmitschriften, Aufzeichnungen. Ich wollte ihr nützlich sein, mich irgendwie revanchieren. Mir gefiel der Gedanke, dass ich in ihrem Zimmer stehen und mir einen Weg durch die von ihr gebauten Straßen und das Wissen, das sie angehäuft hatte, bahnen konnte.
Eines Abends wollte Lena mich überraschen, staubte den Filmprojektor ab und ließ mich im Wohnzimmer Platz nehmen. Das Sofa war mit braunem Velours bezogen, einem mir unbekannten Stoff, der mir immer das Gefühl gab, auf einem Tier zu sitzen. Der Projektor brummte, es ratterte, und der Film begann. Wie gebannt schaute ich in die Welt, die sich auf der weißen Wand auftat. Ich sah eine viel jüngere Lena, die die Strände von Kep an der Südküste Kambodschas entlangwanderte. Die Kamera zoomte auf ihre Badekappe und den zitronengelben Badeanzug. Sie und Todd hatten hier in den 1960ern Urlaub gemacht, als in Kambodscha Frieden herrschte, wenige Jahre, bevor die Kämpfe begannen. Sie habe das alles nie vergessen, sagte sie, die Hitze, die safrangelben Tempel, das Meer. Sie und Todd waren damals frisch verheiratet gewesen.
Nacht für Nacht schlich ich nach unten, bemächtigte mich der Filmrollen und fütterte das Gerät damit. Ich saß auf der Couch und blickte auf, hörte nur das Surren des Projektors, während sich die Spulen drehten und das Band lief, und dieses Schwirren wurde zur wortlosen Trauer über eine verlorene Zeit. Ich sah die Silhouette der Stadt und das lichtgesprenkelte Wasser und Lenas Beine, glatt vor dem Hintergrund des Meers, in das sie immer wieder eintauchte. Von einer anderen Rolle flackerte Phnom Penh körnig in den Raum. Todd, der die Kamera hielt, drehte sich langsam, so dass er uns eine 360-Grad-Sicht von der Kreuzung vor dem Markt bot. Autos glitten vorbei, Fahrräder schwankten durchs Blickfeld, und Familien, in Orange und Rosa und Braun gekleidet, wandten sich um und schauten in das Objektiv. Die Bilder folgten schnell aufeinander, von Orten, die ich erkannte oder auch nicht. Es gab keine Ordnung, keine Chronologie, doch alles war so real, dass ich es riechen konnte, dass ich den Schmutz der Stadt auf meiner Haut spürte.
Eines Nachts setzte ich mich auf Lenas Bettkante und sagte ihr, dass ich mir einen neuen Namen wünschte, eine neue Existenz, und sie starrte mich an, die Augen nass von Tränen. Ich bewunderte diese Tränen, sie schämte sich ihrer nicht und hatte keine Angst vor ihnen. Jane. Janie. In der Sprache der Hilfsorganisationen war ich eine Minderjährige ohne Begleitung, ein Flüchtlingskind, aber Lena versicherte mir, das sei ich keineswegs. »Manchmal bekommen wir eine zweite Chance«, sagte sie zu mir, die ich darauf achtete, dass zwischen uns auf dem Bett ein Abstand blieb. «Du musst dich nicht dafür schämen, dass du viele Leben gelebt hast.«
Ich dachte an meine Freundin Bopha, an meinen Bruder Sopham und meine Eltern. Ich hätte Lena gern erklärt, dass wir zu viele waren, dass ich die Welt schützen musste, die uns alle zusammenhielt. Ich hatte Angst, ich würde sie fallen, zerspringen, zersplittern lassen.
Die Roten Khmer hatten Phnom Penh eingenommen und sich dann daran gemacht, systematisch jede Verbindung zur Außenwelt zu kappen. Sie nannten ihre Führung, ihre Regierung Angkar. Das Wort bedeutet »das Zentrum« oder »die Organisation«. Anfangs blieb unsere Familie noch zusammen. Später jedoch, als das nicht mehr möglich war, versuchte ich, mir einen Weg zurück vorzustellen. Die Zeit musste angehalten, umgekehrt, weit aufgeschnitten werden.
Angkar war besessen davon, Biographien aufzuzeichnen. Jede Person hatte, egal, wie sie zu den Roten Khmer stand, ihre Lebensgeschichte zu diktieren oder selbst zu verfassen. Diese Biographien mussten wir mit unseren Namen unterschreiben, und das wiederholten wir ständig, benannten Angehörige und Freunde, brachten Licht in die Vergangenheit. Mein kleiner Bruder und ich waren erst acht und zehn Jahre alt, doch wir begriffen trotzdem schon, dass der eigenen Lebensgeschichte nicht zu trauen ist, dass sie einen selbst und alle Menschen, die man liebt, zerstören kann.