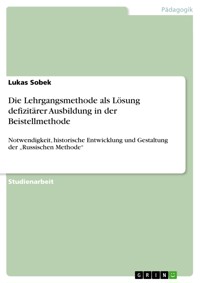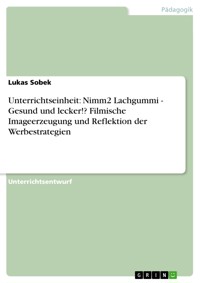Form und Funktion von redebegleitenden Gesten in technisch vermittelter Kommunikation E-Book
Lukas Sobek
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Interpersonale Kommunikation, Note: 1,0, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft der RWTH Aachen Lehrstuhl für Deutsche Philologie und Germanistisches Institut), Veranstaltung: Gestenanalyse: Theoretische und empirische Ansätze, Sprache: Deutsch, Abstract: Redebegleitende Gesten erfüllen in der Kommunikation unterschiedliche Zwecke: Sie nehmen Bezug auf Gegenstände der Rede, strukturieren das Gesagte, lenken die Aufmerksamkeit der Zuhörer, fordern zu Aktionen auf und wirken an der Erschaffung und am Wechsel von Gesprächsrollen mit. Sie sind „verkörperte“ und daher visuell wahrnehmbare Informationen, die den Gehalt der akustisch-sprachlichen Kommunikationsdimension ergänzen, wiederholen, bestärken oder ersetzen. Multimodale Kommunikation rückt die Verständigung der Menschen ab vom sterilen mathematisch-funktionalistischen Modell der Informationsübertragung und akzentuiert die Möglichkeit von sinnlicher, anschaulicher und kreativer Erzeugung (Produktion: auf der Seite des Sprechers) und Anteilnahme (Reproduktion und Empathie auf der Seite des Adressaten) von Erfahrungen, Kenntnissen und Emotionen. Zahlreiche Gesten nehmen typische Form- und Bewegungsparameter aus praktischen Kontexten an, in denen die Hände eingesetzt werden, und werden zur körperlichen Ausdrucksseite eines metaphorischen Ausdrucks: Argumente werden „weggewischt“, wie die Krümel von der Tischplatte; Positionen werden „ergriffen und festgehalten“, wie eine Fernbedienung; eine Sache wird wie mit einem Stift „nachgezeichnet“. Der leiblich-direkte Bezug zur Vorstellungswelt des Sprechers zeigt sich auch in den Darstellungsmöglichkeiten der Hände: Bedeutung kann über zeichnende, agierende, modellierende und repräsentierende Hände/Finger dargestellt werden (Bavelas et. al 1995: 394-405, Fehrmann 2010: 18-36, Ladewig 2010: 89-111, Müller 1998: 110-119, Müller 2010: 37-68). Weil redebegleitende Gesten oftmals in einem face-to-face Gespräch aufkommen, könnte man meinen, dass sie primär ausgeführt werden, um die Verständnisleistung des Adressaten zu unterstützen. In der Tat wird bei der Interpretation von Gesten oft die Perspektive des Rezipienten eingenommen, um ihre Funktion zu deuten. Methodologisch wird so automatisch der Adressatenbezug der Gesten in die Ergebnisse eingeschleust. Das Ziel dieser Untersuchung ist es, Form und Funktion von Gesten zu untersuchen, die in einer Situation produziert werden, in der es keinen unmittelbar-visuellen Adressatenbezug gibt. Diese Gesten können nicht produziert worden sein, um dem Rezipienten das Verstehen zu erleichtern, weil der Sprecher sich der Abwesenheit seines Gesprächspartners vollkommen bewusst ist. Die Untersuchung ermöglicht damit einen Einblick in die Funktionsleistung von Gesten für den Sprecher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft der RWTH Aachen Lehrstuhl für Deutsche Philologie und Germanistisches Institut Hauptseminar: Gestenanalyse: Theoretische und empirische Ansätze WS 20010/20011
Form und Funktion von redebegleitenden Gesten in technisch vermittelter Kommunikation
Page 3
I Einleitung
Redebegleitende Gesten erfüllen in der Kommunikation unterschiedliche Zwecke: Sie nehmen Bezug auf Gegenstände der Rede, strukturieren das Gesagte, lenken die Aufmerksamkeit der Zuhörer, fordern zu Aktionen auf und wirken an der Erschaffung und
wahrnehmbare Informationen, die den Gehalt der akustisch-sprachlichen
Kommunikationsdimension ergänzen, wiederholen, bestärken oder ersetzen. Multimodale Kommunikation rückt die Verständigung der Menschen ab vom sterilen mathematischfunktionalistischen Modell der Informationsübertragung und akzentuiert die Möglichkeit von sinnlicher, anschaulicher und kreativer Erzeugung (Produktion: auf der Seite des Sprechers) und Anteilnahme (Reproduktion und Empathie auf der Seite des Adressaten) von Erfahrungen, Kenntnissen und Emotionen. Zahlreiche Gesten nehmen typische Form- und Bewegungsparameter aus praktischen Kontexten an, in denen die Hände eingesetzt werden, und werden zur körperlichen Ausdrucksseite eines metaphorischen Ausdrucks ,wie die Krümel von der Tischplatte; Positionen werdenergriffenundwie eine Fernbedienung; eine Sache wird wie mit einem Stiftnachgezeichnet.Der leiblich-direkte Bezug zur Vorstellungswelt des Sprechers zeigt sich auch in den Darstellungsmöglichkeiten der Hände: Bedeutung kann über zeichnende, agierende, modellierende und repräsentierende Hände/Finger dargestellt werden (Bavelas et. al 1995: 394-405, Fehrmann 2010: 18-36, Ladewig 2010: 89-111, Müller 1998: 110-119, Müller 2010: 37-68).
Erkenntnisinteresse.Weil redebegleitende Gesten oftmals in einem face-to-face Gespräch aufkommen, könnte man meinen, dass sie primär ausgeführt werden, um die Verständnisleistung des Adressaten zu unterstützen. In der Tat wird bei der Interpretation von Gesten oft die Perspektive des Rezipienten eingenommen, um ihre Funktion zu deuten. Methodologisch wird so automatisch der Adressatenbezug der Gesten in die Ergebnisse eingeschleust. Das Ziel dieser Untersuchung ist es, Form und Funktion von Gesten zu untersuchen, die in einer Situation produziert werden, in der es keinen unmittelbar-visuellen Adressatenbezug gibt. Diese Gesten können nicht produziert worden sein, um dem Rezipienten das Verstehen zu erleichtern, weil der Sprecher sich der Abwesenheit seines Gesprächspartners vollkommen bewusst ist. Die Untersuchung ermöglicht damit einen Einblick in die Funktionsleistung von Gesten für den Sprecher selber. Es kann untersucht werden, ob bestimmte Gestentypen in technisch vermittelter und face-to-face Kommunikation bevorzugt werden, ob die Einschränkung beim Telefonat auf nur einen Artikulator (Hand, Arm, Finger) die Gestenproduktion einschränkt, ob die Produktion von bildhaften Gesten wirklich primär von der Anwesenheit des Adressaten
Page 4
abhängt und wie sich die An- bzw. Abwesenheit des Adressaten auf die Produktion interaktiver Gesten auswirkt (Bavelas et. al. 1995: 398).
Versuchssetting & Datenmaterial.An der Datenerhebung nahmen insgesamt drei Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer teil:
- 2 deutsche Muttersprachlerinnen, 25 Jahre
- 1 polnische Muttersprachlerin aus Oberschlesien, seit 20 Jahren in Deutschland, 51 Jahre
- 1 deutscher Muttersprachler, 50 Jahre
Ein drei minütiger Tom & Jerry Zeichentrickfilm wurde ausgewählt, um die Gestenproduktion zu motivieren. Das Untersuchungsthema, der Ablauf und Aufbau des Versuches wurde vor den Aufnahmen erklärt und bewilligt. Nachdem der Trickfilm ein erstes Mal geschaut wurde, riefen die TeilnehmerInnen eine beliebige Person mit ihrem Mobiltelefon an und erzählten ihr die Handlung des Trickfilms. Während der Videoaufnahme war niemand im Raum und im Blickfeld des Sprechers. Der Versuchsleiter wurde vom Teilnehmer nach Beendigung des Telefonats wieder in den Raum gebeten. Anschließend wurde der Trickfilm ein zweites Mal gezeigt und nun dem Versuchsleiter erzählt. Beide Gesprächsmodi sind eher Monologe als Dialoge: Weder die Gesprächspartner am Telefon noch der Versuchsleiter in der face-to-face Kommunikation unterbrachen die/den TeilnehmerInnen durch Rückfragen oder dergleichen.
Nach einer ersten Sichtung der Daten wurden für diese Untersuchung die Aufnahmen einer Probandin ausgewählt, die in beiden Gesprächsmodi ausgiebig gestikulierte. Nur Gesten der Arme und Hände wurden zur Untersuchung herangezogen. Mimik, Kopf- und Oberkörperbewegungen wurden nicht miteinbezogen. In einer größeren Studie müssten auch die anderen Aufnahmen berücksichtigt und ggf. als Erweiterung/Korrektur der hier entwickelten Erkenntnisse herangezogen werden.
II Analytisches Rüstzeug
Transkription und Annotation.Die Aufarbeitung des Datenmaterials umfasst folgende Schritte, die hier nur kurz umrissen werden. Das Thema der Rede wird in doppelten runden Klammern der Transkription vorangestellt. Die transkribierte Rede wird zeilenweise in Betonungseinheiten eingeteilt. In der folgenden Zeile fortgesetzte Betonungseinheiten werden mit einem Komma (,) gekennzeichnet. Der steigende (/) und der fallende (\) Querstrich repräsentieren steigende und fallende Betonung in einer Betonungseinheit, während der Unterstrich ( _ ) gleichbleibende Betonung anzeigt. Es geren
Page 5
Pausen. Für längere Pausen werden die Sekunden ziffernweise zwischen Bindestrichen aufgezählt: (1-2-3). Gestenphasen können so einzelnen Sekunden zugeordnet werden. Gelächtersilben werden mit @ und lautlich gefüllte Pausen mit einer Transkription des Lautwertes in runden Klammern angegeben: (ehm). Betonte Silben und Wörter werdenkursivgesetzt, vorangehende Silben, die betont werden, werden von der nachfolgenden Silbe mit einem Gleichheitszeichen (=) getrennt (Mittelberg 2007:233,234). Um den synchronen Verlauf von Gesten und Rede darzustellen, werden die Gestenphasen in typographische Repräsentationen übersetzt und mit den Gestenparamtern (siehe folgenden Abschnitt) dem betreffenden Redeteil untergeordnet:
I~~~I:preparation
I***I:stroke
I***I:post stroke holdohne Bewegung
I***Ipost stroke holdmit leichter Bewegung
I.-.-I:recovery
Die mit demstrokezusammenfallende linguistische Einheit wird in der Transkriptionfettgedruckt und mit Gn (n= fortlaufende Zählung der Gesten) überschrieben. Ein kompletter Verlauf von derpreparationbis zurrecoverywirdgesture unit(g-unit) genannt und kann mehrerestrokesbeinhalten (Mittelberg 2007: 236). Ein Beispiel für eine vollständige Annotation und Transkription wird am Ende des folgenden Abschnittes gegeben.
II.1 Notationskonventionen für Gesten: Handform, Orientierung der Handflächen, Bewegung und Ort im Gestenraum