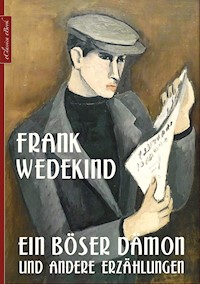
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EClassica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Frank Wedekind: Ein böser Dämon und andere Erzählungen | Neu lektorierte 2023er-Ausgabe, mit zahlreichen erklärenden Fußnoten | Frank Wedekind (18641918) war Theaterautor und Schriftsteller und gilt als einer der Pioniere des deutschen Naturalismus. Neben seinen Theaterstücken verfasste er auch Novellen und Kurzgeschichten, die häufig um seine bevorzugten Themen kreisen: jugendliche Liebe und der Reiz sehr junger Mädchen. Eine der bekanntesten Storys ist die hier enthaltene »Ein böser Dämon«, die psychologisch fein ziselierte Erzählung einer Dreierbeziehung, in der einer der Protagonisten aus Eifersucht zum Psychopathen wird. Auch in »Der Verführer« geht es um Lust und Begierde an einem jungen Mädchen, und der Protagonist schreckt vor keinem Mittel zurück, um sie für sich zu gewinnen. Wedekinds Kurzgeschichten bieten eine bemerkenswerte Einführung in sein Schaffen und spiegeln seine kontroversen Themen wie seinen unkonventionellen Stil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
— INHALT —
Innentitel
Über den Autor
Über die Kurzgeschichten
Ein böser Dämon
Flirt
Der Verführer
Die Fürstin Russalka
Bei den Hallen
Ich langweile mich
Der erste Schritt
Impressum
Fußnoten
Über den Autor
Frank Wedekind (1864–1918) war ein deutscher Schriftsteller und Theaterautor. Er wurde in Hannover geboren und studierte Kunst und Philosophie in München. Während seiner Karriere schrieb er zahlreiche Theaterstücke, die oft kontrovers und provokativ waren. Die bekanntesten dieser Werke sind »Frühlings Erwachen« (1891) und »Erdgeist« (1895), die beide das Thema jugendliche Sexualität im Blick haben. Wedekinds Stücke wurden wegen ihrer heiklen Sujets öfters verboten und kritisiert, doch sie trugen auch dazu bei, dass er heute als einer der Pioniere des deutschen Naturalismus und Expressionismus angesehen wird.
Frank Wedekind war auch politischer Aktivist und sprach sich für soziale Reformen aus. Er war ein Verfechter von Frauenrechten und Homosexualität – sehr ungewöhnlich für seine Zeit. Eine breite Anerkennung blieb ihm zu seinen Lebzeiten versagt, heute ist seine Bedeutung für die deutsche Literatur unbestritten. Seine Bühnenstücke werden nach wie vor aufgeführt.
Über die Kurzgeschichten
Neben seinen Theaterstücken verfasste Wedekind auch einige Novellen und Kurzgeschichten, die häufig um seine bevorzugten Themen kreisen: jugendliche Liebe und der Reiz sehr junger Mädchen. Eine der bekanntesten Storys ist die hier enthaltene ›Ein böser Dämon‹, die psychologisch feinziselierte Erzählung einer Dreierbeziehung, in der einer der Protagonisten aus Eifersucht zum Psychopathen wird. Auch in ›Der Verführer‹ geht es um Lust und Begierde an einem jungen Mädchen, und der Protagonist schreckt vor keinem Mittel zurück, um sie für sich zu gewinnen. Wedekinds Kurzgeschichten bieten eine bemerkenswerte Einführung in sein Schaffen und spiegeln seine kontroversen Themen wie seinen unkonventionellen Stil.
© Redaktion eClassica, 2023
Ein böser Dämon
Es war Nachmittag.
Hinter dem Haus lag ein kleiner Garten; in dem Garten, von einem Kiesweg umgeben, ein runder Rasenplatz. Auf dem Rasenplatz standen zwei Apfelbäume in mittleren Jahren, mit schlanken, starken Stämmen und rundlichen Kronen. Dort, wo die Krone an den Stamm ansetzt, war an jedem das eine Ende einer Hängematte befestigt. In dieser Hängematte lag Beatrix und schlief.
Ihr Schlummer mochte ein verhältnismäßig tiefer sein, denn die Gartenpforte knarrte, und ein junger Mann in anständiger, wenn nicht eben eleganter Kleidung betrat den Rasen, ohne dass sie sich rührte. Es war Theodor Winter, ihr Jugendfreund. Als Nachbarskinder hatten sie miteinander gespielt, und wiewohl ihm das Mädchen im Alter um mehrere Jahre nachstand, hatte es sich doch in seiner Nähe stets behaglicher, unbefangener gefühlt als in irgend anderer Gesellschaft. Als Gymnasiast wusste er den muntern, verständigen Backfisch für seine Lektüre zu begeistern. Man las zusammen Schiller, dann Goethe und schließlich Shakespeare, im Winter neben dem warmen Ofen bei Beatrix’ Eltern, im Sommer in dem kleinen Garten unter einem hohen Fliederbusch. Man las die Dichter in ihren unverkürzten Originalausgaben und ohne dass sich irgendjemand bemüßigt gefühlt hätte, die Lektüre zu überwachen, respektive bei ihrer Auswahl Zensur zu üben. Außerdem besprach Theodor mit seiner Freundin ihre jeweiligen Aufsatzthemen und korrigierte ihr die Konzepte. Als er zur Universität abging, um Medizin zu studieren, schworen sie sich ewige Treue, und als er nach Ablauf von vier Semestern und nach Absolvierung seines ersten Examens in die Heimat zurückkehrte, verlobten sie sich.
Obwohl dieser Ausgang leicht vorauszusehen gewesen, zeigten sich Beatrix’ Eltern doch nicht sonderlich davon erbaut. Theodor Winter war bei all seinen Vorzügen ein armer Teufel, der aus Stipendien lebte, währenddem die reizende Beatrix als einzige Erbin eines nicht unbedeutenden Vermögens mit Leichtigkeit einen Rittergutsbesitzer oder was der Art bekommen haben würde. Umso erfreuter waren sie daher, als drei Jahre später, nachdem Theodor ein glänzendes Staatsexamen abgelegt, wider Erwarten noch durchaus keine Hochzeit in Aussicht genommen, ja selbst der Verlobung weiter nicht mehr Erwähnung getan wurde. Es hatte zweifelsohne ein kühler Wind über die Blütenflur der beiderseitigen Empfindung gefegt. Freilich, hätten Beatrix’ Eltern geahnt, von wannen dieser kühle Wind gekommen, sie hätten sich schwerlich im Geheimen mit solchem Wohlbehagen die Hände gerieben.
Auf der Universität zu München hatte Theodor einen jungen Mann kennengelernt und nach wiederholter Begegnung von Herzen liebgewonnen. Er hieß Kaspar Fridolin Sitterding und war Maler. Seine künstlerische Begabung trug einen ebenso liebenswürdigen Charakter wie seine ganze Person. Er malte Frühlings- und Herbststimmungen, die sich von den übrigen hundert und tausend ihrer Art durch nichts Außerordentliches unterschieden, ihnen aber auch in keiner Weise nachstanden. Was Theodor weit mehr fesselte, war sein überaus treuherziges Naturell, sein goldenes Gemüt und eine fast kindliche, unverwüstliche Heiterkeit. So schien Kaspar Fridolin Sitterding denn auch, wiewohl beinahe zehn Jahr älter als sein Freund, in seinem ganzen Wesen frischer, unberührter, wozu, außer dem großen blauen Auge, der Umstand nicht wenig beitragen mochte, dass sich in seinem freien Antlitz auch noch nicht der geringste Anflug von einem Bart bemerkbar machte.
Als Theodor wenige Monate vor der Staatsprüfung seine Vaterstadt noch einmal besuchte, hatte er seinen Freund eingeladen, ihn zu begleiten; und als er ein halbes Jahr später als gemachter Mann denselben Weg antrat, war es dann jener gewesen, der ihn gebeten, er möchte ihn doch mitnehmen, da er in jener Gegend so ungemein dankbare Sujets entdeckt habe. So bekam Kaspar Fridolin Sitterding Beatrix zum zweiten Mal zu sehen, und da konnte es nicht ausbleiben, dass beide die nahe Verwandtschaft ihrer Naturen herausfühlten. Sie wurden quasi gute Kameraden, und Theodor empfand aufrichtige Freude daran. Bei der außergewöhnlichen Schönheit des Mädchens war es auch nicht mehr als selbstverständlich, dass der Künstler und beiderseitige Freund darum bat, sie porträtieren zu dürfen, und so brach denn das Unheil über Theodor herein, bevor er noch Zeit gefunden, sich nur einigermaßen der kritischen Sachlage bewusst zu werden. Ja, er wohnte sogar mit dem lebhaftesten Interesse und Vergnügen den jeweiligen Sitzungen in Sitterdings bescheidenem Atelier bei, ohne zu ahnen, welch ein zerstörungslustiger Satan ihm in dem werdenden Bild auf der Leinwand mit jedem Pinselstrich ein Stück seines eben der Vollendung entgegenreifenden Lebensglückes hinwegwischte.
Und als ihm schließlich die Schuppen von den Augen fielen, war es längst zu spät. Er sah so klar, dass es ihn fast der Sehkraft beraubte, wie zwischen seiner Verlobten und seinem Freund ein unvergleichlich reicherer, regerer Gefühlsaustausch, ein mächtigerer Zusammenklang, ein innigeres Verständnis möglich war, als es jemals zwischen ihr und ihm selber obgewaltet. Er sah, wie es für ihn nichts zu retten, höchstens noch mehr einzubüßen gab. Er sah, wie es nur noch eine Frage der Zeit war, wann sich die beiden ihrer Liebe bewusst werden würden. Er sah mit alledem einen schaurigen Abgrund zwischen sich und Beatrix gähnen; und im verzweifelten Versuch, diesen Abgrund doch noch einigermaßen zu überbrücken, einer ausgesprochenen Feindschaft zum mindesten vorzubeugen, beschloss er nach dem denkbar fürchterlichsten Seelenkampf, selber zuerst das Losungswort auszusprechen, das Wort, das die Verhältnisse in ihrer wahren Gestalt erscheinen lassen sollte.
Und noch hatte er es nicht über sich vermocht, seinen Entschluss auszuführen, als ihm Beatrix eines Tages schluchzend am Hals hing und ihn bei allem was heilig beschwor, ihr zu verzeihen; sie sei seiner unwürdig, er werde sicherlich eine Würdigere finden; übrigens sei er immer gut und verständig gewesen; er werde es auch jetzt sein; sie habe sich geirrt, sie habe allerdings geglaubt, ihn zu lieben; eigentlich habe sie ihn nur verehrt und hochgeschätzt, wie einen älteren Freund, etwa einen Onkel. Erst jetzt wisse sie, was Liebe sei; und er möchte doch um des Allmächtigen willen ihre Eltern nichts merken lassen, da sie die Verbindung mit Sitterding niemals zugeben würden, sie aber nicht von ihm lassen werde, und wolle man ihr mit glühenden Zangen das Fleisch vom Körper reißen. Was blieb Theodor anders übrig, als das Mädchen mit allen Mitteln zu beruhigen, ihr zu versichern, zu versprechen und zu beschwören, gut und verständig sein zu wollen. Zu gleicher Zeit hatte er die beste Gelegenheit, zu beobachten, wie sehr sich Beatrix in jüngster Zeit zu ihrem Vorteil verändert hatte. Aus ihren Blicken leuchtete ein nie zuvor von ihm bemerkter lichter Funke Genie, offenbar der Widerschein aus dem großen blauen Auge ihres neuen Geliebten.
Kaspar Fridolin Sitterding wollte, als nunmehr auch ihm gewaltsam die Augen geöffnet wurden, ohne Weiteres aufpacken und abreisen. Augenscheinlich litt er Höllenqualen unter dem Bewusstsein des Verrates, den er an seinem besten Freund verübt hatte. Nachdem aber Theodor nach Erschöpfung seiner ganzen Beredsamkeit keine Worte mehr fand, ließ er sich doch noch glücklich vom Äußersten zurückhalten und versprach zu bleiben. So war nun alles wieder in Ordnung. Die Liebenden schwammen in einem Wonnemeer, eine Lustbarkeit löste die andere ab. Man unternahm gemeinsame Spaziergänge, Ausflüge, Wasserfahrten etc., und Theodor durfte niemals fehlen. Beide hatten ihn während der Katastrophe über alle Maßen liebgewonnen und sahen jetzt in seinem ernsten Wesen gewissermaßen ein solides Fundament, einen sicheren Schutz des eigenen leichtgefügten Glückes. Sein Ernst nahm zwar von Woche zu Woche zu, Theodor wurde bleicher, abgehärmter; aber das beachteten sie nicht, und er selber tröstete sich mit der festen Zuversicht, es werde seiner in soundso vielen Examina bewährten Willensstärke schließlich doch auch noch gelingen, dieses an seiner Seele nagende Ungetüm zu erdrosseln.
Es gelang ihm nicht. Und als ihm die äußerste Not den Gedanken eingab, nun selber sein Bündel zu schnüren, besaß er zur Trennung bereits nicht mehr die nötige Kraft. Von nun ab begann in seinem Innern ein eigentlicher Zersetzungsprozess. Der Zwiespalt zwischen der Rolle, die er übernommen, und seinen wahren Empfindungen zerfraß sein natürliches Gefühl, verschob seine Begriffe und zerrüttete seine Gesundheit. Er schwankte fortwährend zwischen einer Untat gegen das Liebespaar und einem Verbrechen gegen sich selbst. Er lernte diese Art Gedanken liebgewinnen, er gefiel sich darin, und sie begleiteten ihn bei Tag wie bei Nacht. Vorbedingung dieses wüsten, unheimlichen Treibens war natürlich, dass er sich nach außen nicht das Geringste merken ließ. Nur bisweilen verließ ihn momentan die Fassung, und dann erschien er launenhaft. Im Allgemeinen hielt er sich aber strenger denn je an die ihm von Beatrix einmal aufgebürdete Verhaltungsmaßregel ›gut und verständig‹, wofür er sich dann freilich bei sich selber durch die absurdesten Rachepläne, durch die schauderhaftesten Phantasien um so gründlicher zu entschädigen suchte. Dass er darüber seine erst seit Kurzem erworbene Praxis vollständig vernachlässigte, kümmerte ihn wenig, wiewohl dieser Umstand seinen übrigen Leiden auch noch die materielle Not hinzufügte. So war im Verlauf eines halben Jahres aus dem besten, dem solidesten, dem glücklichsten jungen Mann ein Ungeheuer, ein unberechenbarer böser Dämon geworden, wie er gemeingefährlicher in keinem Irrenhaus gefangen gehalten wird.
Kaspar Fridolin Sitterding hatte eine Kopie von Beatrix’ Porträt nach München an die Kunstausstellung geschickt, wo das Bild sofort einen Käufer fand, ein Glück, das es nach dem einstimmigen Urteil aller nicht so begünstigten Aussteller mehr seinem Sujet als seinem Schöpfer verdankte. Die dafür ausgezahlte Summe setzte nun den Künstler in die Lage, einen langgehegten Wunsch zu realisieren, der unter gegebenen Verhältnissen auch ganz dazu angetan schien, die Möglichkeit einer ehelichen Verbindung mit Beatrix näherzurücken. Es handelte sich um eine italienische Reise. Dass Beatrix ihn begleitete, ging natürlich nicht, und so versprach man sich wöchentlich zwei- bis dreimal zu schreiben, wobei, da Beatrix’ Eltern immer noch nichts merken durften, Theodor die Vermittlung der Korrespondenz besorgen sollte. Theodor unterzog sich dem Auftrag mit gewohnter Bereitwilligkeit. Obwohl die ganze Reise nur auf den Rest des Sommers und den kommenden Winter bis Neujahr berechnet war, kostete die Trennung Beatrix doch reichliche Tränen; und da war es nun wiederum Theodor, der dieselben durch alle nur denkbaren Trostworte trocknete, während Sitterding voll froher Zuversicht in die Zukunft blickte.
Nach einer ausgelassenen Abschiedsfeier reiste er ab und fuhr in einer Tour bis Neapel, wo er drei Monate nach seiner Ankunft an der Cholera erkrankte und starb. In Theodor, dessen elender Zustand sich während dieser Zeit dank seinem Vermittleramt eher verschlimmert als verbessert hatte, richtete die Nachricht davon eine solche Verwirrung an, dass er nicht dazu kam, einen einzigen vernünftigen Gedanken zu fassen, sondern fortwährend lachte. Ganz dunkel schwebte ihm freilich das Bewusstsein vor, er müsse Beatrix schonen. Beatrix ahnte natürlich noch nichts. Sie hätte sonst wohl kaum am hellen Nachmittag so ruhig schlummernd im Garten in der Hängematte gelegen.
Theodor hatte sich, jedes Gespräch sorgfältig vermeidend, in einen Rohrstuhl zur Seite der Hängematte niedergelassen und Hut und Stock neben sich ins Gras gelegt. Mit unendlicher Gleichgültigkeit schweifte sein müdes Auge über die Schlummernde weg in unbegrenzte Ferne. In der Tiefe dieses Auges glomm es unstet düster wie ein einsames Irrlicht im nächtlichen Dunkel eines Waldgrundes.
Er schauderte zusammen und atmete auf. Ein in Briefform zusammengefaltetes schwarzgerändertes Papier, das er aus der Brieftasche gezogen, ließ er sich zwischen beiden Zeigefingerspitzen um seine Diagonale drehen. Es drehte sich schneller, wilder, und indem er dem Spiel zusah, musste er lautlos lächeln. Dann glitt sein Blick von dem Papier auf die vor ihm ruhende Gestalt hinüber, glitt die schlanken Formen langsam auf und nieder und wieder zurück auf das Papier, und die starr geschlossenen Lippen lächelten nach wie vor.
Da plötzlich scheint ein Kampf in ihm zu entbrennen. Sein Gesicht beginnt in allen Muskeln zu zucken, fällt in raschem Wechsel aus einer Verzerrung in die andere. Wie eine Spindel schwirrt das Papier um seine Achse. Hastig fährt er mit dem Oberkörper nach vorn – sinkt aber sofort wieder in seine vorige Lage zurück und wird ruhig.
Er besinnt sich, schüttelt sich und steht im Begriff, das Blatt wieder einzustecken. Im nächsten Moment zuckt es zum zweiten Mal in seinem blassen Antlitz auf, jählings grell wie der Blitz über einem Schlachtfeld. Und mit straff emporgezogenen Augenbrauen, den Mund mit den aufgeworfenen Lippen halb geöffnet, sich sachte, langsam, lauernd vornüberneigend, ängstlich den Atem anhaltend, schiebt er mit zitternden Fingern die auf feinstes italienisches Velinpapier gedruckte Todesanzeige seines Freundes behutsam, vorsichtig unter den zierlichen Brustlatz der weißen Spitzenschürze, die in vielen Falten über das rot und weiß gestreifte knappe Waschkleid1 des Mädchens herunterfließt. Nicht minder geräuschlos lehnt er sich wieder zurück. Ganz unverkennbar ist ihm ein Stein vom Herzen gefallen. Indem er sich eine Zigarre anzündet, fällt sein Blick von Neuem auf die Schlummernde. Nicht ohne Wohlgefallen verweilt er jetzt bei dem tiefen Frieden in ihren kindlich harmlosen Zügen. Er betrachtet mit Interesse ihren zwar etwas großen, aber weichgeformten, süßgeschlossenen Mund, diese himmlisch helle Stirne, die sanft gewölbten rosigen Lider mit den langen, dunkeln, schattigen Wimpern ...




























