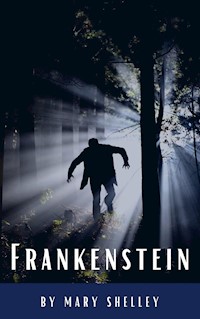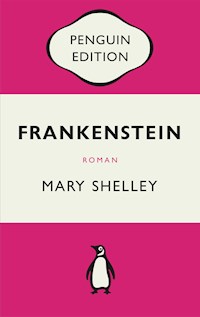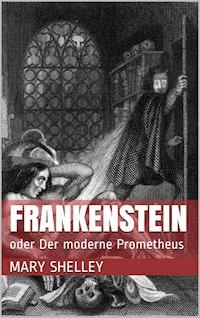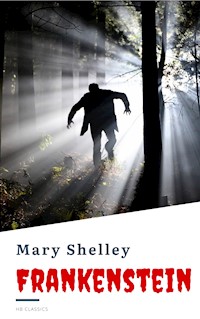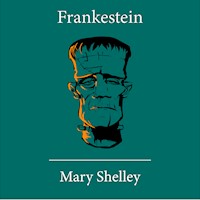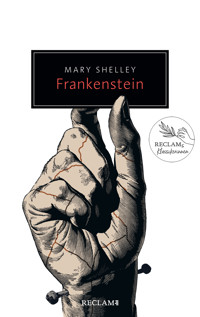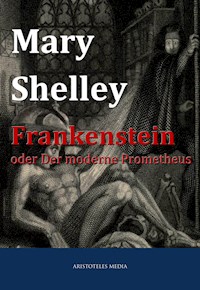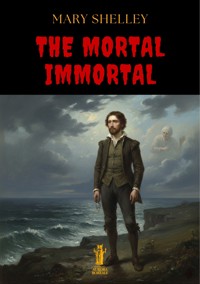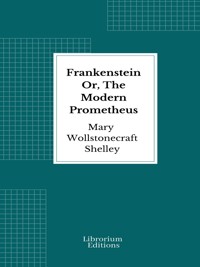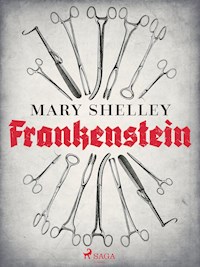
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: SAGA EgmontHörbuch-Herausgeber: GLM
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: World Classics
- Sprache: Deutsch
Die weltbekannte Geschichte eines Experiments, das aus dem Ruder läuft und Tod und Schaden anrichtet: Der junge Schweizer Viktor Frankenstein erschafft an der Universität Ingolstadt einen künstlichen Menschen. Als dieser jedoch viel hässlicher und furchteinflößender ist, als gedacht, flieht Viktor vor ihm und das Wesen entkommt. Doch es dauert nicht lange, bis der erste Todesfall in seiner Familie eintritt, und er bleibt nicht der letzte...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Mary Shelley
Frankenstein
Übersetzt Christian Barth
Saga
Frankenstein ÜbersetztChristian Barth Coverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1818, 2020 Mary Shelley und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726539394
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
VORWORT
Dr. Darwin und einige deutsche Wissenschaftler hielten das Ereignis, von dem im Folgenden berichtet wird, für möglich. Von mir kann man nicht erwarten, daß ich einem solchen Hirngespinst auch nur den geringsten Glauben schenke. Ich benützte es zwar als Grundlage meiner phantastischen Erzählung, doch wollte ich keineswegs nur eine Reihe seltsamer Schrecknisse miteinander verknüpfen. Der Begebenheit, die Interesse verdient, haften durchaus nicht die Nachteile einer gewöhnlichen Spukgeschichte an. Mag sie in physischer Hinsicht auch unmöglich sein, so bietet sie doch eine völlig neuartige Situation: Die Einbildungskraft dringt weiträumiger und tiefer in die menschlichen Leidenschaften ein als sonst bei gewöhnlichen Beziehungen zwischen tatsächlichen Geschehnissen.
Ich habe mich bemüht, an der Wahrheit der elementaren Gesetze der menschlichen Natur festzuhalten, während ich ohne Bedenken neuartige Verwicklungen einführte. Die Ilias, die tragische Dichtung Griechenlands, Shakespeare im »Sturm« und im »Sommernachtstraum« und besonders Milton im »Verlorenen Paradies« richten sich nach dieser Regel; der simpelste Schriftsteller, der nur unterhalten will, wendet ohne Anmaßung dieselbe Regel an, nach der so viele ausgeklügelte Verwicklungen menschlichen Empfindens in den größten Dichtungen verlaufen.
Meine Geschichte stützt sich auf Dinge, die einmal beiläufig erwähnt wurden. Ich fing sie aus Vergnügen und als ein Mittel zur Belebung brachliegender geistiger Fähigkeiten zu schreiben an. Andere Motive vermischten sich damit während der Arbeit. Wenn ich auch nicht gleichgültig gegenüber den moralischen Wirkungen bin, die durch die Empfindungen oder die Charaktere des Werks auf den Leser ausgeübt werden, so beschränkte ich mich dennoch darauf, die entnervenden Effekte der Gegenwartsromane zu vermeiden und dafür die Liebenswürdigkeit persönlicher Neigung und die Größe universaler Tugend herauszustellen. Die Ansichten, die sich natürlicherweise aus dem Charakter und der Situation des Helden ergeben, dürfen nicht als meine eigene Überzeugung betrachtet und keine Folgerung auf diesen Seiten als eine voreilige Beurteilung eines philosophischen Systems bewertet werden.
Für mich ist es zudem reizvoll, daß die Niederschrift in jener eindrucksvollen Landschaft begonnen wurde, von der auch die Handlung ihren Ausgang nimmt, sowie in einem geselligen Kreis, den ich immer vermissen werde. Ich verbrachte den Sommer 1816 in der Umgebung Genfs. Die Jahreszeit war kühl und regnerisch; an den Abenden drängten wir uns um ein flackerndes Holzfeuer und amüsierten uns an deutschen Geistergeschichten, auf die wir zufällig gestoßen waren. Sie erregten in uns den spielerischen Wunsch, ähnliches zu erfinden. Meine zwei Freunde – aus deren Feder das Publikum weitaus bessere Erzählungen als aus meiner erwarten dürfte – und ich kamen überein, jeder von uns solle eine Geschichte um eine gespenstische Begebenheit schreiben.
Das Wetter heiterte sich plötzlich auf; meine beiden Freunde brachen zu einer Alpenwanderung auf und vergaßen beim Anblick der großartigen Szenerie ihre Gespenstervisionen. Die folgende Erzählung wurde als einzige vollendet.
Marlow, September 1817
ROBERT WALTON AN FRAU SAVILLE, SEINE IN ENGLAND LEBENDE SCHWESTER:
Erster Brief
St. Petersburg, den 11. Dezember 17. .
Du wirst gewiß mit Freude hören, daß sich mein Unternehmen trotz der üblen Vorzeichen bisher gut anließ. Ich traf gestern hier ein und habe nichts Eiligeres zu tun, als meiner lieben Schwester mein Wohlergehen zu versichern und ihr Vertrauen auf meinen Erfolg zu stärken.
Von London aus gesehen, befinde ich mich bereits weit im Norden. Wenn ich durch die Straßen von St. Petersburg wandere, verspüre ich eine kalte Brise auf meinen Wangen, die meine Nerven kräftigt und mir frohen Mut verleiht. Verstehst Du diese Empfindung? Die Brise weht aus jenen Breiten, denen ich mich nähere, und vermittelt mir einen Vorgeschmack des eisigen Klimas. Meine Tagträume werden durch diesen Wind der Verheißung zu funkelnder Lebhaftigkeit ermutigt. Vergeblich suche ich mich zu überreden, der Pol sei der Ursprung des Frostes, der Trostlosigkeit. Stets bietet er sich meiner Vorstellung als ein Ort der Schönheit, der Freude an. Dort, Margret, leuchtet die Sonne ewig. Ihr gewaltiges Rad rollt am Horizont hin und verströmt einen beständigen Glanz. Dort – Du erlaubst, liebe Schwester, daß ich den mir zuvorgekommenen Seeleuten glaube – gibt es weder Schnee noch Kälte. Sind wir über das stille Meer gefahren, so werden wir an ein Land getragen, dessen wunderbare Beschaffenheit jede bisher entdeckte Gegend auf dem bewohnbaren Erdball übertrifft. Seine Erzeugnisse und seine Formen sind wie die Erscheinungen der Himmelskörper in jener unbetretenen Einsamkeit zweifellos ohne Beispiel. Was ist nicht alles zu erwarten in einem Land des ewigen Lichts? Ich könnte dort die geheimnisvolle Kraft entdecken, die den Kompaß lenkt; ich könnte tausend Himmelsbeobachtungen erklären, die nur diese Reise erfordern, um ihre scheinbaren Unregelmäßigkeiten als richtig zu erweisen. Ich werde meine brennende Neugierde mit dem Anblick eines noch unerschlossenen Teils der Welt sättigen; ich werde ein Land betreten, das noch nie die Fußspuren eines Menschen trug. Das ist mein Ansporn, der jede Angst vor Gefahr oder Tod verscheucht und mich veranlaßt, die mühselige Reise mit einer Freude zu beginnen, wie sie ein Kind empfinden muß, das mit seinen Ferienkameraden im kleinen Boot zu einer Entdeckungsfahrt längs des heimatlichen Flusses aufbricht. Aber angenommen, alle Mutmaßungen wären falsch, dann kannst Du dennoch die unschätzbare Wohltat nicht abstreiten, die ich der ganzen Menschheit bis ins letzte Glied erwiese, wenn ich eine Durchfahrt nahe dem Pol für jene Länder entdeckte, die man gegenwärtig erst nach vielen Monaten erreichen kann, oder wenn ich das Geheimnis des Magneten ermittelte, was – falls überhaupt – nur durch ein Unternehmen wie meines geschehen kann.
Diese Überlegungen haben die Unruhe, mit der ich den Brief zu schreiben begann, zerstreut und eine himmelstürmende Begeisterung in meinem Herzen entfacht. Nichts trägt mehr dazu bei, dem Geist Ruhe zu schenken, als ein stetiges Ziel – ein Punkt, auf den die Seele ihr inneres Auge richtet. Diese Expedition war der Lieblingstraum meiner Jugend. Ich las mit heißem Eifer die Berichte über die verschiedenen Reisen, auf denen man den Nordpazifik über die den Pol umgebenden Meere erreichen wollte. Gewiß erinnerst Du Dich, daß eine Geschichte aller Forschungsreisen die ganze Bibliothek unseres guten Oheims Thomas darstellte. Meine Erziehung wurde zwar vernachlässigt, doch las ich leidenschaftlich gern. Tag und Nacht verbrachte ich über den Büchern; meine Vertrautheit mit ihnen vermehrte mein Bedauern, als ich im Kindesalter erfuhr, daß der ausdrückliche Wunsch meines Vaters meinem Qheim verbot, mir ein Seemannsleben zu gestatten.
Derartige Visionen verblaßten, als ich zum erstenmal jene Dichter las, deren Ergüsse meine Seele in höhere Sphären entrückten. Auch ich wurde ein Dichter und lebte ein Jahr lang im Paradies meiner eigenen Schöpfung; ich träumte davon, eine Nische im Tempel, in dem die Namen Homers und Shakespeares geheiligt werden, zu erhalten. Du kennst mein Versagen zur Genüge und weißt, wie schwer ich an der Enttäuschung trug. Gerade damals erbte ich das Vermögen meines Vaters, und frühere Wünsche wurden wieder in mir wach.
Vor sechs Jahren entschloß ich mich zu meinem gegenwärtigen Unternehmen. Die Erinnerung an die Stunde, in der ich mich dem großen Wagnis weihte, lebt noch in mir. Zunächst gewöhnte ich meinen Körper an Beschwernisse. Ich begleitete die Walfischer auf mehreren Fahrten ins Nordmeer; ich ertrug freiwillig Kälte, Hunger, Durst und den Mangel an Schlaf; ich arbeitete tagsüber härter als die Seeleute und widmete meine Nächte dem Studium der Mathematik, der Medizin und jener Zweige der Naturwissenschaft, die einem Abenteurer auf See nützlich sind. Zweimal heuerte ich als Untermaat auf einem Grönlandwalfänger an und erwarb mir einiges Ansehen. Ich gestehe, daß ich stolz war, als mir der Kapitän die zweite Stelle auf dem Schiff anbot und mich dringlich ums Bleiben ersuchte, da meine Dienste ihm wertvoll erschienen.
Warum, liebe Margret, sollte ich mir nicht die Ausführung eines größeren Plans zumuten? Mein Leben hätte in Wohlstand und Überfluß verlaufen können; aber ich zog den Ruhm jeder Lockung vor, die der Reichtum in meinen Weg stellte. Wenn nur eine einzige bestätigende Stimme mich ermunterte! Mein Mut und mein Entschluß wanken nicht, aber meine Hoffnungen schwanken, und oft bin ich niedergedrückt. Ich will eine lange, schwierige Reise fortsetzen; unerwartete Ereignisse werden meine ganze Tapferkeit erfordern. Ich muß nicht nur die Stimmung anderer zu heben, sondern auch meine eigene zu halten suchen.
Jetzt ist die günstigste Zeit, um in Rußland zu reisen. Die Schlitten fliegen eilig über den Schnee; so läßt sich weit gemütlicher fahren als in einer englischen Postkutsche. Die Kälte beißt nicht zu arg, wenn man – wie ich nun – in Pelze gehüllt ist. Es besteht nämlich ein großer Unterschied zwischen Herumlaufen und stundenlangem, bewegungslosem Sitzen, wenn keinerlei Tätigkeit das Blut daran hindert, in den Adern zu gefrieren. Ich beabsichtige nicht, mein Leben auf der Straße zwischen St. Petersburg und Archangelsk einzubüßen.
Ich werde nach der letztgenannten Stadt in zwei oder drei Wochen aufbrechen. Dort will ich ein Schiff mieten – was nicht schwerfallen dürfte, wenn ich dem Eigentümer die Versicherung bezahle – und so viele mit dem Walfang vertraute Matrosen anheuern, wie ich brauche. Vor Juni werden wir nicht segeln – wann werde ich wiederkehren? Wer weiß die Antwort, liebe Schwester? Habe ich Erfolg, dann vergehen viele Monate, vielleicht Jahre, bevor wir uns wiedersehen. Mißlingt es mir, wirst Du mich bald oder nie mehr erblicken.
Leb wohl, meine teuerste Margret! Der Himmel möge Dich segnen und mich beschützen, damit ich auch in Zukunft meinen Dank für Deine Güte und Freundlichkeit bezeugen kann.
Herzlichst, Dein Bruder!
Zweiter Brief
Archangelsk, den 28. März 17 . .
Wie träg verrinnt die Zeit in diesem Kerker aus Frost und Schnee! Dennoch – ein zweiter Schritt auf meinem Weg ist getan: Ich habe ein Schiff gemietet und sammle nun meine Matrosen. Die Männer, die ich bereits angeheuert habe, scheinen verläßlich und guten Muts zu sein.
In mir lebt ein Wunsch, dem bisher keine Erfüllung beschieden war. Ich leide sehr darunter, Margret, daß ich keinen Freund habe. Wenn die Begeisterung über ein gelungenes Werk in mir glüht, dann gibt es niemanden, der meine Freude teilt; wenn mich die Enttäuschung niederdrückt, ist niemand da, der mich in meinem Trübsinn aufrichtet. Gewiß, ich werde meine Gedanken dem Papier anvertrauen; aber das ist eine armselige Hilfe, um Gefühle mitteilen zu können. Ich sehne mich nach der Gesellschaft eines Mannes, der wie ich empfindet, dessen Blick dem meinen antwortet. Du hältst mich für romantisch, liebe Schwester, doch mich schmerzt es einfach, keinen Freund zu besitzen. Niemand steht neben mir, dessen Sinn ruhig und mutig, dessen Geist sowohl kultiviert als auch weit gespannt, dessen Geschmack dem meinen ähnlich ist, der meine Pläne billigt oder verbessert. Ein solcher Freund könnte die Fehler Deines Bruders wettmachen! Ich handle oft übereilt und werde bei Schwierigkeiten ungeduldig. Noch schlimmer ist, daß ich Autodidakt bin, denn die ersten vierzehn Jahre meines Lebens wucherte ich wie eine Wildpflanze und las nichts außer den Reisebüchern unseres Oheims Thomas. Dann lernte ich unsere gefeierten Dichter kennen; erst als es zu spät war, Vorteile daraus zu ziehen, erkannte ich die Notwendigkeit, mehr Sprachen als nur die eigene zu beherrschen. Jetzt, im Alter von achtundzwanzig, bin ich ungebildeter als mancher fünfzehnjährige Schuljunge. Ich habe zwar mehr nachgedacht, und meine Phantasie ist ausgedehnter und glänzender, aber sie bedarf – wie ein Maler sagen würde – der Gestaltung. Ich brauche einen Freund, der so viel Verständnis hat, um mich nicht als Phantasten zu verachten, und so große Zuneigung, um die Aufgabe, meinen Geist zu formen, auf sich zu nehmen.
Ich weiß, das sind müßige Klagen; auf dem weiten Ozean finde ich bestimmt keinen Freund, und auch hier nicht unter den Kaufleuten und Matrosen in Archangelsk. Allerdings schlägt selbst bei ihnen, unter Schlacke verborgen, manch warmes Herz. Mein Leutnant ist ein Mann, der Kühnheit und Unternehmungslust besitzt; er verzehrt sich nach dem Ruhm, oder eigentlich nach Verbesserung seines Berufs. Er ist Engländer und trotz der nationalen und standesmäßigen Vorurteile nicht durch die Zivilisation verweichlicht; er zeichnet sich durch die Neigung zu vornehmer Menschlichkeit aus. An Deck eines Walfängerschiffs lernte ich ihn kennen. Als ich ihn in dieser Stadt ohne Beschäftigung antraf, heuerte ich ihn ohne weiteres an, um meinem Vorhaben seine Unterstützung zu gewinnen.
Auch der Steuermann zeigt einen ansprechenden Charakter. An Bord fällt seine milde Zucht auf. Dieser Umstand – zu dem seine wohlbekannte Untadeligkeit und sein unbezweifelbarer Mut kamen – ließ mich ihn anwerben. Meine einsame Jugend, meine glücklichen Jahre unter Deiner sanften Obhut, haben die Grundzüge meines Wesens so verfeinert, daß ich eine gehörige Abscheu vor der Brutalität, wie sie auf Schiffen üblich ist, nicht überwinden kann. Ich glaubte niemals, daß sie unumgänglich ist. Als ich von einem Seemann hörte, der gleicherweise wegen seiner Herzensgüte und des Respekts, den ihm seine Mannschaft erweise, gerühmt wurde, hielt ich es für günstig, mir seine Dienste zu sichern. Eine Dame, die ihm ihr Lebensglück verdankt, erzählte mir seine recht romantische Geschichte. Sie hört sich so an: Vor einigen Jahren entbrannte er in Liebe zu einer jungen Dame russischer Abkunft, die keineswegs reich war. Nachdem er durch Prisengelder ein beträchtliches Vermögen angehäuft hatte, stimmte der Vater des Mädchens der Heirat zu. Er sah seine Angebetete nur einmal vor der vereinbarten Hochzeit; sie wär von Tränen überströmt, warf sich ihm zu Füßen und flehte ihn um Gehör an. Sie gestand ihm, daß sie einen anderen liebe, der aber arm sei und den ihr Vater nie als Schwiegersohn annehmen würde. Großherzig besänftigte er sie, gab sein Werben sogleich auf und bat nur um den Namen ihres Geliebten. Das bereits erworbene Gut, auf dem er sein künftiges Leben verbringen wollte, übereignete er samt dem restlichen Prisengeld seinem Rivalen, der damit ein wohlhabender Mann wurde. Dann bat er den Vater des Mädchens, der Heirat mit ihrem Geliebten zuzustimmen. Der alte Mann weigerte sich und hielt an seiner Verpflichtung gegenüber meinem Steuermann aus Ehrengründen fest. Dieser verließ das Land und kehrte erst zurück, als er hörte, daß seine frühere Angebetete ihrer Liebe gemäß verheiratet war. »Das ist ein edler Mann!« wirst Du sagen. Du hast recht; aber er ist ungebildet und schweigsam wie ein Türke. Eine unbewußte Sorglosigkeit haftet ihm an, die sein Verhalten zwar um so erstaunlicher werden, Interesse und Zuneigung, die er sonst erwarten könnte, aber zurücktreten läßt.
Glaube aber nicht, daß ich mich beklage oder mir einen unerreichbaren Trost für meine Mühsal ersinne, daß meine Entschlüsse schwanken. Sie stehen fest wie das Schicksal. Meine Reise ist nur aufgeschoben, bis das Wetter die Einschiffung erlaubt. Der Winter war äußerst streng, aber der Frühling beginnt hoffnungsvoll und gilt als erstaunlich vorzeitig. Vielleicht kann ich früher segeln, als ich erwartete. Ich werde nichts übereilen. Du kennst meine Vorsicht und Überlegtheit, sobald mir die Sicherheit anderer anvertraut ist.
Ich kann Dir meine Empfindungen angesichts des nahen Beginns meines Unternehmens nicht schildern. Unmöglich vermag ich dir einen Begriff der Erregung zu vermitteln, die halb freudig, halb ängstlich ist. Unerforschtes Gebiet will ich betreten, »das Land des Nebels und des Schnees«; doch keinen Albatros töten. Sei deshalb unbesorgt, auch wenn ich zu Dir so erschöpft und elend zurückkehren sollte wie der »Alte Seemann«. Du wirst über meine Anspielung lächeln, aber ich will Dir ein Geheimnis entdecken. Oft schrieb ich meine Neigung, meine leidenschaftliche Begeisterung für die gefahrvollen Wunder des Ozeans jenem Werk des phantasievollsten der neueren Dichter zu. Etwas geht in meiner Seele vor, das mir unverständlich bleibt. Ich bin praktisch, fleißig, sorgfältig, ein Arbeiter, der mit Beharrlichkeit und Anstrengung werkt; aber daneben ist eine Liebe für das Wunderbare in all meine Pläne verflochten, die mich hinwegtreibt von den gewöhnlichen Pfaden der Menschen, hinaus auf die wilde See und in unbekannte Gebiete, die ich erforschen will.
Doch wenden wir uns angenehmeren Gedanken zu. Wann sehe ich Dich wieder, nachdem ich die ungeheuren Meere überquert habe und um das südlichste Kap Afrikas oder Amerikas zurückgekehrt bin? Ich wage kaum auf solchen Erfolg zu hoffen; dennoch kann ich es nicht ertragen, das Gegenteil anzunehmen. Schreibe mir vorläufig bei jeder Gelegenheit. Deine Briefe sollen mich dann erreichen, wenn ich eine Aufmunterung meiner Stimmung benötige. Ich liebe Dich zärtlich. Behalte mich in freundlichem Gedächtnis, wenn Du nie mehr etwas von mir hörst.
Herzlich, Dein Bruder.
Dritter Brief
Den 7. Juli 17 . .
Liebe Schwester, in Eile ein paar Zeilen: Ich bin wohlauf, und meine Reise schreitet frisch voran. Ein Kaufmann, der von Archangelsk heimreist, soll diesen Brief nach England bringen. Er ist glücklicher als ich, denn ich sehe mein Vaterland vielleicht jahrelang nicht mehr. Doch erfüllt mich frohe Hoffnung; meine Leute besitzen Kühnheit und ernsten Willen. Selbst die treibenden Eisschollen, die ohne Unterlaß an uns vorüberziehen und die Gefahren jenes Gebiets, dem wir näher kommen, anzeigen, können sie nicht schrecken. Wir haben nun einen sehr hohen Breitengrad erreicht. Der Höhepunkt des Sommers ist überschritten; obwohl es nicht so warm ist wie in England, tragen die südlichen Stürme, die uns schnell auf jene von mir so leidenschaftlich ersehnten Küsten zutreiben, eine recht belebende Wärme zu uns her, wie ich sie nicht erwartet hätte.
Bisher überraschten uns keine Zwischenfälle, die in einem Brief erwähnenswert wären. Eine oder zwei steife Brisen und ein Leck sind Unfälle, deren erfahrene Seeleute sich kaum erinnern; ich werde zufrieden sein, wenn uns auf der Reise nichts Schlimmeres zustößt.
Ade, liebe Margret; sei gewiß, daß ich um meinetwillen wie um Deinetwillen mich nie unüberlegt einer Gefahr aussetzen werde. Ich werde kühl, beharrlich und vorsichtig sein.
Aber der Erfolg soll meine Bemühungen krönen. Warum auch nicht? Ich bin weit gelangt, ich habe einen sicheren Weg über das pfadlose Meer gezogen; die Sterne selbst sind Zeugen und Beweis meines Triumphes. Warum soll ich nicht weiter vordringen auf dem ungezähmten und doch gehorsamen Element? Was kann das entschlossene Herz und den festen Willen eines Menschen zurückhalten?
Mein übervolles Herz will sprechen. Aber ich muß aufhören. Der Himmel segne meine geliebte Schwester!
Vierter Brief
Den 5. August 17 ..
Ein seltsames Ereignis ist geschehen, das ich Dir berichten muß, obwohl Du mich wahrscheinlich sehen wirst, ehe diese Blätter in Deinen Besitz gelangen.
Letzten Montag, den 21. Juli, waren wir von Eis umgeben, das sich allseits an unser Schiff klammerte und ihm kaum Raum ließ, vorwärts zu kommen. Unsere Lage war gefährlich, zumal uns dichter Nebel einhüllte. Wir drehten bei und hofften auf eine baldige Änderung des Wetters. Gegen zwei Uhr lichtete sich der Nebel, und wir sahen ringsum weite und unregelmäßige Ebenen aus Eis, die kein Ende zu nehmen schienen. Einige meiner Gesellen murrten; ich selbst begann stutzig zu werden und ängstliche Gedanken zu hegen, als ein merkwürdiger Anblick plötzlich unsere Aufmerksamkeit auf sich zog und uns von der Sorge um die eigene Situation ablenkte. Wir sahen ein niedriges Gefährt, das auf Schlittenkufen befestigt war und von Hunden gezogen wurde, eine halbe Meile entfernt in nördlicher Richtung vorbeifahren. Ein Wesen, das die Umrisse eines Menschen hatte, aber augenscheinlich von gigantischer Statur war, saß in dem Schlitten und lenkte die Hunde. Wir beobachteten das schnelle Vorüberfliegen des Reisenden mit unseren Fernrohren, bis er in den fernen Unebenheiten des Eises verschwand.
Unverhohlenes Staunen bemächtigte sich unser aller. Wir waren nach unserer Meinung viele hundert Meilen von jedem Land entfernt; aber diese Erscheinung schien zu bedeuten, daß es in Wirklichkeit weniger weit war, als wir vermutet hatten. Da wir von Eis umschlossen blieben, konnten wir der Spur, die wir mit größter Aufmerksamkeit betrachtet hatten, nicht folgen.
Ungefähr zwei Stunden danach vernahmen wir das Grollen der Grundsee. Vor Mitternacht barst das Eis, und unser Schiff war frei. Wir lagen jedoch bis zum Morgen still, weil wir fürchteten, in der Dunkelheit mit den schwimmenden Ungeheuern zusammenzustoßen, die nach dem Brechen des Eises herumtrieben. Ich nützte diese Zeit, um einige Stunden auszuruhen.
Am Morgen ging ich, sobald es hell geworden, an Deck und fand alle Seeleute auf der einen Seite des Schiffs versammelt; sie unterhielten sich anscheinend mit jemandem auf dem Meer. Tatsächlich war in der Nacht ein Schlitten, jenem gleich, den wir gestern gesehen hatten, auf einer Eisscholle auf uns zugetrieben. Nur ein Hund war am Leben geblieben, doch es befand sich ein Mensch darin, den die Matrosen gerade überredeten, auf das Schiff zu kommen. Er war nicht, wie es der andere Reisende gewesen zu sein schien, ein wilder Bewohner einer unentdeckten Insel, sondern ein Europäer. Als ich an Deck trat, sagte der Steuermann: »Da kommt unser Kapitän, der gewiß nicht zulassen wird, daß Ihr auf offener See zugrunde geht.«
Der Fremde blickte mich an und sagte dann in englischer Sprache, allerdings mit ausländischem Akzent, zu mir: »Ehe ich den Fuß auf Ihr Schiff setze, möchte ich Sie in aller Freundlichkeit um eine Erklärung bitten, warum Sie hier sind.« Gewärtige Dir meine Verwunderung über eine derartige Frage aus dem Munde eines Mannes, der am Rande des Untergangs stand und für den meiner Überzeugung nach unser Schiff eine Zuflucht bilden mußte, die er nicht für alle Kostbarkeiten der Welt eingetauscht hätte. Ich antwortete, daß wir auf einer Forschungsreise zum Nordpol wären.
Als er das hörte, schien er befriedigt; er willigte ein, auf das Schiff zu kommen. Mein Gott, Margret – hättest Du nur den Mann sehen können, der so auf seine Sicherheit bedacht war! Wie erstaunt wärest Du gewesen! Seine Glieder waren nahezu erfroren, und sein Leib war durch die Erschöpfung in erschreckender Weise ausgemergelt. Niemals sah ich einen Menschen in solch bejammernswertem Zustand. Wir trugen ihn in eine Kajüte; sobald er sich nicht mehr an der frischen Luft befand, fiel er in Ohnmacht. Wir brachten ihn daher an Deck zurück und verhalfen ihm zum Bewußtsein, indem wir ihn mit Branntwein einrieben und ihn zwangen, eine kleine Menge davon zu trinken. Als er wieder Lebenszeichen von sich gab, wickelten wir ihn in Wolldecken und schleppten ihn in die Nähe des Kamins unserer Küche. Er erholte sich allmählich und genoß ein wenig Suppe, die ihm wohltat.
Zwei Tage vergingen, ehe er sprechen konnte. Ich fürchtete oft, daß die erlittenen Beschwernisse ihm den Verstand geraubt hätten. Als er sich etwas besser fühlte, brachte ich ihn in meine eigene Kajüte und pflegte ihn, soweit es meine Obliegenheiten nur erlaubten. Noch nie ist mir ein gleichermaßen interessanter Mensch vor Augen gekommen: sein Blick drückt gewöhnlich Wildheit, sogar Wahnsinn aus; doch gibt es Augenblicke (wenn ihm jemand mit freundlicher Geste begegnet oder einen geringfügigen Dienst leistet), in denen sich sein ganzes Aussehen aufhellt, gewissermaßen durch einen Strahl von Güte und Liebenswürdigkeit, wie ich es zuvor bei niemandem erlebt habe. Im allgemeinen ist er melancholisch und verzweifelt; manchmal knirscht er mit den Zähnen, als ob er sich ungeduldig aufbäume gegen die drückende Last des Leids.
Nachdem sich mein Gast ein wenig erholt hatte, kostete es mich keine geringe Mühe, die Leute fernzuhalten, die ihm tausenderlei Fragen stellen wollten. Ich gestattete nicht, daß er bei seiner körperlichen und geistigen Verfassung, deren Besserung offensichtlich von einer völligen Entspannung abhing, durch ihre müßige Neugierde gequält würde. Einmal jedoch fragte der Leutnant, warum er sich in einem derart seltsamen Gefährt so weit auf das Eis hinausgewagt habe.
Sein Gesicht nahm sofort den Ausdruck tiefster Düsternis an, und er antwortete: »Um jemanden zu suchen, der vor mir floh.«
»Reiste der Mann, den Ihr verfolgtet, auf die gleiche Weise?«
»Ja.«
»Dann glaube ich, haben wir ihn gesehen; am Tag, ehe wir Euch fanden, sahen wir einige Hunde einen Schlitten mit einem Menschen über das Eis ziehen.«
Das erregte die Aufmerksamkeit des Fremden. Er stellte eine Menge Fragen über die Richtung, die der Dämon, wie er ihn nannte, eingeschlagen hatte. Bald danach, als er mit mir allein war, sagte er: »Ich habe zweifellos Ihre Neugierde geweckt, wie auch die Ihrer guten Leute; aber Sie sind zu rücksichtsvoll, um mich mit Fragen zu bedrängen.«
»Es wäre in der Tat ungehörig und unmenschlich von mir, Sie mit meiner Wißbegierde zu belästigen.«
»Sie retteten mich aus einer seltsamen und gefährlichen Situation; Sie haben mir durch Ihre Güte das Leben wiedergegeben.«
Später fragte er mich, ob ich annähme, daß der Eisbruch den anderen Schlitten vernichtet habe. Ich antwortete, dies könnte ich nicht mit Sicherheit sagen. Das Eis sei erst vor Mitternacht zerborsten, und der Reisende könnte einen sicheren Ort schon vor diesem Zeitpunkt erreicht haben. Darüber wagte ich jedoch kein endgültiges Urteil zu fällen.
Von da an befeuerte ein neuer Lebensgeist die verfallende Gestalt des Fremden. Er zeigte den größten Eifer, an Deck zu gelangen, um nach dem Schlitten zu sehen, der damals beobachtet wurde; ich überredete ihn aber, in der Kajüte zu bleiben, denn er ist viel zu schwach, als daß er das rauhe Klima ertragen könnte. Ich mußte versprechen, daß jemand für ihn Ausschau halten und ihm sofort Nachricht geben würde, wenn irgendein neuer Gegenstand in Sichtweite auftauchen sollte.
Soweit mein Tagebuch, das über das seltsame Ereignis bis zum heutigen Tag berichtet. Der Gesundheitszustand des Fremden hat sich allmählich gebessert, aber er ist sehr schweigsam und wird unruhig, sobald jemand außer mir die Kajüte betritt. Jedoch wirken seine Umgangsformen so versöhnend und vornehm, daß die Matrosen alle Interesse für ihn zeigen, obwohl sie kaum Verbindung mit ihm haben. Ich selbst fange an, ihn wie einen Bruder zu lieben; sein anhaltender und tiefer Kummer erfüllt mich mit Zuneigung und Mitleid. Er muß in seinen besseren Tagen ein ausgezeichneter Mensch gewesen sein, da er sogar als Wrack noch so anziehend und liebenswert erscheint.
Ich klagte Dir in einem meiner Briefe, liebe Margret, daß ich auf dem öden Ozean keinen Freund finden könne. Jetzt habe ich einen Mann gefunden, den ich als Herzensbruder hätte besitzen mögen, ehe sein Geist von Elend zerrüttet wurde.
Ich werde mein Tagebuch, soweit es den Fremden betrifft, in Abständen fortsetzen, falls sich Neues ereignet.
Den 13. August 17 . .
Meine Zuneigung für meinen Gast wächst täglich. Er ruft in mir zu gleicher Zeit Bewunderung und Mitleid in höchstem Grad hervor. Wer kann solch einen vorzüglichen Menschen von Leiden gepeinigt sehen, ohne selbst nagenden Kummer zu empfinden? Er ist gütig und klug, sein Geist ist gebildet. Wenn er spricht, strömen seine Worte, obwohl sie trefflichst gewählt sind, flüssig und unvergleichlich beredsam dahin.
Er hat sich nun weitgehend von seiner Krankheit erholt und befindet sich ständig an Deck, anscheinend um Ausschau nach dem Schlitten zu halten, der seinem eigenen voraneilte. Zwar ist er vom Unglück gezeichnet, doch beschäftigt er sich nicht ausschließlich mit seinem eigenen Elend, sondern kümmert sich um die Plane anderer. Häufig unterhielt er sich mit mir über die meinen, die ich ihm ohne Heimlichtuerei mitteilte. Er ging aufmerksam auf alle Argumente zugunsten meines möglichen Erfolgs ein, sogar auf jedes winzige Detail der Maßnahmen, die ich getroffen hatte, um ihn zu sichern. Die Teilnahme, die er mir erwies, indem er die Sprache meines Herzens benützte, veranlaßte mich, die geheimsten Absichten meines Innern aufzudecken. Voll Leidenschaft sagte ich ihm, wie gern ich mein Vermögen, meine Existenz, meine ganze Hoffnung dem Erfolg meines Unternehmens opfern würde. Leben oder Tod eines Menschen wären nur ein geringer Preis für den Gewinn des Wissens, den ich suchte, für die Herrschaft, die ich über die elementaren Feinde der Menschheit erlangen, die ich weiterreichen würde. Während ich sprach, breitete sich ein Schatten auf dem Gesicht meines Zuhörers aus. Ich bemerkte zunächst, daß er seine Bewegung zu unterdrücken suchte, denn er hob die Hände vor seine Augen. Meine Stimme versagte, als ich Tränen zwischen seinen Fingern hindurchquellen sah und ein Stöhnen aus seiner Brust brach. Ich verstummte, und er sprach mit stockender Stimme: »Unseliger! Sind auch Sie diesem Wahn verfallen? Haben auch Sie aus diesem Giftbecher getrunken? Hören Sie mich an – ich will Ihnen meine Geschichte enthüllen, und Sie werden den Becher von Ihren Lippen schleudern!«
Diese Worte erregten, wie Du Dir denken kannst, meine Neugierde in ungemeiner Weise. Heftige Schwermut suchte den Fremden heim und besiegte seine geschwächten Kräfte; viele Stunden der Entspannung und ruhiger Unterhaltung waren nötig, um seinen Gemütszustand wieder auszugleichen.
Als er die Unrast seiner Gefühle überwunden hatte, schien er sich selbst zu verachten, weil er der Sklave seiner Leidenschaften geworden war. Nun unterdrückte er die düstere Tyrannei der Verzweiflung und regte mich dazu an, Dinge zu besprechen, die meine eigene Person betrafen. Er erkundigte sich nach der Geschichte meiner früheren Jahre. Das war schnell erzählt, doch ergab sich daraus manche Überlegung. Ich sprach von meinem Wunsch, einen Freund zu finden, von meinem Durst nach tieferer Sympathie für einen verwandten Geist, was mir bisher verwehrt geblieben war. Ich drückte meine Überzeugung aus, daß sich ein Mensch auch nicht des geringsten Glückes rühmen dürfe, der diesen Segen nicht genossen habe.
»Ich gebe Ihnen völlig recht«, antwortete der Fremde, »wir sind ungeformte Geschöpfe, halb vollendet nur, falls nicht ein Klügerer, Besserer, Wertvollerer als wir selbst (ein Freund sollte so beschaffen sein) uns hilft, unsere schwachen und mängelreichen Naturen zu vervollkommnen. Ich besaß einst einen Freund, der ein wahrhaft edler Mensch war, und fühle mich daher berechtigt, über Freundschaft zu urteilen. Sie können hoffen, die Welt liegt vor Ihnen: Sie haben keine Ursache zur Verzweiflung. Aber ich habe alles verloren und kann das Leben nicht neu beginnen.«
Während er so redete, spiegelte sein Gesicht einen stillen, stetigen Schmerz wider, der mich tief berührte. Er blieb jedoch schweigsam und zog sich bald in seine Kajüte zurück.
Obwohl sein Inneres von Leid geprägt ist, kann niemand die Schönheiten der Natur tiefer empfinden als er. Der Sternenhimmel, das Meer und jeder Anblick, den diese wunderreiche Gegend bietet, scheinen eine erhebende Gewalt über seine Seele auszuüben. Einem solchen Mann ist eine doppelte Existenz gegeben: Er kann leiden, er kann von Enttäuschungen überwältigt werden, und dennoch – zieht er sich in sich selbst zurück, wird er einem himmlischen Geist ähnlich, der eine Aura um sich trägt, in deren Kreis sich weder Schmerz noch Torheit wagen.
Lächelst Du über die Begeisterung, die mich befällt, sobald ich auf diesen begnadeten Wanderer zu sprechen komme? Wenn Du ihn kennen würdest, gewiß nicht. Gebildet durch Bücher und geprägt durch Dein zurückgezogenes Leben, bist Du anspruchsvoll geworden. Das macht Dich um so geeigneter, die außergewöhnlichen Züge dieses wunderbaren Menschen zu schätzen. Ich habe mich bereits bemüht, die Eigenschaft herauszufinden, die ihn so unermeßlich weit über jede mir bisher bekannte Person hinaushebt. Ich glaube, es ist seine intuitive Begabung, seine schnelle, niemals fehlgehende Urteilskraft, sein Eindringen in die Ursachen der Dinge, unvergleichlich an Klarheit und Genauigkeit. Hinzu kommt eine entsprechende Ausdrucksfähigkeit und eine Stimme von musikalischer Tönung, die andere Menschen bezaubert.
Den 19. August 17 . .
Gestern sagte der Fremde zu mir: »Sie werden bemerkt haben, Kapitän Walton, daß ich großes und unvergleichliches Mißgeschick erlitten habe. Ich beschloß einst, die Erinnerung an diese Übel solle mit mir sterben. Sie haben mich veranlaßt, meinen Entschluß zu ändern. Sie suchen nach Wissen und Weisheit wie ehedem ich. Ich hoffe fest, daß die Erfüllung Ihrer Wünsche nicht zur Schlange wird, die Sie beißt, wie mich. Ich weiß nicht, ob die Erzählung meines Unglücks Ihnen nützlich sein wird. Wenn ich aber überlege, daß Sie die gleiche Richtung einschlagen, sich denselben Gefahren aussetzen, die mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin, dann stelle ich mir vor, daß Sie eine brauchbare Lehre aus der Geschichte ziehen können – eine, die Sie geleitet, wenn Ihr Unternehmen glückt, und Sie im Falle des Mißerfolges tröstet. Bereiten Sie sich vor, von Ereignissen zu hören, die gewöhnlich für unglaubwürdig gehalten werden. Wären wir in wohlgepflegten Landschaften, dann müßte ich fürchten, Ihrem Unglauben zu begegnen, vielleicht Ihrem Spott; aber in diesen wilden und geheimnisreichen Gegenden werden viele Dinge möglich erscheinen, die das Gelächter all jener hervorrufen würden, denen die stets veränderlichen Kräfte der Natur nicht vertraut sind. Ich zweifle nicht, daß meine Geschichte durch ihren Verlauf einen Wahrheitsbeweis für die berichteten Geschehnisse liefert.«
Ich war aufs höchste erfreut über sein Angebot, wenn ich auch ungern dulden wollte, daß sein Schmerz durch die Wiedergabe seiner Mißgeschicke erneuert würde. Allerdings hätte ich sehr gern die versprochene Erzählung gehört, einmal aus Neugierde, zum anderen wegen meiner festen Absicht, sein Geschick zu bessern, soweit es in meiner Macht stand. Ich drückte diese Empfindungen in meiner Erwiderung aus.
»Ich danke Ihnen«, antwortete er, »für Ihr Mitgefühl, aber es ist nutzlos, da mein Schicksal fast vollendet ist. Ich erwarte nur noch ein Ereignis; dann werde ich in Frieden ruhen. Ich verstehe Ihre Gefühle«, fuhr er rasch fort, als er wahrnahm, daß ich ihn unterbrechen wollte, »aber Sie geben sich einer Täuschung hin, mein Freund (gestatten Sie mir, Sie so zu nennen), denn nichts kann mein Geschick mehr beeinflussen. Vernehmen Sie meine Geschichte, und Sie werden sehen, wie unwiderruflich es abläuft.«
Er fügte noch hinzu, daß er seine Erzählung am nächsten Tag, falls ich Zeit hätte, beginnen würde. Ich nahm das mit aufrichtigem Dank an. Ich habe beschlossen, jede Nacht, wenn ich nicht von meinen Pflichten abgehalten werde, das im Laufe des Tages Erzählte so getreu wie möglich mit seinen eigenen Worten niederzuschreiben. Sollte ich beschäftigt sein, will ich wenigstens Notizen machen. Dieses Manuskript wird Dir zweifellos die größte Freude bereiten; mit welchem Interesse und Mitgefühl werde aber ich, der ich ihn kenne und es von seinen eigenen Lippen höre, an einem künftigen Tage darin lesen? Sogar jetzt, da ich beginne, klingt mir seine wohltönende Stimme im Ohr; seine glänzenden Augen ruhen auf mir mit ihrem ganzen schwermütigen Charme; seine Hand gestikuliert voll Lebhaftigkeit, während seine Gesichtszüge die verborgene Seele durchstrahlen lassen. Seltsam und leiderfüllt muß seine Geschichte sein – furchtbar der Sturm, der dieses stattliche Schiff auf seiner Lebensfahrt erfaßte und derart zertrümmerte!
1. KAPITEL
Ich bin ein gebürtiger Genfer; meine Familie gehört zu den angesehensten dieser Republik. Meine Vorfahren waren seit vielen Jahren dort Anwälte und Syndici; mein Väter bekleidete verschiedene öffentliche Ämter in Ehren. Er wurde von allen wegen seiner Untadeligkeit und seinem unermüdlichen Eifer für das allgemeine Wohl geachtet. In seinen jüngeren Jahren beschäftigte er sich ständig mit der Politik seines Landes; das und eine Reihe anderer Angelegenheiten hinderten ihn an einer frühen Heirat. Allerdings wurde er auch nicht erst gegen Ende seines Lebens Gatte und Familienvater.
Da die Umstände seiner Heirat Licht auf seinen Charakter werfen, muß ich sie erzählen. Einer seiner besten Freunde, ein Kaufmann in günstigen Verhältnissen, geriet infolge zahlreicher Unglücksfälle in Armut. Beaufort – so hieß der Mann – war stolz und unnachgiebig und konnte es daher nicht ertragen, arm und vergessen im selben Land zu leben, in dem er früher wegen seines reichen Standes angesehen war. Also beglich er auf die ehrenhafteste Weise seine Schulden und zog sich dann mit seiner Tochter nach Luzern zurück, wo er unerkannt und elend lebte. Mein Vater schätzte Beaufort als echten Freund; er war sehr bekümmert über seine Flucht ins Elend. Bitter beklagte er den falschen Stolz, der seinen Freund zu einer jede Zuneigung verachtenden Haltung zwang. Er verlor keine Zeit, ihn ausfindig zu machen, da er ihn zu überreden hoffte, mit Hilfe seines Kredits und seiner Unterstützung von vorne zu beginnen.
Beaufort hatte alles getan, um seine Verborgenheit aufrechtzuerhalten; es dauerte zehn Monate, ehe mein Vater seinen Unterschlupf ausfindig gemacht hatte. Glückstrahlend über diese Entdeckung eilte er auf das Haus zu, das in einer trübseligen Straße nahe der Reuß lag. Als er eintrat, hieß ihn die Verzweiflung willkommen. Beaufort hatte kaum etwas Geld aus dem Wrack seines Vermögens retten können; es genügte als Lebensunterhalt für ein paar Monate. Danach hoffte er eine anständige Arbeit im Hause eines Kaufmanns zu finden. In der Zwischenzeit verstärkte die Untätigkeit, welche Muße zum Grübeln hat, seinen nagenden Kummer; schließlich wurde sein Geist derart davon erfaßt, daß er binnen drei Monaten auf dem Krankenbett lag und zu jeder Anstrengung unfähig war.
Seine Tochter pflegte ihn mit größter Zärtlichkeit, aber sie mußte verzweifelt zusehen, wie ihre geringen Mittel eilig schrumpften, ohne daß Aussicht auf Unterstützung bestand. Caroline Beaufort besaß jedoch einen außergewöhnlichen Charakter. Sie besorgte sich einfache Arbeit: Sie flocht Stroh. Auf diese Weise verdiente sie so viel, daß es gerade für den Lebensunterhalt reichte.
Mehrere Monate vergingen. Ihr Vater verfiel zusehends, und seine Pflege beanspruchte fast ihre ganze Zeit. Die Mittel für den Unterhalt schwanden; im zehnten Monat verschied ihr Vater in ihren Armen und ließ sie als Waise und Bettlerin zurück. Dieser letzte Schicksalsstreich überstieg ihre Kräfte. Sie kniete an Beauforts Sarg und weinte bitterlich, als mein Vater ins Zimmer trat. Er erschien dem armen Mädchen wie ein schützender Geist, und sie vertraute sich seiner Fürsorge an. Nach dem Begräbnis seines Freundes brachte er sie nach Genf und gab sie in die Obhut einer Verwandten. Zwei Jahre später wurde Caroline seine Frau.
Zwischen meinen Eltern bestand ein beträchtlicher Altersunterschied, aber dieser Umstand verband sie nur um so inniger miteinander. Die aufrechte Gesinnung meines Vaters war vom Streben nach Gerechtigkeit beherrscht. Deshalb war es für ihn notwendig, daß er in hohem Maße Achtung aufbringen mußte, um lieben zu können. Vielleicht hatte er vormals an der erst spät entdeckten Unwürdigkeit einer geliebten Frau gelitten und war so dazu gelangt, größeres Gewicht auf erprobten Wert zu legen. In der Neigung zu meiner Mutter zeigte sich eine Dankbarkeit und Verehrung, die gänzlich von der kindischen Verliebtheit des Alters unterschieden war, denn sie beruhte auf der Achtung vor ihren Tugenden und auf dem Wunsch, sie weitestgehend für ihre früheren Sorgen zu entschädigen. Das verlieh seinem Verhalten ihr gegenüber einen Reiz, den ich nicht beschreiben kann. Alles wurde getan, um ihren Wünschen und ihrer Bequemlichkeit nachzukommen. Er bemühte sich, sie vor jedem rauhen Wind zu schützen – wie es ein Gärtner für eine schöne exotische Pflanze tut – und sie mit allem zu umgeben, was ihrem sanften und gütigen Gemüt Freude, bereiten konnte. Ihre Gesundheit und selbst die Ruhe ihres an sich stetigen Geistes waren durch die erlittene Unbill erschüttert worden. Während der zwei Jahre vor ihrer Heirat hatte mein Vater nach und nach seine öffentlichen Ämter aufgegeben. Nach der Hochzeit suchten sie sogleich das angenehme Klima Italiens auf; der Wechsel der Landschaft und der Interessen auf einer Reise durch jenes Wunderland war als stärkende Arznei für die geschwächte Konstitution meiner Mutter gedacht.
Von Italien aus besuchten sie Deutschland und Frankreich. Ich wurde als ihr ältestes Kind in Neapel geboren und begleitete sie als Säugling auf ihrer Wanderschaft. Für mehrere Jahre blieb ich ihr einziges Kind. Wie sehr sie auch aneinander hingen, so schenkten sie mir doch nicht minder wahre Schätze an Liebe aus einer unerschöpflichen Fundgrube. Die zärtlichen Liebkosungen meiner Mutter und das Lächeln freundlichen Wohlwollens auf dem Gesicht meines Vaters sind meine ersten Erinnerungen. Ich war ihr Spielzeug, ihr Abgott, mit einem: ihr Kind, das unschuldige und hilflose Geschöpf, das ihnen der Himmel bescherte, damit sie es zum Guten erziehen konnten; sein zukünftiges Los – sei es Glück oder Unheil – lag in ihren Händen. Das Bewußtsein ihrer Schuldigkeiten gegenüber dem Wesen, dem sie Leben gegeben hatten, war mir, zusammen mit beider regem Gefühl für Zärtlichkeit, in jeder Stunde meiner Kindheit ein Beispiel der Geduld, der Nächstenliebe und der Selbstzucht. Ich wurde an einem seidenen Band von einer Freude zur nächsten geführt.
Lange Zeit galt nur mir ihre Sorge. Meine Mutter hatte sich zwar von Herzen eine Tochter gewünscht, aber ich blieb zunächst ihr einziger Sprößling. Als ich fünf Jahre alt war, brachten meine Eltern auf einem Ausflug über die Grenzen Italiens eine Woche am Ufer des Corner Sees zu. Ihr gütiges Wesen lenkte ihre Schritte oft in die Hütten der Armen. Für meine Mutter war das mehr als nur eine Pflicht, nämlich eine innere Notwendigkeit. Sie hatte nicht vergessen, wie ihr Leid gelindert worden war, und wollte nun der Schutzengel der Bedrängten sein. Auf einem Spaziergang erregte eine dürftige Hütte in einem Seitental ihre Aufmerksamkeit. Sie wirkte besonders trostlos, und eine Schar halbbekleideter Kinder, die herumsprang, zeugte von Armut schlimmsten Ausmaßes. Eines Tages – mein Vater war nach Mailand gefahren – besuchte meine Mutter in meiner Begleitung diese Hütte. Sie traf einen Bauern und sein Weib, beide von Sorge und Arbeit gebeugt, die gerade ein kärgliches Mahl an fünf hungrige Kinder austeilten. Eines befand sich darunter, das meiner Mutter besonders gefiel. Es schien einem anderen Geschlecht zu entstammen, denn vier waren dunkeläugige, kräftige, kleine Vagabunden, während diesem Mädchen eine zarte Schönheit eigen war. Ihr Haar strahlte wie lebendiges Gold; trotz ihrer ärmlichen Kleidung schwebte eine Krone der Auszeichnung über ihrem Köpfchen. Die klare und hohe Stirne, die Augen von schattenlosem Blau, die Lippen und überhaupt die Gesichtsform drückten ein solches Empfindungsvermögen, eine solche Anmut aus, daß sie jeder als etwas Besonderes erkennen mußte, als ein vom Himmel gesandtes Wesen, das in allem engelsgleiche Züge aufwies.
Die Bäuerin merkte, daß meine Mutter mit Erstaunen und Bewunderung auf dieses liebenswerte Mädchen blickte, und erzählte darum eifrig dessen Geschichte. Es war tatsächlich nicht ihr Kind, sondern die Tochter eines mailändischen Edelmannes. Die Mutter, eine Deutsche, war bei ihrer Geburt gestorben. Das Kind wurde diesen guten Leuten in Pflege gegeben, die dadurch ihre Lage verbesserten. Sie waren jung verheiratet, und ihr ältestes Kind war gerade geboren worden. Der Vater ihres Pflegekindes, ein Italiener, der in der Erinnerung an den antiken Ruhm Italiens aufgewachsen war, gehörte zu den »schiavi ognor frementi«, die sich um die Freiheit ihres Landes bemühten. Er wurde das Opfer seiner Neigung. Ob er gestorben war oder noch in den Gefängnissen Österreichs schmachtete, wußte niemand. Sein Eigentum wurde konfisziert, sein Kind blieb verwaist und bettelarm den Zieheltern überlassen. Es erblühte in ihrem dürftigen Heim schöner als eine Gartenrose unter dunkelblättrigen Brombeersträuchern.
Als mein Vater aus Mailand zurückkehrte, fand er in der Halle unseres Hauses ein Kind beim Spiel mit mir vor; es war schöner als ein gemalter Cherub, sein Blick schlug jeden in Bann; seine Gestalt, seine Bewegungen waren zierlicher als die der Gemsen auf den Bergen. Die Erscheinung war bald geklärt. Mit meines Vaters Erlaubnis bat meine Mutter das Bauernpaar um ihr Mündel. Die bisherigen Pflegeeltern mochten zwar das Waisenkind gern, da dessen Gegenwart ihnen als Segen galt, aber sie hielten es für ungerecht, es weiterhin an ein entbehrungsreiches Dasein zu fesseln, wenn die Vorsehung eine so günstige Wendung bot. Sie fragten ihren Dorfpfarrer; das Ergebnis war, daß Elisabeth Lavenza eine Mitbewohnerin des elterlichen Hauses wurde, meine Schwester und mehr als das: die schöne und bewunderte Gefährtin meiner Beschäftigungen und Freuden.
Jeder liebte Elisabeth. Die innige und fast ehrfürchtige Zuneigung, die ihr alle widmeten und die ich teilte, wurde mein größter Stolz. Am Abend vor ihrer Ankunft in unserm Hause sagte meine Mutter neckend zu mir: »Ich habe ein hübsches Geschenk für meinen Viktor; morgen soll er es bekommen.« Als sie mir am nächsten Tag Elisabeth als das versprochene Geschenk vorstellte, faßte ich in kindlichem Ernst ihre Worte buchstäblich auf und betrachtete Elisabeth so, als ob sie mir gehörte. Ich wollte sie beschützen, lieben und hegen. Alles Lob, das man auf sie häufte, nahm ich entgegen, als gelte es einem meiner persönlichen Schätze. Wenn wir auch als Anrede die Namen Vetter und Kusine gebrauchten, so konnte doch kein Wort, kein Ausdruck die Art der Beziehung, in der sie zu mir stand, verkörpern. Sie war mir stets mehr als Schwester und gehörte mir allein bis zum Tode.