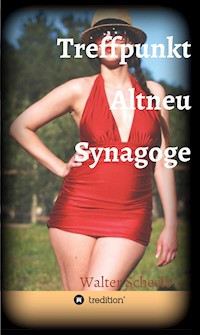3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem Nobelbordell im Frankfurter Westend wird ein Blutbad angerichtet. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Als sich der Schleier um die brutale Tat lichtet, sind sogar erfahrene Beamte fassungslos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
© 2020, Walter Scheele
Autor: Walter Scheele
Umschlaggestaltung: Walter Scheele
Titelfoto: Gesine Sass
Lektorat, Korrektorat: Walter Scheele
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-7323-6409-1 (Paperback)
ISBN: 978-3-7323-6410-7 (Hardcover)
ISBN: 978-3-7345-3794-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Wagen der Nobelklasse glitt leise schnurrend durch die zugeparkte Straße im Frankfurter Westend. In dem Haus mit der barocken Fassade war alles ruhig. Zu ruhig.
Nach dem ersten Klingeln umrundete der Fahrer den Block erneut, als sich auf den mehrfachen Ton des melodischen Gongs nichts rührte. Er schien sich im Gewirr der Einbahnstraßen sehr gut auszukennen. Keine Veränderung, als er zum zweiten Mal an der Gründerzeitvilla vorbeifuhr. Es regte sich nichts.
Der elegante Herr kam zu einem Entschluss. Er parkte seinen Wagen unauffällig in der Nähe der Elsa-Brandström-Schule. Die wenigen Schritte bis zu der noblen Villa mit dem Vorgarten und dem schmiedeeisernen Zaun legte er nervös zurück. Trotzdem darauf achtend, für einen unbefangenen Beobachter wie ein ruhiger Geschäftsmann, eine Hausnummer suchend, zu wirken.
Unschlüssig klingelte er. Mehrfach. Ohne eine Reaktion im Innern des Hauses. Der melodische Gong schien die Ruhe der Straße zu zerreißen. Unschlüssig sah sich der Mann um.
Dann strafften sich seine Schultern. Er kannte den Besitzer des Hauses im Westend gut genug, um zu wissen, dass der eine Zugehfrau hatte, die nur wenige Straßen weiter in einer Dachwohnung lebte. Von seinem Auto aus wählte er per Handy die Nummer der Frau.
Die Angerufene reagierte befremdet. Schließlich stimmte sie dann doch zu und kam zur Villa. Gemeinsam öffneten die ältere Frau und der elegante Herr die Haustür.
Sekunden später stürzten beide panisch aus dem Gebäude. Wo sich sonst die Nachbarn vergeblich bemühten, im Vorübergehen auch nur einen Blick in den Flur zu werfen, stand die Tür jetzt sperrweit offen. Aschfahl, zitternd lehnte die alte Frau an dem mit Eisenspitzen bewehrten Zaun.
Der elegante Geschäftsmann stürzte wie von Furien gehetzt zu seiner Nobelkarosse. Er nahm sich nicht einmal Zeit, die Tür zu schließen, griff nach dem Handy. „Westend “ keuchte er in den Hörer. „Da ist jemand ermordet worden.“
„Bleiben Sie dort“, beschied der Lagebeamte Müller den aufgeregten Anrufer, nachdem er sich die Adresse hatte bestätigen lassen. „Wir sind gleich da.“
Der Polizei war bekannt, dass die dort wohnenden Damen sich ihren Lebensunterhalt bestimmt nicht mit dem Stricken von Strümpfen verdienten. Entsprechend ruhig blieb die Durchsage des Lagebeamten an die derzeit verfügbaren Streifenwagen.
Die eigentlich mehr oder weniger mit Routinekram beschäftig waren. Der sie weder besonders auslastete noch den Beamten Freude machte. So kam es, dass sich plötzlich mehr Beamte als die übliche Einzelstreife vor dem noblen Haus im Frankfurter Westend einfanden.
„Die Tür ist offen“, stellte ein junger Beamter ebenso überflüssig wie augenscheinlich fest und war schon im Haus, bevor andere Kollegen den Treppenabsatz hinaufgekommen waren. Mit kalkweißem Gesicht stürzte er nur Sekunden später aus der Tür. Würgend brachte er gerade noch heraus: „Drinnen, grauenhaft; alles voller Blut. Der Kopf steht auf dem Handlauf …“ dann erbrach er sich.
Seine Kollegen gingen vorsichtiger in das Gebäude. Totenstille. Dann sahen auch sie in das kalkweiße Gesicht einer jungen Frau. Starre, offene Augen schienen sie zu fixieren. Der Sockel, in dem der Handlauf endete und auf dem der Kopf stand, war blutverschmiert. Eine Lache hatte sich gebildet. Die Flüssigkeit war dunkel, geronnen. Vom Körper, der zu diesem Kopf gehören musste, war nichts zu sehen.
Die Beamten suchten auch nicht weiter. Sie alarmierten die Kripo und für alle Fälle einen Notarztwagen der Berufsfeuerwehr. Dann sperrten sie die Zufahrt zu der Straße weiträumig ab. Zwischen Senckenberg Anlage und Niedenau kam keine Maus mehr an den Streifenwagen vorbei. Auch die weiteren kreuzenden Nebenstraßen waren dicht. Die Beamten warteten. Bis Kripo und Notarzt fast gleichzeitig kamen.
So viel Brutalität erschreckte wenig später selbst die abgebrühten Tatortermittler der Frankfurter Kripo. Sie fanden sechs Leichen in dem nobel eingerichteten Haus, zum Teil übelst zugerichtet. Vier von ihnen nackt, weiblich und bildhübsch. Blutjung, wie es schien; die Mädchen waren höchstens 18 bis 24 Jahre alt. Und alle gingen hier offenkundig Mrs. Warrens Gewerbe nach. Bis sie in der feinen Umgebung so blutig endeten.
„Wir brauchen hier keinen Notarzt“, raunzte eine der Kripobeamtinnen am Tatort in den sich quakend meldenden Funk. „Schickt uns, verdammt noch mal, einen Pathologen. Am besten die ganze Gerichtsmedizin. Wir haben hier sechs Leichen. Dass bei denen nix mehr zu machen ist, sieht sogar der Dümmste.“ „Deshalb hast Du es ja auch gemerkt“ erwiderte ebenso ungerührt wie uncharmant der Lagebeamte Müller.
Dann unterbrach er den Kontakt. Er hatte Wichtigeres zu tun. Und in diesem Fall längst alles veranlasst, was im ersten Zugriff nötig war. Inzwischen trafen einer der forensischen Pathologen der Universität und sein Team ein. Sie gesellten sich zum Notarzt der Feuerwehr.
„Ihr wartet, bis wir Euch rein lassen“, beschied der Einsatzleiter der Mordkommission die beiden Mediziner. „Wir werden drinnen erst mal Umschau halten, sehen, was da los ist.“ Den Ärzten war es recht. Sollte sich die Mordkommission zunächst einen unverfälschten Überblick verschaffen.
Ziemlich blass rief schließlich einer der Beamten sie herein. An der Tür gab er ihnen je ein paar Plastiktüten nicht unähnliche Überzieher für ihre Schuhe. Dann schlüpften sie in die weißen Overalls der Tatortermittler.
Als sie endlich die Halle betraten, stockte auch ihnen der Atem. Was die jungen Ärzte hier zu Gesicht bekamen, sollten sie ihr Lebtage lang nicht mehr vergessen. Jetzt konnten sie nur eine Orgie in Blut feststellen. Denn vier toten Mädchen war der Kopf komplett abgetrennt worden. Das fünfte Opfer, eine deutlich ältere Frau, war durch einen Stich ins Genick getötet worden.
Dem einzigen Mann unter den Opfern hatte man von hinten eine Drahtschlinge um den Hals geworfen. Offenbar hatte sie der Täter mit brachialer Gewalt zugedreht. „Das geht so nur mit Griffen an den Enden. Das war ein professionelles Mordinstrument. Wie es Berufskiller verwenden“, waren sich die Beamten der Mordkommission und der Pathologe sofort sicher, als sie das Opfer begutachteten. „Also was für ABaKo“, befanden sie deshalb.
Mindestens 36 Stunden, schätzten die beiden Mediziner nach kurzer Besprechung übereinstimmend, seien die Opfer der Bluttat schon tot gewesen, bevor man sie gefunden habe. Aber genau sei das erst nach eingehenden Untersuchungen zu sagen. Wenn überhaupt noch.
„Das ist ja ein gigantischer Presseauftrieb, wie beim Sturz des Bundeskanzlers“, riss der Leichenbestatter einen seiner makabren Witze. Mit seinen Kollegen legte er weiße Plastiksäcke bereit, in denen die Leichen verstaut werden sollten. Auf der Treppe am Seiteneingang der Villa standen die Metallsärge, für den Transport der Säcke in die Gerichtsmedizin.
Doch daraus wurde zunächst nichts. Die Spurensicherung beschloss, den Tatort zu beschlagnahmen. Die akribische Spurensuche und Aufzeichnung des Tatortes würde dann mit modernsten Mitteln der Forensik ohne Zeitdruck erfolgen. Was vermutlich Tage dauern sollte.
Den Leichen, meinte der Chef der Abteilung, werde es wohl egal sein, wenn sie noch ein paar Stunden am Ort des Geschehens blieben. Denn so lange würde es dauern, stereometrische Fotos zu machen. Dann hätten die Pathologen später immer noch Zeit genug zu dokumentieren, was offensichtlich war. Denn an der Todesursache gab es wohl schwerlich bei einem der Opfer etwas zu deuteln.
Die Arbeit ging nicht unbeobachtet vor sich. Überall drängten sich neugierige Nachbarn. Frauen und Männer hielten mit Videokameras und Handys das Geschehen vor der Villa fest. „Als würden sie dafür bezahlt“, murrte ein Polizeibeamter. Er versuchte vergeblich, die Gaffer abzudrängen.
„Darauf hoffen doch alle: dass irgendein Sender ihnen ihren selbst gedrehten Mist abkauft. Für irgendeine Realityshow. In der sie dann mit ihrer Story auftreten können ‚ich war dabei als …’ darauf stehen diese Haie doch.“
Inzwischen waren außer den Frankfurtern Experten der Spurensicherung deren Kollegen vom Landeskriminalamt in Wiesbaden zur Unterstützung eingetroffen. Für ihre Feinarbeit war nicht mehr viel übrig geblieben. „Ihr seid hier ja durchgetrampelt wie eine ganze Büffelherde“, murrten die. „Was sollen wir da noch groß sichern?“ Doch dann begannen sie gemeinsam mit ihren Frankfurter Kollegen die Feinarbeit mit Lupe, Kamera und modernsten Geräten für chemische Feinanalysen.
Noch während am Tatort diese akribischen Ermittlungen anliefen, bereitete man im Frankfurter Polizeipräsidium eine Presseerklärung vor. „Erst mal Nebel werfen“, lautete die Devise der umstrittenen Vizepräsidentin, die sich grundsätzlich die Information der Presse vorbehielt. „Auf keinen Fall Eure beliebten Andeutungen machen, hier könnte ein Zuhälterkrieg ausgebrochen sein oder die Russenmafia ihre Hände im Spiel haben“, wies sie die Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit an.
Im Bahnhofsviertel der Mainmetropole hatte sich die Nachricht vom „Massenmord im Westend“ wie ein Lauffeuer verbreitet. Was dort passiert war, versetzte verschiedene Barbesitzer und ebenso die Betreiber weniger nobler Häuser in helle Aufregung. „Wer steckt hinter dem Blutbad?“ Fragten sich die Herren im Rotlichtmilieu.
Denn Garbor Borsody, genannt „der Einbeinige“, war einer von ihnen. Der einzige tote Mann in dieser Blutorgie hatte es zu etwas gebracht im Milieu. Deshalb konnte er das feine Etablissement im Westend aufmachen. Der Ungar war mächtig gewesen bis zu seinem Tod. Nicht beliebt, aber gefürchtet und respektiert. Weil er wusste, sich durchzusetzen.
In Moskau wie in Prag, in Warschau wie in Wien oder St. Petersburg hatte er Geschäfte gemacht, wusste man im Milieu. Nur die Polizei, die kannte diesen Hintergrund nicht wirklich. Schon gar nicht unter seinem Spitznamen. Im Präsidium hielt man ihn vielmehr für einen zwar cleveren, aber immerhin doch einfachen Zuhälter wie viele andere auch.
Erst die Vernehmung des feinen Geschäftsmannes, der die Bluttat entdeckt hatte, lieferte mehr Aufschlüsse. Über den mit einer Stahlschlinge von hinten erdrosselten Zuhälter Garbor Borsody hatte der Mann von Welt Geschäfte mit Russland abgewickelt.
Der Elegante hatte nicht nur gern und so oft wie möglich die Dienste der Damen im Westend in Anspruch genommen. Sondern mit Borsody lukrative Kunstgeschäfte eingestielt. Es ging dabei um wertvolle, russische Ikonen. Mehr war aus ihm beim ersten Befragen nicht heraus zu bekommen.
Aber ein Hinweis rutschte dem distinguierten Geschäftsmann dann doch noch raus. „Geht mal nach Egelsbach. Wir haben uns gelegentlich dort im Restaurant des Flugplatzes getroffen.“ Die Beamten folgten dem Rat umgehend.
Die Kripomänner waren begeistert. Nur selten wurden sie bei ihren Ermittlungen so freundlich begrüßt wie am Flugplatz Egelsbach. „Kommt mit ins Restaurant“, lud sie der Verwaltungschef des kleinen Airports ein. Das ließen sich die beiden Beamten nicht zwei Mal sagen. „Der Garbor Borsody“, sinnierte der Mann mit dem militärischen Bürstenhaarschnitt und rührte in seinem Kaffee.
„Der kam nie allein. Alle haben sich gefreut, wenn der anrückte.“ Fliegerisch sei der Mann mit der Unterschenkelprothese gar nicht übel gewesen. Und reich auch. „Der hat die einmotorige Piper Arrow hier vorn. Aber da hinten steht sein Prunkstück: Eine Cessna 340.“ der zweimotorige Flieger sei mit allem Komfort für Passagiere ausgestattet, komplettierte ein Fluglotse die Beschreibung.
„Borsody hatte immer seine ‚Putzkolonne’ dabei“, erweiterte der Verwaltungschef die Informationen. Grinsend fügte er hinzu: „Da hatten die Leute im Tower natürlich einen super Ein- und Anblick.“
Als er das Erstaunen der Kripoleute erkannte, sah sich der Fluglotse zu einer Erklärung genötigt: „Bildhübsche, knackige junge Mädchen. Beine bis oben hin, prächtige Pos und sooo Busen“. Er zeigte mit den Händen ein Format an, das seine Besitzerinnen hätte zu Boden ziehen müssen. „Immer sehr knapp und einsichtsvoll bekleidet“, schwelgten die Männer in Erinnerungen.
Über den Beruf Garbor Borsodys hatte man sich hier am Flugplatz wenig Gedanken gemacht. „Irgendwas mit Im- und Export“, war sich der Flugplatzchef sicher. „Wenn er die Cessna genommen hat, ist er meist in den Osten geflogen. Einmal haben wir den Zoll aus Frankfurt angefordert, weil er eine größere Menge Ikonen angemeldet hatte. Für die brauchte er irgendwelche Zertifikate wegen der Einfuhrkontrolle. Was schweineteuer wurde“, erinnerte sich der Fluglotse.
Der unter Mangel an Beschäftigung leidenden Zollstelle auf dem Verkehrslandeplatz war die Abfertigung dieser seltenen Ware zu heikel gewesen. Deshalb forderten die beiden Beamten Kunstsachverständige ihrer vorgesetzten Dienststelle aus Frankfurt an. Gemeinsam staunte man über die Ehrlichkeit des Importeurs. Denn der hatte bereitwillig seine sämtlichen Schätze ausgepackt. Listen und Ware stimmten bis ins kleinste Detail überein. Und beschäftigten die peniblen Zöllner stundenlang.
Wobei den erstaunten Zöllnern entging, dass die wirklichen Schätze unauffällig unter den Hutzen der Sitze verstaut waren. Die Ikonen waren nur eine teure Finte. Lenkten von der wertvollen Ware ab: 350 Kilo reines Kokain. Und das war unbemerkt durch den Zoll gegangen. Die „Putzkolonne“ hatte, während die Kunstschätze überprüft wurden, für den ebenso reibungslosen wie augengefälligen Abtransport aus der Maschine und vom Flugplatz gesorgt.
Für ABaKo hatten sich die Arbeitsbedingungen in der Zwischenzeit völlig überraschend geändert. Eine Konferenz der Innenminister hatte beschlossen. Ihre Ermittlungseinheit unter eigenem Namen und ohne viel Bürokratismus neu zu ordnen. Dafür zogen sie aus den alten Räumen im Polizeipräsidium aus.
Die Umzugskartons waren schnell ausgepackt, die Zimmer eingerichtet. Das ehemalige Sonderkommando OK in Frankfurt hatte nicht nur ein neues Domizil, sondern auch einen neuen Namen. Am Eingang prangte jetzt die Abkürzung für „Abteilung Bandenkriminalität und Korruption in Europa“: Euro-ABaKo.
„Der alte Wein in neuen Schläuchen“, äußerten Petra Stein und Klaus Wolf despektierlich gegenüber ihrem obersten Chef. Peter Horn pflichtete ihnen bei. „Aber das ist gut so“, befand er. „Unser neuer Name trifft unsere Funktion deutlich besser als das alte ‚OK‘, das ja eigentlich nur für ‚Organisierte Kriminalität‘ stand.“
In der Tat war die gesamte Abteilung erstaunlich kurzfristig umgezogen. Die vorher als Sonderkommando OK am Frankfurter Polizeipräsidium installierten Ermittler wurden nach polizeitypischen Querelen erstaunlich kurzfristig als Bundesbehörde installiert.
Für Peter Horn bedeutete dies eine finanzielle Verbesserung. Sein Titel blieb jedoch Kriminaldirektor. Aber Petra Stein und Klaus Wolf bekamen beide Ernennungsurkunden zum 1. Leitenden Kriminalhauptkommissar. Und mehr Geld. Alle anderen Kollegen waren, sofern nicht schon vorher geschehen, zu Hauptkommissaren befördert worden.
Die Integration in andere Institutionen der Polizei hielt sich auch weiter in Grenzen, aber das war so gewollt. Allerdings gestaltete sich die Zusammenarbeit der Kollegen herzlich und gut. Auch wenn von der ministeriellen Führungsspitze kein Hehl daraus gemacht wurde: ABaKo war ein Fremdkörper in der Polizeihierarchie. Eine eigene, von den Befehlsstrukturen selbst des Bundeskriminalamtes (BKA) unabhängige Einrichtung. Mit besonderen Befugnissen, die außerhalb ABaKo niemand genau kannte. Selbst in den zuständigen Verwaltungsbehörden unterhalb der Ministerebene nicht. Dort kursierten allenfalls Gerüchte.
Die Unzertrennlichen erfuhren von dem blutigen Vorfall im Frankfurter Westend, als sie nach längerer Dienstreise die Tür zum Konferenzraum von ABaKo aufstießen. Aufgrund der Ereignisse der letzten Stunden blieb die Begrüßung des Duos kühl, kurz und geschäftsmäßig. Keine Zeit für Witze oder Schwätzchen.
Später, als Wolf und Stein in ihrem geräumigen neuen Büro saßen, wurde es Ernst. „Wieso haben wir diese Sache bekommen?“ Wolf mäkelte herum. Die ebenso attraktive wie sportliche Beamtin feixte. „Weil du, wie immer, nicht schnell genug Nein sagen kannst und unseren Boss immer herausfordernd anstarren musst.“
Petra Stein zog einen roten Ordner zu sich heran, in dem die ersten Protokolle des eben angelaufenen Falls lagen. Sie las. Wortlos. Die Falten auf ihrer Stirn verrieten ihrem Kollegen Wolf, dass sich etwas Übles anbahnte. Erst als seine Pfeife rauchte, begann auch er seinen Ausdruck des Dossiers zu überfliegen. Schon nach kurzer Zeit legte er den Ordner zur Seite.
Als sie wenig später in der gemeinsamen Lagekonferenz saßen, brummelte er: „Hier stimmt was nicht. Das hätte den Kollegen eigentlich gleich auffallen müssen. Das sieht alles zu glatt aus.“ Seine Partnerin hob den Kopf. „Womit bist Du nicht einverstanden?“ Die übrigen Kollegen sahen jetzt ebenfalls auf.
„Entweder hat hier einer einfach gestümpert, oder wir sollen gezielt auf eine Spur gebracht werden. Wer richtet so ein Blutbad an, wenn er mit Freiern rechnen muss? Möglich natürlich auch, dass hier was aus dem Ruder gelaufen ist. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Die sind doch alle Profis.“
Jetzt wurde auch ihr Chef aufmerksam. Peter Horn meinte: „Lass hören, wenn Dir was aufgefallen ist.“ Klaus Wolf zierte sich. Aber nur scheinbar. „Mir kommt es so vor, als würde uns ein erstklassiges Ablenkungsmanöver serviert. Richtig schön blutig dekoriert und alles, was dazu gehört.“
„Woran denkst Du?“ Die Spannung war fast mit Händen zu greifen. „Wir haben doch Akten über verschwundenen Mädchen aus Tschechien … wo sind die denn bloß?“ Wolf ging zu einem der Aktenschränke. Endlich zog er einen Stapel mit mehreren Aktenkartons heraus. „Hier müsste doch was zu finden sein …“ Klaus Wolf murmelte vor sich hin. Schließlich schien er gefunden zu haben, was er suchte.
„Hier, da sind die ersten Fälle. Alle noch ungeklärt.“
„Was soll uns das in dieser Sache weiterhelfen?“, schnappte Peter Horn, dessen Ungeduld immer deutlicher zu spüren war. „Wir haben es hier doch mit einem