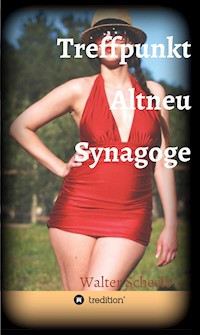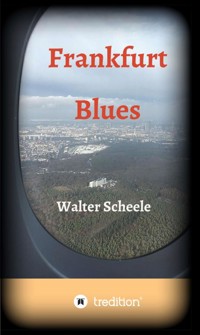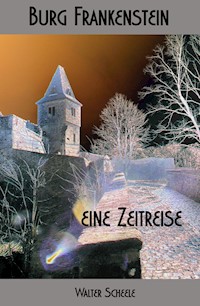
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Burg Frankenstein bei Darmstadt hat mit Mary Shelleys Roman "Frankenstein" zu tun oder nicht? Diese Frage stellt sich nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr. Fakten und Hintergründe sprechen dafür, dass ein auf der Burg geborener Wissenschaftler versuchte, Gott zu spielen und aus Leichenteilen ein Monster zu schaffen. Mary Shelley erfuhr davon durch die Brüder Grimm und im verregneten Sommer am Genfer See schrieb sie ihren berühmten Roman. Der über 200 Mal verfilmt wurde. Im Moment (August 2015) stehen drei neue Filmprojekte vor dem Kinostart...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Burg Frankenstein —
Eine Zeitreise
Walter Scheele
www.tredition.de
© 2015 Walter Scheele
Umschlaggestaltung:
Thomas Wellner Atelier Spaceart, Darmstadt
www.sonja-tuerschmann-thomas-wellner
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN:
978-3-7323-5795-6 (Paperback)
978-3-7323-5796-3 (Hardcover)
978-3-7323-5797-0 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Verlages und des Autors ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wernher von Braun
Johann Konrad Dippel
Mary Shelley
Rundgang durch die Ruine
Die Burgkapelle
Geschichte bis 1604
Streit der Historiker
Rixners Turnierbuch
Frankensteiner und Burgunder
Handelsweg Bernsteinstraße
Völkerwanderung
Bedeutung der Frankensteiner
Der Name Arbogast
Ilbeskopf und Magnetsteine
Danke
Hiermit möchte ich mich bei allen Bibliotheken, Archiven, Hochschulen und Universitäten des In- sowie des Auslandes bedanken, die meine Recherchen tatkräftig unterstützt haben.
Mein besonderer Dank gilt jedoch Ute Gerking, die meine Arbeit von Anfang an sachkundig begleitete, Mathias Bührer der mir bei der Beschaffung von Informationen stets zur Seite stand sowie Erika Reinhardt, die mit sachkundigen und kritischen Korrekturen sowie Anregungen hilfreich war.
Nicht zuletzt aber auch Oliver Reil und Heiko Binanzer, die für die reibungslose Computertechnik sorgten.
August 2015, Walter Scheele
Vorwort
Dunkel und geheimnisvoll waren die Nächte auf Burg Frankenstein bei Darmstadt. Voller unheimlicher Geräu- sche, wie sie nur die Nächte voller Grauen hervorbringen können, die man auch die „Rauen Nächte“1 nennt. Wenn das Grauen seinen Bann verlässt und die Mächte des Dunklen ihren unheimlichen Reigen ausfechten.
So stellte sich ein junges Mädchen, gerade mal 16 Jahre alt, auf- grund der Geschichte Jacob Grimms in einem Brief von 1813 die Geburt des Monsters Frankenstein vor: Mary Shelley. Jene Frau, die später einmal die Weltliteratur um ein Werk bereichern sollte, das noch heute den einen Schauer über den Rücken laufen lässt, den anderen Rätsel aufgibt. Die Weltliteratur wurde von der inzwischen gerade 18-Jährigen im Sommer 1816, nach diesem Erlebnis, um ein Werk berei- chert, das den Begriff „Romantik“ völlig neu interpretierte.
Der Brockhaus sagt in einer frühen Ausgabe über diesen berühmten Roman unter dem Stichwort Frankenstein ganz lapidar: „Titelfigur eines romantischen Schauerromans (1818) der englischen Schriftstellerin Mary Wollstonecraft Shelley. Dr. Frankenstein, Schöpfer eines künstlich hergestellten, aber beseelten Monsters, wird von diesem getötet.“
War das in früheren Ausgaben noch die einzige – und ausgesprochen spärliche – Information zu diesem Thema, werden spätere Ausgaben deutlicher. Zahlreiche Autoren setzen sich mit dem „Mythos Frankenstein“ auseinander.
Inzwischen weicht der frühere Trend, dieses Werk zu belächeln immer mehr ernsthafter Betrachtung. Vor allem die Zusammenhänge mit bekannten Literaten der Romantik werfen ein völlig neues Licht auf den Roman dieser jungen Frau. Immerhin war sie die Tochter der ersten Feministin, Mary Wollstonecraft, und des Mannes, aus dessen Ideen Marx und Engels ihr Kommunistisches Manifest extrahierten: William Godwin.
Nur noch einzelne, von neuem Wissen wenig verunsicherte, Stimmen tun dieses Werk als „Schund“ ab. Ihre teilweise bizarren „Beweisführungen“ spielen in Literatur und Geschichte nur noch am Rande eine Rolle. Nicht zuletzt, wenn es darum geht, warum Mary Shelley sich für ihren Roman nicht ausschließlich der gewählten Ausdrucksweise der feinen Gesellschaft bediente.
Mary Shelleys Frankenstein ist der erste Roman der Weltliteratur, der ein Thema diskutiert, das heute wieder so brisant ist wie vor fast 200 Jahren: Wie weit darf ein Wissenschaftler kraft seines Wissens gehen? Darf er aus eigener Machtvollkommenheit heraus einen neuen Menschen, mit neuer Ethik und neuer Moral „erschaffen“? Die Stammzellenforschung, die Experimente am ungeborenen Leben, beschäftigen auch die heutige Medizin.
Zu Mary Shelleys Zeiten war das Thema auf andere Weise aktuell. Geheimnisvoller, mystischer waren das Leben und seine Entstehung. Goethes „Zauberlehrling“ behandelt das gleiche Thema in Gedichtform, aus dem Mary Shelleys Roman seine Dramatik schöpft.
In „wissenschaftlichen Circeln“ ließ sich die feine Gesellschaft, ob in London, Paris, Berlin oder München und Wien, in „elektrischen Experimenten“ darüber aufklären, ob es möglich sei, einen Toten mithilfe der Elektrizität wieder zum Leben zu erwecken. Konnte ein Wissenschaftler so „Gott spielen“? Hatte man dann noch im Tod Ruhe vor dem Leben oder musste man gewärtig sein, zurückgerufen zu werden?
In Goethes „Faust“ spielen die „Drei vom unmoralischen Sommer am Genfer See“ eine nicht unwichtige Rolle. Im zweiten Teil seines wohl berühmtesten Dramas hat der Dichterfürst ihnen ein bleibendes literarisches Denkmal gesetzt: Sie sind die drei bösen Geister, die Faust auf seinem Weg in die Hölle hetzen.
Viele Dichter der Romantik haben dieses Thema in unterschiedlichsten Weisen aufgegriffen. Viele von ihnen orientierten sich an dem Roman der 18-Jährigen. Deren Leben bis heute Rätsel aufgibt. Die sie selbst ganz bewusst Zeit ihres Lebens der Welt aufgab. Viele Widersprüche ihrer Biografie werden wohl nie befriedigend aufgeklärt werden. Dazu spielen zu viele Interessen eine Rolle, die auf keinen Fall die „Geheimnisse“ der jungen Frau verraten sehen wollen. Weil es auch die eigenen sind. Die in gewissen Kreisen noch heute lieber nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen.
Aber das ist noch längst nicht alles an Geheimnistuerei. Während des 2. Weltkrieges und an seinem Ende spielt der Frankenstein eine bedeutende Rolle, die noch immer verschwiegen wird. Hier hat im Wohnzimmer des Pächters der Landwirtschaft Wernher von Braun einen Vertrag mit dem Kommandanten der „action paperclip“ unterzeichnet. Darin war festgehalten, unter welchen Bedingungen der „Mann im Mond“ in die USA kommen und was er als „Morgengabe“ mitbringen würde.
Auf dem Waldsportplatz am Ilbeskopf haben die Nazis mit geheimen Fluggeräten experimentiert, die in Wiener Neustadt in einem Labor der SS entwickelt wurden. Unter Federführung des SS-Generals Hans Kammler, dessen Verbleib nach dem Krieg bis heute ungeklärt ist. Angeblich wurde er in den Forschungseinrichtungen verschiedener führender Luftfahrtunternehmen in den USA gesehen.
Aber außer Mary Shelley oder Wernher von Braun haben weitere führende Köpfe aus Kultur und Wissenschaft enge Verbindungen zum Frankenstein. So der Anatom, Alchemist und Theologe Johann Konrad Dippel von Frankenstein (1673 hier geboren), sowie zwei Grafen von Frankenstein, die in der Politik Preußens und des Deutschen Reiches eine wichtige Rolle spielten. Von ihnen soll in diesem Buche ebenfalls die Rede sein. Setzen sie mit mir Teile des Puzzles zusammen: Begeben Sie sich, liebe Leser, mit mir in dieser Abhandlung auf eine spannende Zeitreise …
Walter Scheele
Wernher von Braun auf Burg Frankenstein
Am Anfang waren es mysteriöse Hinweise, Vermutungen, für die es keine Beweise zu geben schien. Es sah so aus, als solle niemals Licht in das Dunkel um die geheimen Laboratorien, Versuche und Experimente des Dritten Reiches an der Technischen Hochschule Darmstadt und auf Burg Frankenstein kommen. Doch dann änderte ein Besuch auf Burg Frankenstein Alles.
Es war am 17. Juni 1994, dass ein heiterer älterer Herr auf Burg Franken- stein herumspazierte. Er schien etwas zu suchen und so sprach der Autor dieses Buches ihn an, fragte ob man be- hilflich sein könne. Der Fremde stellte sich als Bob Konopacky vor: „Erster amerikanischer Kommandant auf dem Frankenstein, als wir Deutschland ero- berten.“
Jagdglück: Bob Konopacky als junger GI im Burghof
Seine Geschichte vom Ende des 2. Weltkriegs klang so abenteuerlich, dass der Fragesteller wohl nur den Kopf geschüttelt haben muss. Doch Bob‘s Begleiter zog einen brau- nen Briefumschlag aus seinem Sakko, zeigte alte Fotos. Eindeutig Bob als junger GI, mit einer bildhübschen Frau, auf der Jagd und mit erlegtem Wild im Hof der Burg.
„Meine Frau Betty“, erläuterte er. Sie war unmittelbar nach der Besetzung schon bei mir.“ Wie er das geschafft hat? Bob lächelte nur. Nicht nur hierüber. Er zeigte weitere Fotos. Ein Esstisch, mit Leuten daran. „Hier saßen“, er deutete auf zwei leere Plätze am gedeckten Tisch, „Wernher von Braun und der Kommandant der ‚Action Pa- perclip‘ aus Bensheim2. Sie wollten nicht mit auf das Bild.“
Es dauerte Jahre, bis sich seine sensationelle Geschichte bis in die Details hinein entrollte. Bei einem zufälligen Treffen mit dem dama- ligen Kommandanten der „Action Paperclip“ (die deutsche Wissenschaftler für die USA rekru- tierte) bestätigte dieser die Story.
Geheimer Treffpunkt auf dem Frankenstein
Henry Kissinger, später Au- ßenminister der USA, war der damalige Kommandant der Spionageeinheit – und unter- zeichnete mit Wernher von Braun auf dem Frankenstein einen „Vertrag“. Nach dem sollten die Amerikaner die Familie von Brauns aus Thüringen in die USA schaffen. Dann wollten sich Wernher von Braun und weitere 13 Wissenschaftler aus Darmstadt und der Umgebung den neuen Machthabern stellen. Größtes Problem bei dieser „Transaction“: Die Familie von Braun befand sich in einem russischen Internierungsla- ger zwischen Ohrdruf und Arnstadt in Thüringen. Wobei die Rus- sen hofften, mit dem Faustpfand Familie auch Wernher von Braun in die Hände zu bekommen. Denn sie hatten von Spezialisten in Peenemünde und in Prag erfahren, dass der eigentliche Kopf der „Wunderwaffe“ der Nazis der Landedelmann aus dem heutigen Po- len war.
Die Mannschaft von Peenemünde geriet nicht erst in den letzten Kriegstagen in den Verdacht, nicht system-konform zu denken. Die Gestapo hatte offenkundig über Spitzel erfahren, dass in den Kreisen der Wissenschaftler ganz offen und unverkennbar Pläne gemacht wurden, wie man nach dem Krieg mit wem wo weiterarbeiten wollte. Man wusste auch, dass die Meinungen unter den Beteiligten zum Teil weit auseinandergingen.
Wernher von Braun hatte sogar 14 Tage in Gestapo-Haft verbracht, weil er sich weigerte, den Nazis „unsichere Kantonisten“ in seiner Mannschaft zu nennen. Als dann die russischen Heere auf Peenemünde zu marschierten, reifte der Plan, die verbliebenen Reste der Mannschaft in einem Sonderzug unter SS-Bewachung nach Oberammergau zu transportieren. Denn viele Experten hatten sich schon abgesetzt.
Auch Hitlers Berghof bei Berchtesgaden war zeitweise als Ausweichquartier für die Wissenschaftler und Techniker aus Peenemünde im Gespräch. Jedoch dessen ungeachtet fehlte es hier zu diesem Zeitpunkt offenkundig am „fachgerechten“ Ausbau der Stollen, in denen die Wunderwaffe der Nazis in den letzten Kriegstagen doch noch streng geheim fertig werden sollte.
Die Pläne zur Evakuierung von der Ostsee nach Bayern führten zur kompletten Auflösung der dortigen Mannschaft. Ein Teil der Wissenschaftler und der Techniker setzte sich ab. So taten es auch der Treibstoffspezialist Heinz Millin ger und Wernher von Braun mithilfe von Technikern aus Pfungstadt und Nieder-Beerbach in Südhessen. Mit ihnen „verschwanden“ zwölf weitere Mitarbeiter des geheimen Labors in Darmstadt.
Wichtige Unterlagen mussten in Peenemünde ebenso zurückgelassen werden wie in Darmstadt. Jedoch nicht alle. So waren die Detailplanungen der Triebwerke der V 2 zunächst nicht auffindbar. Einige wurden in einem Stollensystem bei Goslar im Harz entdeckt. Andere blieben für immer verschollen. Bis heute ist unklar, wer von den Siegermächten welche Forschungsergebnisse, Dokumentationen und Versuchsprotokolle in die Hände bekam. Sicher erscheint heute nur eines: Der Roten Armee fielen wichtige Unterlagen über geheime Fluggeräte in die Hände, an denen in einem Skoda-Werk bei Prag gearbeitet wurde.
Wichtige Details der Darmstädter Raketenforschung an der V 10 wurden später in den USA von Millinger und Wernher von Braun weitergeführt oder rekonstruiert. Was zahlreiche Detailverbesserungen brachte. Deshalb trug die „V 10“ unter dem Namen „Redstone“ den ersten Amerikaner ins All.
Im Gegensatz dazu allerdings wurden die Ergebnisse deutscher Forschungen an anderen, auch raketengetriebenen, Fluggeräten in den USA an streng geheimen Orten von US-Technikern und Wissenschaftlern wesentlich weiterentwickelt. So konnte man in den USA mithilfe von Rüstungsunternehmen aus der Luftfahrt wie Northrop, Lockheed, Martin und Grumman den deutschen Forschungsvorsprung von zehn bis 15 Jahren – was die Flugzeugtechnologie anging – relativ schnell aufholen.
In Peenemünde war es zwischen Wernher von Braun und einigen SS-Offizieren während eines Startversuchs mit einer veränderten Version der V 2 zu einer heftigen Diskussion gekommen. Die Offiziere warfen Wernher von Braun vor, er verfolge die Arbeiten an der Waffe gegen England nicht mit dem nötigen Elan und eher lustlos. Er müsse doch ein größeres als das gezeigte Interesse haben, den Krieg zu gewinnen. Nur dann könne er schließlich seine Forschungen fortsetzen.
Dem widersprach von Braun ebenso spontan wie massiv: „Ich forsche nicht, um jemandes Krieg zu gewinnen. Ich will den ersten Menschen auf den Mond bringen.“ Das reichte den SS-Offizieren. Ihr Argwohn war entweder geweckt oder bei anderen von ihnen wurde er verstärkt. Noch in der gleichen Nacht wurde Wernher von Braun von der Gestapo abgeholt und in ein geheimes Gefängnis in Stettin zum Verhör gebracht. Dort blieb es nicht nur bei einer Anhörung. Wernher von Braun wurde gefoltert. Danach brachte man ihn, mehr tot als lebendig, zurück in sein Quartier nach Peenemünde. Ohne dass er seine Kollegen verpfiffen hätte.
In seiner Unterkunft nahmen sich zwei seiner Feinmechaniker des Verletzten an. Die medizinische Versorgung war mehr schlecht als Recht. Schließlich beschlossen die beiden Handwerker, die mit Wernher von Braun auch in Darmstadt zusammenarbeiteten, ihn nach Darmstadt oder nach Frankfurt zu bringen. Frankfurt als Ziel hatte gute Gründe.
Während seiner Arbeiten an der Technischen Hochschule in Darmstadt hat Wernher von Braun laut Information von Patrick D. C., Sohn eines hochrangigen Offiziers des Headquarters des 5. Korps in Frankfurt, in der Altkönigstraße in Frankfurt gewohnt. Patrick C., Europa–Chef eines weltweit agierenden Elektronikkonzerns, berichtete hierüber 2011 bei einem Besuch auf Burg Frankenstein.
In der Altkönigstraße lebte, so Patrick C., auch die jüdische Großmutter seiner Familie C., die als vermeintliche Deutsche von den Nazis unbehelligt geblieben war. Ihr Mann hatte sich 1933 in kluger Weitsicht von ihr scheiden lassen und sich mit einem Teil des beweglichen Familienvermögens sowie den Kindern in die USA abgesetzt. Ihr blieb der größere Teil des Immobilienbesitzes und damit das als nobel geltende Mietshaus.
Die alte Dame wohnte im ersten Stock in einer der größeren Wohnung ihres Mietshauses, neben ihr in einem Appartement Wernher von Braun. Der junge Wissenschaftler trug der Seniorin die Kohlen zum Heizen in die Wohnung und putzte für sie die Treppe, wenn sie mit der „Hausordnung“ dran und Wernher von Braun daheim war.
Diese Angaben wurden von mehreren Zeugen bestätigt. Sie alle arbeiteten beim 5. Korps der Amerikaner in Frankfurt. Alle wunderten sich, dass die „kinderlose“ Frau von den Nazis unbehelligt geblieben war. „Sie galt als Deutsche, hatte nach der Scheidung wieder ihren Mädchennamen angenommen, der ins Bayerische deutete. Das war wohl der Grund“ meinte Patrick C. in einem Gespräch.
Für die Zuneigung des Wissenschaftlers zu der alten Dame gab es, so Patrick C., wohl einen ganz persönlichen Grund. Der Raketen- forscher hatte großes Interesse am „Wilden Westen“ sowie den sich um ihn rankenden Legenden. Und die Seniorin besaß eine, für die damalige Zeit, unbezahlbare Rarität. Es war ein Plakat einer der letz- ten großen Völkerschauen, die den Namen Buffalo Bill europaweit bekannt gemacht haben. Das Plakat zeigte – und war von ihnen sig- niert – den Indianerhäuptling Sitting Bull und Buffalo Bill, den Chef dieser Show. Dieses Plakat schenkte die Seniorin ihrem darob höchst erfreuten Nachbarn Wernher von Braun.
Das Mietshaus aus der Gründerzeit steht noch und scheint gut erhalten zu sein. Die Altkönigstraße ist eine noble Wohngegend schon damals gewesen, liegt im Westend in der Nähe von Grüne- burgpark, Palmengarten und IG Farben Hauptverwaltung – heute Goethe-Universität. Die Jüdische Gemeinde Frankfurt hat mit der Westend-Synagoge einen Sitz in unmittelbarer Nähe.
Die Handwerker aus Nieder-Beerbach befanden, es sei keine er- folgversprechende Idee, den Verletzten in seiner Wohnung oder im Darmstädter Labor zu verstecken. Mit ihrem Chef verstanden sich die Männer, beide im Besitz eines Flugscheines, mehr als gut. Auf dem Griesheimer Sand, im größ- ten Windkanal Europas, hatten sie an Versuchen mit Raketenmo- dellen mitgewirkt.
August Euler mit Heinrich von Preußen
Außerdem hatte das Trio auf dem Ilbeskopf gemeinsam Tests nicht nur mit Segelflugzeugen unternommen. Bis die SS, die aus August Eulers Zeiten stammende Startrampe und den angrenzenden Waldsportplatz in Beschlag nahm, wurden hier Lafetten für mobile Raketenabschussrampen getestet. Auf dem ehemaligen Segelflugplatz richteten die Nazis ein streng geheimes Versuchsgelände ein.
Die Männer kamen schließlich auf die Idee, den sich immer schlechter fühlenden Raketenforscher mit einem Flieger in ihre Heimat bei Darmstadt zu schaffen. Mit einem „ausgeliehenen“ F 89, einem Flugzeug der Firma Fieseler, dem Vorgänger des berühmten „Fieseler Storch“, landeten sie mit Wernher von Braun an Bord in der Mordach bei Nieder-Beerbach. Von dort schafften sie ihren schwer kranken Chef in die Nieder-Ramstädter Heime der Inneren Mission.
Hier wurde er vom Anstaltsleiter und seinem Chefarzt sofort und ohne viele Fragen behandelt. Der Leiter der christlichen Einrichtung, die offiziell nach Schussverletzungen an Epilepsie leidende Soldaten behandelte, entschied, was zu tun war. Der zur Bekennenden Kirche gehörende Pfarrer versteckte den Schwerkranken und schärfte den beiden Nieder-Beerbachern ein, niemandem etwas von seinem Patienten zu sagen. Was die aus eigenem Interesse sofort versprachen.
Doch weder das fremde Flugzeug auf der Wiese noch die nächtlichen Aktivitäten an den Heimen in Nieder-Ramstadt ließen sich auf Dauer verheimlichen. Einer der führenden Köpfe der Deutschen Christen3 aus Darmstadt-Eberstadt bekam Wind von der Sache. Dieser Pfarrer informierte die Gestapo und den zuständigen Gauleiter in Frankfurt. Der mutige Diener Gottes und sein Chefarzt wurden festgenommen. Wernher von Braun gelang die Flucht und er versteckte sich im Wald am Frankenstein.
Wo ihn seine Feinmechaniker mit dem nötigsten versorgten. Sie erinnerten sich noch 2012 an eine „Anekdote“, die vermutlich Wernher von Braun überhaupt nicht lustig gefunden hat. Sein Versteck war die sogenannte Josephhütte. Die behagliche Jagdhütte an den „Drei Buchen“, einem Naturdenkmal, verfügte über ein großes, komfortabel eingerichtetes „Herrenzimmer“, eine geräumige Terrasse sowie eine Kammer, in der Jagd- und Gartengeräte standen. Ebenso wie Reisig und Holz, um bei Bedarf den Ofen der Hütte zu befeuern.
Eines Nachmittags hörte Wernher von Braun fremde Stimmen, die sich der Hütte näherten und versteckte sich in diesem dafür vorbereiteten Raum. Er wusste genau, wann seine Helfer kommen würden und dies war nicht die gewohnte Zeit. Mit Recht verbarg er sich, denn eine Gruppe von SS-Männern durchsuchte die Hütte und den umgebenden Wald.
Allerdings nicht den Abstellraum. „Zu dreckig“, befanden die Herren in den schwarzen Uniformen. „Auch wenn er ein Verräter ist: Ein Kamerad versteckt sich nicht in diesem Dreckloch“, waren sie sicher.
Die Josephshütte bei den Drei Buchen
Weil sich nicht ein Hin- weis auf den gesuchten Inge- nieur ergab, ließen sich die SS-Männer auf der Terrasse nieder, tranken Schnaps aus ihren Flachmännern und be- klagten den Ärger, im Wald nach einem mutmaßlichen „Verräter“ suchen zu müs- sen. Erst als es bereits Dunkel geworden war, verschwanden sie schwankend wie die Eichelhäher im Sturm auf einem der Waldwege in Richtung Nieder-Beerbach.
Weil sie dort in einer Schankwirtschaft weitertranken, erfuhren auch die beiden Feinmechaniker von der Aktion in der Jagdhütte an den „Drei Buchen“. Sie machten sich unauffällig auf den Weg zu Wernher von Braun. Gemeinsam kam das Trio zu dem Schluss, zunächst einmal nichts zu unternehmen. Sondern die weitere Entwicklung ohne Hektik abzuwarten.
Die Nieder-Beerbacher hatten noch immer Verbindungen in die geheime Forschungsstätte Wernher von Brauns an der Technischen Hochschule. Der konnte sich dort unter diesen Umständen natürlich nicht sehen lassen. Aber seine Handwerker verständigten die wissenschaftlichen Kollegen, die in den Trümmern noch immer suchten, was nach der Brandnacht von ihren Unterlagen zu retten war. Alle beschlossen, sich nicht zuletzt aufgrund der Bombardierung vom 11. September 1944 unauffällig abzusetzen.
Die möglichst unauffälligen Absetzbewegungen von Wissenschaftler der Forschungseinrichtungen hatten schon im Frühsommer 1944 begonnen. Ihnen war klar geworden, dass es in der Stadt nicht mehr sicher war.