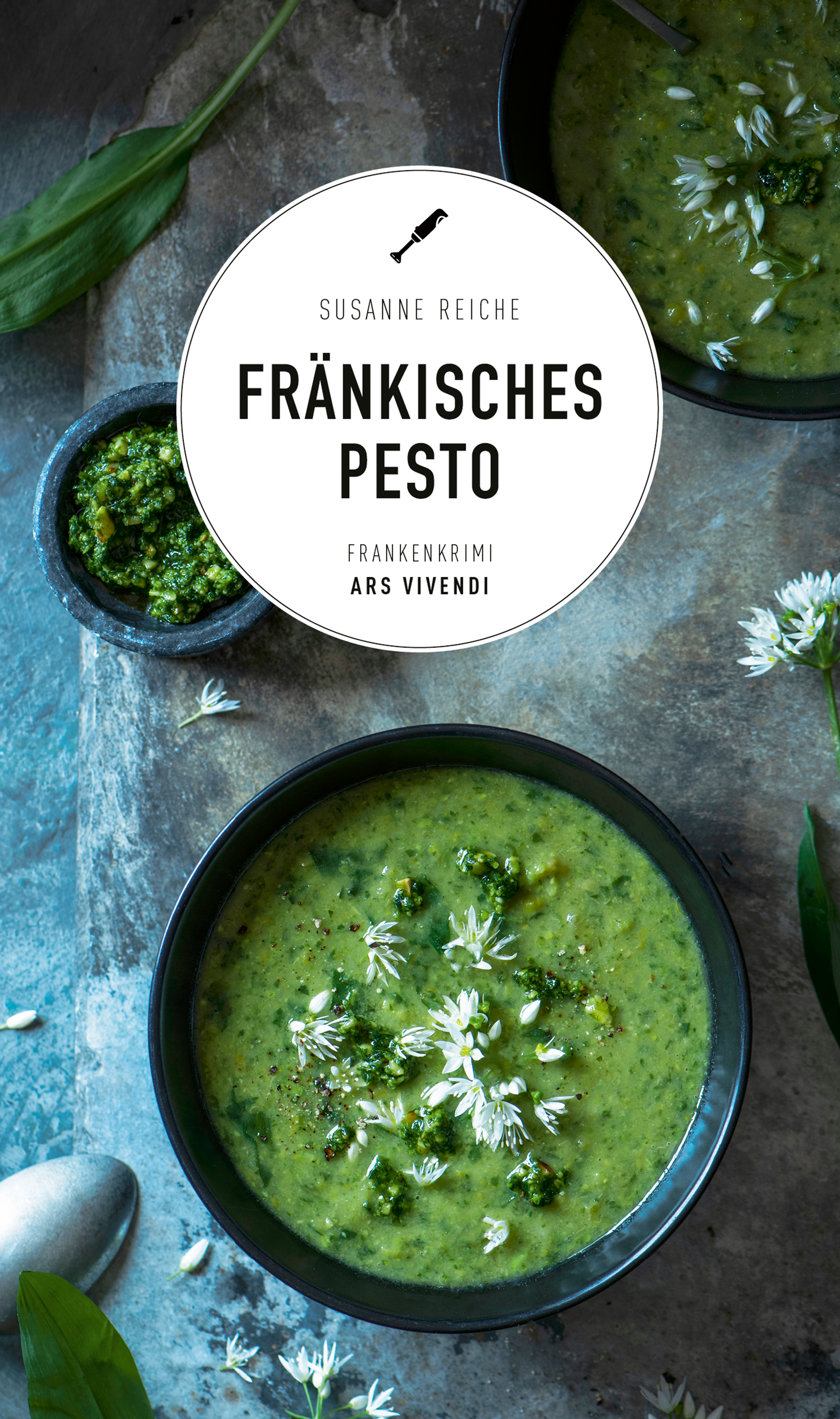Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Kastner-Reihe
- Sprache: Deutsch
An der Hallerwiese treibt ein junger Mann tot in der Pegnitz, und im nahen Ufergebüsch stößt man auf einen verwahrlosten Jungen, der so stumm ist wie ein Fisch. Wie sich herausstellt, hatte der minderjährige Tote Migrationshintergrund und einen grünen Daumen, aber keine Aufenthaltserlaubnis. War er von einem Gärtnereibesitzer wirklich aus reiner Nächstenliebe aufgenommen worden? Hat der Junge aus dem Gebüsch eine "autistische Störung" oder schweigt er aus einem anderen Grund? Und welche Rolle spielt Ralf, der Tag und Nacht die Pegnitz beobachtet? Eine weitere Leiche taucht auf, und auch privat ist für den Nürnberger Kommissar Kastner die Lage alles andere als entspannt. Da hilft nur eins: Freiräume schaffen. Nicht nur deshalb trifft Kastner sich mit Ralf, um Fränkisches Sushi zu essen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Oktober 2017)
© 2017 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Stephan Naguschewski
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: © Hanne Beinhofer
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
ISBN 978-3-86913-865-7
Susanne Reiche
Fränkisches Sushi
Kriminalroman
ars vivendi
Inhalt
Prolog
Mittwoch, 14. Dezember – Stumm wie ein Fisch
Donnerstag, 15. Dezember – Fakten
Freitag, 16. Dezember – Lady Gaga
Samstag, 17. Dezember – Yellowstone
Sonntag, 18. Dezember – Wie läuft’s mit Fritz?
Montag, 19. Dezember – Kaspar Hauser 2.0
Dienstag, 20. Dezember – Schafspudel
Mittwoch, 21. Dezember – Level 30
Donnerstag, 22. Dezember – Zweitwilli
Freitag, 23. Dezember – Unsere kleine Farm
Samstag, 24. Dezember – Pfandflaschenschlangendilemma
Sonntag, 25. Dezember – Ein kreatives Element
Montag, 26. Dezember – Die Morlocks
Dienstag, 27. Dezember – Ralf
Mittwoch, 28. Dezember – Ein Schritt ohne Schatten
Donnerstag, 29. Dezember – Pokerface
Freitag, 30. Dezember – Buddhistische Erleuchtung
Samstag, 31. Dezember – Kinderüberraschung
Die Autorin
Prolog
Böiger Wind zerrte an der Aufhängung des Kettenstegs und trieb einen leeren Pappkaffeebecher über das Kopfsteinpflaster am Maxplatz. Die tief hängenden Wolken drohten mit Regen oder Graupel – bisher hatte der Dezember nur trübe Regentage und klare, frostige Nächte gebracht, keinen Schnee. Manuel Matzke war das ganz recht. Über naive Romantiker, die auf weiße Weihnachten hofften, konnte er nur den Kopf schütteln. Als Straßenreiniger des Servicebetriebs Öffentlicher Raum wusste er, dass eine Großstadt wie Nürnberg Schnee unverzüglich in Dreck und Matsch verwandelte.
Er zog den Reißverschluss seiner orangefarbenen Arbeitsjacke zu und fing, von einer fröstelnden Möwe misstrauisch beäugt, den tanzenden Pappbecher mit dem Müllgreifer ein, ehe er seinen Weg in Richtung Hallerwiese fortsetzte. In der Unterführung, die unter dem Westtorgraben hindurchführte, studierte er en passant die neuesten Graffiti auf den gekachelten Wänden, dann schob er seinen Tonnenwagen über den holprigen Fußweg zwischen Pegnitzufer und Wiese. Er leerte die Abfalleimer, angelte mit dem Greifer nach Kippen und Papiertaschentüchern und wies, aus gegebenem Anlass, eine Dame mit Pelzmantel und Langhaardackel darauf hin, dass Hundekot vom Tierhalter zu entsorgen sei. Sie starrte ihn grantig an.
Im regennassen Gras um den Schnepperschützenbrunnen lagen einige Bierdosen und ein Pizzakarton, an den sich mithilfe eines Käsefadens ein Rest Salamipizza klammerte. Matzke bückte sich gerade danach, als etwas in dem trockengelegten Brunnenbecken seine Aufmerksamkeit erregte – ein brauner Herrenschuh und ein toter Fisch lagen einträchtig beieinander. Der Schuh hatte schwarze Schnürsenkel.
Das ist doch mal was, fand Matzke. Seine Arbeit barg die Gefahr einer gewissen Eintönigkeit, und deshalb dachte er sich dabei gerne Geschichten aus – Geschichten über den Abfall, den er einsammelte. Müllgeschichten. Schon als Schulkind hatte er viel Fantasie gehabt, und einmal hatte die Deutschlehrerin einen seiner Aufsätze laut vorgelesen, als positives Beispiel. Dass die meisten Müllgeschichten trivial waren, lag also nicht an ihm, sondern an der Einfallslosigkeit der Bürger. Dramatischer Szenarien um leere Wodkaflaschen und Dönerverpackungen war er schon lange überdrüssig … Dies hier versprach wieder einmal Abwechslung!
Er beugte sich über das runde Becken und nahm das Arrangement in Augenschein. Der gut handlange, silbrig geschuppte Fisch formte mit dem Herrenschuh einen spitzen Winkel in Richtung der Pegnitz. Mit Fischen kannte Matzke sich nicht aus, zoologisch, und kulinarisch nur bedingt: Karpfen und Forellen waren stets frittiert, blau oder Müllerin, wenn er ihnen begegnete. Aber die Art der Anordnung rief scheue Assoziationen hervor: ein mathematisches Symbol, eine nordische Rune, ein archaischer Wegweiser?
»Hallo! Hallo? Sie da drüben, Sie sind doch von der Stadt? Hallo!«
Matzke hob unwillig den Kopf von seinem anregenden Fund. »Kommen Sie schnell!«, schrie ein junger Mann, der ihm vom Pegnitzufer her aufgeregt zuwinkte. »Da schwimmt einer!«
Schwimmen? In der Pegnitz? Mitte Dezember?
Der junge Mann lief Matzke entgegen, packte ihn am Arm und zerrte ihn durch das Ufergebüsch bis zum Fluss. »Da! Sehen Sie’s?«
Manuel Matzke sah es und wünschte sich sofort, er hätte es nicht gesehen. Zwischen sparrigen Ästen, die weit in den Fluss hineinragten, hatte sich ein blaues Kleidungsstück verfangen, ein Parka oder Anorak, in dessen Ärmeln die ausgestreckten Arme eines menschlichen Körpers festsaßen. Es schien, als krallte sich der Tote verzweifelt an den Ästen fest, um von der Strömung nicht mitgerissen zu werden. Sein bleiches, aufgedunsenes Gesicht tauchte im bedächtigen Wogen des Flusses auf und wieder ab, seine weit aufgerissenen Augen starrten blicklos in den bewölkten Himmel. Die schwarzbesockten Füße der Leiche zeigten flussabwärts, nach Fürth.
Mittwoch, 14. Dezember – Stumm wie ein Fisch
»Nun mal ganz ruhig«, sagte Kastner zu dem jungen Mann, der die Leiche gefunden hatte. »Bitte noch mal langsam und der Reihe nach, Herr …«
»Thiesfeld.«
»Herr Thiesfeld. Sie waren also mit dem Fahrrad stadteinwärts unterwegs?«
»Richtig«, nickte Thiesfeld und wischte sich verstohlen die laufende Nase mit den Fingern ab. »Ich hab heut früher Feierabend gemacht und wollte heim, bevor es wieder regnet. Aber dann musste ich mal dringend und hab mich da drüben in die Büsche geschlagen.« Er zeigte zum Fluss, wo Martina Götz, die Chefin des Erkennungsdienstes, mit ihren Kriminaltechnikern hinter rot-weißem Absperrband die Spuren sicherte. »Und da hab ich dann die Leiche gesehen und gleich dem Müllmann hier Bescheid gesagt.«
Kastner nickte und nahm den Mann in der orangefarbenen Arbeitskleidung ins Visier. »Und Sie haben dann sofort die Polizei gerufen, Herr Matzke?«
Matzke nickte.
»Arbeiten Sie öfter hier an der Hallerwiese?«
»Ich mache diese Runde jeden Tag, Herr Kommissar«, erklärte Matzke und fügte, mit einem strengen Seitenblick auf den Wildpinkler Thiesfeld, hinzu: »Und ich bin kein Müllmann, sondern Straßenreiniger.«
»Natürlich«, sagte Kastner. »Äh … ist Ihnen hier in den letzten Tagen vielleicht etwas Ungewöhnliches aufgefallen?«
Matzke dachte eine Weile nach. »Hm. Also heute … Ja. Im Schnepperschützenbrunnen liegt ein toter Fisch …«
»Kastner?« Martina Götz winkte vom Ufer her. »Kommst du mal eben?«
Kastner bat Matzke um etwas Geduld und bahnte sich einen Weg durch die Schaulustigen auf dem Fußweg, die aufgeregt tuschelten und sich die Köpfe nach der Bahre mit dem schwarzen Leichensack verrenkten. Der Tote sei ein junger Mann, die Leiche habe schon ein paar Tage im Wasser gelegen, hatte Frau Dr. Rendlick, die Rechtsmedizinerin, Kastner erklärt. Ob der Mann ertrunken sei oder ein Fremdverschulden vorliege, könne sie vor der forensischen Untersuchung nicht sagen.
Vor dem Absperrband blieb Kastner stehen, aber Martina Götz hob es einladend hoch und winkte ihn weiter. »Immer hereinspaziert. Das musst du dir ansehen«, sagte sie und führte ihn ein Stück flussaufwärts, näher ans Ufer. Einer ihrer Mitarbeiter stand vornübergebeugt vor einem dichten Gestrüpp und sprach scheinbar mit sich selbst.
»Was ist? Habt ihr etwas gefunden?«, erkundigte sich Kastner.
Martina nickte nachdrücklich, und Kastner trat einen Schritt vor und beugte den Rücken, um unter die Äste des Gebüschs zu spähen.
***
»Wie, ein Kind?«, wollte Mirjam abends wissen. Sie hatte geduscht und rubbelte sich die blonden Haare mit einem Frotteehandtuch trocken, ehe sie sich mit einer Flasche Rotwein und einem Glas an den Küchentisch setzte und in der Schublade nach dem Korkenzieher kramte.
»Na ja, ein Kind halt«, erklärte Kastner seiner Lebensgefährtin. »Ein Junge, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Da war so eine Art Unterschlupf in dem Gestrüpp, eine Plastikplane, ein paar Decken auf dem Boden, Konservendosen …«
»Und der war da ganz alleine?! Das ist ja nicht zu fassen!« Mirjam entkorkte die Flasche und schenkte sich ein. »Da kommen doch jeden Tag zig Leute vorbei – das muss doch jemandem mal aufgefallen sein, dass da ein Kind im Gebüsch sitzt!«, sagte sie kopfschüttelnd. »Kennt der Junge den Toten? Vielleicht haben die beiden zusammen da gehaust …«
»Möglich«, nickte Kastner, »aber es hat wenig Sinn, die Spekulationen ins Kraut schießen zu lassen. Wir wissen noch gar nichts – weder der Tote noch der Junge hatten irgendwelche Papiere bei sich, und der Junge hat kein Wort gesagt. Der arme Kerl saß auf den zerlumpten Decken und hat uns angestarrt wie die ersten Menschen, die er je zu Gesicht bekommen hat. Stumm wie ein Fisch.«
Mirjam schüttelte sich. »Eine Plastikplane und ein Schlafsack, Mitte Dezember! Das blanke Grauen … Apropos Grauen – du erinnerst dich, dass meine Eltern an Weihnachten kommen und die Spülmaschine hin ist?«
»Äh ja. Natürlich«, behauptete Kastner. »Das kriegen wir schon geregelt, Hase. Bis Weihnachten sind ja noch ein paar Tage.«
»Ach. Und bis dahin hoffst du wohl auf eine Wunderheilung? Was ist denn mit diesem Dings, der muss sich doch mit Spülmaschinen auskennen – Harald? Stefan? Peter? Du weißt schon, der AEG-Heini.«
Der Mann, den Mirjam meinte, hieß Peter. Kastner hatte ihn im Café Kraft kennengelernt, vor einem oder zwei Jahren, als der Streifenbeamte Felix Wernreuther ihm so lange zugesetzt hatte, bis er ein paarmal mit ihm klettern gegangen war. Es war keine schöne Erinnerung. Nicht wegen Peter – der war ein netter Kerl und hatte ihm ein paar Tricks gezeigt, ohne ihn vorzuführen. Er sei Ingenieur und entwickle Spülmaschinen, hatte Peter erzählt, früher sei er bei der AEG gewesen, dann sei er, mitsamt der AEG, an Electrolux verkauft worden, und jetzt arbeite er für eine chinesische Firma. Unangenehm war die Erinnerung deshalb, weil Kastner wie ein nasser Mehlsack an der Kletterwand gehangen hatte, während Wernreuther ihm von unten launige Tipps zugerufen hatte: Das Seil ist nur die Sicherung, Kastner, ich kann dich daran nicht hochziehen!, oder: Du darfst nur die Griffe derselben Farbe benutzen, sonst gilt es nicht!
»Der Kletterfuzzi«, half Mirjam ihm auf die Sprünge.
»Ja, ich weiß, wen du meinst. Peter. Aber ich kenne ihn wirklich nur flüchtig, und ich hab ihn auch schon ewig nicht mehr gesehen – genau genommen, seit ich das letzte Mal klettern war …« Kastner holte sich ein Landbier aus dem Kühlschrank, der außer dem Bier und ein paar ältlichen Toastscheiben nichts Nennenswertes enthielt. Mit zunehmender Besorgnis fragte er sich, was er zu Abend essen sollte. In der Regel kochte Mirjam abends, aber heute hatte sie an einer Fortbildungsmaßnahme teilgenommen – sie war Verwaltungsangestellte der Stadt Nürnberg beim Service Öffentlicher Raum, kurz: SÖR, also gewissermaßen eine entfernte Kollegin von diesem Herrn Matzke – und war selbst erst spät nach Hause gekommen.
»Wie war eigentlich deine Schulung?«, fragte er mit einem Anflug schlechten Gewissens.
»Man hat mir die Software erklärt, die ich privat schon seit fünf Jahren benutze … aber danke, dass du danach fragst.«
Kastner zog den Toastbeutel aus dem Kühlschrank und kniff die Augen zusammen, um das Haltbarkeitsdatum zu entziffern. Je wichtiger die Informationen auf Lebensmittelverpackungen waren, desto kleiner schienen sie gedruckt zu werden.
»Was machst du da, Kastner? Du willst doch nicht etwa die Toastmumien essen?«, erkundigte sich Mirjam belustigt. »Ich hab uns was beim Chinesen bestellt, das müsste bald kommen.«
»Ich liebe dich, Hase!«, sagte Kastner, wahrheitsgemäß und aufrichtig erleichtert, ehe er den Toast wieder zurück in den Kühlschrank legte.
Wenig später saßen sie am Küchentisch und verzehrten gebratene Ente und Gemüse mit Reis direkt aus den Styroporschalen. Danach entsorgte Kastner, auf Mirjams sanftes Drängen hin, zunächst vorschriftsmäßig den Toast und rief dann bei Peter an. Offensichtlich erhielt der arme Mann mehr solcher Anrufe, als ihm lieb war, denn seine Freude über das Wiederhören nach so langer Zeit wurde merklich verhaltener, als Kastner nach kurzem Small Talk mit seinem Anliegen herausrückte. Trotzdem versprach er, am nächsten Abend vorbeizukommen und sich die Spülmaschine mal anzusehen – ein guter Mensch.
Donnerstag, 15. Dezember – Fakten
»Gibt es schon was?«
Kastner hörte Martina Götz durchs Telefon trocken lachen.
»Kriminaltechnik ist Handwerk, kein Kaffeesatzlesen. Das dauert seine Zeit, Kastner. Und nein, es gibt noch keinen Zwischenbericht.«
Ein Anruf bei der Rechtsmedizin erbrachte ein ähnliches Ergebnis – Frau Dr. Rendlicks Team war noch mit der Leichenöffnung beschäftigt. Derart zur Geduld gezwungen suchte Kastner zwischen alten Akten nach seiner Blümchentasse und ging in die Teeküche, um sich einen Kaffee zu holen.
Am Küchentresen lehnte Wernreuther und bewachte den Wasserkocher – die unbefugte Aneignung kochenden Wassers durch räuberische Kollegen war eines der häufigsten Verbrechen, die im Dezernat 1 des Polizeipräsidiums Nürnberg aufgeklärt werden mussten. »Ach, der Herr Kriminalhauptkommissar!« Wernreuther lüpfte neckisch grüßend die Schirmmütze. »Einen wunderschönen guten Morgen!«
»Hm. Morgen, Felix.« Kastner schenkte sich Kaffee ein, holte die Milch aus dem Kühlschrank und kippte einen guten Schluck davon in seine Tasse, wo sie sofort klumpig koagulierte. Traurig schüttelte er den Kopf und schnüffelte an der Milchtüte.
»Sauer, was?«, riet Wernreuther gut gelaunt. »Das kommt daher, dass Kollege Staufer seinen Käse immer ohne Tupperdose in den Kühlschrank legt.«
Kastner kippte den verdorbenen Kaffee in die Spüle und suchte eine Weile vergeblich nach frischer Milch, dann musterte er den jungen Streifenbeamten mit gerunzelter Stirn. Wernreuther hatte sich inzwischen einen grünen Tee aufgebrüht und kontrollierte die Ziehzeit mithilfe der Stoppuhrfunktion seiner Armbanduhr. Dabei pfiff er fröhlich vor sich hin. »Gibt es einen besonderen Grund für deine gute Laune am frühen Morgen?«, erkundigte sich Kastner misstrauisch.
»In der Tat!«, flötete Wernreuther. »Es gibt ausgezeichnete Neuigkeiten! Wir können schon bald noch enger zusammenarbeiten.«
»Äh … wie das?«, fragte Kastner erschrocken. Wernreuther unterstützte ihn gelegentlich bei einer Mordermittlung, wenn Not am Mann war – eine Hilfe, die er mitunter als recht anstrengend empfand. In zwischenmenschlicher Hinsicht.
»Na, ich hab mich doch für die modulare Schulung zum Aufstieg in den höheren Dienst angemeldet … und stell dir vor, der Herr Polizeidirektor hat mich zu diesem Entschluss ausdrücklich beglückwünscht!«
»Ach so«, sagte Kastner, und »was du nicht sagst«, während sein Kollege wortreich die Vorzüge schilderte, aufgrund derer er für den höheren Dienst und vermutlich auch für Führungsaufgaben wie geschaffen sei. Sobald Wernreuther seine Arie des Eigenlobs unterbrach, um einzuatmen, entschuldigte Kastner sich und flüchtete in sein Büro. Nach einem Augenblick der Sammlung rief er Wernreuthers Streifenkollegin Claudia auf ihrem Diensthandy an.
»Wolfschmidt.«
Kastner hörte die Polizeisirene durchs Telefon. »Kastner«, sagte er. »Hast du gerade einen Einsatz? Dann mach ich’s kurz – können wir uns zum Mittagessen treffen?«
»Warum nicht. Halb zwölf in der Rathauskantine?«
Kastner hörte quietschende Autoreifen und schlagende Türen. »Kantine ist schlecht«, erwiderte er, »wir müssen ein Vieraugengespräch führen. Aber wir treffen uns dort, okay?«
»Okay«, stimmte Claudia zu, »bis dann.«
Kastner legte auf und hob den Telefonhörer nach kurzem Nachdenken erneut ans Ohr. Er rief die junge Anwärterin mit dem blonden Kurzhaarschnitt und der Nerdbrille an, die zurzeit neben Polizeimeisterin Ulrike Hirschel im Großraumbüro saß.
»Filipowitz.«
»Kastner. Guten Morgen, Nele. Hör mal, es gibt eine Art Notfall: Wir haben keine Milch mehr. Könntest du vielleicht mal eben ein paar Tüten holen? Und, äh, wenn du schon unterwegs bist – bist du so lieb und bringst mir einen großen Cappuccino mit?«
Die folgenden fünfzehn Minuten starrte Kastner blicklos aus dem Fenster seines Büros in den wolkenschweren Himmel über dem Jakobsplatz. Hölle auch, dachte er. Modulare Schulung. Höherer Dienst. Engere Zusammenarbeit. Wernreuther war jung und ehrgeizig, ließ sich von forsch auftretenden Kriminellen nicht die Butter vom Brot nehmen und brillierte regelmäßig im Schießstand; aber damit waren, nach Kastners Meinung, seine Talente auch schon umfassend beschrieben.
»Herr Kastner?«
Neles Stimme riss ihn aus seinen trüben Gedanken. Er bedankte sich bei der Anwärterin für den Cappuccino und erstattete ihr das Geld, das sie ausgelegt hatte. Das Koffein brachte ihn halbwegs zurück in die Spur – nachdem er den letzten Tropfen Milchschaum aus dem Pappbecher geschüttelt hatte, rief er beim Jugendamt an.
»Nein, auf gar keinen Fall«, wies ihn eine energische Dame in seine Schranken. »Der Junge ist vermutlich traumatisiert, da kommt eine polizeiliche Befragung nicht infrage.«
»Hören Sie«, sagte Kastner, »von einer polizeilichen Befragung war auch nicht die Rede. Ich will mich nur kurz und freundlich mit dem Kind unterhalten – es könnte ein wichtiger Zeuge sein.«
»Das Kindswohl hat immer Vorrang«, bekam er erklärt. »Der Junge wird von einem Psychologen betreut, und solange der kein grünes Licht gibt …«
»Ja, schon gut. Würden Sie mir dann bitte die Telefonnummer dieses Psychologen geben?«
»Dazu bin ich nicht befugt.«
Kastner schloss für einen Moment die Augen – irgendwie schien das heute nicht sein Tag zu sein.
»Aber wir könnten es so machen: Ich gebe dem Psychologen Ihre Nummer, dann kann er sich bei Ihnen melden«, lenkte die Frau ein.
»Ja«, seufzte Kastner, »so machen wir es. Vielen Dank.«
Er legte auf und sah seine Mailbox blinken. Martina Götz hatte eine Nachricht hinterlassen: Ihr Team sei jetzt mit der vorläufigen Auswertung der Spurenlage fertig, und auch die Rechtsmedizin habe einen ersten Bericht erstellt. Sie schlug für zehn Uhr eine Besprechung vor, damit alle auf den gleichen Stand kämen.
Sofort besserte sich Kastners Laune: Ein paar Fakten würden ihn jetzt richtig aufheitern.
***
Kriminaldirektor Carsten Wismeth, Leiter des Dezernats 1, begrüßte die Anwesenden und stellte die einzige Person, die Kastner nicht kannte, als neues und vielversprechendes Gesichtaus der Rechtsmedizin vor. Martina Götz hüstelte bei diesen gönnerhaften Worten verstohlen in ihre Faust, aber das vielversprechende Gesicht selbst lächelte strahlend und nickte in die Runde. Es gehörte einer jungen Frau mit kupferblondem Pferdeschwanz und den runden, blauen Augen einer Mangafigur, die in einem lindgrünen Hosenanzug steckte.
»Ich heiße Tessa Seitz«, ergänzte sie, »und arbeite seit Oktober im Forensikteam von Frau Dr. Rendlick. Freut mich, Sie kennenzulernen!«
»Die Freude ist ganz auf unserer Seite, Frau Seitz!«, erklärte Wismeth. »Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Äh, Frau Götz, wenn Sie uns vielleicht zunächst einen kurzen Überblick über Fundsituation und Spurenlage geben würden, damit wir uns ein Bild machen können?«
»Gern, Herr Polizeidirektor.« Die Chefin des Erkennungsdienstes heftete ein Foto an die Pinnwand. »Das ist ein Luftbild vom Fundort und dessen Umgebung«, erklärte sie. »Genau hier« – sie markierte die Stelle mit einem roten Fähnchen – »hat sich die Leiche in überstehenden Ästen verfangen. Am rechten Pegnitzufer, knapp zwei Meter vom Ufer entfernt. Der Tote trug einen blauen Anorak, Jeans und ein graues Sweatshirt, alles günstige No-Name-Kleidung, weder neuwertig noch übermäßig zerschlissen. Schwarze Socken, keine Schuhe. Die Kleidung des Toten wird im Labor aktuell auf Fremdspuren untersucht …«
»Keine Schuhe? Bei der Kälte?«, wunderte sich Wismeth.
Martina Götz lächelte. »In sehr kaltem Wasser schrumpft der Körper einer Leiche«, erklärte sie, »und wenn es dann noch Strömungen und/oder Hindernisse gibt, rutschen die Schuhe von den Füßen und gehen unter oder werden abgetrieben. Vielleicht könnte ein Taucher …«
»Ja, um Gottes willen«, rief Wismeth. »Wir wissen ja noch nicht einmal, ob überhaupt ein Verbrechen vorliegt! Ein Taucher!«
»Ganz wie Sie meinen.« Martina zuckte die Achseln und fuhr fort: »Der Tote hatte nichts bei sich. Keinen Geldbeutel, keinen Ausweis, kein Handy, keinen Schlüsselbund – die Aufzählung ließe sich fortsetzen, nehmen Sie nichts also bitte wörtlich. Und nun zur Spurenlage … Im fraglichen Uferbereich haben wir Fußabdrücke von fünf verschiedenen Personen gefunden, die noch abgeglichen werden müssen.« Sie legte Computerausdrucke auf den Tisch und bat Wernreuther, sie zu verteilen. »Blatt eins: die Liste der Dinge, die wir am Fundort und bis etwa hundert Meter flussaufwärts eingesammelt haben«, erklärte sie. »Das meiste ist Müll im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Ein Gegenstand könnte allerdings interessant sein: ein Prepaidhandy älterer Bauart. Es lag im Gestrüpp einer Baumscheibe, am linken Flussufer zwischen Maxbrücke und Kettensteg. Es sind Fingerabdrücke drauf, allerdings zu verwischt, um brauchbar zu sein. Die SIM-Karte ist unbeschädigt – eventuell kann man herausbekommen, wer es gekauft hat. Die Speicherkarte ist leider defekt, aber mein IT-Spezialist hat sich ihrer angenommen – wenn es da was zu retten gibt, dann rettet er es.« Sie drehte sich wieder zur Pinnwand um und steckte ein blaues Fähnchen ins Luftbild. »Und hier, vom Fundort der Leiche aus gute fünfzehn Meter flussaufwärts, haben wir etwas besonders Interessantes gefunden.«
»Das Kind?«, riet Wismeth.
»Das Kind«, bestätigte Martina. Sie pinnte ein Foto des behelfsmäßigen Unterschlupfs an, daneben einen Schnappschuss, auf dem der Junge selbst zu sehen war: Auf einer fleckigen, grün karierten Decke kauerte ein etwa Achtjähriger, dem das dunkelblonde Haar in verfilzten Locken bis auf die Schultern hing. Er hielt die Arme dicht an den Oberkörper gepresst, und seine blauen Augen starrten denjenigen, der ihn fotografiert hatte, ausdruckslos an.
»Der Junge muss sich da die ganze Zeit versteckt haben: während die Leiche entdeckt wurde, während wir mit Blaulicht angerückt sind und die Absperrung angebracht haben, während die Leiche geborgen wurde … Er hat sich nicht gemuckst, nicht einmal, als mein Kollege ihn schließlich entdeckt hat. Hat einfach nur dagesessen und sich möglichst klein gemacht, bis diese Frau vom Jugendamt gekommen ist und ihn weggeschleppt hat – sorry, mir fällt kein anderer Ausdruck dafür ein. Er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt …«
»Nun, man konnte ihn wohl schlecht dort lassen«, gab Wismeth zu bedenken.
Dieser offensichtlich zutreffenden Feststellung hatte niemand etwas hinzuzufügen.
»Auch der Junge hatte keinerlei Papiere bei sich«, fuhr Martina fort und deutete wieder auf die Ausdrucke. »Blatt zwei listet auf, was wir in dem Unterschlupf gefunden haben: drei Fleecedecken und zwei alte Armeeschlafsäcke, eine Plastiktüte mit Kinder- und Erwachsenenkleidung, ein Einwegfeuerzeug, einen Gaskocher, einen Dosenöffner, Konservendosen – Pichelsteiner, Linseneintopf, Ravioli. Dazu eine stattliche Sammlung leerer und voller Plastikwasserflaschen, einige Löffel und Gabeln, ein Taschenmesser und … das hier.« Ein weiteres Foto. Darauf war ein zerfleddertes Stofftier zu sehen, eine hellblaue Chimäre zwischen Hase und Mensch, der ein Auge fehlte. »Das Stofftier könnte vielleicht bei der Identifizierung des Jungen helfen«, sagte Martina Götz. »Der ganze Kram wird aktuell noch auf Spuren untersucht; bis morgen werden wir wohl erste Ergebnisse haben. Das wär’s von meiner Seite. Fragen?«
Kastner hob die Hand. »Der Junge hat sich den Unterschlupf also mit einem Erwachsenen geteilt – war das womöglich unser unbekannter Toter?«
Martina lächelte. »Tja. Das ewige Dilemma: wilde Mutmaßungen anstellen oder doch besser warten, bis die Spuren ausgewertet sind? Als Kriminaltechnikerin würde ich Letzteres bevorzugen.«
Wismeth nickte zustimmend. »Vielen Dank, Frau Götz. Ja dann, äh, würde ich vorschlagen, dass jetzt die junge Kollegin aus der Rechtsmedizin …«
Tessa Seitz erhob sich geschmeidig und klappte ein pinkfarbenes Hartschalenköfferchen auf, dem sie einen Laptop und einen USB-Stick entnahm. »Ich habe Ihnen auch einige Fotos mitgebracht«, sagte sie lächelnd, während sie den Laptop an den Beamer stöpselte, der meist ungenutzt auf dem Besprechungstisch stand.
Kastner, der mit Obduktionen nichts am Hut hatte, schätzte dies als den richtigen Zeitpunkt ein, um sich auf der Toilette etwas frisch zu machen. Andererseits wollte er doch gerne wissen, ob es nun einen Fall gab oder nicht, und deshalb blieb er erst einmal sitzen.
»Hier sehen wir den Toten vor der Sektion«, erklärte die Rechtsmedizinerin zum ersten Foto. »Es handelt sich um einen jungen Mann im Alter von etwa sechzehn bis dreiundzwanzig, einsachtundsiebzig groß, sehr schlank, hellhäutig, dunkelhaarig, braune Augen. Schuhgröße zweiundvierzig. Kein Körperschmuck, keine Tätowierungen, keine Operationsnarben, keine auffälligen Muttermale, ein vollständiges und gesundes Gebiss. Fingerabdrücke und DNA-Probe für einen Abgleich mit den üblichen Datenbanken werden Ihnen demnächst zugehen, aber eines können wir aufgrund der Blutgruppe jetzt schon sagen: Der Tote ist mit dem Jungen aus dem Gebüsch sicher nicht verwandt.«
Wismeth schnalzte enttäuscht mit der Zunge.
»An der Leiche sind äußerlich einige kleinere Verletzungen erkennbar«, fuhr Tessa Seitz fort und klickte das nächste und übernächste Foto an. »Das sehen Sie hier – und hier. Am rechten Unterarm geringfügige Abschürfungen, an der rechten Wade ein etwa handflächengroßes Hämatom. Und hier« – ein weiteres Foto – »eine Schürfwunde über dem rechten Auge. Diese Verletzungen sind vor dem Tod entstanden. Sie wären durch den Sturz über die Ufermauer oder den Versuch, wieder ans Ufer zu klettern, halbwegs plausibel zu erklären, aber sie könnten dem Mann auch bei einer Auseinandersetzung oder einem tätlichen Angriff zugefügt worden sein. Insbesondere das Hämatom an der Wade könnte, der Form nach, von einem heftigen Schlag oder Tritt herrühren.«
»Der Mann hat also noch gelebt, als er in die Pegnitz gefallen ist?«, erkundigte sich Kastner.
»Zumindest für kurze Zeit«, lächelte Tessa Seitz. »Der Kälteschock tritt bei den derzeit herrschenden Temperaturen sehr schnell ein – zwischen dem Sturz ins Wasser und dem Eintritt des Todes sind maximal dreißig Minuten vergangen, vermutlich sehr viel weniger …«
»Ist er ertrunken?«, fragte Kastner.
Frau Seitz schüttelte den Kopf. »Nein, todesursächlich war ein Herzinfarkt. Es ist so: Der Kälteschock führt zu Atemproblemen und muskulären Dysfunktionen – selbst gute Schwimmer können ihre Bewegungen nicht mehr koordinieren, und Mund- und Nasenraum geraten immer wieder unter Wasser. Es kommt zur Panik. Herzfrequenz und Blutdruck steigen dramatisch an, und die Folge ist häufig ein Herzversagen.« Das konnte Kastner gut nachvollziehen – schon das bloße Zuhören löste in ihm eine leichte Panik aus.
Tessa Seitz räusperte sich. »Damit kommen wir zum Todeszeitpunkt: Die Leiche hat fünf oder sechs Tage im Wasser gelegen – der Mann ist also schon am achten oder neunten Dezember gestorben. Die ersten vier, fünf Tage lag der Körper auf dem Grund des Flusses, bis die Faulgase ihn dann aufgetrieben haben …«
»Das erklärt, warum man den Kerl nicht schon früher entdeckt hat«, merkte Wernreuther an. »In der braunen Pegnitzbrühe sieht man keinen Viertelmeter tief.«
»Und wo ist der Mann in den Fluss gefallen? Also – wie weit hat die Strömung ihn flussabwärts getragen?«, wollte Kastner wissen.
»Das kann ich Ihnen nicht sagen«, bedauerte die Rechtsmedizinerin. »Das hängt von vielen Faktoren ab – Wassertiefe, Strömungsverhältnisse, Hindernisse, die Art der Kleidung, die die Leiche trägt …«
»Eine grobe Schätzung würde mir genügen«, sagte Kastner.
Tessa Seitz dachte kurz darüber nach. »Hm. Bei den vielen Wehren und Sandbänken im Stadtgebiet – fünfzig bis zweihundert Meter? Aber nageln Sie mich nicht darauf fest.« Sie beugte sich über ihren Laptop und drückte ein paar Tasten. »Gut, wenn so weit alles klar ist«, sagte sie munter, »dann sehen wir uns jetzt die Sektion und deren Ergebnisse an. Bezüglich der Todesumstände ist dabei ein Punkt besonders bemerkenswert …«
»Äh«, machte Kastner. »Bitte entschuldigen Sie mich kurz … Ich müsste … Sie können ruhig ohne mich weitermachen, ich kann mir die Fotos ja später ansehen.«
Unter Wismeths tadelndem Blick verließ er eilig den Besprechungsraum.
»Hallo? Äh, Herr Kommissar?«
Im Flur stand ein Mann in einem grauen Wolljanker, die Linke zu einem zaghaften Gruß erhoben. In der Rechten hielt er eine Plastiktüte, der ein äußerst befremdlicher Geruch entströmte. »Weil wir ja gestern unterbrochen worden sind, dachte ich … also ich dachte, ich bring’s Ihnen vorbei. Vielleicht ist es ja wichtig.«
Kastner zuckte unwillkürlich zurück, als der Mann ihm die stinkende Tüte entgegenhielt. Sein Gegenüber nickte daraufhin betreten. »Ich hatte den Fisch über Nacht auf dem Balkon, aber die Fahrt mit der U-Bahn ist ihm wohl nicht gut bekommen. Er riecht schon ein wenig. Der Schuh ist auch da drin … Sie erinnern sich doch? Die Sachen aus dem Schnepperschützenbrunnen?«
»Ach – Herr Matzke!«, rief Kastner. »Ohne Ihre Arbeitskleidung habe ich Sie jetzt nicht gleich erkannt. Bitte entschuldigen Sie – in der ganzen Aufregung um das Kind ist Ihre Aussage gestern wohl ein wenig, äh, untergegangen.« Genau genommen hatte er Matzke vollkommen vergessen, nachdem Martina ihn zu dem Jungen geführt hatte, aber jetzt erinnerte er sich an den rätselhaften Satz: Im Schnepperschützenbrunnen liegt ein toter Fisch. Und was war das nun mit einem Schuh?
»Es ist ein brauner Halbschuh mit schwarzem Schnürsenkel«, sagte Matzke, als hätte er seine Gedanken gelesen, »und weil der Tote ja strümpfig war, dachte ich, das ist vielleicht wichtig.«
Kastner nickte zustimmend und griff mit spitzen Fingern nach der Tüte. »Danke, Herr Matzke. Es ist sehr freundlich, dass Sie uns das bringen!«
»Ja dann«, sagte Matzke und winkte wieder schüchtern mit der Linken. »Ich muss los. Meine Schicht fängt gleich an.«
Am Ende des Flurs befand sich eine kleine Putzkammer, in der Kastner sich eine Schürze und ein Paar Gummihandschuhe auslieh. Derart ausgerüstet betrat er sein Büro, stellte die stinkende Tüte im Waschbecken ab und spähte mit angehaltener Luft hinein. Der Fisch war notdürftig in Zeitungspapier gewickelt, der Schuh, der ihn weitaus mehr interessierte, lag unglücklicherweise darunter. Er griff beherzt zu und zog den Schuh am Schnürsenkel heraus. Auch den Fisch würde man sich ansehen müssen, aber das hatte Zeit. Kastner wickelte die Tüte um den Fisch, trug ihn in die Küche und verstaute ihn einstweilen im Eisfach des Kühlschranks.
Zurück in seinem Büro nahm er den Schuh in Augenschein. Es war ein rehbrauner Herrenhalbschuh mit einer Profilsohle aus Gummi, auf der die Größe eingeprägt war: zweiundvierzig. Der Schuh wies deutliche Gebrauchsspuren auf und sah aus, als habe er längere Zeit im Wasser gelegen. Das Leder war aufgequollen, der Schnürsenkel schlammig und zerschlissen. Der unbekannte Tote hatte Schuhgröße zweiundvierzig gehabt, erinnerte sich Kastner – aber wie hätte der Schuh vom Fuß des Toten in das Brunnenbecken kommen sollen?
Das Klingeln des Telefons riss ihn aus seinen Gedanken.
»Kastner?«
»Frodenberg. Guten Tag, Herr Kastner. Eine Dame vom Jugendamt hat mir Ihre Nummer gegeben – ich bin der Psychologe, der den Jungen betreut, der am Pegnitzufer aufgegriffen wurde.«
»Ah«, sagte Kastner. »Vielen Dank, dass Sie sich so schnell melden …«
Auch Frodenberg schloss eine Befragung des Jungen kategorisch aus, aber er bot ein Treffen an. »Viel kann ich Ihnen noch nicht sagen«, dämpfte er Kastners Erwartungen, »aber ich werde natürlich mein Bestes tun, um bei der Aufklärung dieser Sache zu helfen – im Interesse des Kindes.«
Sie verabredeten sich für den frühen Nachmittag in der Praxis des Psychologen. Kaum hatte Kastner aufgelegt, klingelte das Telefon erneut – diesmal war es der Polizeidirektor, der Kastner in einem Ton, der nichts Gutes verhieß, umgehend zu sich beorderte.
»Sind Sie verrückt geworden?«, begann Wismeth und schüttelte vorwurfsvoll seinen kahlen Schädel. »Nele Filipowitz soll als Anwärterin einen Einblick in unseren polizeilichen Alltag bekommen – und Sie schicken sie Kaffee holen wie ein persönliches Dienstmädchen? Polizeimeisterin Hirschel hat sich bei mir darüber beschwert, also lassen Sie das gefälligst in Zukunft! Und dass Sie einfach eine anberaumte Besprechung verlassen, das ist … unglaublich!«
»Ich wurde leider aufgehalten«, erklärte Kastner, mehr oder weniger wahrheitsgemäß. »Dieser Herr Matzke von SÖR hat etwas vorbeigebracht, das der Spurensicherung gestern durch die Lappen gegangen ist. Eventuell hängt es mit dem Fall zusammen – falls es ein Fall ist. Ist es ein Fall?«
Wismeth seufzte. »Man kann es leider nicht ausschließen. Dr. Rendlicks Team hat im Blut des Toten Diazepam nachgewiesen – K.-o.-Tropfen, gewissermaßen. Diazepam wirkt angstlösend und beruhigend; die Nebenwirkungen sind Benommenheit, Schwindel und erhöhte Sturzgefahr.« Den letzten Satz hatte Wismeth vom Monitor seines PCs abgelesen. »Frau Seitz zieht daraus folgenden Schluss«, fuhr er fort: »Entweder hat der junge Mann das Diazepam selbst eingenommen, vermutlich in Vorbereitung eines Suizids; oder jemand hat es ihm heimlich verabreicht, um ihn wehrlos zu machen.«
»Also entweder Selbstmord oder Mord«, fasste Kastner zusammen. »Wobei die Hämatome und Schürfwunden eher für Letzteres sprechen.«
Wismeth nickte resigniert. »Ja, leider. So oder so müssen wir den Toten zunächst einmal identifizieren – ich hoffe, dieses Kind kann dabei helfen … Apropos: Martina Götz hat mir das hier gegeben.« Er griff unter seinen Schreibtisch und zog eine Papiertüte hervor. »Das ist dieses – na, Sie wissen schon. Das Stofftier, der blaue Hase. Die KTU ist damit schon durch, und Frau Götz war der Meinung, dass der Junge sich vielleicht freut, wenn er ihn zurückbekommt. Vielleicht könnten Sie …?«
***
Kastners Magen knurrte schon gehörig, als Claudia endlich vor der Rathauskantine auftauchte.
»Sorry, ich bin spät dran«, entschuldigte sie sich, »aber ich hatte eine Festnahme wegen räuberischer Erpressung – Spucke auf der Uniform und frauenfeindliche Beschimpfung inklusive. Was ist los, Kastner? Ehrlich gesagt hab ich einen Mordshunger, wollen wir nicht doch in die Kantine?«
»Das geht nicht. Felix sitzt da drin.«
Claudia grinste. »Oh. Steht es so schlimm um euch?«
»Noch geht es«, sagte Kastner, »aber das könnte sich bald ändern. Und deshalb muss ich dringend mit dir sprechen … Was hältst du von einer Einladung ins Bratwursthäusle?«
»Eine Einladung?«, staunte Claudia. »Jetzt werd ich aber wirklich neugierig.«
Das Bratwursthäusle, keine hundert Meter vom Christkindlesmarkt entfernt, war rappelvoll. Durch geduldiges Warten ergatterten Kastner und Claudia schließlich zwei freie Stühle an einem Achtertisch. Die Bedienung fragte en passant »Zu trinken?« und stellte zwei Minuten später ein Spezi (Claudia) und ein Radler (Kastner) auf den Tisch. Für die Essensbestellung zückte sie nur ihren Block und hob fragend die Augenbrauen – wegen des großen Andrangs musste hier alles zack, zack gehen. Sie orderten acht Nürnberger mit Kraut und Meerrettich (Claudia) sowie ein Schäufele mit Kloß und grünem Salat (Kastner).
»Jetzt sag schon«, schrie Claudia gegen den Lärm von Touristen und Einheimischen an.
Kastner nahm einen Schluck Radler und sammelte sich, dann schrie er zurück: »Hast du schon mal über eine modulare Schulung nachgedacht?«
»Freilich«, nickte Claudia. »Aber da muss man an mehreren Maßnahmen teilnehmen und am Ende eine mündliche Prüfung machen – du erinnerst dich, dass ich alleinerziehend bin? Ich wüsste wirklich nicht, wo ich die Zeit dafür hernehmen sollte …«
Die Bedienung stellte das Essen auf den Tisch und wies stumm auf einen Bierkrug, der mit in rot-weiße Servietten gewickeltem Besteck gefüllt war.
»Das kommt jetzt gut«, sagte Claudia nach den ersten Bissen. »Danke, Kastner.«
»Bitte.« Kastner widmete sich eine Weile dem ordnungsgemäßen Zerpflücken des Kloßes in der Soße. Dabei erkannte er sofort, dass es ein Problem gab, und winkte nach der Bedienung, die von dieser nicht eingeplanten Störung ihrer wohlkoordinierten Kreise wenig erbaut war.
»Was nicht in Ordnung?«, fragte sie streng.
»Alles bestens«, beruhigte Kastner, »aber könnte ich vielleicht noch etwas Soße bekommen?«
Die Antwort war ein Blick, unter dem sich Kastner wie ein Kind fühlte, das an der Supermarktkasse nach Süßigkeiten plärrt. Die Dame eilte davon, und Kastner konnte nur hoffen, dass das Ja natürlich, kommt sofort bedeuten sollte.
»Aber der Mehraufwand wäre doch zeitlich begrenzt«, nahm er das Gespräch wieder auf. »Und danach würde man dir interessantere Aufgaben zuteilen. Wir könnten öfter zusammenarbeiten!«
Claudia hob den Kopf und musterte ihn aufmerksam. »Es ist wegen Felix, stimmt’s? Er hat mir erzählt, dass er demnächst die Qualifizierung macht. Und du befürchtest, dass er dir danach erst so richtig auf die Nerven geht.«
Kastner nickte.
»Du hast mein volles Mitgefühl. Aber ich weiß echt nicht, wie ich …« Claudia hob die Hände mitsamt Messer und Gabel in einer Geste der Ratlosigkeit. »Ich komm ja so schon kaum rum. Sofie steht vor dem Übertritt ins Gymnasium, und Jannik ist, na ja, nennen wir es betreuungsaufwendig. Klar sind die beiden nachmittags im Hort, aber du weißt schon: einkaufen, Essen kochen, Wohnung putzen …«
Die Bedienung rauschte vorüber und stellte wortlos ein Espressotässchen voll Soße neben Kastners Teller.
»Vielen, vielen Dank«, rief Kastner ihr nach. »Das ist wirklich sehr freundlich.«
»… Elternabende, Fußballtraining, Flötenunterricht, meine Mutter einfliegen lassen, wenn einer der beiden mal wieder krank ist …«
»Deine Mutter!«, fiel Kastner ihr hoffnungsvoll ins Wort. »Könnte die nicht mal für eine Weile …?«
Claudia schüttelte den Kopf. »Das will ich ihr wirklich nicht zumuten. Mein Vater hat sich auf der Arbeit das Kreuz ruiniert – ein halber Pflegefall. Meine Mutter kann wirklich nur in absoluten Notfällen einspringen.«
Aber mein Fall ist ein absoluter Notfall!, wollte Kastner rufen, verkniff es sich jedoch. Stattdessen seufzte er und goss die Extrasoße über den Kloß. »Überleg es dir bitte noch mal in Ruhe«, bat er. »Und versteh mich richtig: Ich sag das nicht nur, weil mir vor einer engeren Zusammenarbeit mit Felix graut, sondern weil ich dich für ausgesprochen fähig halte. Du bist wie alt? Vierunddreißig? Da liegt eine lange berufliche Zukunft vor dir.«
***
Nach der Mittagspause erteilte Kastner Wernreuther den Auftrag, in den Vermisstendatenbanken nach dem Toten und dem Kind zu suchen. Dann klickte er sich durch den Obduktionsbericht, oder, besser gesagt: die Obduktionspräsentation, die Tessa Seitz per E-Mail verschickt hatte, und mied dabei Unterordner mit Titeln wie Sektion des Urogenitalpakets. Guter allgemeiner Gesundheitszustand, im Blut keine Auffälligkeiten außer dem Diazepam, der Magen leer, im Darm Reste von Fischeiweiß. Kein Hinweis auf regelmäßigen Drogenkonsum, keine Spuren eines sexuellen Missbrauchs, kein kürzlich erfolgter Geschlechtsverkehr … Schließlich fand er, was er suchte – ein Porträtfoto des Toten. Kurzes braunes Haar, gelockt und im Nacken etwas länger, braune Augen, die im grellen Licht des Obduktionssaales fast schwarz wirkten. Fein gezeichnete Augenbrauen. Ein Dreitagebart. Das Gesicht war bleich und vom Wasser aufgequollen, aber Kastner erkannte eine hohe Stirn, einen etwas fleischigen Mund und ein kräftiges Kinn. Der Tote war kein im landläufigen Sinn schöner Mann gewesen, aber durchaus attraktiv. Und jung. Sehr jung.
Kastner seufzte.
Sein Handy piepte, um ihn an das Treffen mit dem Psychologen zu erinnern. Er lud das Foto des Toten auf sein Mobiltelefon und druckte es zusätzlich ein paar Mal aus, dann zog er seinen Mantel an, packte einige Dinge in seine Umhängetasche und machte sich auf den Weg zur U-Bahn.
***
Dr. Frodenberg hatte eine kleine Praxis in der Allersberger Straße, unweit des seit Längerem geschlossenen Kaufhauses am Aufseßplatz, das alteingesessene Nürnberger noch immer hartnäckig als Schocken bezeichneten, obwohl es zuletzt Kaufhof und davor Horten und Merkur geheißen hatte. Kastner hatte sich gelegentlich überlegt, ob das als eine Art zivilen Widerstands der Nürnberger gegen den Nationalsozialismus zu verstehen war – Schocken war der Name des Bauherrn jüdischer Herkunft, den das Kaufhaus bis 1938 getragen hatte –, oder ob es einfach nur Bequemlichkeit war. Für Letzteres sprach, dass es vor der Lorenzkirche im Volksmund noch immer ein Duda-Eck gab, benannt nach einem Schuhgeschäft, das vor gut sechzehn Jahren einem Drogeriemarkt hatte weichen müssen. Aber aus lokalpatriotischen Gründen wollte Kastner die andere Erklärung nicht völlig verwerfen …
Ein ruckelnder Lift brachte ihn in die vierte Etage eines großen, schmucklosen Sechzigerjahrebaus, in dem außer dem Psychologen auch noch ein Kieferorthopäde und ein Immobilienbüro residierten. Frodenberg selbst öffnete die Tür und schüttelte ihm zur Begrüßung freundlich lächelnd die Hand.
»Herr Kastner, wie schön. Kommen Sie doch rein. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Oder Kaffee?«
Kastner entschied sich für Kaffee und nahm in einem der weinroten Plüschsessel Platz, die sich in Frodenbergs Büro um einen niedrigen Tisch gruppierten. Auf dem Tisch lagen Stifte und ein Malbuch, an den hellgelben Wänden hingen Kinderzeichnungen. Es war sehr warm, und Kastner knöpfte seinen Mantel auf.
»Wollen Sie nicht ablegen?«, fragte der Psychologe und stellte ein Tablett auf den Tisch. »Ich drehe die Heizung immer hoch, denn Wärme vermittelt Geborgenheit. Und das ist es ja, was vielen Kindern und auch Jugendlichen heutzutage oft fehlt. Psychische Erkrankungen nehmen auch bei Kindern und Jugendlichen immer mehr zu. Angststörungen, depressive Störungen, Essstörungen und Aufmerksamkeitsdefizite … etwa zwanzig Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind psychisch krank. Leider werden nur wenige von ihnen adäquat therapiert.«
»Das ist bedauerlich.«
»Das ist tragisch, Herr Kastner. Gesellschaft und Politik müssen sich klarmachen, dass diese Kinder und Jugendlichen die Zukunft sind, mit der sie leben müssen. Ignorieren ist in diesem Fall keine Lösung.«
»Da haben Sie sicher recht, Herr Frodenberg. Aber ich würde gerne etwas über ein ganz bestimmtes Kind erfahren – den Jungen vom Pegnitzufer.«
»Natürlich. Zucker? Milch?«
Kastner nickte.
»Also – der Junge. Man hat ihn zunächst medizinisch untersucht und dann in einem kirchlichen Kinderhaus untergebracht. Da geht es erst einmal um grundlegende Dinge wie Essen, Schlafen und Sauberkeit. Eine gewisse Regelmäßigkeit des Lebens …«
Kastner nickte. »Wie heißt der Junge? Wo sind seine Eltern? Hat er den Toten gekannt?«
»Diese Fragen kann ich leider nicht beantworten«, sagte Frodenberg bedauernd.
»Warum nicht? Was hat der Junge denn gesagt?«
Frodenberg lehnte sich zurück und starrte auf eine der Kinderzeichnungen an der Wand, auf der ein ungelenk gezeichnetes Pferd mit blauen Flügeln und eine Art Ritter-Spiderman zu sehen waren. »Ein solcher Reiter möcht ich werden, wie mein Vater gewesen ist«, deklamierte er.
»Bitte?«
»Das hat er natürlich nicht gesagt«, gab Frodenberg zu, »aber die Assoziation hat sich mir aufgedrängt. Sie wissen, wen ich zitiert habe?«
Kastner nickte zögernd. »Das hat doch Kaspar Hauser gesagt, als er in Nürnberg aufgetaucht ist?«
»Korrekt«, nickte der Psychologe. »Und an eben diesen erinnert mich der Junge. Er spricht nicht, aber wie Kaspar Hauser hat er etwas auf ein Stück Papier gekritzelt, das ich ihm gegeben habe. Allerdings wohl kaum seinen Namen …«
»Sondern was?«, fragte Kastner gespannt.
Frodenberg zuckte die Achseln. »Das weiß ich nicht, die Sprache ist mir nicht bekannt. Aber ich habe eine Kopie gemacht – vielleicht können Sie es ja herausfinden.«
Kastner griff nach dem Zettel, den Frodenberg ihm hinhielt, aber die Sprache war auch ihm nicht geläufig. Es waren sieben Wörter, die Buchstaben klein und rundlich, das Schriftbild ungelenk. »Und gesagt hat er nichts? Gar nichts?«, hakte er nach.
»Kein Wort. Er hat auf meine Fragen nicht reagiert.«
»Das ist dann vermutlich ein Sprachproblem?«, riet Kastner mit Blick auf den Zettel.
Frodenberg sog Luft durch die geschlossenen Zähne. »Ich meine etwas anderes … Kinder reagieren immer auf eine Frage – irgendwie. Sie sagen etwas in ihrer eigenen Sprache, oder sie zucken die Achseln, heben die Augenbrauen, verziehen das Gesicht, wenden sich ab … verstehen Sie: Es gibt sehr viel mehr Arten, auf eine Frage zu reagieren, als nicht darauf zu reagieren. Er reagiert nicht darauf.«
Kastner erinnerte sich an den ausdruckslosen Blick, mit dem das Kind ihn angestarrt hatte. »Hm. Vielleicht ist er geistig behindert? Oder wie sagt man politisch korrekt: Er hat ein Handicap?«
Frodenberg lächelte. »Man sagt ein besonderes Kind. Nun, es ist zu früh, um da eine Aussage machen zu können. Er könnte an einer Störung aus dem autistischen Spektrum leiden oder ein psychisches Trauma erlitten haben … Um das abzuklären, sind Untersuchungen durch Spezialisten nötig, an die man natürlich erst denken kann, wenn das Kind sich halbwegs eingewöhnt hat.«
Kastner war enttäuscht. »Das ist schade«, seufzte er. »Was können Sie sonst über den Jungen sagen? Was hat die ärztliche Untersuchung ergeben?«
»Er leidet an Durchfall – Darmparasiten. Vermutlich hat er irgendwann einmal rohes Fleisch gegessen. Nagetiere. Ratten oder Mäuse. Ansonsten ist er körperlich verblüffend gesund. Es gibt keine Hinweise auf Gewalt oder Missbrauch und keine organischen Gründe für seine Stummheit, er ist auch weder taub noch blind. Der Junge hat einen hervorragenden Appetit, er isst alles, was man ihm vorsetzt, bis zum letzten Krümel auf; und nein, er isst nicht mit den Fingern. Er benutzt Messer und Gabel so geschickt wie Sie und ich, und am liebsten trinkt er Orangenlimonade.«
Kastner dachte eine Weile darüber nach, dann nickte er. »Na gut. Da kann man wohl nichts machen … Sobald wir herausgefunden haben, ob der Junge irgendwo vermisst wird, sage ich Ihnen Bescheid.« Er griff nach seiner Tasche und holte den Stoffhasen heraus. »Eine Runde in der Waschmaschine könnte ihm nicht schaden.«
»Oh«, sagte Frodenberg. »Gehört der …?«
»Ja, den hatte der Junge bei sich. Vielleicht freut er sich, ihn wiederzusehen. Und noch etwas … Ich habe hier ein Foto des Toten. Könnten Sie ihm das zeigen, wenn er so weit ist? Es wäre für uns sehr wichtig zu erfahren, ob er den Mann kennt.«
Frodenberg nickte zögernd und nahm das Foto an sich. »Auch ich melde mich natürlich, sobald ich neue Erkenntnisse habe. Und ich kann Ihnen meine Mobilnummer geben, dann können Sie mich jederzeit erreichen.«
»Das ist nett«, sagte Kastner und gab Frodenberg zum Abschied die Hand. »Danke, Sie haben mir sehr geholfen.«
Draußen dämmerte es bereits. Kastner stapfte durch regennasse Straßen zum Aufseßplatz und erstand am U-Bahn-Kiosk einen Döner, den er sich – angesichts der Tatsache, dass er mittags bereits ein Schäufele verzehrt hatte – als kleinen Snack mit viel Gemüse schönredete. Wie hungrig man wohl sein musste, um rohe Mäuse als Nahrungsmittel einzustufen? Anschließend fuhr er mit der U1 wieder stadteinwärts. Am Weißen Turm stieg er aus und gab es bald auf, sich zum Aufgang Jakobsplatz durchzukämpfen, stattdessen ließ er sich von Menschenmassen mit Einkaufstüten die Rolltreppe zum Ludwigsplatz hochschieben. Es hatte zu regnen begonnen, ein kalter Schneeregen, getrieben von böigem Wind. Neben dem Weißen Turm war eine lebende Krippe aufgebaut – eine gescheckte Kuh und ein magerer Esel duckten sich eng an den Holzzaun, daneben standen, bibelgeschichtlich nicht ganz korrekt, zwei braune Lamas und sahen hochnäsig auf die Passanten herab. In der Futterkrippe gab eine Babypuppe das Jesuskind, daneben saß Josef leger auf einem Schemel und rauchte eine Selbstgedrehte. Maria trug einen gelben Regenmantel. »So ein Scheißwetter«, sagte sie zu Josef, »das war eine Scheißidee von dir. Nächstes Weihnachten soll sich deine Schwester selber um ihre Drecksviecher kümmern, und wir fliegen wieder nach Malle.«
Zwischen Jakobskirche und St. Elisabeth waren ein paar Glühwein- und Bratwurststände aufgebaut, und in den Bäumen hingen Lichterketten. Gott sieht dich!, stand auf einem großen Banner an der Jakobskirche. Ob das aufmunternd oder drohend gemeint war, konnte Kastner nicht einschätzen; aber er kam zu dem Schluss, dass ein Gott, der nichts Wichtigeres zu tun fand, als griesgrämige Franken bei ihren Weihnachtseinkäufen zu beobachten, immerhin manches Elend auf der Welt erklären würde.
Im Großraumbüro des Dezernats fand Kastner einen ebenfalls griesgrämigen Wernreuther vor, der sich durch eine Datenbank des Internationalen Roten Kreuzes klickte, ein Foto des Toten vor sich auf dem Schreibtisch.
»Hallo, Felix. Gibt’s schon was?«
»Also für mich sehen die alle gleich aus«, schimpfte Wernreuther. »Wenn du mich fragst, kommen wir bei dem Toten mit dem Kriminalaktennachweis weiter als mit den Vermisstendateien – mein Instinkt sagt mir, dass das ein Drogendealer war, der zu viel von seinem eigenen Stoff erwischt hat. Plumps in den Fluss, und Ende.«
»Soso«, sagte Kastner. »Es spricht ja nichts dagegen, in der Kriminalaktendatei ebenfalls nachzusehen. Was ist mit dem Kind?«
»Nichts ist mit dem Kind. In Europa wird es jedenfalls nicht vermisst. Wenn es aus Südafrika oder Argentinien kommt, dann haben wir vielleicht über Interpol noch eine Chance … Was hat denn der Psychologe gesagt? Der Banggerd wird doch wohl wissen, wer er ist!«
»Danach sieht es im Moment nicht aus«, erklärte Kastner und gab einen kurzen Bericht über sein Gespräch mit Frodenberg.
»Na so ein Scheiß.« Wernreuther klickte sich wieder durch die Datenbank, wirkte aber zunehmend unkonzentriert. »Sag mal, hast du mit Wismeth über weitere personelle Unterstützung gesprochen? Ich mein, ich hab ja auch noch ein Privatleben. Um fünf muss ich im Bildungszentrum sein.«
Kastner erinnerte sich, dass Wernreuther zurzeit an der Volkshochschule Schwedisch lernte – warum auch immer. »Ich klär das morgen«, versprach er und wusste auch schon, wen er sich zur Unterstützung wünschen würde.
»Gut«, nickte Wernreuther. »Um sich hier unscharfe Fotos von vermissten Asylbetrügern anzusehen, braucht es nämlich nicht unbedingt einen Mann meiner Fähigkeiten.«
Das ließ Kastner unkommentiert, obwohl ihm einiges dazu eingefallen wäre. »Wenn du mit den Vermissten durch bist, nimm dir doch bitte die Kriminalaktendatei vor«, sagte er stattdessen.
Wernreuther riss die Augen auf. »Wie? Du meinst heute noch?«
Kastner nickte.
Der dezente Verwesungsgeruch in seinem Büro erinnerte Kastner an den braunen Halbschuh, der noch immer im Waschbecken stand. Er stülpte einen Beweismittelbeutel darüber und verschloss ihn luftdicht, dann griff er nach dem Telefon und wählte die Kurzwahltaste fünf.
»Götz.«
»Kastner. Dieser Herr Matzke von SÖR hat gestern einen Herrenschuh im Schnepperschützenbrunnen gefunden. Größe zweiundvierzig – der könnte doch unserem Toten gehören?«
»Zweiundvierzig ist nicht gerade eine seltene Herrenschuhgröße«, sagte Martina. Sie klang skeptisch. »Und die Schuhe des Toten liegen vermutlich am Grund der Pegnitz … Aber bitte, wenn du meinst. Ich hol das Ding morgen ab, nach dem DNA-Abgleich wissen wir mehr.« Ehe Kastner nach Neuigkeiten fragen konnte, fuhr sie fort: »Wir kommen langsam voran. Die schlechte Nachricht zuerst: An der Leiche gibt es keine brauchbaren Fremdspuren. Vermutlich, weil sie so lange im Wasser gelegen hat.«
»Na so ein Mist«, sagte Kastner. »Und was ist die gute Nachricht?«
»Hm. Von den Fußabdrücken am Ufer konnten wir drei bereits zuordnen: Sie stammen, wenig überraschend, vom Finder der Leiche, diesem Herrn Thiesfeld, und dem SÖR-Mann Matzke. Interessanter ist, dass offensichtlich auch der Junge da herumgelaufen ist, wo die Leiche gefunden wurde. Mit dem Unterschlupf sind wir auch weitergekommen: Auf den Decken und Schlafsäcken gibt es DNA-Spuren von dem Kind und dem unbekannten Toten, und auf den leeren Dosen und Wasserflaschen sind Unmengen Fingerabdrücke, ebenfalls von beiden.«
»Na, immerhin. Der Junge und der Mann haben also zusammen dort gehaust. Sie kannten sich.«
»Das ist anzunehmen«, gab Martina zu. »Wir haben auch Fremdspuren gefunden – Fingerabdrücke und ein paar Fusseln und Haare –, aber das muss nichts heißen. Die können von sonst wem stammen. Von den Supermarktangestellten zum Beispiel.«
»Hm«, machte Kastner missvergnügt.
Dann machte er Feierabend.
***
In der Küche von Kastners Zweieinhalbraumwohnung stapelte sich schmutziges Geschirr auf jeder möglichen Abstellfläche. Der Küchentisch war an die Wand geschoben worden, seinen zentralen Platz nahm nun die aus dem heimeligen Verbund der Küchenzeile herausgezerrte Spülmaschine ein. Irgendwie gelang es Mirjam, auf dem verbleibenden halben Quadratmeter freien Bodens nervös qualmend auf und ab zu laufen und dabei geschickt den verschiedenen Abdeckungen und Bauteilen auszuweichen, die Peter bereits abgeschraubt hatte. Um sich einen Überblick zu verschaffen, wie Mirjam zur Begrüßung erklärte.
»Hallo, Peter«, sagte Kastner. »Das ist nett von dir, dass du uns hilfst.«
Peter kauerte vor der Spülmaschine und leuchtete mit einer Stabtaschenlampe in deren verborgenes Innenleben. Seine gerunzelte Stirn verhieß nichts Gutes.
»Hallo, Kastner«, sagte er. »Schön, dass wir uns mal wieder sehen, auch wenn der Anlass eher traurig ist.«
»Ist es was Ernstes?«
»Ich bin dabei, das herauszufinden. Seit wann habt ihr die Maschine denn schon?«
Kastner überlegte. »Hm. Die war schon da, als ich hier eingezogen bin. Das war so vor … elf Jahren? Zwölf?«
»Oh«, sagte Peter. »Mirjam meint, sie pumpt nicht richtig ab und das Geschirr bleibt schmutzig – hast du dem etwas hinzuzufügen, das zur Diagnose beitragen kann?«
»Seit ein paar Wochen röchelt und seufzt sie bei der Arbeit«, trug Kastner bei. »Wir nennen sie die Fee Amaryllis.«
Peter hob fragend die Augenbrauen.
»Räuber Hotzenplotz«