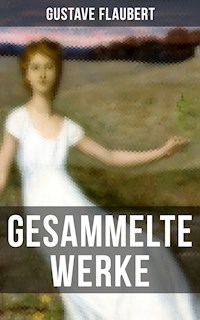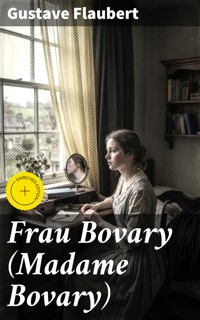
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Frau Bovary" präsentiert Gustave Flaubert ein meisterhaftes Porträt der Sehnsucht und der Unerfülltheit. Die Erzählung folgt Emma Bovary, einer Frau, die in ihrer provinziellen Existenz gefangen ist und nach einer leidenschaftlichen, romantischen Liebe strebt. Durch seine präzise, minutiöse Sprache und psychologische Einfühlung gelingt es Flaubert, die inneren Konflikte und den sozialen Druck, der auf Emma lastet, eindringlich darzustellen. Der Roman, der als eines der ersten Werke des literarischen Realismus gilt, ist von einer tiefen Ambivalenz durchzogen und thematisiert die Kluft zwischen Illusion und Realität, sodass der Leser in eine Welt voller Enttäuschungen und fragiler Träume eintaucht. Gustave Flaubert (1821-1880) war ein zentraler Vertreter des französischen Realismus und ist bekannt für seine unermüdliche Suche nach stilistischer Perfektion. Sein eigenes Leben war von einer intensiven Auseinandersetzung mit den Themen Liebe, Kunst und Gesellschaft geprägt, was sich in der komplexen Charakterzeichnung seiner Figuren widerspiegelt. Flaubert selbst war zeitlebens geprägt von der Suche nach dem "unmöglichen" Ideal, was sich direkt in Emma Bovarys inniger, jedoch vergeblicher Suche nach Erfüllung niederschlägt. "Frau Bovary" ist ein unverzichtbares Werk für jeden, der die menschliche Psyche und die Fallstricke des Lebens erkunden möchte. Flauberts Roman eröffnet den Leserinnen und Lesern einen tiefen Einblick in die Komplexität des Verlangens und die tragischen Konsequenzen von Utopien, die an der Wirklichkeit scheitern. Diese zeitlose Erzählung bleibt auch heute relevant und inspiriert dazu, über die eigene Existenz und die gesellschaftlichen Erwartungen nachzudenken. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Frau Bovary (Madame Bovary)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit spannt sich ein Abgrund. Madame Bovary erkundet ihn mit unerbittlicher Genauigkeit: das Drängen einer entfesselten Imagination, das dumpfe Gewicht des Alltags, die feinen Selbsttäuschungen, aus denen Wünsche Gewohnheiten und schließlich Schicksal werden. Flauberts Roman macht die Reibung zwischen innerem Begehren und äußerer Ordnung zum Motor jeder Szene. In der Provinz des 19. Jahrhunderts, fern der großen Ereignisse, staut sich ein Übermaß an Erwartungen, das keine angemessenen Ventile findet. Gerade in dieser Enge leuchtet das Buch auf: als präzises Porträt eines Daseins, das viel verspricht, wenig gewährt und doch unvergesslich bewegt.
Verfasst von Gustave Flaubert (1821–1880), entstand der Roman in den frühen 1850er Jahren. 1856 erschien er zuerst als Fortsetzungsroman in der Revue de Paris, 1857 folgte die Buchausgabe. Die Handlung ist in der Normandie situiert und konzentriert sich auf das Leben in Kleinstädten und Dörfern, abseits der Metropolen. Flaubert arbeitete jahrelang an jedem Satz, getrieben vom Ideal größter Genauigkeit. Das Ergebnis gilt als Meilenstein des europäischen Realismus: ein Werk, das Beobachtungslust mit stilistischer Strenge verbindet und dem Roman neue Möglichkeiten der psychologischen Darstellung und der unbestechlichen Beschreibung sozialer Wirklichkeit eröffnete.
Im Mittelpunkt steht Emma, eine junge Frau aus der Provinz, die den Landarzt Charles Bovary heiratet. Sie erwartet vom Eheleben und der bürgerlichen Ordnung eine Erhebung über das Gewöhnliche, eine Steigerung des Daseins. Doch der Rhythmus der Tage erweist sich als eintönig, die Umgebung als begrenzt, die Möglichkeiten als kleiner, als ihre Vorstellungen ihnen Platz einräumen. Zwischen Pflicht und Verlangen entstehen Spannungen, die weder lautes Drama noch spektakuläre Taten brauchen, um Wirkung zu entfalten. Flaubert zeigt, wie Erwartungen geformt werden, wie sie wachsen und an Widerständen zerschellen können – ohne das Ergebnis vorwegzunehmen.
Berühmt wurde das Buch für seine Erzähltechnik, insbesondere für die kunstvolle Verwendung der freien indirekten Rede. Flaubert lässt uns Gedanken, Stimmungen und Wahrnehmungen seiner Figuren erleben, ohne den Erzähler aufzugeben, der die Distanzen vermisst. Aus diesem Wechsel von Nähe und Ironie entsteht eine vielschichtige Perspektive, in der sich Selbstbild und Außenblick ständig spiegeln. Die Wahrnehmungen der Figuren färben die Beschreibung der Dinge; Gegenstände werden zu Resonanzkörpern innerer Zustände. Diese Technik prägte die moderne Prosa und gab dem Roman ein Instrument, um Bewusstsein nicht nur zu schildern, sondern zu inszenieren.
Nicht minder prägend ist Flauberts Sprache. Jedes Detail ist gesetzt, als hätte es kein alternatives Wort, keine andere Stellung im Satz. Der Rhythmus balanciert Schönheit und Strenge; die Bilder sind genau, nie ornamental um ihrer selbst willen. Der Ton bleibt unpathetisch und doch suggestiv, zugleich empathisch und unerbittlich. Form und Inhalt durchdringen einander: Die Nüchternheit der Beschreibung lässt das Ungesagte stärker wirken, die Ökonomie der Mittel verleiht den Bewegungen der Figuren Gewicht. So entsteht ein literarischer Raum, in dem das vermeintlich Kleine groß erscheint, und das Spektakuläre verweigert bleibt zugunsten dauernder, stiller Intensität.
Madame Bovary verhandelt Themen, die über Zeit und Ort hinausweisen: das Begehren nach einem anderen Leben, die Macht der Einbildung, die lähmende Erfahrung von Langeweile. Zugleich zeigt der Roman eine frühe Konsumgesellschaft, in der Waren, Anzeigen und Kredit die Träume strukturieren. Die Vorstellung vom Glück wird an Gegenstände, Interieurs und Gesten gebunden; die Grenze zwischen Gefühl und Vorstellung, Bedürfnis und Bedürfnisgenerierung verwischt. Flaubert fragt, was Freiheit bedeutet, wenn die Möglichkeiten vorgeprägt sind, und wie Identität entsteht, wenn Vorbilder aus Büchern, Bildern und Gesprächsfloskeln stammen.
Die Provinzgesellschaft erscheint dabei nicht als Karikatur, sondern als fein abgestuftes Gefüge aus Konventionen, Rollenerwartungen und ökonomischen Zwängen. Medizin, Kirche, Verwaltung und Geschäft bilden ein Netzwerk, das Sicherheit verspricht und doch das Handlungsspektrum eng definiert. Flaubert beobachtet, wie Sprache soziale Ordnung stiftet: Höflichkeitsformeln, Redensarten und Phrasen halten das Zusammenleben zusammen, verdecken aber auch Unkenntnis, Desinteresse und Selbstsucht. Die Figuren sind nicht bloß Typen, sondern in sich widersprüchlich; das Urteil fällt nie eindimensional. Damit wird der Roman zu einer Studie über die feine Mechanik des Bürgertums und seine oft unbewussten Selbstbeschreibungen.
Der Einfluss des Romans reicht weit. Seine Genauigkeit, sein Blick für die symbolische Kraft von Dingen und seine psychologische Durchdringung prägten Autorinnen und Autoren des späten 19. und des 20. Jahrhunderts. Häufig genannt werden Guy de Maupassant, Henry James, James Joyce und Marcel Proust, deren Werk ohne Flauberts Neuerungen schwer vorstellbar wäre. Zugleich inspirierte die Erzählweise zahlreiche Adaptionen in Theater und Film. Nicht nur die Handlung, sondern vor allem die Haltung – die kompromisslose Aufmerksamkeit für das Alltägliche – wurde zu einem Maßstab, an dem sich die realistische und moderne Prosa messen ließ.
Die Veröffentlichung löste 1857 einen viel beachteten Prozess aus: Flaubert und seine Verleger wurden wegen angeblicher Verletzung der öffentlichen und religiösen Moral angeklagt. Es kam zum Freispruch, doch die gerichtliche Auseinandersetzung machte das Buch schlagartig berühmt und prägte seine Rezeptionsgeschichte. Seitdem wird Madame Bovary als Prüfstein literarischer Freiheit gelesen – als Werk, das nicht Empörung sucht, sondern Genauigkeit, und damit Konventionen berührt, die gerade durch diese Genauigkeit sichtbar werden. Die Debatte um Anstand und Kunst, Wirklichkeitssinn und moralische Zumutungen gehört seither zum Text wie sein Schauplatz und seine Figuren.
Im deutschsprachigen Raum ist der Roman unter dem Titel Madame Bovary weithin bekannt; die Bezeichnung Frau Bovary verweist auf die gleiche Figur und Geschichte. Zahlreiche Übersetzungen haben den Ton unterschiedlich eingefangen, doch die Kontur des Werks bleibt unverwechselbar: präzise, illusionslos, von leiser Ironie getragen. Neue Ausgaben und Kommentare eröffnen immer wieder frische Zugänge, sei es über historische Kontexte, sprachliche Feinheiten oder Erzählstruktur. So ist das Buch nicht nur ein Klassiker im Regal, sondern ein Text, der bei jeder Lektüre anders antwortet – je nachdem, welche Fragen die Gegenwart an ihn richtet.
Heute wirkt Madame Bovary bemerkenswert gegenwärtig. Es zeigt, wie Bilder des guten Lebens – damals aus Romanen, Modejournalen und Schaufenstern – Erwartungen erzeugen, die an den Realitäten scheitern können. Die Mechanismen der Selbstinszenierung, des Vergleichens und der Verschuldung sind uns in neuen Medienformen vertraut. Auch die Fragen nach Geschlechterrollen, nach dem Verhältnis von Gefühl und Form, von Authentizität und Pose, behalten Schärfe. Das Buch lädt dazu ein, eigene Bedürfnisse und ihre Quellen zu prüfen: Was ist selbst gewählt, was übernommen? Und wie lässt sich ein Leben führen, das der Wirklichkeit standhält?
Darin liegen die zeitlosen Qualitäten dieses Romans: stilistische Disziplin, erzählerische Präzision, psychologische Tiefe und eine Ironie, die nie zynisch wird. Flaubert zeigt, wie ernst das Alltägliche zu nehmen ist, und wie groß die Konsequenzen kleiner Entscheidungen werden können. Wer dieses Buch liest, erhält keine moralische Lektion, sondern ein Instrument zur Beobachtung – von sich, von anderen, von den Formen, in denen die Welt sich darbietet. Als Klassiker gilt Madame Bovary, weil es Maßstäbe gesetzt hat und weiterhin setzt. Es bleibt relevant, solange Sehnsucht und Wirklichkeit einander nicht vollständig decken.
Synopsis
Madame Bovary von Gustave Flaubert, erstmals 1856/57 veröffentlicht, spielt in der französischen Provinz der Normandie. Der Roman gilt als Meilenstein des Realismus und verfolgt nüchtern die Wege, wie Vorstellungen und gesellschaftliche Zwänge das Leben seiner Figuren formen. Im Zentrum steht Emma, die Tochter eines Landwirts, und ihr Ehemann Charles, ein gutmütiger Landarzt. Aus alltäglichen Situationen heraus entfaltet Flaubert einen stillen, aber stetigen Konflikt zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit. Die Erzählung folgt der Chronologie, zeigt das dörfliche Milieu und arbeitet mit indirekter Rede, um Innenwelten und Selbsttäuschungen greifbar zu machen. Auf dieser Bühne beginnen unscheinbare Entscheidungen, weitreichende Folgen zu entwickeln.
Zunächst zeichnet der Roman Charles’ Weg: ein unauffälliger Schüler, der später eine einfache Praxis übernimmt und durch Pflichtbewusstsein eher als durch Talent auffällt. Eine Behandlung auf einem nahegelegenen Hof führt ihn zu Les Bertaux, wo er Emma Rouault kennenlernt. Ihre gepflegten Manieren und ihr Bildungshintergrund aus dem Kloster beeindrucken ihn. Sie hat dort Romane verschlungen und von einem kultivierten, erlebnisreichen Leben geträumt. Charles, damals noch verheiratet, besucht den Hof häufiger. Nach einer Wendung in seinem Privatleben öffnet sich die Möglichkeit zur Verbindung mit Emma. Die Begegnungen sind höflich, doch in ihnen liegt bereits der Keim unterschiedlicher Erwartungen an Liebe, Status und Zukunft.
Emma und Charles heiraten und richten sich zunächst in Tostes ein. Sie hofft auf Verfeinerung, Reisen und gesellschaftlichen Glanz, doch das Landleben erweist sich als eintönig. Charles verehrt sie, bleibt aber in Routinen gefangen. Die Diskrepanz zwischen Emmas idealisierten Erwartungen und der Provinzwirklichkeit wächst. Um Abstand zu gewinnen und die Praxis zu verbessern, ziehen beide nach Yonville-l’Abbaye. Dort kreuzen sich ihre Wege mit dem Apotheker Homais, der sich als tonangebender, selbstsicherer Bürger präsentiert, und mit dem jungen Schreiber Léon, der von Kunst, Musik und Literatur schwärmt. In diesem neuen Umfeld entstehen neue Hoffnungen, aber auch subtilere Versuchungen.
In Yonville erlebt Emma eine kurze Belebung: Gespräche mit Léon wecken in ihr wieder die Sehnsucht nach Kultur und Empfindung. Beide finden eine gemeinsame Sprache über Bücher, Theater und die Stadt, doch die Konventionen des Ortes, Emmas Rolle als Ehefrau und Léons Unsicherheit setzen Grenzen. Aus Furcht vor Gerede und aus Pragmatismus entscheidet sich Léon, Yonville zu verlassen, um in einer größeren Stadt sein Fortkommen zu suchen. Zurück bleibt Emma mit der Erkenntnis, dass Nähe und Erfüllung in ihrer Umgebung schwer zu halten sind. Ihr Unmut richtet sich weniger gegen Personen als gegen die Enge ihres Lebensentwurfs.
Mit der Ankunft des Grundbesitzers Rodolphe Boulanger erhält Emmas Unruhe eine neue Richtung. Er erkennt rasch ihre Empfänglichkeit für Komplimente und das Versprechen eines intensiveren Daseins. Während eines prägnanten öffentlichen Ereignisses, bei dem Fortschritt und Tugend beschworen werden, entsteht zwischen beiden eine intime Verständigung, die der Autor kunstvoll mit der Rhetorik des Festes verschränkt. Eine Liaison beginnt, gespeist von Emmas romantischen Bildern und Rodolphes Weltgewandtheit. Für Emma scheint sich hier die ersehnte Abweichung vom Gewöhnlichen zu eröffnen, und sie steigert das Bild eines möglichen anderen Lebens, in dem Leidenschaft, Luxus und Selbstbestimmung endlich deckungsgleich wären.
Ermutigt durch seine Versprechungen treibt Emma die Idee einer gemeinsamen Flucht voran. Sie organisiert, verheimlicht und entwirft Szenarien, die nicht nur die Ehe, sondern auch die sozialen Grenzen überschreiten würden. Als der entscheidende Schritt ansteht, verschiebt sich das Kräfteverhältnis: Rückzug, Ausflüchte und ein plötzliches Schweigen lassen Emma aus großer Höhe in Ernüchterung stürzen. Auf den emotionalen Schock folgt eine Phase der körperlichen Schwäche, in der Charles sie hingebungsvoll pflegt. Das Umfeld reagiert mit Anteilnahme, aber auch mit leiser Neugier. Zurück bleibt das Gefühl, dass ein entscheidender Versuch gescheitert ist, ohne die inneren Ursachen zu beheben.
Nach der Genesung sucht Charles mit gutem Willen nach Ablenkungen, die Emma Freude machen könnten. Ein Ausflug nach Rouen öffnet den Blick auf Theater, Musik und städtische Lebendigkeit. Dort trifft Emma überraschend Léon wieder, nun gereifter und selbstbewusster. Aus Begegnungen werden regelmäßige Zusammenkünfte, die zwischen Kulturgenuss und heimlicher Nähe changieren. Parallel weitet Emma ihren Konsum aus: Einrichtung, Stoffe, kleine Luxusobjekte. Der Händler Lheureux bietet bereitwillig Kredit und Ratschläge, deren Bedingungen und Verflechtungen zunächst harmlos erscheinen. Die neue Doppelökonomie aus Gefühl und Besitz nährt die Vorstellung eines reicheren Lebens, lässt aber auch Verpflichtungen anwachsen, die schwer zu überblicken sind.
Mit fortschreitender Zeit verdichten sich die Verbindlichkeiten. Rechnungen, Wechsel und Versprechen kreuzen sich, während Emma bemüht ist, verschiedene Rollen zugleich aufrechtzuerhalten: engagierte Ehefrau, kultivierte Dame, unabhängige Persönlichkeit. Versuche, kurzfristig Geld zu beschaffen, offenbaren Abhängigkeiten, die sie zuvor unterschätzt hat. Das Gefüge des Ortes – Nachbarn, Kunden, Honoratioren – reagiert empfindlich auf Abweichungen von Norm und Zahlungsdisziplin. Homais, stets um Ansehen bemüht, verkörpert die laute Seite bürgerlicher Selbstgewissheit, während andere Figuren die leisere Skepsis des Milieus spiegeln. Die Diskrepanz zwischen Schein und Sein wird zunehmend sichtbar, und Emmas Handlungsspielraum verengt sich merklich.
Der Roman steuert auf eine Zuspitzung zu, in der persönliche Sehnsucht, ökonomische Abhängigkeit und soziale Kontrolle zusammenprallen. Ohne große Gesten zeigt Flaubert, wie Bilder von Liebe und Glanz in die Mechanik von Gewohnheit, Kredit und Gerede geraten. Seine Erzähltechnik macht innere Stimmen hörbar und legt die feinen Übergänge von Wunsch zu Selbsttäuschung frei. Madame Bovary bleibt dadurch mehr als ein Ehedrama: eine kritische Studie der modernen Alltagswelt, ihrer Verführungen und Grenzen. Die Geschichte endet nicht mit einer einfachen Lektion, sondern mit einer nachhallenden Frage nach Verantwortung und Freiheit, deren Ernst bereits im Verlauf der Ereignisse spürbar wird.
Historischer Kontext
Madame Bovary spielt in der französischen Provinz, vornehmlich in der Normandie, in den 1830er und 1840er Jahren. Diese Zeit fällt großteils in die Julimonarchie unter Louis-Philippe (1830–1848), deren politische Ordnung auf Besitz und bürgerliche Repräsentation setzte. Dominant waren staatliche Zentralisierung mit Präfekten, der Einfluss der katholischen Kirche im Alltag, sowie das napoleonische Zivilrecht, das Familien- und Eigentumsverhältnisse prägte. Der Schauplatz – fiktive Orte wie Tostes und Yonville-l’Abbaye nahe Rouen – spiegelt das Frankreich der Kleinstädte: Notare, Apotheker, Ärzte, Geistliche und Kaufleute bilden die lokalen Eliten, während Bauern und Handwerker die soziale Basis stellen. Diese Konstellation strukturiert Handlungsspielräume und Erwartungen der Figuren.
Die Julimonarchie förderte eine selbstbewusste, pragmatische Bourgeoisie, die wirtschaftlichen Erfolg und respektable Lebensführung als Leitnormen setzte. Politische Stabilität galt als Vorbedingung für Handel und Eigentumsschutz. In der Provinz zeigte sich diese Ordnung in Vereinen, kommunalen Feierlichkeiten und einem Idealkanon der Nützlichkeit. Madame Bovary reflektiert diese bürgerliche Vorstellungswelt in Sitten, Sprache und materiellen Objekten: Möbel, Kleidung, Festlichkeiten, Zeitungen und Visitenkonventionen sind nicht bloße Requisiten, sondern Ausdruck sozialer Position. Die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität – zwischen bürgerlichem Anspruch und provinzieller Beschränktheit – wird zur Quelle von Spannungen, die Flaubert mit nüchterner Genauigkeit registriert.
Die französische Verwaltung war stark zentralisiert, doch im Alltag prägten „honorige“ Ortsgrößen das soziale Gefüge. Bürgermeister, Notar, Pfarrer und Apotheker wetteiferten um Einfluss, Ehrungen und öffentliche Sichtbarkeit. Komitees, Wohltätigkeitsvereine und Preisverleihungen strukturierten das Gemeindeleben. Flauberts Provinzpanorama folgt diesen Mechanismen: Öffentliche Reden, Anzeigen, Einladungen und Lokalzeitungen werden zu Medien symbolischen Kapitals. Das System der lokalen Notablen vermittelt zwischen Staat und Gesellschaft, betont aber auch Konformität. Die Figuren agieren in einem Netz aus Höflichkeiten, Rivalitäten und diskreter Kontrolle, das sowohl soziale Sicherung bietet als auch individuelle Wünsche normiert und begrenzt.
Ökonomisch erlebte die Provinz einen Übergang von subsistenznaher Landwirtschaft zu stärkerer Marktorientierung. Kommerzielle Vermittler – Textilhändler, Hausierer, Eisenwarenläden – erschlossen neue Konsumwünsche. Kauf auf Kredit, Wechsel und Schuldscheine verbreiteten sich, unterstützt durch das Handelsrecht und lokale Notare. Diese Kreditwirtschaft war flexibel, aber riskant: verspätete Zahlungen führten zu Protesten, Pfändungen und öffentlichen Versteigerungen. In Madame Bovary wird diese Ökonomie sichtbar in Modeartikeln, Einrichtungsgegenständen und Verträgen, die Status versprechen und Abhängigkeiten schaffen. Konsum wird zur sozialen Sprache; zugleich offenbart Flaubert die rechtliche und moralische Schwere, die Schulden in kleinen Gemeinschaften haben.
Das napoleonische Zivilrecht strukturierte Ehe, Erbrecht und Eigentum. Für verheiratete Frauen galten im 19. Jahrhundert umfangreiche Einschränkungen der Geschäftsfähigkeit; vielerorts war die Zustimmung des Ehemanns erforderlich, um Verträge wirksam zu schließen. Zugleich blieb die Scheidung in Frankreich von 1816 bis 1884 abgeschafft; nur die gerichtliche Trennung war möglich, die die Ehe nicht aufhob. Das Strafrecht bewertete weibliche und männliche Untreue ungleich. In diesem normativen Rahmen gewinnen bürgerliche Tugenden – Treue, Sparsamkeit, Bescheidenheit – besonderes Gewicht. Flauberts Roman zeigt, wie rechtliche Strukturen intime Entscheidungen rahmen und Konflikte verschärfen, ohne die Figuren psychologisch zu entschuldigen oder zu anklagen.
Die katholische Kirche blieb ein zentraler Bezugspunkt der Provinzgesellschaft. Volksfrömmigkeit, Sakramente, Prozessionen und religiöse Vereine prägten den Kalender. Gleichzeitig spitzte sich im 19. Jahrhundert der Konflikt zwischen kirchlicher Autorität und liberal-aufklärerischen Milieus zu. Antiklerikale Haltungen gewannen im Bürgertum an Boden, nicht zuletzt in den freien Berufen. Madame Bovary spiegelt diese Frontstellung in alltäglichen Begegnungen: Pfarrer, Apotheker und Arzt vertreten unterschiedliche Deutungen von Fortschritt, Moral und Heil. Flaubert zeigt weniger Glaubensfragen als soziale Rollenspiele, in denen Religion, Wissenschaft und Nützlichkeit um Deutungshoheit ringen.
Die Medizin befand sich im Aufbruch. Zwischen Pariser Klinik und Provinz lagen große Unterschiede in Ausbildung und Praxis. Neben promovierten Ärzten wirkten „officiers de santé“ mit kürzerer Ausbildung, besonders auf dem Land. Orthopädische Innovationen – etwa die Tenotomie zur Behandlung des Klumpfußes, in Frankreich seit den 1830er Jahren von Chirurgen wie Jules Guérin propagiert – erregten Hoffnungen und Kontroversen. Der Roman greift diese Ambivalenz auf: Prestige, Heilserwartung und Risiko verweben sich in provinziellen Therapieversuchen. Flauberts genaue Beobachtung medizinischer Routinen verweist auf sein Umfeld in Rouen, wo sein Vater als Chirurg arbeitete und ihm Krankenhausrealität vertraut war.
Bildungspolitisch markierte das Guizot-Gesetz von 1833 einen Einschnitt: Jede Gemeinde sollte eine Primarschule unterhalten, und Lehrerbildung wurde systematisiert. Für Mädchen blieb der Schulweg oft über religiöse Institutionen – Klosterschulen und Pensionate – organisiert, mit Schwerpunkt auf Moral, Handarbeit und „guten Manieren“. Gleichzeitig wuchs der Lesestoff: Leihbibliotheken, Feuilletons und preisgünstige Bändchen verbreiteten Historienromane, Reiseberichte und sentimentale Literatur. Madame Bovary verknüpft diese Bildungs- und Lesekultur mit Erwartungshorizonten: Bücher, Magazine und Alben liefern Vorlagen für Gefühle und Lebensentwürfe, die im provinziellen Alltag auf Widerstände stoßen.
Literarisch steht der Roman im Übergang von der Romantik zum Realismus. Während die Romantik ekstatische Gefühle, außergewöhnliche Schicksale und Naturmetaphern privilegierte, insistiert der Realismus auf Milieu, Alltagssprache und Kausalität. Flaubert radikalisiert diese Tendenz mit seinem Ideal der „Unpersönlichkeit“ und einem präzisen, rhythmisch komponierten Stil. Das Verfahren des erlebten Redens (style indirect libre) ermöglicht, Gedankenwelten der Figuren mit der Erzählinstanz zu verschränken, ohne Kommentar. So entsteht eine subtile Kritik an Klischees romantischer Rhetorik, die im sozialen Raum der Julimonarchie – geprägt von Nutzenkalkül und Respektabilität – fremd wirkt und zugleich verführerisch bleibt.
Kommunikation und Mobilität veränderten sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spürbar. Regelmäßige Diligencen verbanden Kleinstädte mit Präfektursitzen wie Rouen; Post und Zeitungen verbreiteten Nachrichten und Moden. Ab den 1840er Jahren kamen Eisenbahnlinien hinzu, zunächst auf Hauptstrecken, was Distanzen schrumpfen ließ und Städtezugänge erleichterte. In Madame Bovary bleibt die Postkutsche ein wichtiges Requisit des Alltagsverkehrs, während die Nähe zur Großstadtkultur bereits spürbar wird. Diese Infrastrukturverschiebung vergrößert Handlungsspielräume, schafft jedoch zugleich neue Vergleichshorizonte: Die Provinz misst sich an urbanen Versprechen, deren Erfüllung im Alltag brüchig bleibt.
Rouen fungiert als regionales Zentrum mit Handel, Verwaltung, Theater und Oper. Es bietet die Bühne bürgerlicher Repräsentation – Logen, Abonnements, Flanieren – und vermittelt Pariser Moden in die Normandie. Flaubert, 1821 in Rouen geboren, kannte diese Kultur aus nächster Nähe. Der Roman nutzt die Stadt als Kontrastfolie zur Kleinstadt: Hier verdichten sich Anregungen, Waren und Verlockungen. Das städtische Vergnügungsangebot steht für Modernität und kulturelles Kapital, zugleich für finanzielle Belastungen und soziale Bewertung. Der Weg zwischen Yonville und Rouen räumlich wie symbolisch – markiert den Übergang von provinzieller Enge zu urbaner Inszenierung.
Agrarische Modernisierung manifestierte sich in landwirtschaftlichen Ausstellungen und Preisverleihungen. Diese „comices agricoles“ – gefördert von Behörden und Vereinen – propagierten neuartige Geräte, Zuchtmethoden und Düngungstechniken. Reden über Fortschritt, Moral und Patriotismus begleiteten die Prämierungen. Flaubert inszeniert eine solche Veranstaltung, um bäuerliche Arbeit, städtisches Pathos und bürgerliche Selbstdarstellung ineinander zu spiegeln. Hinter dem Fortschrittsjargon erscheint eine Gesellschaft, die sich über Produktivität und Ordnung definiert, aber ihre Widersprüche rhetorisch überdeckt. Die Gleichzeitigkeit von technischer Neuerung und sozialer Stagnation wird zur leisen Satire auf öffentliche Selbstversicherung.
Der Publikationskontext ist selbst Teil der Geschichte: Madame Bovary erschien 1856 zunächst als Fortsetzungsroman in der Revue de Paris, also im Medium, das bürgerliche Lektüregewohnheiten prägte. Die Reaktion der Behörden folgte rasch: Anfang 1857 wurde Flaubert wegen Verstoßes gegen die öffentliche Moral und Religion angeklagt. Vor Gericht verteidigte er die künstlerische Objektivität und den dokumentarischen Anspruch seines Stils. Das Urteil endete mit einem Freispruch, doch die Debatte legte offen, wie Realismus als Provokation verstanden wurde, sobald er Sexualität, Ehebruch und Heuchelei ohne moralisierende Absicherung zeigte.
Die Affäre fiel in das Klima des Zweiten Kaiserreichs (seit 1852), das publizistische Kontrolle und Sittenpolitik verschärfte. Im selben Jahr 1857 wurde auch Charles Baudelaire wegen Les Fleurs du mal verurteilt; in beiden Prozessen agierte der Staatsanwalt Ernest Pinard. Der Staat beanspruchte, Kunst im Namen öffentlicher Ordnung und Moral zu zügeln. Flauberts Freispruch war daher mehr als persönlicher Erfolg: Er markierte einen Grenzfall, der die Autonomie realistischer Literatur behauptete. Die Kontroverse machte das Buch weithin bekannt und rahmte seine Lektüre als zeitkritisches Dokument, nicht als bloße Provokation.
Zur Entstehungsgeschichte gehört Flauberts Rückzug nach Croisset bei Rouen, wo er zwischen etwa 1851 und 1856 in strenger Arbeitsdisziplin am Text feilte. Briefe bezeugen sein Bemühen um „le mot juste“ und eine genaue Topographie der Normandie. Als möglicher Realhintergrund gilt ein in der Region bekannt gewordener Fall: das Ehe- und Verschuldungsschicksal des Ehepaars Delamare in Ry in den 1840er Jahren. Flaubert bestritt die Reduktion auf ein Schlüsselroman-Schema, nutzte aber nachweislich Beobachtungen, Zeitungsberichte und lokale Details. Der Roman verdichtet damit Erfahrungen der Provinz zu einem allgemeineren, literarisch geformten Befund.
Konsumkultur gewann in der Mitte des Jahrhunderts an Dynamik. Pariser Warenhäuser – die in den 1850er Jahren neue Verkaufsformen etablierten – setzten Maßstäbe für Auswahl, Schaufenstergestaltung und Preispsychologie. Auch in der Provinz weckten Musterbücher, Anzeigen und Zwischenhändler Begehren nach Mode, Tapisserien und Accessoires. Der Roman zeigt diese zirkulierenden Objekte als Versprechen von Stil und Identität. Gleichzeitig offenbart sich die Schattenseite: Kreditketten, Wechsel und juristische Konsequenzen. Der Kaufmann als moderne Figur moderiert Träume – und bindet. So wird Konsum zur sozialen Dramaturgie, in der ökonomische Innovationen intime Lebensentwürfe formen.
Schließlich reflektiert Madame Bovary den Spannungsbogen zwischen Modernisierung und Normendruck. Schulreformen, Verkehr, Medizin und Märkte erweitern Möglichkeiten; Recht, Moral und Reputationsökonomie ziehen Grenzen. Flauberts Realismus kommentiert diese Gegenwart, indem er die Sprache der Gefühle, der Werbung, der Amtsrede und der Wissenschaft nebeneinanderstellt. Ohne Thesenroman zu sein, legt das Buch die Mechanik einer Gesellschaft frei, die Glück verspricht und Konformität belohnt. Seine Kritik trifft romantische Klischees ebenso wie bürgerliche Selbstgewissheiten. Darin liegt die Zeitgenossenschaft des Werks: Es zeigt, wie modern gewordene Wünsche auf vorindustrielle Strukturen treffen – mit Folgen, die weit über die Provinz hinausweisen.
Autorenbiografie
Gustave Flaubert (1821–1880) gilt als eine der prägendsten Stimmen des französischen 19. Jahrhunderts. Seine prosaästhetische Strenge, die Suche nach dem mot juste und die Haltung einer weitgehend unpersönlichen Erzählweise machten ihn zu einem Bezugspunkt des literarischen Realismus und darüber hinaus. Flauberts Werk verbindet minutiöse Beobachtung mit formaler Disziplin und einer skeptischen Betrachtung bürgerlicher Vorstellungen und Phrasen. Mit Romanen, historischen Stoffen und Kurzprosa setzte er Maßstäbe für Narration, Rhythmus und Satzbau, die bis in die Moderne wirken. Er verfeinerte den Stil indirect libre und eröffnete neue Möglichkeiten der Bewusstseinsdarstellung. Zeitgenössische Kontroversen begleiteten sein Schaffen, doch sein nachhaltiger Einfluss ist unbestritten.
Flaubert wurde in Rouen geboren und erhielt dort eine solide schulische Ausbildung, die frühe Lektüren und Schreibversuche begünstigte. In den frühen 1840er-Jahren zog er nach Paris, um Rechtswissenschaften zu studieren, brach das Studium jedoch nach einer schweren gesundheitlichen Krise ab. Er kehrte in die Normandie zurück und richtete sich in Croisset an der Seine als konsequent arbeitender Autor ein. Von da an widmete er sich ganz der Literatur, mit einem Tagesregime aus Lesen, Notieren und lauten Probedurchgängen, um Klang und Rhythmus zu prüfen. Frühfassungen der Versuchung des heiligen Antonius zeigen sein hartnäckiges Ringen um Stoff, Struktur und Ton.
Am Anfang stand eine deutliche Nähe zur Romantik, doch Flaubert entfernte sich schrittweise von pathetischer Selbstausstellung und strebte nach stilistischer Impersonalität. Zwischen 1849 und 1851 reiste er mit Maxime Du Camp durch Ägypten, den Nahen Osten und Teile Nordafrikas; Eindrücke, Studien und Notate speisten spätere historische Stoffe. Er setzte sich intensiv mit antiken Quellen, Geschichtsschreibung und Reiseberichten auseinander. Der briefliche Austausch mit Zeitgenossen wie George Sand und Iwan Turgenjew ist gut dokumentiert und beleuchtet seine poetologischen Überzeugungen. Als Förderer jüngerer Autorinnen und Autoren unterstützte er Guy de Maupassant. Sein Perfektionismus sprengte gängige Schulen und stärkte zugleich die realistische Tradition.
Den literarischen Durchbruch brachte Madame Bovary, nach Vorabdrucken in den Jahren 1856/57 als Buch erschienen. Das Werk führte 1857 zu einem vielbeachteten Prozess wegen Sittenverstoßes; Flaubert wurde freigesprochen, der Roman erlangte enorme Aufmerksamkeit. Madame Bovary gilt als Muster für genaue Milieuschilderung, ironische Distanz und psychologische Feinzeichnung, ohne auf programmatische Botschaften zu setzen. Mit Salammbô (1862) wandte er sich einem antiken Historienstoff zu, gestützt auf akribische Recherchen und Exzerpte. Die kontrastierenden Stoffe zeigen seine Spannweite zwischen zeitgenössischer Provinz und rekonstruierter Vergangenheit, verbunden durch dieselbe formale Strenge und eine kompromisslose Ablehnung von stilistischen Ungenauigkeiten.
Mit L’Éducation sentimentale (1869) entwarf Flaubert ein weites Gesellschaftspanorama, das individuelle Sehnsüchte, Bildungswege und historische Umbrüche kunstvoll verschränkt. Die zeitgenössische Resonanz fiel verhalten aus, doch heute gilt der Roman als Schlüsselwerk der europäischen Prosa. Er verfeinert Verfahren wie den Stil indirect libre, die verteilte Fokalisierung und subtile Ironie. Flauberts anhaltende Skepsis gegenüber Gemeinplätzen und sprachlichen Floskeln bildet dabei ein kritisches Fundament. Er arbeitete parallel an anderen Projekten, sichtete Archive und Augenzeugenberichte und akzeptierte langwierige Überarbeitungen. So zeigte sich ein Autor, der Genauigkeit über Tempo stellte und die Form als ethischen Maßstab des Schreibens verstand.
Die endgültige Fassung der Versuchung des heiligen Antonius erschien 1874, ein poetisch-spekulatives Prosawerk voller gelehrter Anspielungen. 1877 veröffentlichte er Trois contes, drei stilistisch unterschiedliche Erzählungen, die seine Meisterschaft in der Kurzform bekräftigten. In seinen letzten Jahren widmete er sich Bouvard et Pécuchet, einer satirischen, unvollendet gebliebenen Romanunternehmung, die nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Das ebenfalls postum verbreitete Dictionnaire des idées reçues versammelt in Stichwortform Stereotype und Redensarten und beleuchtet seine Abneigung gegen gedankenlose Phrasen. Diese späten Projekte bündeln seine lebenslange Kritik an Banalität, seine Belesenheit und sein Streben nach präziser, klangbewusster Darstellung.
Flaubert erlebte tiefgreifende politische und gesellschaftliche Erschütterungen seiner Epoche, beharrte jedoch auf einer werkzentrierten Autorschaft, die Genauigkeit, Distanz und Form vor Meinungsäußerung stellte. Er starb 1880 in der Normandie, hinterließ jedoch ein Werk, das die Poetik des modernen Romans nachhaltig geprägt hat. Seine Kunst des Ausschnitts, die ironische Perspektive und die konsequente Stilkritik wirken in Strömungen von Naturalismus bis Moderne fort. Autorinnen und Autoren verschiedener Sprachen beriefen sich auf seine Präzision und seine Erzähltechnik. Forschung, Lehre und neue Übersetzungen halten sein Werk präsent und eröffnen fortlaufend Zugänge zu Themen, Verfahren und Wirkung.
Frau Bovary (Madame Bovary)
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Es war Arbeitsstunde[1q]. Da trat der Rektor ein, ihm zur Seite ein »Neuer«, in gewöhnlichem Anzuge. Der Pedell hinter den beiden, Schulstubengerät in den Händen. Alle Schüler erhoben sich von ihren Plätzen, wobei man so tat, als sei man aus seinen Studien aufgescheucht worden. Wer eingenickt war, fuhr mit auf.
Der Rektor winkte ab. Man setzte sich wieder hin. Darauf wandte er sich zu dem die Aufsicht führenden Lehrer.
»Herr Roger!« lispelte er. »Diesen neuen Zögling hier empfehle ich Ihnen besonders. Er kommt zunächst in die Quinta[1]. Bei löblichem Fleiß und Betragen wird er aber in die Quarta versetzt, in die er seinem Alter nach gehört.«
Der Neuling blieb in dem Winkel hinter der Türe stehen. Man konnte ihn nicht ordentlich sehen, aber offenbar war er ein Bauernjunge, so ungefähr fünfzehn Jahre alt und größer als alle andern. Die Haare trug er mit Simpelfransen in die Stirn hinein, wie ein Dorfschulmeister. Sonst sah er gar nicht dumm aus, nur war er höchst verlegen. So schmächtig er war, beengte ihn sein grüner Tuchrock mit schwarzen Knöpfen doch sichtlich, und durch den Schlitz in den Ärmelaufschlägen schimmerten rote Handgelenke hervor, die zweifellos die freie Luft gewöhnt waren. Er hatte gelbbraune, durch die Träger übermäßig hochgezogene Hosen an und blaue Strümpfe. Seine Stiefel waren derb, schlecht gewichst und mit Nägeln beschlagen.
Man begann die fertigen Arbeiten vorzulesen. Der Neuling hörte aufmerksamst zu, mit wahrer Kirchenandacht, wobei er es nicht einmal wagte, die Beine übereinander zu schlagen noch den Ellenbogen aufzustützen. Um zwei Uhr, als die Schulglocke läutete, mußte ihn der Lehrer erst besonders auffordern, ehe er sich den andern anschloß.
Es war in der Klasse Sitte, beim Eintritt in das Unterrichtszimmer die Mützen wegzuschleudern, um die Hände frei zu bekommen. Es kam darauf an, seine Mütze gleich von der Tür aus unter die richtige Bank zu facken, wobei sie unter einer tüchtigen Staubwolke laut aufklatschte. Das war so Schuljungenart.
Sei es nun, daß ihm dieses Verfahren entgangen war oder daß er nicht gewagt hatte, es ebenso zu machen, kurz und gut: als das Gebet zu Ende war, hatte der Neuling seine Mütze noch immer vor sich auf den Knien. Das war ein wahrer Wechselbalg von Kopfbedeckung. Bestandteile von ihr erinnerten an eine Bärenmütze, andre an eine Tschapka, wieder andre an einen runden Filzhut, an ein Pelzbarett, an ein wollnes Käppi, mit einem Worte: an allerlei armselige Dinge, deren stumme Häßlichkeit tiefsinnig stimmt wie das Gesicht eines Blödsinnigen. Sie war eiförmig, und Fischbeinstäbchen verliehen ihr den inneren Halt; zu unterst sah man drei runde Wülste, darüber (voneinander durch ein rotes Band getrennt) Rauten aus Samt und Kaninchenfell und zuoberst eine Art Sack, den ein vieleckiger Pappdeckel mit kunterbunter Schnurenstickerei krönte und von dem herab an einem ziemlich dünnen Faden eine kleine goldne Troddel hing. Diese Kopfbedeckung war neu, was man am Glanze des Schirmes erkennen konnte.
»Steh auf!« befahl der Lehrer.
Der Junge erhob sich. Dabei entglitt ihm sein Turban, und die ganze Klasse fing an zu kichern. Er bückte sich, das Mützenungetüm aufzuheben. Ein Nachbar stieß mit dem Ellenbogen daran, so daß es wiederum zu Boden fiel. Ein abermaliges Sich-darnach-bücken.
»Leg doch deinen Helm weg!« sagte der Lehrer, ein Witzbold.
Das schallende Gelächter der Schüler brachte den armen Jungen gänzlich aus der Fassung, und nun wußte er gleich gar nicht, ob er seinen »Helm« in der Hand behalten oder auf dem Boden liegen lassen oder aufsetzen sollte. Er nahm Platz und legte die Mütze über seine Knie.
»Steh auf!« wiederholte der Lehrer, »und sag mir deinen Namen!«
Der Neuling stotterte einen unverständlichen Namen her.
»Noch mal!«
Dasselbe Silbengestammel machte sich hörbar, von dem Gelächter der Klasse übertönt.
»Lauter!« rief der Lehrer. »Lauter!«
Nunmehr nahm sich der Neuling fest zusammen, riß den Mund weit auf und gab mit voller Lungenkraft, als ob er jemanden rufen wollte, das Wort von sich: »Kabovary!«
Höllenlärm erhob sich und wurde immer stärker; dazwischen gellten Rufe. Man brüllte, heulte, grölte wieder und wieder: »Kabovary! Kabovary!« Nach und nach verlor sich der Spektakel in vereinzeltes Brummen, kam mühsam zur Ruhe, lebte aber in den Bankreihen heimlich weiter, um da und dort plötzlich als halbersticktes Gekicher wieder aufzukommen, wie eine Rakete, die im Verlöschen immer wieder noch ein paar Funken sprüht.
Währenddem ward unter einem Hagel von Strafarbeiten die Ordnung in der Klasse allmählich wiedergewonnen, und es gelang dem Lehrer, den Namen »Karl Bovary« festzustellen, nachdem er sich ihn hatte diktieren, buchstabieren und dann noch einmal im ganzen wiederholen lassen. Alsdann befahl er dem armen Schelm, sich auf die Strafbank dicht vor dem Katheder zu setzen. Der Junge wollte den Befehl ausführen, aber kaum hatte er sich in Gang gesetzt, als er bereits wieder stehen blieb.
»Was suchst du?« fragte der Lehrer.
»Meine Mü…«, sagte er schüchtern, indem er mit scheuen Blicken Umschau hielt.
»Fünfhundert Verse die ganze Klasse!«
Wie das Quos ego[2] bändigte die Stimme, die diese Worte wütend ausrief, einen neuen Sturm im Entstehen.
»Ich bitte mir Ruhe aus!« fuhr der empörte Schulmeister fort, während er sich mit seinem Taschentuche den Schweiß von der Stirne trocknete. »Und du, du Rekrut du, du schreibst mir zwanzigmal den Satz auf: Ridiculus sum!« Sein Zorn ließ nach. »Na, und deine Mütze wirst du schon wiederfinden. Die har dir niemand gestohlen.«
Alles ward wieder ruhig. Die Köpfe versanken in den Heften, und der Neuling verharrte zwei Stunden lang in musterhafter Haltung, obgleich ihm von Zeit zu Zeit mit einem Federhalter abgeschwuppte kleine Papierkugeln ins Gesicht flogen. Erwischte sich jedesmal mit der Hand ab, ohne sich weiter zu bewegen noch die Augen aufzuschlagen.
Abends, im Arbeitssaal, holte er seine Ärmelschoner aus seinem Pult, brachte seine Habseligkeiten in Ordnung und liniierte sich sorgsam sein Schreibpapier. Die andern beobachteten, wie er gewissenhaft arbeitete; er schlug alle Wörter im Wörterbuche nach und gab sich viel Mühe. Zweifellos verdankte er es dem großen Fleiße, den er an den Tag legte, daß man ihn nicht in der Quinta zurückbehielt; denn wenn er auch die Regeln ganz leidlich wußte, so verstand er sich doch nicht gewandt auszudrücken. Der Pfarrer seines Heimatdorfes hatte ihm kaum ein bißchen Latein beigebracht, und aus Sparsamkeit war er von seinen Eltern so spät wie nur möglich auf das Gymnasium geschickt worden.
Sein Vater, Karl Dionys Barthel Bovary, war Stabsarzt a.D.; er hatte sich um 1812 bei den Aushebungen etwas zuschulden kommen lassen, worauf er den Abschied nehmen mußte. Er setzte nunmehr seine körperlichen Vorzüge in bare Münze um und ergatterte sich im Handumdrehen eine Mitgift von sechzigtausend Franken, die ihm in der Person der Tochter eines Hutfabrikanten in den Weg kam. Das Mädchen hatte sich in den hübschen Mann verliebt. Er war ein Schwerenöter und Prahlhans, der sporenklingend einherstolzierte, Schnurr-und Backenbart trug, die Hände voller Ringe hatte und in seiner Kleidung auffällige Farben liebte. Neben seinem Haudegentum besaß er das gewandte Getue eines Ellenreiters. Sobald er verheiratet war, begann er zwei, drei Jahre auf Kosten seiner Frau zu leben, aß und trank gut, schlief bis in den halben Tag hinein und rauchte aus langen Porzellanpfeifen. Nachts pflegte er sehr spät heimzukommen, nachdem er sich in Kaffeehäusern herumgetrieben hatte. Als sein Schwiegervater starb und nur wenig hinterließ, war Bovary empört darüber. Er übernahm die Fabrik, büßte aber Geld dabei ein, und so zog er sich schließlich auf das Land zurück, wovon er sich goldne Berge erträumte. Aber er verstand von der Landwirtschaft auch nicht mehr als von der Hutmacherei, ritt lieber spazieren, als daß er seine Pferde zur Arbeit einspannen ließ, trank seinen Apfelwein flaschenweise selber, anstatt ihn in Fässern zu verkaufen, ließ das fetteste Geflügel in den eignen Magen gelangen und schmierte sich mit dem Speck seiner Schweine seine Jagdstiefel. Auf diesem Wege sah er zu guter Letzt ein, daß es am tunlichsten für ihn sei, sich in keinerlei Geschäfte mehr einzulassen.
Für zweihundert Franken Jahrespacht mietete er nun in einem Dorfe im Grenzgebiete von Caux und der Pikardie ein Grundstück, halb Bauernhof, halb Herrenhaus. Dahin zog er sich zurück fünfundvierzig Jahre alt, mit Gott und der Welt zerfallen, gallig und mißgünstig zu jedermann. Von den Menschen angeekelt, wie er sagte, wollte er in Frieden für sich hinleben.
Seine Frau war dereinst toll verliebt in ihn gewesen. Aber unter tausend Demütigungen starb ihre Liebe doch rettungslos.
Ehedem heiter, mitteilsam und herzlich, war sie allmählich (just wie sich abgestandner Wein zu Essig wandelt) mürrisch, zänkisch und nervös geworden. Ohne zu klagen, hatte sie viel gelitten, wenn sie immer wieder sah, wie ihr Mann hinter allen Dorfdirnen her war und abends müde und nach Fusel stinkend aus irgendwelcher Spelunke zu ihr nach Haus kam. Ihr Stolz hatte sich zunächst mächtig geregt, aber schließlich schwieg sie, würgte ihren Grimm in stummem Stoizismus hinunter und beherrschte sich bis zu ihrem letzten Stündlein. Sie war unablässig tätig und immer auf dem Posten. Sie war es, die zu den Anwälten und Behörden ging. Sie wußte, wenn Wechsel fällig waren; sie erwirkte ihre Verlängerung. Sie machte alle Hausarbeiten, nähte, wusch, beaufsichtigte die Arbeiter und führte die Bücher, während der Herr und Gebieter sich um nichts kümmerte, aus seinem Zustande griesgrämlicher Schläfrigkeit nicht herauskam und sich höchstens dazu ermannte, seiner Frau garstige Dinge zu sagen. Meist hockte er am Kamin, qualmte und spuckte ab und zu in die Asche.
Als ein Kind zur Welt kam, mußte es einer Amme gegeben werden; und als es wieder zu Hause war, wurde das schwächliche Geschöpf grenzenlos verwöhnt. Die Mutter nährte es mit Zuckerzeug. Der Vater ließ es barfuß herumlaufen und meinte höchst weise obendrein, der Kleine könne eigentlich ganz nackt gehen wie die Jungen der Tiere. Im Gegensatz zu den Bestrebungen der Mutter hatte er sich ein bestimmtes männliches Erziehungsideal in den Kopf gesetzt, nach welchem er seinen Sohn zu modeln sich Mühe gab. Er sollte rauh angefaßt werden wie ein junger Spartaner, damit er sich tüchtig abhärte. Er mußte in einem ungeheizten Zimmer schlafen, einen ordentlichen Schluck Rum vertragen und auf den »kirchlichen Klimbim« schimpfen. Aber der Kleine war von friedfertiger Natur und widerstrebte allen diesen Bemühungen. Die Mutter schleppte ihn immer mit sich herum. Sie schnitt ihm Pappfiguren aus und erzählte ihm Märchen; sie unterhielt sich mit ihm in endlosen Selbstgesprächen, die von schwermütiger Fröhlichkeit und wortreicher Zärtlichkeit überquollen. In ihrer Verlassenheit pflanzte sie in das Herz ihres Jungen alle ihre eigenen unerfüllten und verlorenen Sehnsüchte. Im Traume sah sie ihn erwachsen, hochangesehen, schön, klug, als Beamten beim Straßen-und Brückenbau oder in einer Ratsstellung. Sie lehrte ihn Lesen und brachte ihm sogar an dem alten Klavier, das sie besaß, das Singen von ein paar Liedchen bei. Ihr Mann, der von gelehrten Dingen nicht viel hielt, bemerkte zu alledem, es sei bloß schade um die Mühe; sie hätten doch niemals die Mittel, den Jungen auf eine höhere Schule zu schicken oder ihm ein Amt oder ein Geschäft zu kaufen. Zu was auch? Dem Kecken gehöre die Welt! Frau Bovary schwieg still, und der Kleine trieb sich im Dorfe herum. Er lief mit den Feldarbeitern hinaus, scheuchte die Krähen auf, schmauste Beeren an den Rainen, hütete mit einer Gerte die Truthähne und durchstreifte Wald und Flur. Wenn es regnete, spielte er unter dem Kirchenportal mit kleinen Steinchen, und an den Feiertagen bestürmte er den Kirchendiener, die Glocken läuten zu dürfen. Dann hängte er sich mit seinem ganzen Gewicht an den Strang der großen Glocke und ließ sich mit emporziehen. So wuchs er auf wie eine Lilie auf dem Felde, bekam kräftige Glieder und frische Farben.
Als er zwölf Jahre alt geworden war, setzte es seine Mutter durch, daß er endlich etwas Gescheites lerne. Er bekam Unterricht beim Pfarrer, aber die Stunden waren so kurz und so unregelmäßig, daß sie nicht viel Erfolg hatten. Sie fanden statt, wenn der Geistliche einmal gar nichts anders zu tun hatte, in der Sakristei, im Stehen, in aller Hast in den Pausen zwischen den Taufen und Begräbnissen. Mitunter, wenn er keine Lust hatte auszugehen, ließ der Pfarrer seinen Schüler nach dem Ave-Maria zu sich holen. Die beiden saßen dann oben im Stübchen. Mücken und Nachtfalter tanzten um die Kerze; aber es war so warm drin, daß der Junge schläfrig wurde, und es dauerte nicht lange, da schnarchte der biedere Pfarrer, die Hände über dem Schmerbauche gefaltet. Es kam auch vor, daß der Seelensorger auf dem Heimwege von irgendeinem Kranken in der Umgegend, dem er das Abendmahl gereicht hatte, den kleinen Vagabunden im Freien erwischte; dann rief er ihn heran, hielt ihm eine viertelstündige Strafpredigt und benutzte die Gelegenheit, ihn im Schatten eines Baumes seine Lektion hersagen zu lassen. Entweder war es der Regen, der den Unterricht störte, oder irgendein Bekannter, der vorüberging. Übrigens war der Lehrer durchweg mit seinem Schüler zufrieden, ja er meinte sogar, der »junge Mann« habe ein gar treffliches Gedächtnis.
So konnte es nicht weitergehen. Frau Bovary ward energisch, und ihr Mann gab widerstandslos nach, vielleicht weil er sich selber schämte, wahrscheinlicher aber aus Ohnmacht. Man wollte nur noch ein Jahr warten; der Junge sollte erst gefirmelt werden.
Darüber hinaus verstrich abermals ein halbes Jahr, dann aber wurde Karl wirklich auf das Gymnasium nach Rouen geschickt. Sein Vater brachte ihn selber hin. Das war Ende Oktober.
Die meisten seiner damaligen Kameraden werden sich kaum noch deutlich an ihn erinnern. Er war ein ziemlich phlegmatischer Junge, der in der Freizeit wie ein Kind spielte, in den Arbeitsstunden eifrig lernte, während des Unterrichts aufmerksam dasaß, im Schlafsaal vorschriftsmäßig schlief und bei den Mahlzeiten ordentlich zulangte. Sein Verkehr außerhalb der Schule war ein Eisengroßhändler in der Handschuhmachergasse, der aller vier Wochen einmal mit ihm ausging, an Sonntagen nach Ladenschluß. Er lief mit ihm am Hafen spazieren, zeigte ihm die Schiffe und brachte ihn abends um sieben Uhr vor dem Abendessen wieder in das Gymnasium. Jeden Donnerstag abend schrieb Karl mit roter Tinte an seine Mutter einen langen Brief, den er immer mit drei Oblaten zuklebte. Hernach vertiefte er sich wieder in seine Geschichtshefte, oder er las in einem alten Exemplar von Barthelemys »Reise des jungen Anacharsis«, das im Arbeitssaal herumlag. Bei Ausflügen plauderte er mit dem Pedell, der ebenfalls vom Lande war.
Durch seinen Fleiß gelang es ihm, sich immer in der Mitte der Klasse zu halten; einmal errang er sich sogar einen Preis in der Naturkunde. Aber gegen Ende des dritten Schuljahres nahmen ihn seine Eltern vom Gymnasium fort und ließen ihn Medizin studieren. Sie waren der festen Zuversicht, daß er sich bis zum Staatsexamen schon durchwürgen würde.
Die Mutter mietete ihm ein Stübchen, vier Stock hoch, nach der Eau-de-Robec zu gelegen, im Hause eines Färbers, eines alten Bekannten von ihr. Sie traf Vereinbarungen über die Verpflegung ihres Sohnes, besorgte ein paar Möbelstücke, einen Tisch und zwei Stühle, wozu sie von zu Hause noch eine Bettstelle aus Kirschbaumholz kommen ließ. Des weiteren kaufte sie ein Kanonenöfchen und einen kleinen Vorrat von Holz, damit ihr armer Junge nicht frieren sollte. Acht Tage darnach reiste sie wieder heim, nachdem sie ihn tausend-und abertausendmal ermahnt hatte, ja hübsch fleißig und solid zu bleiben, sintemal er nun ganz allein auf sich selbst angewiesen sei.
Vor dem Verzeichnis der Vorlesungen auf dem schwarzen Brette der medizinischen Hochschule vergingen dem neubackenen Studenten Augen und Ohren. Er las da von anatomischen und pathologischen Kursen, von Kollegien über Physiologie, Pharmazie, Chemie, Botanik, Therapeutik und Hygiene, von Kursen in der Klinik, von praktischen Übungen usw. Alle diese vielen Namen, über deren Herkunft er sich nicht einmal klar war, standen so recht vor ihm wie geheimnisvolle Pforten in das Heiligtum der Wissenschaft.
Er lernte gar nichts. So aufmerksam er auch in den Vorlesungen war, er begriff nichts. Um so mehr büffelte er. Er schrieb fleißig nach, versäumte kein Kolleg und fehlte in keiner Übung. Er erfüllte sein tägliches Arbeitspensum wie ein Gaul im Hippodrom, der in einem fort den Hufschlag hintrottet, ohne zu wissen, was für ein Geschäft er eigentlich verrichtet.
Zu seiner pekuniären Unterstützung schickte ihm seine Mutter allwöchentlich durch den Botenmann ein Stück Kalbsbraten. Das war sein Frühstück, wenn er aus dem Krankenhause auf einen Husch nach Hause kam. Sich erst hinzusetzen, dazu langte die Zeit nicht, denn er mußte alsbald wieder in ein Kolleg oder zur Anatomie oder Klinik eilen, durch eine Unmenge von Straßen hindurch. Abends nahm er an der kargen Hauptmahlzeit seiner Wirtsleute teil. Hinterher ging er hinauf in seine Stube und setzte sich an seine Lehrbücher, oft in nassen Kleidern, die ihm dann am Leibe bei der Rotglut des kleinen Ofens zu dampfen begannen.
An schönen Sommerabenden, wenn die schwülen Gassen leer wurden und die Dienstmädchen vor den Haustüren Ball spielten, öffnete er sein Fenster und sah hinaus. Unten floß der Fluß vorüber, der aus diesem Viertel von Rouen ein häßliches Klein-Venedig machte. Seine gelben, violett und blau schimmernden Wasser krochen träg zu den Wehren und Brücken. Arbeiter kauerten am Ufer und wuschen sich die Arme in der Flut. An Stangen, die aus Speichergiebeln lang hervorragten, trockneten Bündel von Baumwolle in der Luft. Gegenüber, hinter den Dächern, leuchtete der weite klare Himmel mit der sinkenden roten Sonne. Wie herrlich mußte es da draußen im Freien sein! Und dort im Buchenwald wie frisch! Karl holte tief Atem, um den köstlichen Duft der Felder einzusaugen, der doch gar nicht bis zu ihm drang.
Er magerte ab und sah sehr schmächtig aus. Sein Gesicht bekam einen leidvollen Zug, der es beinahe interessant machte. Er ward träge, was gar nicht zu verwundern war, und seinen guten Vorsätzen mehr und mehr untreu. Heute versäumte er die Klinik, morgen ein Kolleg, und allmählich fand er Genuß am Faulenzen und ging gar nicht mehr hin. Er wurde Stammgast in einer Winkelkneipe und ein passionierter Dominospieler. Alle Abende in einer schmutzigen Spelunke zu hocken und mit den beinernen Spielsteinen auf einem Marmortische zu klappern, das dünkte ihn der höchste Grad von Freiheit zu sein, und das stärkte ihm sein Selbstbewußtsein. Es war ihm das so etwas wie der Anfang eines weltmännischen Lebens, dieses Kosten verbotener Freuden. Wenn er hinkam, legte er seine Hand mit geradezu sinnlichem Vergnügen auf die Türklinke. Eine Menge Dinge, die bis dahin in ihm unterdrückt worden waren, gewannen nunmehr Leben und Gestalt. Er lernte Gassenhauer auswendig, die er gelegentlich zum besten gab. Béranger, der Freiheitssänger, begeisterte ihn. Er lernte eine gute Bowle brauen, und zu guter Letzt entdeckte er die Liebe. Dank diesen Vorbereitungen fiel er im medizinischen Staatseramen glänzend durch.
Man erwartete ihn am nämlichen Abend zu Haus, wo sein Erfolg bei einem Schmaus gefeiert werden sollte. Er machte sich zu Fuß auf den Weg und erreichte gegen Abend seine Heimat. Dort ließ er seine Mutter an den Dorfeingang bitten und beichtete ihr alles. Sie entschuldigte ihn, schob den Mißerfolg der Ungerechtigkeit der Examinatoren in die Schuhe und richtete ihn ein wenig auf, indem sie ihm versprach, die Sache ins Lot zu bringen. Erst volle fünf Jahre darnach erfuhr Herr Bovary die Wahrheit. Da war die Geschichte verjährt, und so fügte er sich drein. Übrigens hätte er es niemals zugegeben, daß sein leiblicher Sohn ein Dummkopf sei.
Karl widmete sich von neuem seinem Studium und bereitete sich hartnäckigst auf eine nochmalige Prüfung vor. Alles, was er gefragt werden konnte, lernte er einfach auswendig. In der Tat bestand er das Examen nunmehr mit einer ziemlich guten Note. Seine Mutter erlebte einen Freudentag. Es fand ein großes Festmahl statt.
Wo sollte er seine ärztliche Praxis nun ausüben? In Tostes. Dort gab es nur einen und zwar sehr alten Arzt. Mutter Bovary wartete schon lange auf sein Hinscheiden, und kaum hatte der alte Herr das Zeitliche gesegnet, da ließ sich Karl Bovary auch bereits als sein Nachfolger daselbst nieder.
Aber nicht genug, daß die Mutter ihren Sohn erzogen, ihn Medizin studieren lassen und ihm eine Praxis ausfindig gemacht hatte: nun mußte er auch eine Frau haben. Selbige fand sie in der Witwe des Gerichtsvollziehers von Dieppe, die neben fünfundvierzig Jährlein zwölfhundert Franken Rente ihr eigen nannte. Obgleich sie häßlich war, dürr wie eine Hopfenstange und im Gesicht so viel Pickel wie ein Kirschbaum Blüten hatte, fehlte es der Witwe Dubuc keineswegs an Bewerbern. Um zu ihrem Ziele zu gelangen, mußte Mutter Bovary erst alle diese Nebenbuhler aus dem Felde schlagen, was sie sehr geschickt fertig brachte. Sie triumphierte sogar über einen Fleischermeister, dessen Anwartschaft durch die Geistlichkeit unterstützt wurde.
Karl hatte in die Heirat eingewilligt in der Erwartung, sich dadurch günstiger zu stellen. Er hoffte, persönlich wie pekuniär unabhängiger zu werden. Aber Heloise nahm die Zügel in ihre Hände. Sie drillte ihm ein, was er vor den Leuten zu sagen habe und was nicht. Alle Freitage wurde gefastet. Er durfte sich nur nach ihrem Geschmacke kleiden, und die Patienten, die nicht bezahlten, mußte er auf ihren Befehl hin kujonieren. Sie erbrach seine Briefe, überwachte jeden Schritt, den er tat, und horchte an der Türe, wenn weibliche Wesen in seiner Sprechstunde waren. Jeden Morgen mußte sie ihre Schokolade haben, und die Rücksichten, die sie erheischte, nahmen kein Ende. Unaufhörlich klagte sie über Migräne, Brustschmerzen oder Verdauungsstörungen. Wenn viel Leute durch den Hausflur liefen, ging es ihr auf die Nerven. War Karl auswärts, dann fand sie die Einsamkeit gräßlich; kehrte er heim, so war es zweifellos bloß, weil er gedacht habe, sie liege im Sterben. Wenn er nachts in das Schlafzimmer kam, streckte sie ihm ihre mageren langen Arme aus ihren Decken entgegen, umschlang seinen Hals und zog ihn auf den Rand ihres Bettes. Und nun ging die Jeremiade los. Er vernachlässige sie, er liebe eine andre! Man habe es ihr ja gleich gesagt, diese Heirat sei ihr Unglück. Schließlich bat sie ihn um einen Löffel Arznei, damit sie gesund werde, und um ein bißchen mehr Liebe.
Zweites Kapitel
Einmal nachts gegen elf Uhr wurde das Ehepaar durch das Getrappel eines Pferdes geweckt, das gerade vor der Haustüre zum Stehen kam. Anastasia, das Dienstmädchen, klappte ihr Bodenfenster auf und verhandelte eine Weile mit einem Manne, der unten auf der Straße stand. Er wolle den Arzt holen. Er habe einen Brief an ihn.
Anastasia stieg frierend die Treppen hinunter und schob die Riegel auf, einen und dann den andern. Der Bote ließ sein Pferd stehen, folgte dem Mädchen und betrat ohne weiteres das Schlafgemach. Er entnahm seinem wollnen Käppi, an dem eine graue Troddel hing, einen Brief, der in einen Lappen eingewickelt war, und überreicht ihn dem Arzt mit höflicher Gebärde. Der richtete sich im Bett auf, um den Brief zu lesen. Anastasia stand dicht daneben und hielt den Leuchter. Die Frau Doktor kehrte sich verschämt der Wand zu und zeigte den Rücken.
In dem Briefe, den ein niedliches blaues Siegel verschloß, wurde Herr Bovary dringend gebeten, unverzüglich nach dem Pachtgut Les Bertaur zu kommen, ein gebrochenes Bein zu behandeln. Nun braucht man von Tostes über Longueville und Sankt Victor bis Bertaur zu Fuß sechs gute Stunden. Die Nacht war stockfinster. Frau Bovary sprach die Befürchtung aus, es könne ihrem Manne etwas zustoßen. Infolgedessen ward beschlossen, daß der Stallknecht vorausreiten, Karl aber erst drei Stunden später, nach Mondaufgang, folgen solle. Man würde ihm einen Jungen entgegenschicken, der ihm den Weg zum Gute zeige und ihm den Hof aufschlösse.
Früh gegen vier Uhr machte sich Karl, fest in feinen Mantel gehüllt, auf den Weg nach Bertaur. Noch ganz verschlafen überließ er sich dem Zotteltrab seines Gaules. Wenn dieser von selber vor irgendeinem im Wege liegenden Hindernis zum Halten parierte, wurde der Reiter jedesmal wach, erinnerte sich des gebrochnen Beines und begann in seinem Gedächtnisse alles auszukramen, was er von Knochenbrüchen wußte.
Der Regen hörte auf. Es dämmerte. Auf den laublosen Ästen der Apfelbäume hockten regungslose Vögel, das Gefieder ob des kühlen Morgenwindes gesträubt. So weit das Auge sah, dehnte sich flaches Land. Auf dieser endlosen grauen Fläche hoben sich hie und da in großen Zwischenräumen tiefviolette Flecken ab, die am Horizonte mit des Himmels trüben Farben zusammenflossen; das waren Baumgruppen um Güter und Meiereien herum. Von Zeit zu Zeit riß Karl seine Augen auf, bis ihn die Müdigkeit von neuem überwältigte und der Schlaf von selber wiederkam. Er geriet in einen traumartigen Zustand, in dem sich frische Empfindungen mit alten Erinnerungen paarten, so daß er ein Doppelleben führte. Er war noch Student und gleichzeitig schon Arzt und Ehemann. Im nämlichen Moment glaubte er in seinem Ehebette zu liegen und wie einst durch den Operationssaal zu schreiten. Der Geruch von heißen Umschlägen mischte sich in seiner Phantasie mit dem frischen Dufte des Morgentaus. Dazu hörte er, wie die Messingringe an den Stangen der Bettvorhänge klirrten und wie seine Frau im Schlafe atmete…
Als er durch das Dorf Vassonville ritt, bemerkte er einen Jungen, der am Rande des Straßengrabens im Grase saß.
»Sind Sie der Herr Doktor?«
Als Karl diese Frage bejahte, nahm der Kleine seine Holzpantoffeln in die Hände und begann vor dem Pferde herzurennen. Unterwegs hörte Bovary aus den Reden seines Führers heraus, daß Herr Rouault, der Patient, der ihn erwartete, einer der wohlhabendsten Landwirte sei. Er hatte sich am vergangenen Abend auf dem Heimwege von einem Nachbar, wo man das Dreikönigsfest[3] gefeiert hatte, ein Bein gebrochen. Seine Frau war schon zwei Jahre tot. Er lebte ganz allein mit »dem gnädigen Fräulein«, das ihm den Haushalt führte.
Die Radfurchen wurden tiefer. Man näherte sich dem Gute. Plötzlich verschwand der Junge in der Lücke einer Gartenhecke, um hinter der Mauer eines Vorhofes wieder aufzutauchen, wo er ein großes Tor öffnete. Das Pferd trat in nasses rutschiges Gras, und Karl mußte sich ducken, um nicht vom Baumgezweig aus dem Sattel gerissen zu werden. Hofhunde fuhren aus ihren Hütten, schlugen an und rasselten an den Ketten. Als der Arzt in den eigentlichen Gutshof einritt, scheute der Gaul und machte einen großen Satz zur Seite.
Das Pachtgut Bertaur war ein ansehnliches Besitztum. Durch die offenstehenden Türen konnte man in die Ställe blicken, wo kräftige Ackergäule gemächlich aus blanken Raufen ihr Heu kauten. Längs der Wirtschaftsgebäude zog sich ein dampfender Misthaufen hin. Unter den Hühnern und Truthähnen machten sich fünf bis sechs Pfauen mausig, der Stolz der Güter jener Gegend. Der Schafstall war lang, die Scheune hoch und ihre Mauern spiegelglatt. Im Schuppen standen zwei große Leiterwagen und vier Pflüge, dazu die nötigen Pferdegeschirre, Kumte und Peitschen; auf den blauen Woilachs aus Schafwolle hatte sich feiner Staub gelagert, der von den Kornböden heruntersickerte. Der Hof, der nach dem Wohnhause zu etwas anstieg, war auf beiden Seiten mit einer Reihe Bäume bepflanzt. Vom Tümpel her erscholl das fröhliche Geschnatter der Gänse.
An der Schwelle des Hauses erschien ein junges Frauenzimmer in einem mit drei Volants besetzten blauen Merinokleide und begrüßte den Arzt. Er wurde nach der Küche geführt, wo ein tüchtiges Feuer brannte. Auf dem Herde kochte in kleinen Töpfen von verschiedener Form das Frühstück des Gesindes. Oben im Rauchfang hingen naßgewordene Kleidungsstücke zum Trocknen. Kohlenschaufel, Feuerzange und Blasebalg, alle miteinander von riesiger Größe, funkelten wie von blankem Stahl, während längs der Wände eine Unmenge Küchengerät hing, über dem die helle Herdflamme um die Wette mit den ersten Strahlen der durch die Fenster huschenden Morgensonne spielte und glitzerte.
Karl stieg in den ersten Stock hinauf, um den Kranken aufzusuchen. Er fand ihn in seinem Bett, schwitzend unter seinen Decken. Seine Nachtmütze hatte er in die Stube geschleudert. Es war ein stämmiger kleiner Mann, ein Fünfziger, mit weißem Haar, blauen Augen und kahler Stirn. Er trug Ohrringe. Neben ihm auf einem Stuhle stand eine große Karaffe voll Branntwein, aus der er sich von Zeit zu Zeit ein Gläschen einschenkte, um »Mumm in die Knochen zu kriegen«. Angesichts des Arztes legte sich seine Erregung. Statt zu fluchen und zu wettern – was er seit zwölf Stunden getan hatte – fing er nunmehr an zu ächzen und zu stöhnen.
Der Bruch war einfach, ohne jedwede Komplikation. Karl hätte sich einen leichteren Fall nicht zu wünschen gewagt. Alsbald erinnerte er sich der Allüren, die seine Lehrmeister an den Krankenlagern zur Schau gerragen harten, und spendete dem Patienten ein reichliches Maß der üblichen guten Worte, jenes Chirurgenbalsams, der an das Öl gemahnt, mit dem die Seziermesser eingefetter werden. Er ließ sich aus dem Holzschuppen ein paar Latten holen, um Holz zu Schienen zu bekommen. Von den gebrachten Stücken wählte er eins aus, schnitt die Schienen daraus zurecht und glättete sie mit einer Glasscherbe. Währenddem stellte die Magd Leinwandbinden her, und Fräulein Emma, die Tochter des Hauses, versuchte Polster anzufertigen. Als sie ihren Nähkasten nicht gleich fand, polterte der Vater los. Sie sagte kein Wort. Aber beim Nähen stach sie sich in den Finger, nahm ihn in den Mund und sog das Blut aus.
Karl war erstaunt, was für blendendweiße Nägel sie hatte. Sie waren mandelförmig geschnitten und sorglich gepflegt, und so schimmerten sie wie das feinste Elfenbein. Ihre Hände freilich waren nicht gerade schön, vielleicht nicht weiß genug und ein wenig zu mager in den Fingern; dabei waren sie allzu schlank, nicht besonders weich und in ihren Linien ungraziös. Was jedoch schön an ihr war, das waren ihre Augen. Sie waren braun, aber im Schatten der Wimpern sahen sie schwarz aus, und ihr offener Blick traf die Menschen mit der Kühnheit der Unschuld.
Als der Verband fertig war, lud Herr Rouault den Arzt feierlich »einen Bissen zu essen«, ehe er wieder aufbräche. Karl ward in das Esszimmer geführt, das zu ebener Erde lag. Auf einem kleinen Tische war für zwei Personen gedeckt; neben den Gedecken blinkten silberne Becher. Aus dem großen Eichenschranke, gegenüber dem Fenster, strömte Geruch von Iris und feuchtem Leinen. In einer Ecke standen aufrecht in Reih und Glied mehrere Säcke mit Getreide; sie hatten auf der Kornkammer nebenan keinen Platz gefunden, zu der drei Steinstufen hinaufführten. In der Mitte der Wand, deren grüner Anstrich sich stellenweise abblätterte, hing in einem vergoldeten Rahmen eine Bleistiftzeichnung: der Kopf einer Minerva. In schnörkeliger Schrift stand darunter geschrieben. »Meinem lieben Vater!«
Sie sprachen zuerst von dem Unfall, dann vom Wetter, vom starken Frost, von den Wölfen, die nachts die Umgegend unsicher machen. Fraulein Rouault schwärmte gar nicht besonders von dem Leben auf dem Lande, zumal jetzt nicht, wo die ganze Last der Gutswirtschaft fast allein auf ihr ruhe. Da es im Zimmer kalt war, fröstelte sie während der ganzen Mahlzeit. Beim Essen fielen ihre vollen Lippen etwas auf. Wenn das Gespräch stockte, pflegte sie mit den Oberzähnen auf die Unterlippe zu beißen.
Ihr Hals wuchs aus einem weißen Umlegekragen heraus. Ihr schwarzes, hinten zu einem reichen Knoten vereintes Haar war in der Mitte gescheitelt; beide Hälften lagen so glatt auf dem Kopfe, daß sie wie zwei Flügel aus je einem Stücke aussahen und kaum die Ohrläppchen blicken ließen. Über den Schläfen war das Haar gewellt, was der Landarzt noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Ihre Wangen waren rosig. Zwischen zwei Knöpfen ihrer Taille lugte – wie bei einem Herrn – ein Lorgnon aus Schildpatt hervor.
Nachdem sich Karl oben beim alten Rouault verabschiedet hatte, trat er nochmals in das Eßzimmer. Er fand Emma am Fenster stehend, die Stirn an die Scheiben gedrückt. Sie schaute in den Garten hinaus, wo der Wind die Bohnenstangen umgeworfen hatte. Sich umwendend, fragte sie:
»Suchen Sie etwas?«
»Meinen Reitstock, wenn Sie gestatten!«
Er fing an zu suchen, hinter den Türen und unter den Stühlen. Der Stock war auf den Fußboden gefallen, gerade zwischen die Säcke und die Wand. Emma entdeckte ihn. Als sie sich über die Säcke beugte, wollte Karl ihr galant zuvorkommen. Wie er seinen Arm in der nämlichen Absicht wie sie ausstreckte, berührte seine Brust den gebückten Rücken des jungen Mädchens. Sie fühlten es beide. Emma fuhr rasch in die Höhe. Ganz rot geworden, sah sie ihn über die Schulter weg an, indem sie ihm seinen Reitstock reichte.
Er hatte versprochen, in drei Tagen wieder nachzusehen; statt dessen war er bereits am nächsten Tag zur Stelle, und von da ab kam er regelmäßig zweimal in der Woche, ungerechnet die gelegentlichen Besuche, die er hin und wieder machte, wenn er »zufällig in der Gegend« war. Übrigens ging alles vorzüglich; die Heilung verlief regelrecht, und als man nach sechs und einer halben Woche Vater Rouault ohne Stock wieder in Haus und Hof herumstiefeln sah, hatte sich Bovary in der ganzen Gegend den Ruf einer Kapazität erworben. Der alte Herr meinte, besser hätten ihn die ersten Ärzte von Yvetot oder selbst von Rouen auch nicht kurieren können.
Karl dachte gar nicht daran, sich zu befragen, warum er so gern nach dem Rouaultschen Gute kam. Und wenn er auch darüber nachgesonnen hätte, so würde er den Beweggrund seines Eifers zweifellos in die Wichtigkeit des Falles oder vielleicht in das in Aussicht stehende hohe Honorar gelegt haben. Waren dies aber wirklich die Gründe, die ihm seine Besuche des Pachthofes zu köstlichen Abwechselungen in dem armseligen Einerlei seines tätigen Lebens machten? An solchen Tagen stand er zeitig auf, ritt im Galopp ab und ließ den Gaul die ganze Strecke lang kaum zu Atem kommen. Kurz vor seinem Ziele aber pflegte er abzusitzen und sich die Stiefel mit Gras zu reinigen; dann zog er sich die braunen Reithandschuhe an, und so ritt er kreuzvergnügt in den Gutshof ein. Es war ihm ein Wonnegefühl, mit der Schulter gegen den nachgebenden Flügel des Hoftores anzureiten, den Hahn auf der Mauer krähen zu hören und sich von der Dorfjugend umringt zu sehen. Er liebte die Scheune und die Ställe; er liebte den Papa Rouault, der ihm so treuherzig die Hand schüttelte und ihn seinen Lebensretter nannte; er liebte die niedlichen Holzpantoffeln des Gutsfräuleins, die auf den immer sauber gescheuerten Fliesen der Küche so allerliebst schlürften und klapperten. In diesen Schuhen sah Emma viel größer aus denn sonst. Wenn Karl wieder ging, gab sie ihm jedesmal das Geleit bis zur ersten Stufe der Freitreppe. War sein Pferd noch nicht vorgeführt, dann wartete sie mit. Sie hatten schon Abschied voneinander genommen, und so sprachen sie nicht mehr. Wenn es sehr windig war, kam ihr flaumiges Haar im Nacken in wehenden Wirrwarr, oder die Schürzenbänder begannen ihr um die Hüften zu flattern. Einmal war Tauwetter. An den Rinden der Bäume rann Wasser in den Hof hinab, und auf den Dächern der Gebäude schmolz aller Schnee. Emma war bereits auf der Schwelle, da ging sie wieder ins Haus, holte ihren Sonnenschirm und spannte ihn auf. Die Sonnenlichter stahlen sich durch die taubengraue Seide und tupften tanzende Reflexe auf die weiße Haut ihres Gesichts. Das gab ein so warmes und wohliges Gefühl, daß Emma lächelte. Einzelne Wassertropfen prallten auf das Schirmdach, laut vernehmbar, einer, wieder einer, noch einer …