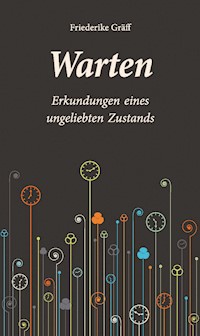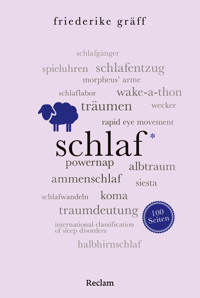15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In jedem Leben gibt es Momente, in denen etwas Unerwartetes geschieht. Momente wie Wunder. Oder Lebensphasen, in denen sich eine überraschende Abzweigung von eingetretenen Pfaden auftut und man sich selbst staunend zuschaut. Von diesen Momenten und Zuständen erzählt Friederike Gräff empathisch, lakonisch und mit nüchterner Komik. Jede Erzählung ist ein eigener Kosmos, und in jedem herrschen eigene Regeln: Die stellvertretende Abteilungsleiterin Frau Zilius legt zu ihrem Befremden ein faustgroßes Ei, während sie eigentlich mit einer unschönen Personalangelegenheit beschäftigt ist. Inmitten eines Gottesdienstes fängt Sabine Kleinhans an, ihrer Kirchenbank zu entschweben – und damit einem Leben, eingeklemmt zwischen selbstherrlichen Arbeitskollegen und einem desinteressierten Ehemann. Bernward Kreutzträger beschließt an einem Mittwoch, sich einer Schafherde anzuschließen, weil ihn die Nähe anderer Menschen zunehmend zornig macht ... Friederike Gräffs Erzählungen gehen an die Grenzen dessen, was wir für Alltag und Wirklichkeit halten, und öffnen so den Blick für die quälend-wunderbaren Rätsel unserer Existenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Friederike Gräff
Frau Zilius legte ihr erstes Ei an einem Donnerstag
Erzählungen
Schöffling & Co.
Inhalt
Eier
Eine höhere Ordnung
Meine Hoffnung und meine Freude
So wahr dieser Zweig nicht grünt
Prügelei, Samstagnachmittag, ohne Zuschauer
Vor der Schur
Adam
Die Sanftheit ihrer Haut
Meine allerliebsten Freunde
Das Volk der Midianiter
Paul Unkrich klingelte nicht
Ein haariger Mann
Schlaf, Kindlein, schlaf
Eingaben und Beschwerden
Dank
Eier
Frau Zilius legte ihr erstes Ei an einem Donnerstag. Am Mittwoch hatte sie Herrn Möllers entlassen. Es war ihre erste Kündigung gewesen.
»Wir müssen Ihnen leider kündigen, Herr Möllers«, hatte Frau Zilius zu ihm gesagt.
Herr Möllers hatte keine Überraschung gezeigt, es war das zweite Mal gewesen, dass er zu Kunden der Wasserwerke gefahren war und ihnen nahegelegt hatte, die Wasserrechnung bar bei ihm zu bezahlen. Als der erste Versuch bekannt geworden war, hatte er Frau Zilius gegenüber geschwiegen, aber in der Stadt hieß es, dass er mit dem Geld die Spielschulden seiner Frau bezahlt habe.
»Zu wann?«, fragte Herr Möllers.
»Zum Ende des Monats«, sagte Frau Zilius.
»Möchten Sie noch etwas wissen?«, fragte sie. »Können wir etwas für Sie tun?«
Aber Herr Möllers hatte keine Fragen, und er schien nicht zu glauben, dass die Wasserwerke etwas für ihn tun könnten.
Frau Zilius war an diesem Abend früh zu Bett gegangen, und am nächsten Morgen hatte sie auf dem Teppich davor das Ei gefunden. Es war hellbraun, faustgroß, und Frau Zilius war sich bewusst, dass sie selbst es gelegt hatte.
Sie bettete es in die Strümpfe im unteren Fach ihres Kleiderschranks und vermied es, über die genauen Umstände nachzudenken, denn das Körperliche war ihr fremd. Sie aß zwar gerne und hatte mit der Zeit die Form einer Birne angenommen, aber sie hielt einen Abstand zwischen sich und den Menschen, und als ihr Mann sie verließ, hatte er ihr mitgeteilt, dass er endlich körperliche Leidenschaft kennengelernt habe.
Als Frau Zilius am Donnerstag zu den Wasserwerken fuhr, versuchte sie, das Ei zu vergessen. Sie begegnete Herrn Möllers auf dem Parkplatz und grüßte ihn, aber er grüßte nicht zurück.
Sie hatte sich nie gewünscht, Abteilungsleiterin zu werden, sie war zufrieden damit gewesen, die Qualität des Trinkwassers zu prüfen. Doch als der Geschäftsführer sie gefragt hatte, ob sie die Stelle nicht wenigstens vorübergehend übernehmen könne, den Wasserwerken zuliebe, hatte sie eingewilligt.
Den Tag verbrachte sie damit, die Briefe der Wasserwerkskunden aus der vergangenen Woche zu beantworten. Es waren zwei Beschwerden, die beide beklagten, dass die Wasserwerke den Jodgehalt im Wasser nicht erhöhten. Sie hätten im Fernsehen einen Bericht über eine kalifornische Kleinstadt gesehen, schrieben die Wasserwerkskunden, wo dem Wasser Jod zugesetzt werde, weshalb die Bewohner dieser Stadt nun viel älter würden. Die Wasserwerkskunden fragten, warum ihre Wasserwerke nicht das Gleiche täten, und brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass es nicht am Geiz der Wasserwerke scheitere.
Frau Zilius erstellte eine Liste, um die Tage, an denen sie noch kommissarische Abteilungsleiterin sein würde, abzuhaken.
Auf dem Nachhauseweg ging sie in einen Supermarkt und blätterte eine Weile in den Zeitschriften, dann blieb sie vor dem Regal mit den Eiern stehen. Es gab Eier aus Bodenhaltung und Eier aus Freilandhaltung, es gab weiße und braune, und es gab auch welche, denen drei wertvolle Omega-Säuren zugesetzt worden waren.
Am nächsten Tag fand Frau Zilius kein Ei vor ihrem Bett. Herrn Möllers sah sie nur von ferne, und sie hakte einen Tag auf ihrer Liste ab.
Am Abend rief ihr Sohn an. Er hieß Lasse, und der Name hatte gut zu ihm gepasst, als er ein kleiner Junge mit wirren blonden Haaren gewesen war. Nun war er Punk, seine Haare waren in dunklen Tönen gefärbt und stachen in sieben Strahlen in die Höhe, und Frau Zilius fragte sich gelegentlich, ob sie seinen Namen zu selbstgewiss gewählt hatte. Es störte sie nicht, dass er Nietenjacken trug, und die Vielfalt seiner Frisuren fand sie erfrischend, aber sie wusste seinen Vorwürfen wenig entgegenzusetzen. Lasse warf ihr Resignation vor und den Wasserwerken Ausbeutung, und in trüben Momenten ging Frau Zilius nicht ans Telefon, wenn er anrief.
An diesem Abend teilte ihr Lasse mit, dass er Lisa kennengelernt habe, sie sei Zeugin Jehovas, und er studiere nun mit Interesse die Bibel. Er sagte Frau Zilius, dass sie dringend die Apokalypse bei Johannes nachlesen müsse, es stehe viel Wahres darin, sagte er und klang aufgeräumt.
Das nächste Ei legte Frau Zilius am Montag. Sie fand es unter dem Schuhregal, es war rotbraun und größer als das erste. An diesem Tag kam Herr Möllers in ihr Büro. Er war ein schmaler, kleiner Mann mit vorstehenden Zähnen, er erinnerte sie an ein Kaninchen, und sie hatte Angst vor dem, was er sagen würde.
»Ich fange jetzt etwas Neues an«, sagte Herr Möllers. »Ich werde Tagesvater.«
»Wie schön«, sagte Frau Zilius. »Leider ist mein Sohn zu alt, sonst würde ich ihn vorbeibringen.«
»Nichts für ungut«, sagte Herr Möllers.
Frau Zilius fragte sich, wie viele Eltern ihre Kinder Herrn Möllers anvertrauen würden. Heutige Eltern schienen ihr eher heikel, aber vielleicht profitierte Herr Möllers vom gegenwärtigen Ruf nach mehr männlichen Bezugspersonen.
In den nächsten zwei Wochen legte Frau Zilius vier Eier. Eines war tischtennisballgroß und bläulich, zwei schimmerten in dunklem Rot und hatten die Größe eines Hühnereis, das größte glich einem Tennisball und war bräunlich gesprenkelt. Frau Zilius gefiel vor allem das bläuliche, dessen Färbung ihr kühn und elegant erschien. Sie mochte auch die glatte Schale der Eier und ihre freundlichen Rundungen.
An einem Abend, an dem sie zwei Gläser Rotwein getrunken hatte, sah Frau Zilius bei Wikipedia unter »Huhn« nach und las, dass weite Teile der Eierproduktion bei den Hühnern im Restdarm stattfanden. Lichtverhältnisse und Hormonstand seien entscheidend dafür, ob ein Huhn brüte oder nicht.
Danach fand sie fünf Wochen lang keine Eier mehr in ihrer Wohnung.
Als sie das nächste Mal im Supermarkt nach den dortigen Eiern sah, bauten die Mitarbeiter gerade die Osterdekoration auf. Sie errichteten ein großes Rasenrondell, in dessen Mitte ein mannshoher grüner Strohhase stand. Er trug eine Kiepe voller Eier auf dem Rücken und hatte große Zähne, die ihm etwas Unheimliches verliehen. Frau Zilius betrachtete die Schokoladeneier, sie kamen ihr sehr klein vor.
Am Abend rief Lasse an. Er klang unfroh. Die Hausbesuche, die er mit Lisa machte, um die Menschen von der Botschaft Gottes zu überzeugen, stießen auf wenig Gegenliebe, und seine Freude an der Apokalypse hatte sich abgekühlt.
»Warum sollte im Paradies nicht Platz für alle sein?«, fragte er, und Frau Zilius sagte, das sei eine berechtigte Frage. Lasse meinte, dass er vielleicht Ostern vorbeikomme, er könne sich noch nicht festlegen, vielleicht mit Lisa, je nachdem, ob ihre Pflichten es zuließen.
Als Frau Zilius den Fernseher anstellte, lief eine Dokumentation über Königspinguine auf den Prinz-Edward-Inseln. Man sah, wie sich die Pinguine vorsichtig über einem Ei zwischen ihren Füßen niederließen, und Frau Zilius erfuhr, dass sie sich kaum je von ihrem Ei erhoben und deshalb während der Brutzeit stark abmagerten. Der Kommentator sagte, die Pinguinmütter und -väter wechselten sich beim Brüten ab und wie wichtig es sei, dass sie sich aufeinander verlassen könnten.
Das nächste Ei, das Frau Zilius fand, hatte die Form einer Zitrone. Es war ein wenig angedellt, aber wenn die Sonne darauf schien, schimmerte es nahezu golden. Frau Zilius hüllte es in eine grüne Mütze, die sie für Lasse gestrickt hatte. Er hatte sie lange getragen, bis seine Frisur zu ausladend geworden war. Frau Zilius holte ihre Wollreste aus dem Schrank und begann, eine Mütze mit Aussparungen zu stricken, doch nach dreien hörte sie wieder auf.
Gründonnerstag fuhr sie nach der Arbeit zum Supermarkt. Sie hatte eine Auswahl ihrer Eier in ein Küchenhandtuch eingewickelt und wollte sie zu Füßen des unheimlichen Hasen hinterlassen, aber ihm gegenüber hatte man einen Stand aufgebaut, an dem ein schlaksiger Junge Gemüsehacker vorführte. Frau Zilius schlenderte zweimal von den Zeitschriften zum Hasen, aber der Junge verließ seinen Stand nicht.
Sie fuhr nach Hause und schlug die Adresse von Herrn Möllers nach. Es war schon spät, als sie bei seinem Haus ankam, aber sie sah Herrn Möllers und eine Frau mit rotem Haar, die seine Ehefrau zu sein schien, vor der Tür stehen. Herr Möllers nagelte ein großes Schild an einen Holzpfosten. Tagesvater Möllers stand darauf.
Frau Zilius wartete, bis Herr und Frau Möllers im Haus verschwunden waren, dann grub sie eine kleine Erdhöhle unter dem Pfosten und legte das nahezu goldene Ei hinein.
Eine höhere Ordnung
Gunnar Peck unternahm drei Kontrollgänge, zwei in der U3 und einen in der U7, bevor er sich einen Ausweis erstellte.
Es schien ihm, als wären insbesondere das Format und die Klarsichthülle wichtig, sowie ein runder, nicht zu großer Stempel. Gunnar Peck hatte wenig Geduld und keine besondere Freude an der Fälschung, aber es erschien ihm mittelfristig zu riskant, seinen alten Studentenausweis in die Höhe zu halten. Er schrieb eine Bestätigung, dass Gunnar Peck im Auftrag der städtischen Fahrgastbetriebe kontrolliere, die er auf taubengrauem Papier ausdruckte. Dann versah er sie mit einem Stempel, den er in seiner alten Kinderpost auf dem Dachboden gefunden hatte. Es war einer für Eilbriefe, aber Gunnar Peck hatte bei seinen Probe-Kontrollen den Eindruck gewonnen, dass die Leute nur flüchtig auf den Ausweis sahen.
Ihr Blick war ähnlich flüchtig wie der, den der Prüfer auf die Liste der theologischen Examensfragen geworfen hatte, als man ihn zum Gleichnis vom Guten Samariter befragt hatte. Gunnar Peck mochte das Gleichnis, ihm gefiel die Klarheit der Unterscheidung zwischen dem hilfreichen Samariter einerseits und dem gleichgültigen Leviten und dem allzu gesetzesgläubigen Priester andererseits, vor allem gefiel ihm, dass niemand versuchte, die Schuld des Leviten und des Priesters zu bemänteln. Aber als der Prüfer Gunnar Peck nach der augustinischen Auslegung befragte, wurde sein Kopf plötzlich wolkig, so sehr, dass er schließlich nicht einmal mehr die Merkmale eines Gleichnisses erklären konnte und durch die Prüfung fiel.
Danach verbrachte er weniger Zeit an der Universität, und schließlich blieb er ihr ganz fern. Stattdessen dehnte er seine Fahrten mit der U-Bahn, dem Bus und den Straßenbahnen aus.
Er bevorzugte die Straßenbahnen und Busse, weil ihm die Stimmung darin freundlicher erschien als im Untergrund, den Kontrolleuren jedoch begegnete er in der U-Bahn.
Es waren zwei junge Männer mit kurz geschorenen Haaren und Jeansjacken, die mit einer Frau und einem Jungen, die beide keinen Fahrschein hatten, an der nächsten Station ausstiegen. Gunnar Peck folgte ihnen. Die Frau trug einen blonden Pferdeschwanz und einen blauen Mantel aus teurer Wolle, und die Kontrolleure siezten sie und sagten, dass es kein Problem sei, wenn sie statt des Personalausweises ihren Führerschein vorzeige. Der Junge war picklig und mürrisch. Dennoch schien es Gunnar Peck unangebracht, dass die Kontrolleure ihn duzten, und er fand es nicht angemessen, dass sie die Bahnpolizei riefen, als er keinen Personalausweis vorweisen konnte.
Gunnar Peck stellte sich gelegentlich die Frage »Was wäre wenn?«, aber er hatte sie nie weiter verfolgt. In der Regel waren es düstere Fragen wie die, was wäre, wenn er von der S-Bahn Brücke spränge oder plötzlich die Sprechstundenhilfe des Hals-, Nasen-, Ohrenarztes anschrie. Gunnar Peck war überrascht, als er sich fragte: »Was wäre, wenn ich sagte, ›die Fahrkarten bitte‹?«, und es dann tat. Die Fahrgäste hielten ihre Fahrausweise in die Höhe, ohne ihn dabei anzusehen.
»Herzlichen Dank«, sagte Gunnar Peck, und er war froh, dass niemand ohne Fahrschein war, weil er nicht gewusst hätte, was er dann hätte tun sollen.
Hinterher ging er zu einer Bankfiliale und bat um einhundert Überweisungsformulare, in die er zu Hause mit einer Schreibmaschine in das Empfängerfeld Städtische Verkehrsbetriebe und die passende Kontoverbindung einfügte.
Der erste Fahrgast, den er ohne Fahrschein antraf, war ein Punk.
»Hab ich nicht«, sagte der, als Gunnar Peck ihn nach seiner Fahrkarte fragte.
»Dann würde ich gerne Ihren Personalausweis sehen«, sagte Peck.
»Hab ich auch nicht«, sagte der Punk. Seine grün-roten Haare standen armlang in die Höhe, und er hatte einen räudigen Hund bei sich, der an Gunnar Peck hochsprang.
Es saßen sieben Fahrgäste im Abteil, vier von ihnen sahen interessiert zu. Doch sie waren wie eine Schar Hühner, aus der eine Bäuerin eines zum Schlachten herausgegriffen hatte, es war ihnen nicht anzumerken, ob sie Mitleid empfanden oder voller Schadenfreude waren.
»Dann müssen wir jetzt aussteigen«, sagte Peck und fürchtete, dass der Punk sich weigern würde.
Aber der Punk sagte: »Auch gut«, und folgte ihm.
Gunnar Peck dachte, dass er ihn jetzt gehen lassen könnte. »Ich mache eine Ausnahme«, könnte er sagen und: »Denken Sie künftig daran, einen Fahrschein zu kaufen.«
Aber er tat es nicht, sondern zog ein Bankformular aus seiner Tasche hervor.
»Sie müssen leider das erhöhte Beförderungsentgelt von sechzig Euro bezahlen«, sagte er.
»Auch gut«, sagte der Punk.
»Auf Wiedersehen«, sagte Gunnar Peck, und da er nicht wusste, was er tun sollte, stieg er die Treppe zum Ausgang hoch.
Auf dem ersten Absatz drehte er sich vorsichtig noch einmal um und glaubte zu sehen, wie der Punk das Überweisungsformular zu einem Ball formte und es für den räudigen Hund in die Luft warf.
Erst auf der Rückfahrt fiel Gunnar Peck auf, dass er nicht die Personalien des Punks aufgenommen hatte, und er fragte sich, ob diesem seine Unprofessionalität aufgefallen war.
Er gewöhnte sich an, an seinen Dienst-Tagen ein blaues Cordjackett zu tragen, und wenn er in den Gang der U-Bahn trat und eine Kontrolle ankündigte, fühlte er sich wie ein Dirigent, der den Taktstock hebt. Bei guten Kontrollen kam er mit den Fahrgästen ins Gespräch. Meist waren es ältere Leute, die sagten, es sei gut, dass jemand nach dem Rechten sehe, oder darüber klagten, dass die Karten immer teurer würden.
»Ich muss Ihnen da recht geben«, sagte Gunnar Peck, »aber wir unterliegen einer höheren Ordnung.«
An einem Sonntag, an dem er sich einsam fühlte, kontrollierte er in der M4. Er war sich unsicher, ob Kontrollen in Straßenbahnen üblich waren, aber er hatte Sehnsucht nach ihrem unregelmäßigen Klingeln und dem holprigen Auffalten ihrer Türen.
In der Straßenbahn saß lediglich eine hutzelige alte Frau mit Haarknoten, die einen Korb mit Äpfeln auf dem Schoß stehen hatte.
»Das ist doch kein Leben«, sagte sie zu Gunnar Peck. »Hast du nichts gelernt?« Dann sortierte sie die großen Äpfel in ihrem Korb, bis sie einen sehr kleinen fand, den sie ihm gab.
»Ich schätze meine Arbeit«, sagte Gunnar Peck und fragte sich, ob das Cordjackett schäbig aussah.
Es dauerte lange, bis die Straßenbahn wieder hielt. Er setzte sich auf den am weitesten von der Frau entfernten Sitzplatz, und als er ausstieg, warf er den Apfel in einen Mülleimer.
An einem Mittwoch fühlte er sich eigentlich nicht im Dienst, aber als er in die U-Bahn einstieg, hatte er das Bedürfnis nach einer Aufmunterung und rief: »Die Fahrkarten, bitte.«
Am Ende des Waggons stand eine junge Frau, deren fatalistischer Blick ihm sagte, dass sie keinen Fahrschein hatte. Neben ihr stand ein Mann in löchrigen Jeans, der ein Bündel Straßenzeitungen unterm Arm trug.
»Ich habe noch eine Fahrkarte übrig«, rief er freudig, während die Frau ihn unschlüssig ansah.
»Das geht so nicht«, sagte Gunnar Peck.
»Ich habe eine, ich habe eine«, rief der Straßenzeitungsverkäufer.
»Es ist wie mit den klugen und den törichten Jungfrauen«, sagte Gunnar Peck. »Irgendwann ist es zu spät.«
Aber der Straßenzeitungsverkäufer hörte nicht auf ihn, und Gunnar Peck fühlte sich in seiner Autorität als Kontrolleur missachtet.
»Das ist Strafvereitelung«, sagte er, wie er es in einem Film gesehen hatte, »hören Sie auf damit.«
Der Straßenzeitungsverkäufer schwieg, und Gunnar Peck schrieb die Personalien der Frau auf.
Als er ausstieg, sprach ihn ein Junge mit Mardergesicht an.
»Mir gefällt der Job«, sagte der Junge. »Man darf die nicht davonkommen lassen.«
Gunnar Peck sagte nichts.
»Braucht man eine Ausbildung dafür?«, fragte der Mardergesichtige.
»Ja, und sie dauert lange«, sagte Gunnar Peck und wandte sich ab.
Meine Hoffnung und meine Freude
Sabine Kleinhans erhob sich zunächst in der Osterkirche in die Luft.
Es war das erste Mal, dass es geschah, und ihr Körper schwebte höchstens einen Zentimeter oberhalb der Kirchenbank. Außer ihr war nur der Küster da, der sich an den Blumen vor dem Altar zu schaffen machte.
Sabine Kleinhans hatte die Osterkirche in Eile betreten, weil sie auf dem Weg zur Arbeit gewesen war. Es sollte gelingen, wenigstens einmal am Tag zu beten, hatte sie im Vorübergehen gedacht, war umgekehrt und hatte sich in die letzte Kirchenbank gesetzt.
Sabine Kleinhans ging in ihren Gebeten nicht ins Detail. Sie legte Gott nicht die Abgründe dar, die sie ihm hätte darlegen können, solche des Zorns, der Gleichgültigkeit und anderer Art, denn es waren so viele, dass ihre Betrachtung sie müde machte. Sie erhoffte sich keine Lösung davon, und es war ihr unangenehm, sie noch einmal auszubreiten.
Sie dankte Gott dafür, dass sie mit Ausnahme eines kurzen Geschreis im Badezimmer nicht mit den Kindern gestritten hatte, und sie betete für ihre Großtante, die gerade einundneunzig geworden war und bei ihren Anrufen nicht mehr vorgab, einen Anlass zu haben.
»Ich wollte gern mit jemandem sprechen«, sagte die Großtante mit einer Stimme, die so zitterte wie die Schrift auf ihren Postkarten, und dann bedankte sie sich für eine Spieluhr, die ihr Sabine Kleinhans vor Jahren geschenkt hatte.
Sabine Kleinhans’ Körper erhob sich, als ihr Gebet sich ihrer Großtante zuwandte. Der Aufstieg war trotz der geringen Höhe, die sie erreichte, stockend, so, als zöge man sie mit einer Seilwinde allmählich hinauf.
Sabine Kleinhans hielt kurz inne, dann bat sie Gott um mehr Besucher für ihre Großtante, und nachdem sie dies getan hatte, sank ihr Körper zurück auf die Kirchenbank. Der Küster nahm welke Sonnenblumen aus der Vase vor dem Altar und verschwand in der Sakristei.
Sie kam etwas verspätet zur Arbeit, aber niemand nahm davon Notiz.
Sabine Kleinhans arbeitete in der Anzeigenabteilung einer Monatszeitung, die sich als radikal links verstand und deren Auflage über die Jahre immer weiter geschrumpft war. Inzwischen gab es neben ihr nur noch drei Redakteure statt wie früher sieben, und es schien nur eine Frage der Zeit, bis der Verlag das Blatt einstellen würde. Sabine Kleinhans teilte nicht immer die Meinungen, die darin verbreitet wurden, aber sie hatte Achtung davor, dass die Schreiber noch immer fragten, was Gerechtigkeit bedeute, obwohl sich die Antworten schlecht verkauften. Vor einem Jahr hatte die Redaktion in ein günstigeres Büro umziehen müssen und war nun Untermieter der Kommunikationsagentur fresh friends, die die Redakteure grämlich »foul friends« nannten.
»Fair is foul, and foul is fair«, summte der Chefredakteur, wenn er in die Teeküche kam, die sich alle Mieter teilten.
»Shakespeare«, sagte er, als Sabine Kleinhans ihn fragte, was das bedeute. »Das wusste man mal.«
Der Chefredakteur war ein kleiner fülliger Mann, der enge T-Shirts mit bunten Aufdrucken trug. Eines davon war flammend rot und zeigte ein durchgestrichenes Christuskreuz in einem Kreis, als wäre es ein Verkehrszeichen. Als Sabine Kleinhans es das erste Mal an ihm sah, hatte sie sich gefragt, ob das Design ihr galt, aber es erschien ihr unwahrscheinlich, da sie mit niemandem über ihre religiösen Angelegenheiten sprach.
Sabine Kleinhans war Mitglied der Osterkirchengemeinde, und etwa alle drei, vier Wochen besuchte sie dort die Gottesdienste. In der Regel war neben ihr nur eine Handvoll Besucher dort. Die Pastorin hieß Bogenschneider, sie war klein und drahtig und hatte einen praktischen Kurzhaarschnitt. Sie trug die Bibeltexte mit einer trockenen Sachlichkeit vor, die Sabine Kleinhans angenehm fand. Die Rachsucht Gottes, der erschlagene Kinder einforderte, und die Wundertaten Jesu wirkten dann auch für Frau Bogenschneider fremd, und das machte Sabine Kleinhans die eigene Befremdung leichter.