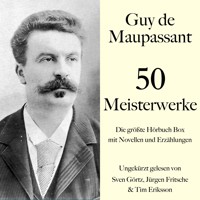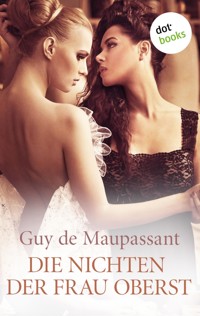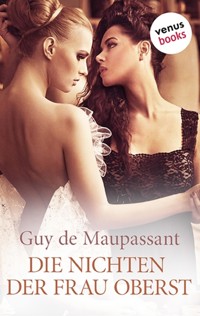Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Guy de Maupassant's 'Fräulein Fifi' ist eine Sammlung von Erzählungen, die die sozialen Probleme und Hierarchien des 19. Jahrhunderts kritisch beleuchten. Der literarische Stil des Autors zeichnet sich durch präzise und realistische Beschreibungen aus, die das Leben der französischen Gesellschaft der Zeit treffend einfangen. Maupassant nutzt subtile Ironie und scharfe Beobachtungen, um die menschliche Natur und Moral herauszufordern. In 'Fräulein Fifi' werden Themen wie Klasse, Macht und Unterdrückung meisterhaft dargestellt, was das Buch zu einem wichtigen Werk des literarischen Naturalismus macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fräulein Fifi
Books
Inhaltsverzeichnis
Pariser Abenteuer
Giebt es ein brennenderes Gefühl für eine Frau als die Neugier? Was gäbe sie darum, das, wovon sie geträumt, kennen zu lernen und zu erleben! Wenn die ungeduldige Neugierde einer Frau einmal geweckt ist, ist sie aller Dummheiten, jeder Verrücktheit fähig. Sie wird alles wagen, vor nichts mehr zurückschrecken. Ich rede von den Frauen, die wirklich Frau sind, von jenem dreifachen Geiste beseelt, der äußerlich kalt und vernünftig erscheint, in Wirklichkeit jedoch versteckt drei Eigenschaften birgt: den immer unstäten Weibessinn, List im Schäferkleide der Unschuld – jener spitzfindige gefährliche Kunstgriff der Scheinheiligen, – endlich reizende Gemeinheit, köstliche Niedertracht wundervolle Treulosigkeit, kurz alle jenen gottlosen Eigenschaften, die den einen Liebhaber, wenn er leichtgläubig und dumm ist, zum Selbstmord treiben, während sie den anderen bezaubern.
Die Frau, deren Geschichte ich erzählen will, war eine kleine, bis dahin in ihrer Naivetät anständige Provinzialin. Ihr Leben lief, äußerlich unbewegt in ihren vier Pfählen dahin, zwischen einem vielbeschäftigten Manne und zwei Kindern, die sie tadellos erzog. Aber ihr Herz bebte vor ungestillter, quälender Sehnsucht nach irgend etwas, das sie selbst nicht kannte. Immer dachte sie an Paris. Sie verschlang die Zeitungen und was darin stand von Festen, Toiletten, Vergnügungen, weckte in ihr stürmische Wünsche. Am wundersamsten erregten sie die kleinen Notizen voller Andeutungen, die geschickt halbverschleierten Sätze, die etwas ahnen ließen von sündhaft ausschweifenden Freuden.
Von weitem schien ihr Paris wie ein Traum von wunderbarer, verderbter Üppigkeit.
Und in den langen Nächten, wo ihr das regelmäßige Schnarchen ihres Gatten ein Wiegenlied sang, ihres Gatten, der mit der Schlafmütze auf dem Schädel an ihrer Seite auf dem Rücken lag, da dachte sie an jene berühmten Männer, deren Namen auf der ersten Seite der Zeitungen oft genannt wurden, gleich leuchtenden Sternen am dunklen Himmel. Sie stellte sich das geniale Leben dieser Leute vor, voller Schwelgereien, voll antiker Orgien von furchtbarer Sinnlichkeit, voll heimlicher Ausschweifungen der Sinne – nicht auszudenken.
Die Boulevards erschienen ihr wie der Abgrund menschlicher Leidenschaften, ihre Häuser bargen Rätsel seltsamer Liebe.
Sie aber fühlte, daß sie alt wurde, alt ohne anderes vom Leben gehabt zu haben als immer die langweilige gleichmäßige Tretmühle derselben häuslichen Pflichten, »Glück des Daheims« geheißen. Sie war noch hübsch – das stille Dasein hatte sie erhalten, wie eine Winterfrucht im verschlossenen Schranke – nur verzehrt war sie, zerquält, aus dem Gleichgewicht gebracht durch heimliche Wünsche. Und sie fragte sich, ob sie denn in die Grube fahren sollte, ohne diese verbotenen Früchte nur ein einziges Mal gekostet zu haben, ohne sich auch nur einmal in den Strudel der Lüste von Paris zu stürzen!
Da bereitete sie mit langer Ausdauer eine Reise nach Paris vor. Sie fand einen Vorwand, ließ sich durch Verwandte einladen und reiste, da sie ihr Mann nicht begleiten konnte, allein ab.
Als sie angekommen war, dachte sie sich einen Grund aus, gegebenen Falls zwei Tage, oder vielmehr zwei Nächte fortbleiben zu können: sie behauptete, Freunde wiedergetroffen zu haben, die draußen in einem der Vororte wohnten.
Dann ging sie auf Entdeckungen. Sie durchstreifte die Boulevards. Aber sie sah nichts als das gewerbsmäßige Laster der Straße. Sie beobachtete die großen Cafés, und studierte aufmerksam die »Kleine Korrespondenz« im Figaro, die ihr jeden Morgen wie ein lockendes Licht zur Liebe erschien.
Doch nichts brachte sie auf die Spur der wilden Feste von Künstler und Künstlerin, nichts verriet ihr den Tempel der Ausschweifungen, den sie verschlossen wähnte durch ein Zauberwort, wie in den Märchen von tausend und einer Nacht, wie die Katakomben Roms, wo der verfolgte Glaube heimlich seine Wunderfeiern hielt.
Durch ihre Verwandten – kleine Bürgersleute – konnte sie mit keiner jener Berühmtheiten bekannt werden, deren Namen in ihrem Kopfe schwirrten. Schon gab sie alle Hoffnung auf, als ihr der Zufall zu Hilfe kam.
Als sie eine Tages die rue de la Chaussée-d’Antin ging, blieb sie vor einem Laden stehen, wo jene japanischen, kleinen Sächelchen auslagen, die in ihrer Buntheit das Auge erfreuen. Während sie die spaßhaften, winzigen Elfenbeinarbeiten, die farbenleuchtend eingelegten Vasen, die seltsamen Bronzen betrachtete, hörte sie im Inneren des Ladens die Stimme des Besitzers. Er zeigte unter vielen Bücklingen einem kahlköpfigen, wohlgenährten, kleinen Herrn mit grauem Bart eine riesige, dickbäuchige Pagode. Es sei ein Unikum meinte er.
Und in jedem Satz posaunte er wie mit Trompetenstoß einmal den Namen des Kunstfreundes aus, einen berühmten Namen. Die übrigen Käufer, junge Frauen, elegante Herren, warfen verstohlen einen schnellen Blick ehrerbietiger Würdigung zu dem bekannten Schriftsteller, der seinerseits nur sehnsüchtig die Pagode beachtete. Sie gaben sich an Häßlichkeit nichts nach, wie Kinder eines Schoßes.
Der Kaufmann sagte:
– Herr Jean Varin, Ihnen würde ich das Ding für tausend Franken lassen. Das kostet es mich selbst: Von anderen verlange ich fünfzehnhundert Franken, aber mir liegt an der Kundschaft der Herren Künstler, darum mache ich ihnen Vorzugspreise. Sie beehren mich alle, Herr Jean Varin. Gestern noch kaufte Herr Busnach eine große, antike Schale. Neulich erst habe ich an Herrn Alexandre Dumas zwei solche Leuchter verkauft. Sie sind schön, was? Sehen Sie mal, wenn Herr Zola das Ding da sähe, das Sie in der Hand haben – wär’s schon weg, Herr Varin!
Der Schriftsteller schwankte unschlüssig. Der Gegenstand reizte ihn, doch er dachte an den Preis. Dabei kümmerte er sich so wenig um die neugierigen Blicke, als ob er in der Wüste allein gewesen wäre.
Sie war zitternd eingetreten, beinahe frech, das Auge auf ihn gerichtet. Nichts fragte sie darnach, ob er schön sei, elegant, jung. Es war ja Jean Varin in eigner Person! Jean Varin!
Nach langem Kampf und schmerzlichem Zögern stellte er die Figur auf den Tisch mit den Worten:
– Nein, das ist zu teuer!
Der Kaufmann verdoppelte seine Beredsamkeit:
– Aber Herr Jean Varin, zu teuer? Das ist seine zweitausend Franken unter Brüdern wert!
Der Schriftsteller gab traurig zurück, indem er die Pagode mit den Emailaugen betrachtete:
– Das glaube ich schon! Aber es ist mir zu teuer.
Da packte sie närrische Keckheit. Sie trat vor und sagte:
– Für wieviel geben Sie mir das Ding da?
Der Kaufmann entgegnete erstaunt.
– Fünfzehnhundert Franken, meine Dame.
– Ich nehme es.
Bis dahin hatte sie der Schriftsteller nicht einmal bemerkt. Nun drehte er sich hastig um und musterte sie beobachtend, blinzelnd von Kopf zu Fuß. Dann blickte er sie schärfer an mit Kenneraugen.
Sie sah reizend aus. Das Feuer, das bis dahin in ihr geschlummert, hatte sie heute belebt und lieh ihr seinen Glanz. Und dann konnte eine Frau, die für fünfzehnhundert Franken eine Nippessache kauft, nicht gerade die erste beste sein.
Da wandte Sie sich zu ihm in einer Regung reizenden Zartgefühles und sagte mit bebender Stimme:
– Entschuldigen Sie, ich bin wohl voreilig gewesen, vielleicht waren Sie noch nicht schlüssig?
Er verbeugte sich:
– Ich war schlüssig, gnädige Frau.
Ganz bewegt antwortete sie:
– Jedenfalls, wenn Sie Ihre Ansicht ändern … sollten, so werde ich Ihnen das Stück jederzeit überlassen. Ich habe es nur gekauft, weil es Ihnen gefiel.
Er lächelte, sichtlich geschmeichelt:
– Woher wissen Sie denn wer ich bin?
Da erzählte sie ihm von ihrer Bewunderung, sprach von seinen Werken und redete wie ein Wasserfall.
Bei der Unterhaltung hatte er sich auf ein Möbel gestützt und richtete auf sie seine durchdringenden Augen, im Bemühen sie zu erraten.
Ab und zu, wenn neue Käufer eingetreten waren, rief der Kaufmann, der glücklich war diese lebendige Reklame zu haben, vom anderen Ende des Ladens herüber:
– Bitte schön, Herr Jean Varin, sehen Sie mal das an; gefällt es Ihnen?
Dann wandten sich alle Köpfe herum, und es überlief sie kalt vor Wonne so im intimen Gespräch mit einem berühmten Manne gesehen zu werden.
Das machte sie förmlich trunken und sie wagte ein Äußerstes, wie ein Feldherr der den Sturm befiehlt:
– Herr Varin wollen Sie mir eine Freude machen, eine sehr große Freude. Erlauben Sie mir Ihnen diese Pagode als Andenken anzubieten an eine Frau die Sie leidenschaftlich bewundert, und die Sie nach diesen zehn Minuten nicht wiedersehen!
Er lehnte ab. Sie bestand darauf. Er widerstrebte höchlichst belustigt unter herzlichem Lachen.
Da sagte sie eigensinnig:
– Gut, dann bringe ich sie Ihnen sofort selbst! Wo wohnen Sie?
Er wollte seine Adresse nicht angeben, aber sie fragte den Händler darum, erfuhr sie, bezahlte ihren Kauf und lief zu einem Wagen. Der Schriftsteller hinterdrein, sie einzuholen, denn er wollte sich dem nicht aussetzen, ein Geschenk von jemandem zu erhalten, den er nicht kannte. Er erreichte sie, als sie gerade in den Wagen sprang, stürzte nach und fiel beim plötzlichen Anziehen des Pferdes beinahe auf sie drauf. Dann setzte er sich verdrießlich an ihre Seite.
Er hatte schön bitten, in sie dringen, sie blieb unbeugsam. Als sie an seine Thür kamen, stelle sie folgende Bedingungen:
– Ich erlasse es Ihnen, das da anzunehmen, wenn Sie versprechen, heute alles zu thun, was ich will.
Das schien ihm so komisch, daß er sich einverstanden erklärte. Nun fragte sie:
– Was machen Sie gewöhnlich um diese Zeit?
Er zögerte ein wenig, ehe er antwortete:
– Ich gehe spazieren!
Da befahl sie mit fester Stimme:
– Also in’s Bois de Boulogne!
Sie gingen.
Er mußte ihr alle bekannten Damen zeigen, vor allem die der Halbwelt, mit allen Einzelheiten über ihr Leben, ihre Gewohnheiten, ihr Haus, ihre Laster.
Es begann Abend zu werden.
– Was machen Sie sonst um diese Zeit? fragte sie. Er antwortete lachend:
– Ich trinke meinen Absinth.
Da entgegnete sie ernsthaft:
– Herr Varin, so trinken wir unseren Absinth.
Sie traten in ein großes Boulevardcafé, wo er Kollegen zu treffen pflegte. Er stellte ihr alle vor. Sie war verrückt vor Freude und immerfort summte ihr das Wort im Hirn: Endlich! Endlich!
Die Zeit verstrich. Sie fragte:
– Ist’s jetzt etwa Ihre gewohnte Essenszeit?
– Jawohl, gnädige Frau.
– Schön Herr Varin; dann wollen wir zu Tisch gehen!
Als sie das Café Bignon verließen meinte sie:
– Was machen Sie abends?
Er blickte sie starr an:
– Das kommt darauf an. Manchmal gehe ich ins Theater.
– Gut, Herr Varin, so gehen wir ins Theater.
Sie besuchten das Vaudeville, durch seine Vermittlung umsonst, und zu ihrem höchsten Stolze ward sie auf dem Balkonfauteuil vom ganzen Hause an seiner Seite gesehen.
Nach der Vorstellung küßte er ihr galant die Hand.
– Gnädige Frau, ich muß mich noch für diesen reizenden Tag bedanken ….
Sie unterbrach ihn:
– Was pflegen Sie sonst nachts um diese Zeit zu thun?
– Nun … nun … ich gehe nach Haus ….
Sie fing an zu lachen mit einem Zittern im Ton:
– Schön, Herr Varin … wir wollen also zu Ihnen gehen.
Sie redete nicht mehr. Ab und zu schauerte sie zusammen von Kopf zu Fuß, indem sie abwechselnd der Wunsch überkam zu fliehen oder zu bleiben. Im Grunde ihres Herzens war sie aber doch entschlossen, alles auszukosten.
Auf der Treppe klammerte sie sich ans Geländer vor innerer Erregung. Er stieg atemlos voran einen Fünfminutenbrenner in der Hand.
Sobald sie im Zimmer war, zog sie sich schnell aus und schlüpfte ins Bett, ohne ein Wort zu sprechen. Dort wartete sie an die Wand gedrückt.
Aber sie war unerfahren, eben wie die Ehefrau eines Provinznotares. Er aber anspruchsvoller denn ein Pascha. Sie verstanden sich nicht. Nicht im Geringsten.
Da schlief er ein. Die Nacht strich hin nur vom Tik-Tak der Wanduhr unterbrochen. Sie lag unbeweglich und dachte an die Nächte daheim, und beim gelben Licht einer chinesischen Laterne betrachtete sie, unsägliche Traurigkeit im Herzen, neben sich diesen kleinen rundlichen Mann, der auf dem Rücken lag und dessen kugelförmiger Leib die Bettdecke hob gleich einem gefüllten Luftballon. Er schnarchte, daß es klang wie Orgelgebraus, wie langdauerndes Schnauben, wie die komischsten Erstickungsanfälle. Seine paar Haare machten sich die Ruhe zu nutze und sträubten sich auf die abenteuerlichste Art, als hätten sie die ewig gleiche Lage auf diesem nackten Schädel satt bekommen, dessen Verheerungen im Haarwuchs sie verstecken sollten. Und aus dem Winkel seines halboffenen Mundes zogen Speichelfäden.
Da sich endlich das Frührot ins Zimmer stahl, stand sie auf, kleidete sich lautlos an, und hatte schon halb die Thür geöffnet als das Schloß kreischte und er erwachte.
Er rieb sich die Augen. Als er seine Schlaftrunkenheit überwunden und ihm die Erinnerung des ganzen Erlebnisses wiedergekommen, fragte er:
– Nun? Sie gehen?
Sie blieb stehen und stotterte verlegen:
– Es ist ja Morgen!
Er richtete sich auf:
– Hören Sie mal, nun muß ich Sie aber etwas fragen.
Sie antwortete nicht und er fuhr fort:
– Sie haben mich höllisch in Erstaunen gesetzt seit gestern. Seien Sie mal aufrichtig und gestehen Sie mir, wozu Sie das alles gemacht haben! Denn ich kapiere die ganze Geschichte nicht.
Sie trat leise näher und jungfräuliches Rot stieg ihr in die Wangen:
– Ich wollte das … das Laster … kennen lernen … nun … nun … schön ist es nicht.
Und sie entfloh, eilte die Treppe hinab und stürzte auf die Straße.
Ganze Reihen von Straßenkehrern kehrten. Sie kehrten die Bürgersteige und den Fahrdamm indem sie den Kehricht in die Gosse fegten. Immer mit dem gleichen regelmäßigen Schwung, wie Schnitter auf der Wiese, trieben sie den Schmutz im Halbkreis vor sich her. Von Straße zu Straße fand sie sie wieder, gleich ausgezogenen Hampelmännern automatisch schreitend.
Und ihr schien, als wäre auch aus ihr etwas hinausgekehrt worden, als wären ihre überhitzten Träume in den Rinnstein, in die Gosse gefegt.
Atemlos, erstarrt kam sie zu Hause an, nur die Erinnerung im Hirne jenes Besenschwunges, der Paris reinfegte am Morgen.
Und als sie in ihrem Zimmer war, weinte sie bitterlich.
Fräulein Fifi
Der preußische Befehlshaber Major Graf von Farlsberg durchflog die eingelaufenen Postsachen. Er war in einem großen gestickten Fauteuil versunken und hatte die Stiefel auf den eleganten Marmor des Kamins gelegt, in den seine Sporen seit den drei Monaten, die er nun im Schloß von Uville lag, zwei tiefe Löcher gebohrt. Von Tag zu Tag wurden sie tiefer.
Eine Tasse Kaffee dampfte auf einem kleinen eingelegten Tischchen, das durch Likör beschmutzt, von Cigarren verbrannt und mit dem Federmesser des als Sieger hausenden Offiziers zerschnitten war. Wenn er seinen Bleistift spitzte, hielt er oft in Gedanken inne und kritzelte Buchstaben oder Figuren auf dem zierlichen Möbel.
Als er seine Briefe zu Ende gelesen und die deutschen Zeitungen durchflogen, die ihm der Wachtmeister gebracht, stand er auf. Er warf drei oder vier mächtige Kloben frischen Holzes ins Feuer – denn die Herren fällten allmählich, um sich zu wärmen, den ganzen Park – und trat ans Fenster.
In Strömen ging der Regen nieder, ein echter Regen der Normandie, als ob er im Zorn heruntergeschüttet worden, schief, wie ein dichter Vorhang, eine schräge gestreifte Mauer. Ein Regen, der das Gesicht peitschte, mit Kot bespritzte, alles ersäufte, ein Regen, wie er nur um Rouen fallen kann, dem Nachtgeschirr Frankreichs.
Der Offizier sah lange auf die überschwemmten Rasenflächen hinaus und weiterhin auf die angeschwollene Andelle, die über die Ufer getreten. Er trommelte einen rheinischen Walzer an den Scheiben, als er Lärm hörte. Er drehte sich um: der zweitälteste Offizier war gekommen: Rittmeister Freiherr von Kelweingstein.
Der Major war ein breitschultriger Riese mit langem Vollbart, der sich fächerartig auf der Brust ausbreitete. Seine mächtige gravitätische Erscheinung machte den Eindruck eines militärischen Pfaues, aber eines Pfaues, dessen Schweif unter dem Kinn wuchs und dort ein Rad schlug. Er hatte kühle, mildblickende blaue Augen, eine Backe war ihm im österreichischen Feldzuge durch einen Säbelhieb gespalten. Er galt für einen braven Mann und guten Soldaten.
Der Rittmeister dagegen war klein, rotwangig mit dickem Bauch und gebremster Taille. Kurz geschoren trug er sein feuerrotes Haar, dessen Stoppeln ihm bei gewisser Beleuchtung einige Ähnlichkeit mit einer Streichholzkuppe gaben. In einer Bummelnacht hatte er einmal, weiß Gott wie, zwei Zähne eingebüßt, sodaß man ihn nun bei seiner Sprechweise schlecht verstand. Dazu trug er eine Glatze, gleich einer Mönchstonsur, um deren nackten Kreis ein Fell goldglänzender kleiner Härchen stand.
Der Befehlshaber gab ihm die Hand und schüttete auf einen Zug seinen Kaffee hinab (die sechste Tasse seit heute früh), indem er die Meldung seines Untergebenen über die Vorkommnisse im Dienst anhörte. Dann traten beide ans Fenster und meinten, es sei hier nicht gerade zum Totlachen. Der Major, eine ruhige Natur, der eine Frau daheim besaß, fügte sich in alles, aber der freiherrliche Rittmeister, ein großer Bummler und Mädchenjäger, war wütend, nun seit drei Monaten auf diesem verlorenen Posten zur Enthaltsamkeit gezwungen zu sein.
Da sie an der Thür Lärm vernahmen, rief der Major »herein« und ein Mensch – einer ihrer steifen Soldaten – erschien in der Öffnung, durch seine stumme Gegenwart das Frühstück meldend.
Im Eßsaal fanden sie drei andere Offiziere vor: Premierleutnant Otto von Großling, die Leutnants Fritz Schönauburg und Wilhelm Reichsgraf von Eyrik, ein winziges, blondes Kerlchen, das stolz und roh gegen seine Leute war, schroff gegen die Besiegten, und heftig wie ein Gewehr, das immerfort losgeht.
Seitdem sie sich in Frankreich befanden, nannten ihn seine Kameraden nur noch »Fräulein Fifi«. Ein Spitzname, den er seinem gezierten Wesen verdankte, seiner engen Taille, die den Eindruck machte, als trüge er ein Korsett und seinem bleichen Gesicht, auf dem man kaum den ersten Bartflaum sah. Vor allem aber, weil er es sich angewöhnt hatte, um seine allerhöchste Verachtung von Menschen und Dingen auszudrücken, fortwährend die französische Redensart zu gebrauchen » fi donc«, deren » fi« er leise pfeifend aussprach.
Der Eßsaal des Schlosses Uville war ein großer, fürstlich ausgestatteter Raum. Seine mit Kugellöchern besäten, alten Kristallspiegel, seine hohen, flandrischen Gobelins, die von Säbelhieben zerfetzt hier und da herunterhingen, zeugten von Fräulein Fifis Beschäftigung in seinen Mußestunden.
An der Wand hingen drei Familienbilder, ein gepanzerter Krieger, ein Kardinal und ein Staatsmann. Sie rauchten lange Porzellanpfeifen, während eine Edelfrau in enganschließendem Gewand aus ihrem durch die Jahre etwas goldverblichenen Rahmen anmaßend mit einem mächtigen Kohleschnurrbart herausschaute.
Die Offiziere nahmen beinahe schweigend das Frühstück ein in diesem verwüsteten, bei dem Regenwetter düsteren Gemach, das traurig dreinschaute angesichts der Sieger und dessen altes Eichengetäfel abgetreten war wie die Diele einer Kneipe.
Nach Tisch rauchten sie, tranken und sprachen wie alltäglich von ihrer Langeweile. Cognac und Schnaps ging reihum, sie lehnten sich in den Stühlen zurück, und bliesen in kleinen Wölkchen den Dampf aus ihren im Mundwinkel baumelnden, langen Pfeifen mit den Porzellanköpfen, auf denen Bilder geklext waren, um Hottentotten zu berücken.
Sobald die Gläser leer wurden, füllten sie sie müde von neuem. Aber Fräulein Fifi zerbrach alle Augenblicke das seine, und sofort reichte ihm ein Soldat ein anderes.
Schwarzer Tabakrauch hüllte sie ein wie in eine Wolke, und sie brüteten hier in trauriger, schläfriger Trunkenheit, jener stumpfsinnigen Sauferei von Leuten, die nichts zu thun haben.
Aber der Freiherr raffte sich plötzlich auf. Er ärgerte sich und fluchte:
– Gott verdamm’ mich, das kann nicht so weiter gehen! Wir müssen irgend was aushecken!
Premierleutnant von Großling und Leutnant Schönauburg, zwei echt deutsche, schwerfällige, ernste Menschen, antworteten zugleich:
– Was denn Herr Rittmeister?
Er sann einen Augenblick nach, bis er zurückgab:
– Was? Nun, wenn der Herr Major nichts dagegen hat müßten wir irgend ein Fest veranstalten.
Der Major nahm seine Pfeife aus dem Mund:
– Was für’n Fest meinen Sie, Kelweingstein?
Der Freiherr erklärte sich näher:
– Herr Major ich übernehme alles. Ich schicke den » Befehl« nach Rouen. Der wird uns Weiber holen. Ich weiß schon woher. Wir veranstalten ein kleines Souper. Wir haben alles dazu hier. Jedenfalls giebt’s einen ganz netten Abend!
Graf Farlsberg zuckte lächelnd die Achseln.
– Sie sind verdreht, lieber Freund!
Aber die Offiziere waren alle aufgesprungen, umringten den Major und baten:
– Herr Major müssen’s dem Herrn Rittmeister erlauben! Es ist zu ledern hier!
Endlich willigte der Major ein:
– Meinetwegen.
Da ließ der Freiherr den »Befehl« kommen, einen alten Unteroffizier, der nie eine Miene verzog, und für jeden Auftrag seiner Vorgesetzten nur ein »Befehl« hatte.
Unbeweglich nahm er des Rittmeisters Auseinandersetzung entgegen, ging, und fünf Minuten später jagte im strömenden Regen ein mit vier Pferden bespannter Trainwagen, über den man die Plane eines Müllerwagens gespannt, im Galopp davon.
Da schienen sie sofort aufzuwachen, sie richteten sich aus ihren müden Stellungen auf, ihre Mienen wurden lebhaft und man begann zu schwatzen.
Der Major behauptete, obgleich es noch immer weiter goß, es sei schon heller geworden. Premierleutnant von Großling kündigte mit Bestimmtheit an, der Himmel würde sich aufklären. Selbst Fräulein Fifi schien erregt, stand auf, setzte sich. Sein hartes, klares Auge suchte nach einem Zerstörungsobjekt. Der junge Blondkopf sah plötzlich die Dame mit dem Schnurrbart scharf an, zog seinen Revolver und sagte:
– Du sollst das nicht mit ansehen!
Ohne aufzustehen zielte er, und schoß mit zwei Kugeln scharf hintereinander dem Bilde die Augen aus. Dann rief er: