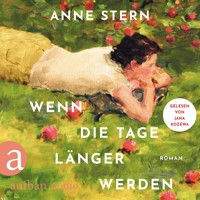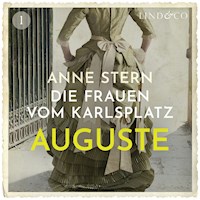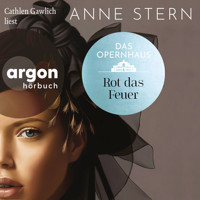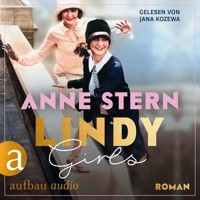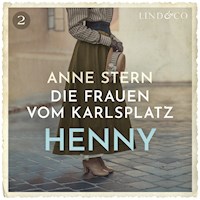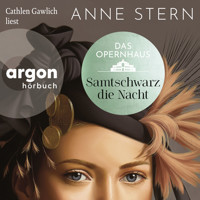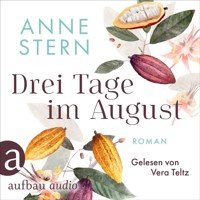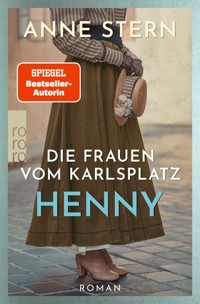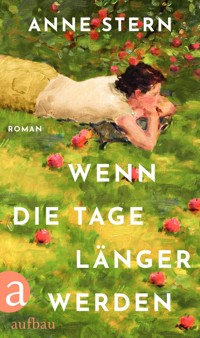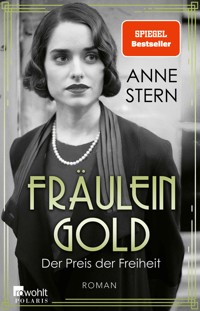
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Hebamme von Berlin
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1932: Hulda Gold hat eine neue Wirkungsstätte als Hebamme gefunden. Im berüchtigten Frauengefängnis Barnimstraße versorgt sie inhaftierte Schwangere und entwickelt einen guten Draht zu den oftmals verzweifelten Frauen. Als innerhalb der Gefängnismauern eine junge Insassin völlig unerwartet stirbt, kann Hulda nicht untätig bleiben. Bald kommen Zweifel wegen der Todesursache auf, und der Verdacht fällt auf Anna Marwitz, die bereits wegen Mordes verurteilt ist. Doch Hulda kann nicht glauben, dass diese verschüchterte Frau, die kurz vor der Entbindung ihres ersten Kindes steht, wirklich eine mehrfache Mörderin sein soll. Mit der Aufklärung des Falls wird ausgerechnet Irma Siegel betraut. Hulda und die Kriminalkommissarin kennen sich von früher, und sie gingen nicht als Freundinnen auseinander. Aber während sich die politischen Kräfte in Deutschland immer mehr radikalisieren, müssen sie nun gemeinsam gegen das Unrecht kämpfen – für die Zukunft aller Frauen und auch die ihrer eigenen Familien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anne Stern
Fräulein Gold: Der Preis der Freiheit
Roman
Über dieses Buch
Die Stärke der Frauen
Berlin, 1932: Hulda Gold hat eine neue Wirkungsstätte als Hebamme gefunden. Im berüchtigten Frauengefängnis Barnimstraße versorgt sie inhaftierte Schwangere und entwickelt einen guten Draht zu den oftmals verzweifelten Frauen. Als innerhalb der Gefängnismauern eine junge Insassin völlig unerwartet stirbt, kann Hulda nicht untätig bleiben. Bald kommen Zweifel wegen der Todesursache auf, und der Verdacht fällt auf Anna Marwitz, die bereits wegen Mordes verurteilt ist. Doch Hulda kann nicht glauben, dass diese verschüchterte Frau, die kurz vor der Entbindung ihres ersten Kindes steht, wirklich eine mehrfache Mörderin sein soll. Mit der Aufklärung des Falls wird ausgerechnet Irma Siegel betraut. Hulda und die Kriminalkommissarin kennen sich von früher, und sie gingen nicht als Freundinnen auseinander. Aber während sich die politischen Kräfte in Deutschland immer mehr radikalisieren, müssen sie nun gemeinsam gegen das Unrecht kämpfen – für die Zukunft aller Frauen und auch die ihrer eigenen Familien.
Vita
Anne Stern ist promovierte Germanistin und Historikerin und lebt in Berlin. Ihre Reihe um die Berliner Hebamme Fräulein Gold ist ein großer Erfolg, jeder Band ein Spiegel-Bestseller. Weitere Romane sind in Planung.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Karte © Peter Palm, Berlin
Covergestaltung bürosüd, München
Coverabbildung Richard Jenkins
ISBN 978-3-644-01839-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Glückseligkeiten und Katastrophen wohnen Wand an Wand.»
Vicki Baum: Menschen im Hotel, 1929
Prolog
Montag, 7. März 1932
Endlich hielt der Wagen mit einem Ruck an. Die vier Frauen, die mit Handschellen gefesselt darin saßen, wurden durcheinandergerüttelt und sahen stumm hoch. Anna versuchte, etwas durch die vergitterten Scheiben der Grünen Minna zu erkennen, doch sie erblickte nur ein Stück blassblauen Berliner Himmel und kahle Zweige eines Ahorns, der noch auf seine ersten zarten Blüten wartete.
«Raus!», befahl eine männliche Stimme von draußen. «Marsch!»
Schon wurden die Türen des Wagens aufgerissen, und eine Frau nach der anderen kletterte unbeholfen hinaus.
Anna schob sich mühsam als Letzte aus dem Auto und stand einen Moment benommen auf der Straße. Aus den Fenstern ringsum reckten sich die Köpfe neugieriger Hausfrauen, die die Neuankömmlinge unverhohlen musterten. Gegenüber, hinter einem hohen Zaun, erhob sich ein riesiger Backsteinbau. Er ragte in den Himmel, und Anna schloss schnell die Augen und sog die frische Frühlingsluft ein, die sie so vermisst hatte. So roch die Welt, so roch Berlin im März. Vor lauter Glück, diesen Duft endlich einmal wieder in der Nase zu haben, kamen ihr die Tränen. Sie zwinkerte ein paarmal energisch. Geweint hatte sie in den letzten Wochen genug.
Es blieb keine Zeit, den kleinen Moment der Freiheit zu genießen. Einer der Polizisten griff sie bereits hart am Ellenbogen und zerrte sie auf die andere Straßenseite. Das Tor öffnete sich, Anna lief neben ihrem Bewacher hindurch und kam zur Pforte. Man erwartete sie. Ein Pförtner ließ die vier Frauen ein. Vor ihnen erstreckte sich jetzt ein langer, schwach beleuchteter Gang mit vielen Türen. Im Schlepptau des Polizisten ging Anna bis ganz ans Ende. Hier drinnen roch es nicht mehr nach Frühling und zaghaftem Blütenduft, sondern beißend nach menschlichen Ausdünstungen, Exkrementen und dem scharfen Lysolgeruch, der den Gestank jedoch niemals vertreiben konnte. Anna kannte diesen Geruch. Er hatte sie schon die vergangenen Wochen im Untersuchungsgefängnis in Moabit umhüllt. Daher war es eine Wohltat gewesen, ihm für die kurze Zeit der Verlegung in der Grünen Minna entkommen zu dürfen. Doch schon bestimmte er wieder Annas Welt.
Sie und die anderen Frauen wurden in einen Warteraum geführt, wo sie auf einer Holzbank Platz nehmen mussten. Der Raum war fensterlos und bis auf die harten Bänke und einen Abort in der Ecke unmöbliert. Doch die Wände wirkten frisch gestrichen – überhaupt machte das ganze Gefängnis auf Anna bisher eher den Eindruck einer Klinik als den einer Haftanstalt. Einer Klinik jedoch, aus der kaum eine Frau gesünder herauskommen würde, als sie hineingegangen war.
In dem Raum warteten schon mehrere Frauen, und Anna betrachtete sie aus den Augenwinkeln. Einige der Gesichter kannte sie bereits aus Moabit, zum Beispiel die kleine verhutzelte Frau ganz in der Ecke, die ihr schüchtern zunickte. Und die große Blonde auf der zweiten Bank, neben der Anna in einer der Massenzellen in der Untersuchungshaft ein paar Nächte verbracht hatte. Diese Frau, die vor niemandem Angst zu haben schien, hatte ihr gezeigt, wie man nachts dafür sorgte, dass einen die anderen Insassinnen nicht bestahlen. Anna fing ihren Blick auf und lächelte der Bekannten jetzt dankbar quer durch den Raum zu. Es war nur ein winziges Zeichen, doch es tat gut.
Nach und nach wurden sie aufgefordert mitzukommen. Irgendwann war auch Anna an der Reihe. Eine Aufseherin zeigte mit dem Finger auf sie, nannte aber nicht ihren Namen. Man war an Orten wie diesem namenlos, man war kein Mensch mehr, sondern nur noch eine Nummer.
«Folgen!», befahl die Wächterin im schwarzen Kleid.
Anna stand gehorsam auf und trabte hinter ihr her durch einen weiteren Gang. Hier reihten sich kleine Fenster aneinander, und Anna blieb kurz stehen und spähte hinaus, während die Aufseherin weiter vorauslief und es nicht bemerkte. Auch hier hing der blassblaue Himmel über ihnen, und draußen sah Anna einen düsteren Hof, der von hohen Gittern und Mauern umschlossen war. Der Wind wehte eine vergessene Zeitung quer über das Pflaster, es sah trostlos aus.
«Weiter!», murrte die Aufseherin, die sich jetzt nach ihr umblickte und mit einem Schlüsselbund rasselte.
Anna gehorchte. Sie kamen zu einem Tisch im Gang, hinter dem eine hagere Frau mit Brille saß. Die Aufseherin schloss Annas Handschellen auf und nahm sie ihr ab. Dann musste Anna etwas unterschreiben und das bisschen Geld, das sich noch in ihren Kleidertaschen befand, aushändigen. Die Frau hinter dem Tisch notierte gewissenhaft, wie viel es war, und steckte Annas Habseligkeiten in einen Briefumschlag. In Moabit hatte man sich bei den kargen Mahlzeiten ein Stück Brot, etwas Fett oder einen Apfel dazukaufen können, wenn man Bares besaß. In der Barnimstraße wurde das aber nicht geduldet, wie Anna schon gehört hatte.
Sie gingen weiter und betraten schließlich eine Kleiderkammer. Hier saß eine grauhaarige Frau in der schwarzen Uniform der Aufseherinnen hinter einem großen Holztisch, auf dem sich Kleiderstapel türmten. Daneben warteten zwei dürre junge Helferinnen, Kalfaktorinnen genannt, in der Kleidung der Gefangenen – dunkelblauer Kittel, weiße Schürze, kariertes Schultertuch.
«Ausziehen», befahl die Grauhaarige.
Anna knöpfte ihre Bluse auf, stieg aus dem Rock und stand einen Moment unschlüssig im Hemd da.
«Weitermachen», sagte die Aufseherin ungeduldig.
Unsicher zog Anna sich auch das Hemd über den Kopf – und zeigte sich nun vollkommen nackt vor den vier fremden Frauen.
Die Aufseherin starrte sie einen Moment an und ließ ihren Blick unverhohlen über Annas vorgewölbten Bauch wandern. Eine der Kalfaktorinnen kicherte unterdrückt.
«Auch das noch», war der einzige Kommentar der Grauhaarigen, ehe sie sich kopfschüttelnd abwandte.
Nun bekam Anna von einem der beiden jungen Mädchen ihr Wäschepaket ausgehändigt und wurde in die Badestube der Aufnahme geschickt. In mehreren eisernen Wannen wuschen sich hier Frauen, hastig, mit abgewandten Blicken, und stiegen dann schnell in ihre Gefängniskleidung.
Das Wasser war kalt, Anna fröstelte und beeilte sich wie die anderen auch. Das grobe Leinen des blauen Gefängniskittels kratzte auf der Haut, doch immerhin war er weit genug und passte ihr einigermaßen. Sie bekam aber das Schultertuch nicht umgebunden, weil ihre Hände auf einmal zitterten.
«Ich helfe dir», sagte eine Stimme hinter ihr.
Anna drehte sich um. Eine unbekannte Frau stand da, die bereits angekleidet war. Ihr hellbraunes Haar war kurz geschoren, doch ihr Lächeln leuchtete warm. Wortlos nahm sie Anna das Tuch aus der Hand, legte es ihr geschickt um die Schultern und knotete es vorn zusammen.
«Danke», sagte Anna.
Sie wurden von der ersten Aufseherin abgeholt. Seite an Seite gingen sie hinter der Frau her, immer tiefer in das Gebäude hinein. Am Ende dieses letzten Weges, so viel war Anna bereits klar, wartete eine Welt aus Eisen auf sie.
Sie kamen in das Hauptgebäude. In der Mitte erhob sich eine Treppe aus Stahl, auf beiden Seiten umgittert. Dahinter, darüber, daneben – noch mehr stählerne Treppen, noch mehr Eisengitter, die sich immer höher hinaufschraubten. Links und rechts auf den Stockwerken befanden sich lange Reihen von Zellen mit Nummern an den Türen. Auf jedem Absatz saß eine Aufseherin an einem kleinen Tisch, auf dem ein Lampenschirm glomm. Von ihren Positionen aus hatten sie die ganzen Trakte des Gefängnisses im Blick wie in einem stählernen Panoptikum.
«Sie gehen da lang», befahl die Aufseherin der Frau mit den kurzen Haaren und deutete auf eine offen stehende Zellentür. «Und Sie kommen mit mir weiter, in die Mütterzelle», sagte sie zu Anna und wedelte mit ihrem Schlüsselbund.
«Ich heiße Ruth», sagte die Kurzhaarige noch über die Schulter zu Anna, ehe sie in ihre Zelle trat.
«Und ich bin Anna!»
Eben doch nicht nur eine Nummer, dachte Anna. Sie waren trotz allem noch Menschen in der Barnimstraße 10.
Aber wenn die anderen Frauen erfuhren, warum man sie eingesperrt hatte, wäre es wohl ganz schnell wieder vorbei mit der Freundschaft. Denn einer Mörderin traute niemand über den Weg.
1.
Karsamstag, 26. März 1932
«Gleich kommt das Vögelchen», säuselte der Fotograf, dessen Kopf unter dem schwarzen Tuch seiner Kamera verborgen war.
Hulda sah Meta zu, wie diese bemerkenswert brav still hielt und tapfer in die Linse lächelte. Ihre Tochter trug ein neues kariertes Kleid mit weißem Kragen und frisch gewichste Schnürstiefel. Das dunkle Haar mit den lustigen Ponyfransen glänzte in der Frühlingssonne, und Meta umklammerte mit beiden Händen ihre riesige Schultüte. Diese war hellgrün, hatte oben einen Spitzenbesatz und war über und über mit glänzenden Oblaten beklebt, die spielende Kinder, Kätzchen und Engel zeigten. Zu ihren Füßen lehnte eine Schiefertafel neben dem Schulzaun, auf der in Schönschrift geschrieben stand: Mein erster Schulgang 1932.
«Du hättest ihr doch die neuen Lackschuhe anziehen sollen», murrte Viktoria, Metas Großmutter. «Sie würden auf den Bildern so viel mehr hermachen als die alten Stiefel.»
Hulda zuckte zusammen.
«Es ist heute viel zu kühl», gab sie zurück. «Außerdem wollte ich nicht, dass Meta sie sich gleich in der nächsten Pfütze verdirbt.»
Sie standen alle zusammen auf dem Bürgersteig vor der 14. Gemeindeschule in der Berchtesgadener Straße, direkt um die Ecke von der großen Wohnung im Bayerischen Viertel, in der Hulda seit über einem Jahr mit Max und Meta lebte. Über ihnen zogen die Wolken am kühlen Märzhimmel vorüber, ein frischer Wind fuhr durch das erste zaghafte Grün an den Zweigen. Und wie immer galt, dass man an Ostern in Berlin gut beraten war, die Wintergarderobe noch nicht auf dem Dachboden einzumotten – man würde sie noch ein paar Wochen brauchen, denn der Frühling ließ sich gern Zeit.
Hulda betrachtete Viktoria Wenckow unauffällig. Die Mutter von Metas verstorbenem Vater Johann trug ein geschmackvolles Kostüm aus rosafarbenem Samt und darüber einen Wollmantel in Pfeffer-Salz-Optik. Ihr Gatte Friedemann, der sie am Arm hielt, war wie immer im eleganten Gehrock und mit Zylinder erschienen. Ein Stück weiter lehnte Benjamin Gold, Huldas Vater, an einer Laterne und rauchte. In offener Jacke, eine Hand lässig in der Tasche seiner gestreiften Stresemann-Hose und mit einem schief sitzenden Bowler Hat auf der weißen Löwenmähne hätte er nicht deutlicher machen können, dass er keinen Wert auf steife Kleidung und Umgangsformen legte. Und frieren war für Benjamin Gold ohnehin seit jeher ein Fremdwort.
Hulda dagegen zog sich fröstelnd ihren etwas schäbigen braunen Mantel am Kragen enger zusammen und trat von einem Bein aufs andere. Immerhin trug sie ihren neuen Glockenhut aus cremefarbenem Filz, doch für ein neues Kleid hatte ihre Barschaft nicht auch noch gereicht. Sie hatte heute Morgen also wider besseres Wissen das weiße Sommerkleid mit den kurzen Ärmeln angezogen, weil es das einzige in ihrem Kleiderschrank war, das Viktorias Vorstellung von Festtagsgarderobe zumindest nahekam. Ihre Gänsehaut war jetzt der Preis.
«So», sagte der Fotograf endlich und kam mit rotem Gesicht wieder unter dem Tuch hervor. Er rieb sich die Hände und wandte sich an Hulda. «Das hätten wir im Kasten. Sie können die Bilder nächste Woche in meinem Atelier abholen, meine Dame.» Er zog ein Kärtchen mit der Adresse seines Fotostudios aus der Tasche und reichte es Hulda, die es dankend einsteckte.
«Die Nächsten, bitte», rief der Fotograf, und aus der kurzen Schlange, die sich hinter Metas Familie auf dem Trottoir gebildet hatte, löste sich schüchtern ein kleiner Junge mit Pausbacken und einer Schultüte in den Armen, die so groß war, dass sie ihn unter sich zu begraben drohte. Er trug einen Matrosenanzug nebst Mütze und, wie Hulda zufrieden bemerkte, ähnlich abgetretene Schnürstiefel wie Meta. Ehe er sich neben der Schiefertafel positionieren konnte, stürzte eine Frau mit einem bunten Schultertuch zu ihm und begann, mit einem losen Zipfel über seinen Mund zu fahren, an dem noch Spuren des Frühstücks klebten.
«Hugo», jammerte sie, «du bist und bleibst ein Dreckspatz. Aber heute beginnt für dich der Ernst des Lebens, hörst du?»
Meta lief zu Hulda und reichte ihr die Schultüte.
«Endlich fertig», sagte sie, «mir tut schon das Gesicht vom Lächeln weh.» Sie sah zu dem Jungen hinüber, der sich treuherzig abmühte, den Anweisungen des Fotografen Folge zu leisten und dabei seine Schultüte nicht fallen zu lassen. Metas Stirn zog sich kraus – wie immer, wenn sie über etwas nachdachte. «Der Ernst des Lebens?», fragte sie. «Was bedeutet das?»
«Die Frau meint, dass es für Kinder in der Schule mehr Regeln gibt als zuvor», gab Hulda zurück. «Doch ich denke, es wird euch vor allem Freude machen, zusammen zu sein und viele neue, interessante Dinge zu lernen.»
«Das denke ich auch», sagte Meta unbekümmert und drängte sich zwischen ihre Großeltern. «Kommt», sagte sie, «gleich fängt es an.» Sie nahm Friedemann und Viktoria bei der Hand und zog beide in Richtung Eingang.
Hulda sah, dass Viktorias säuerliches Lächeln in echten Stolz umschlug, bevor sie den dreien mit Benjamin folgte.
«Wo ist denn eigentlich dein Mann?», fragte Viktoria über die Schulter und blieb stehen, weil sich vor ihnen ein Knäuel aus Menschen gebildet hatte, die ebenfalls in die Schule eintreten wollten.
Hulda entging nicht die kleine Pause vor dem Wort Mann, mit der Viktoria zu verstehen gab, dass sie den Umstand dieser Ehe noch immer mit Skepsis beäugte.
«Max ist über Ostern mit seinen beiden Söhnen verreist», sagte Hulda. «Sie verbringen ein paar Tage zu dritt an der Ostsee.»
«Er verpasst die Einschulung von Meta?», fragte Friedemann ungläubig. Man konnte ihm ansehen, dass er diese Tatsache für unverzeihlich hielt. Und das wiederum rechnete Hulda ihm hoch an.
Nun mischte sich Meta ein. «Er hat mich ja um Erlaubnis gebeten», rief sie fröhlich. Sie ließ die Hände ihrer Großeltern los. «Und er hat mir die hier in einem Brief aus Warnemünde geschickt.» Sie deutete strahlend auf die Abziehbildchen, mit denen Hulda ihre Schultüte verziert hatte, und nahm das Ungetüm wieder liebevoll an sich. «Und nächste Woche, wenn er zurück ist, bringt er mich jeden Morgen zur Schule, hat er gesagt.»
«Jeden Morgen?», fragte Viktoria erstaunt. «Und was ist mit dir, Hulda?»
«Ich arbeite nach Ostern tageweise in Mitte, im Königsviertel», sagte Hulda, «da muss ich schon frühmorgens anfangen.»
«In einer Klinik?», fragte Viktoria stirnrunzelnd.
«Nein!», rief Meta dazwischen. «Im Gefängnis! Ist das nicht aufregend?»
«Im … Gefängnis?», wiederholte Viktoria schaudernd. «Du lieber Himmel! Warum brauchen sie dich denn ausgerechnet dort?»
«Auch im Frauengefängnis werden Kinder geboren», sagte Hulda, «es gibt dort eine richtige Geburtenstation. Aber die Hebamme, die sie sonst hinzuziehen, hat sich zur Ruhe gesetzt, und jetzt bin ich erst einmal eingesprungen.»
«Ich fasse es nicht», sagte Viktoria und legte sich eine Hand auf die Brust. «Du hilfst Kriminellen bei der Geburt? Mörderinnen womöglich?»
«Irgendjemand muss es tun», sagte Hulda ruhig.
Viktoria presste die Lippen aufeinander. Wie immer konnte man in ihrem Gesicht deutlich ablesen, was sie davon hielt.
«Ich verstehe euer Leben einfach nicht», sagte sie. «Die Eheleute andauernd getrennt und eine Hausfrau, die völlig unpassenderweise arbeiten geht. Und dann noch an einem solchen Ort.» Sie schloss leidend die Augen. «Und Max verpasst Metas Einschulung. Das übersteigt meinen Verstand.»
«Es kann eben nicht immer alles gleichzeitig gehen», sagte Hulda, «vor allem nicht bei uns – in unserer Situation.»
«Wir kennen die Situation, Liebes», sagte Viktoria, und Friedemann nickte düster. «Und wir bewundern dich, wie tadellos du das alles erträgst», fuhr sie fort. «Nun, wie man sich bettet, so liegt man, nicht wahr?»
Hulda öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch Viktoria hatte sich bereits abgewandt.
Ohne ein weiteres Wort gingen die Wenckows mit Meta in ihrer Mitte weiter auf das Schulhaus zu und verschwanden im Inneren.
Von überallher strömten Familien mit frischgebackenen Abc-Schützen herbei, die ihre leuchtenden Schultüten umklammerten. In zehn Minuten würde die Einschulungsfeier auf dem Schulhof hinter dem großen Gebäude beginnen.
Benjamin fasste Hulda am Arm. «Mach dir nichts draus», murmelte er, «die Giftspritze da vorne hat eben ihre eigenen Ansichten.»
«Ich weiß», sagte Hulda und atmete tief durch. Sie wollte sich auf keinen Fall Metas großen Tag verderben lassen. Aber es war eben auch ihr großer Tag, schließlich hatte vor allem sie Meta bis hierher begleitet. Sie hatte sie geboren, hatte die Nächte durchwacht, hatte ihr Kind genährt, gekleidet, umsorgt und geliebt. Und nun würde ihre Tochter in diesem Juni schon sechs Jahre alt werden. Eingeschult wurden in diesem Zyklus die Jahrgänge 1925 und 1926. Manchmal konnte Hulda es nicht glauben, wie schnell die Zeit vorüberflog und dass aus ihrem kleinen Kind ein Schulkind geworden war. Dann wieder dachte sie an die hoffnungslos überfüllten letzten Jahre, an ihre dauernde Müdigkeit, die aufgeschlagenen Knie, die Sorge, als Meta Scharlach bekam und direkt danach die Windpocken. Die Tage, an denen Hulda schon morgens nicht wusste, wie sie es bis zum Abend durchhalten sollte, ohne umzufallen – und dass sie es dann doch immer irgendwie geschafft hatte. Sie dachte an unzählige geschmierte Brotschnitten, an das angstvolle Zählen des Geldes am Ende des Monats, an Wutanfälle und Gebrüll, aber auch an das Lachen, an Metas Klugheit und Witz, ihre weiche kleine Hand in ihrer, an das pure Glück. Und da kamen Hulda sechs Jahre auf einmal gar nicht kurz vor, sondern wie ein ganzes zweites Leben, das sie gelebt hatte und das doch gerade erst begann.
Als Benjamin ihr unaufgefordert ein etwas schmuddeliges Taschentuch reichte, merkte Hulda, dass sie Tränen in den Augen hatte. Sie wischte sie mit dem Tuch fort, schnäuzte sich vernehmlich hinein und stopfte es in ihre Manteltasche, wobei sie den Blick ihres Vaters mied. Doch der lachte leise und legte ihr ganz kurz seinen Arm um die Schultern.
«Wein ruhig, Huldakind», sagte er unbekümmert. «Ich habe bei deiner Einschulung auch ein paar Tränen vergossen.»
«Du veralberst mich», sagte sie mit noch immer kratziger Stimme und schnaubte. «Ich erinnere mich noch nicht einmal, dass du überhaupt da gewesen bist.»
«Tatsächlich kam ich an dem Tag ein wenig zu spät», gab er zu. «Ich hatte die ganze Nacht wie ein Wahnsinniger an einem neuen Bild gearbeitet und darüber alles vergessen.»
«Wie überraschend», gab Hulda spitz zurück.
«Aber dann fiel es mir rechtzeitig wieder ein», sagte er. «Ich stand in der Morgensonne und war so glücklich, weil ich wusste, dass das, was ich da gerade geschaffen hatte, gut war. Richtig gut! Und ich dachte, dass ich es dir gern zeigen wollte, wenn du etwas größer wärst. Und da erst wurde mir bewusst, welcher Tag es war. Sofort rannte ich los zur Schule, so, wie ich war – in meinem beklecksten Malerkittel, übernächtigt und taumelnd vor Glück. Ich stürmte in die Aula, stellte mich in die letzte Reihe und hörte gerade noch, wie du gemeinsam mit den anderen Kindern auf der Bühne ein Lied sangst.» Er räusperte sich und schob sich die Melone zurecht. «Du sahst so groß aus, du warst schon immer ein großes Mädchen – und bildhübsch. Dein Gesicht war ganz ernst und feierlich, so wie heute auch.» Er warf Hulda einen raschen Blick zu, und sie verschränkte verlegen die Hände ineinander und sah zu Boden. «Und da wurde mir klar, wie viel ich bereits verpasst hatte.»
Hulda wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Denn auch in den Jahren nach ihrer Einschulung hatte Benjamin vor allem durch Abwesenheit geglänzt. Doch es rührte sie zu wissen, dass er bei ihrer Einschulungsfeier gewesen war. Es war immerhin ein kleiner Trost. Und ein viel größerer Trost war, dass er heute, bei Meta, keinen Anlass ausließ, für seine Enkelin da zu sein. Der Rest, fand Hulda, konnte eigentlich als verjährt angesehen werden.
«Komm», sagte sie und hakte ihren Vater entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit unter, «wir wollen uns einen guten Platz suchen.»
Sie traten ins Schulgebäude, durchquerten das Foyer und kamen zur Hintertür, die auf den Schulhof hinausführte.
«Wieso findet das Ganze überhaupt draußen statt, bei dieser Kälte?», fragte Benjamin kopfschüttelnd, als sie auf den Hof traten, der schon gut gefüllt war. «Mir macht es ja nichts aus, aber diese ganzen Damen hier in ihren hübschen Kleidchen frieren sicher fürchterlich.»
Hulda hob die Schultern. «Die Aula ist noch geschlossen», sagte sie. «Die Polizei hat sie vor ein paar Jahren dichtgemacht, wegen Baufälligkeit.»
Benjamin verdrehte die Augen. «Vor ein paar Jahren …», sagte er. «Und seitdem ist natürlich nichts weiter passiert. So ist es ja überall in den öffentlichen Gebäuden der Stadt», fuhr er fort. «Nichts geht voran, es gibt kein Geld, keine Handwerker, nichts. Und unsere armen Kinder haben keine Aula.»
Ehe Hulda etwas erwidern konnte, entdeckte sie hinter sich Familie Winter, die gerade aus dem Schulgebäude nach draußen trat. Felix trug eine braune Parteiuniform, seine Frau Helene wie immer einen teuren Nerz, und sie hatte die Haare in ihre ewig blonde Wasserwelle gelegt. Die Zwillinge Emil und Eduard waren in Matrosenanzüge gesteckt worden, man hatte ihnen die hellblonden Haare mit Pomade zur Seite gekämmt, sodass sie aussahen wie kleine Herren.
Normalerweise gingen Felix und Hulda sich aus dem Weg. Die Zeiten ihrer Jugendliebe und langjährigen Freundschaft waren längst vorbei, und ihre Leben drifteten immer weiter auseinander. Doch hier, auf dem engen Schulhof, gab es kein Entkommen. Das Ehepaar Winter blieb vor Hulda stehen.
Helene beugte sich zu ihren Söhnen.
«Geht rasch vor und sucht Fräulein Kranz», sagte sie streng, «sie wird den Schulchor schon aufstellen wollen.»
Die Kinder verschwanden, und Helene richtete sich auf. Sie musterte Hulda unverhohlen von oben herab, bequemte sich dann aber zu einem Nicken. Auch Felix begrüßte Hulda und ihren Vater knapp.
«Die zukünftigen Zweitklässler singen heute für die neuen Kinder zur Begrüßung», erklärte er. «Unsere beiden Lausejungen waren schon den ganzen Morgen sehr aufgeregt.»
«Wie nett», brachte Hulda heraus.
Helene sah sich um, und der unzufriedene Zug um ihren hübschen, grellrot bemalten Mund vertiefte sich. «Ich wollte Emil und Eduard eigentlich auf eine gute katholische Schule schicken», sagte sie, «aber Felix meinte, es sei wichtig, dass sie auch mit Arbeiterkindern zusammenkämen.»
«Wir waren früher doch auch alle zusammen auf der Volksschule», sagte Felix und warf Hulda einen schnellen Blick zu. «Und es hat uns nicht geschadet.»
«Aber dieses Viertel hier hat sich seitdem sehr verändert», sagte Helene, «und nicht zum Guten.» Sie schaute zu einer Familie hinüber, deren Vater eine Kippa auf dem Kopf trug, und schnalzte geringschätzig. «Du weißt, was ich meine, Felix.»
«Wir wissen alle, was Sie meinen, gnädige Frau», mischte sich Benjamin Gold ein, der bis jetzt stumm geblieben war. «Und genau das wollen Sie ja auch erreichen, oder?»
Helene starrte ihn entrüstet an.
Schon richtete Felix seine massige Gestalt auf. «Was fällt Ihnen ein …», begann er, doch Helene zog ihn schnell fort.
«Komm, mein Liebling», säuselte sie, «ich möchte keine Sekunde länger mit diesen Leuten zusammenstehen. Ach, sieh mal, da sind ja die Gehrkes!»
Sie winkte einer Frau mit altmodischer Zopffrisur, die mit einem kleinen blonden Mädchen und einem Mann in brauner Uniform im Schlepptau über den Schulhof auf sie zueilte. Helene ging ihnen mit falschem Lächeln und ausgebreiteten Armen entgegen. Felix folgte ihr, jedoch nicht, ohne Hulda noch einen letzten Blick zuzuwerfen.
Sie wusste nicht, was sie darin las. Wut? Ablehnung? Oder nicht doch eine Spur Bedauern?
«Wenn du Meta bei der jüdischen Schule angemeldet hättest, wäre dir so etwas wie gerade erspart geblieben», sagte Benjamin.
«Das stimmt», sagte Hulda, während sie in der bunten Menschenmenge nach dem Rest der Familie Ausschau hielten. «Aber ich habe mit der jüdischen Gemeinde ebenso wenig am Hut wie du. Und ich möchte, dass Meta auf die Gemeindeschule geht wie alle anderen Kinder aus der Nachbarschaft auch.» Sie presste kurz die Lippen aufeinander. «Überhaupt ist ein Viertel der Kinder hier jüdisch, so sagte es mir die Sekretärin bei der Anmeldung, und niemand hat etwas dagegen.» Sie warf einen Blick zu den Winters, die weitergegangen waren. «Oder jedenfalls niemand, der etwas zu sagen hat.»
«Ich gebe dir vollkommen recht», sagte Benjamin. «Allerdings muss sich noch herausstellen, wer hier etwas zu sagen hat.»
Ihr Gespräch wurde von Viktoria unterbrochen, die ihnen wild zuwinkte. Sie und Friedemann standen ganz vorn und hielten ihnen Plätze frei. Eine kleine behelfsmäßige Bühne war aufgebaut worden, ein paar bunte Wimpel flatterten im Wind. Auf der Bühne selbst versuchte eine junge Lehrerin gerade, etwa zwanzig durcheinanderpurzelnde Kinder zu einer Chorformation aufzustellen, auch Emil und Eduard waren darunter. Meta und die anderen neuen Schüler standen vor der Bühne in einem Grüppchen zusammen und wurden von zwei weiteren Lehrerinnen in Schach gehalten.
Als sie Hulda entdeckte, warf sie ihr eine Kusshand zu, und Hulda warf eine zurück, ehe sie sich mit Benjamin zu den Wenckows stellte.
«Besonders viel Stil hat das Ganze hier ja nicht», bemerkte Viktoria und streifte einen etwas welken Blumenkranz mit den Augen, der die Treppe zur Holzbühne zierte. «Hör mal, Hulda, Friedemann und ich laden euch alle nachher zum Imbiss in ein feines Gasthaus ein. Dieser Freudentag heute braucht doch den richtigen Anstrich!»
«Ich dachte eigentlich, dass wir einfach bei uns zu Hause Kaffee trinken könnten», sagte Hulda, doch der Blick von Benjamin brachte sie zum Verstummen. «Also gut, warum nicht», murmelte sie. «Danke schön.»
Die Gespräche ringsum erstarben, als die Lehrerin auf der Bühne, die wie durch ein Wunder Ordnung in ihren kleinen Haufen gebracht hatte, die Arme hob. Die Kinder, die dort oben jetzt in zwei Reihen standen, begannen zu singen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Es klang fröhlich, wenn auch ein wenig schief. Doch der Anblick der kleinen Gesichter, die allesamt vertrauensvoll zur Musiklehrerin erhoben waren, und die Kinderstimmen, die aus voller Kehle sangen, ließen auch Huldas Herz schneller klopfen. Ihr machte es nichts aus, dass das Gebäude der Gemeindeschule teilweise baufällig war und die Dekorationen windschief, die Schülerschaft bunt. Alles, was sie spürte, war die Freude, dass Meta nun an diesem Ort lernen durfte und Freundschaften schließen würde – und der Stolz darüber, es bis hierher geschafft zu haben.
Ihre Gedanken flogen zu Max, der jetzt gerade vielleicht seine Zehen in den noch kalten Ostseesand grub und sicher auch an sie dachte, an ihr gemeinsames Zuhause in der Rosenheimer Straße und an die neue, aufregende Arbeit, die nächste Woche in der Barnimstraße auf Hulda wartete.
All das war ein gutes Leben, dachte sie, auch wenn Viktoria Wenckow es nicht verstand. In ihren Augen mochte es das Leben einer Außenseiterin sein, einer, die nie den geraden Weg gegangen war. Doch niemand konnte sich darin mehr zu Hause fühlen als die frischgebackene Frau von Max Dessauer.
2.
Karsamstag, 26. März 1932
Die drei Männer standen im Halbkreis an der Straßenecke des Winterfeldtplatzes und steckten die Köpfe zusammen. Alle trugen dunkle Anzüge, korrekt gebundene Krawatten und schwarz schimmernde Melonen auf dem Kopf. Es waren Geschäftsmänner, wie man sie überall in Berlin antraf. Sie wirkten jedoch so konspirativ wie eine etwas zu sehr herausgeputzte Gangsterbande, die gerade einen Coup plante.
Die Frühlingssonne des frühen Nachmittags warf ihre Strahlen noch etwas zaghaft auf das Straßenpflaster und setzte die Männer in ihrem seltsamen Tun in Szene.
Was heckten die drei dort nur aus?
Bert, der sich nach einem langen Vormittag im Kiosk ein wenig die Beine vertreten wollte, blieb auf seinem Schlendergang quer über den belebten Platz stehen und warf erneut einen Blick hinüber. Er stemmte die Hände in die Hüften und konnte ein amüsiertes Kopfschütteln nicht ganz unterdrücken. Erwachsene Männer, offenbar in Lohn und Brot in einem respektablen Beruf, und dann so etwas!
Auf und ab gingen die Jo-Jos, die mit dünnen Fäden an den Fingern der Spieler festgemacht waren. Auf und ab, hoch und runter, fast lautlos und mit einem so leisen Surren, dass Bert es auf seinem Beobachterposten nicht hören konnte. Und doch meinte er, ein feines Singen zu vernehmen, während die Schnüre flink über die glatten Holzspulen der Spielzeuge glitten.
Keiner der Männer sprach, sie schienen völlig versunken in ihre rhythmischen, fast hypnotischen Bewegungen.
Natürlich hatte Bert dieses Schauspiel schon öfter beobachtet. Überall in Berlin waren diese kleinen runden Dinger jetzt zu sehen. Manch einer sprach sogar schon von einer Epidemie. Man spielte Jo-Jo in den Büros, auf den Schulhöfen, in den Betrieben, auf den Straßen, in den Obdachlosenunterkünften, im Park, in den Kneipen, ja sogar in der Kirche. Und die Zeitungen waren voller Bilder von Jo-Jo-Meisterschaften in der ganzen Welt, in Shanghai, in Tokio, in New York. Es war, als sei ein weltweites Fieber ausgebrochen, und die Sucht nach dem monotonen, aber schnellen Auf und Ab der Holzspielzeuge ließ das Interesse an allem anderen erlahmen.
Unwillkürlich schlich sich eine Melodie in Berts Gedanken. Jo-Jo ist die neueste Verirrung,Jo-Jo bringt die Welt in Verwirrung. Er ertappte sich dabei, wie er den Schlager von Paul O’Montis vor sich hinsummte. Ich sag nicht ja, ja, ich sage Jo-Jo …
Kürzlich hatte ein kluger Kopf in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben, das Jo-Jo sei eine Art Kaugummi für die Hand. Und wenn Bert diese drei dort drüben betrachtete, musste er dem Feuilletonisten Siegfried Kracauer recht geben. Es hatte etwas Unreifes, ja Unwürdiges für erwachsene Herren, dieses Spiel ohne Sinn und Ziel derart ernsthaft zu verfolgen. Und doch – Bert riss sich los und ging nachdenklich weiter über den belebten Marktplatz – war es vielleicht heutzutage beinahe vernünftig, nur im Moment zu leben und nicht über die Zukunft zu grübeln. Denn jene schien in diesem Frühling düster und verhangen.
Davon wussten allerdings die Blumen nichts, die in leuchtenden Farben am Stand von Frau Grünmeier prunkten. Das Sonnengelb der Narzissen, das helle Rot der Tulpen und die weißen Schneeglöckchen mischten sich mit dem frischen Grün der geschnittenen Weidenzweige im Kübel und mit den fliederfarbenen Tupfern der Hyazinthen, die in kleinen Töpfchen auf Käufer warteten.
Bert schlenderte kurz entschlossen hinüber, angezogen von der Farbenpracht. Lange hatte er keine Blumen bei der Marktfrau gekauft, die mehrmals in der Woche ihre Ware hier feilbot. In seiner Junggesellenbude in der Nollendorfstraße schien es ihm Verschwendung, Schnittblumen in einer Vase zu haben, da er oft nur zum Schlafen nach Hause kam, denn der Zeitungsstand war täglich lange geöffnet. Ab und zu, an einem besonderen Datum, kaufte er eine weiße Rose oder eine Sonnenblume für seinen Geliebten Arnold. Doch der letzte Geburtstag lag schon ein paar Monate zurück.
Die Stoßzeit des Marktsamstags war vorbei, einige Budenbesitzer und Marktleute räumten bereits ihre Waren ein und verstauten die Eimer und Körbe, die Schüsseln und Säcke auf ihren Fuhrwerken. Eine bimmelnde Straßenbahn der Linie neunzehn kam vorbei und hielt an der Ecke des Platzes vor der gestreiften Markise des Café Winter.
Bert erreichte den Blumenstand und ließ den Blick über die bunte Pracht gleiten. Frau Grünmeiers Mops beäugte den Neuankömmling misstrauisch, ehe er sich wieder dem Knochen zuwandte, an dem er offenbar seit geraumer Zeit nagte.
Bert entschied sich für eine rote Nelke, die er sich ins Knopfloch stecken wollte. Zwar waren das keine Frühlingsblumen, aber sie wurden in Gewächshäusern gezüchtet und waren das ganze Jahr über zu bekommen. Eine rote Nelke wäre außerdem das richtige Signal. Denn heutzutage war es wichtiger als je zuvor, offen seine politische Gesinnung zu zeigen. Und Bert, dem die Ästhetik sehr am Herzen lag, sagte die elegante, unaufdringliche Sprache der Blumen mehr zu als das Herausposaunen politischer Slogans.
«Guten Tag, liebe Frau Grünmeier», sagte er herzlich. «Wie geht’s denn so?»
Die Marktfrau, die gerade dabei war, überschüssige Blumenerde aus dem Eimer zurück in einen Sack zu füllen, richtete sich auf. Sie ließ den Eimer sinken und klopfte sich die schmutzigen Hände an ihrem Kittel ab. Ihr ohnehin schon von Natur aus mürrisches Gesicht, das immer ein wenig dem einer Bulldogge ähnelte, verzog sich zu einer Grimasse.
«Ich schließe gerade», sagte sie anstelle eines Grußes.
Bert sah sie verblüfft an. Frau Grünmeier war nie ein Ausbund an Diplomatie gewesen, doch so unwirsch war er selten von ihr abgekanzelt worden.
«Ich brauche nur eine einzige Blume», sagte er schnell und setzte sein gewinnendstes Lächeln auf. «Eine rote Nelke, wenn es geht, liebe Frau Grünmeier?»
Ein seltsamer Ausdruck huschte über ihr Gesicht.
«Ham’wa nich», war die Antwort.
Sie bückte sich und nahm den Eimer wieder hoch, als sei das Gespräch für sie damit beendet.
Bert betrachtete den großen Kübel hinter ihr am Stand, der über und über mit Nelken gefüllt war. Etwas Schadenfrohes ging von den leuchtenden Blüten in Rot, Rosa und Weiß aus. Auch Frau Grünmeier schien die Sprache der Blumen zu beherrschen – wenn auch auf andere Art, als Bert sich das gedacht hatte.
«Schade», sagte er und tippte sich höflich an den Hut. «Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend, Gnädigste. Bis zum Markt am Mittwoch!»
Frau Grünmeier brummte etwas Undeutliches, das in Berts Ohren klang wie Kann’s kaum erwarten, doch sicher war er nicht.
Irritiert machte er kehrt und ging langsam über den Marktplatz zurück. Was war denn in die Blumenverkäuferin gefahren? Zugegeben, sie waren nie die besten Freunde gewesen, doch man hatte sich als Verkäufer gegenseitig geachtet und das ein oder andere Mal aus der Klemme geholfen in den vielen Jahren, in denen sie Teil der Gemeinschaft am Winterfeldtplatz waren. Was hatte diese plötzliche Feindseligkeit zu bedeuten?
Berts Blick fiel wieder auf die flatternden Markisen des Cafés an der Ecke. Noch etwas wehte dort im Frühlingswind – viele kleine rote Wimpel mit Hakenkreuzen darauf. Sie tanzten in der Brise und sahen dabei fast harmlos aus.
Vor dem Eingang des Café Winter stand ein Lieferwagen, und eifrige Helfer trugen Lebensmittelpakete hinein und wuchteten eine Sackkarre mit einem großen Bierfass über die Schwelle. Felix Winter, der Inhaber, hatte ein ausladendes Plakat malen und auf der Terrasse aufhängen lassen. Großes Osterfest, stand darauf, Spiele, Ostereier und Gaumenfreuden für Groß und Klein. Parteimitglieder erhalten Rabatt. Auch dieses Plakat war nicht nur mit Osterhasen und bunten Tortenstücken verziert, sondern zusätzlich mit einer feinen Borte aus Hakenkreuzen gesäumt.
Ein Frösteln überrieselte Bert. Er wandte sich ab und ging rasch zurück zu seinem Kiosk. Dort warteten bereits zwei Kunden auf seine Rückkehr, und er sperrte schnell den Eingang des kleinen Pavillons auf, trat ein und fragte die Leute nach ihren Wünschen. Dem Herrn im Stresemann händigte er eine Mottenpost aus, die junge Dame im seidenen Bolero und mit französischer Baskenmütze verlangte die Frauen- und Modezeitschrift.
«Und einmal Der Weg der Frau», fügte sie selbstbewusst hinzu.
Bert zog überrascht die Augenbrauen hoch, denn dies war eine kommunistische Drucksache, die sein ursprüngliches Bild von der adretten Frau sofort geraderückte. Er gab ihr auch diese Zeitschrift, kassierte und sah ihr nach, wie sie auf seiden bestrumpften Beinen fortstöckelte. Hoffentlich würde sie nicht am Blumenstand vorbeigehen und Frau Grünmeier das provokante Titelblatt allzu dicht unter die Nase halten.
«Bert!», rief da ein helles Stimmchen.
Er beugte sich aus seinem Fenster und sah Meta, die mit einer riesigen Schultüte bewaffnet auf seinen Kiosk zulief. Nein, sie lief nicht, sie rannte, was ihre kurzen Beine hergaben. Sie war immer auf Draht, ging es ihm durch den Kopf, genau wie ihre Mutter.
Hulda kam ein paar Meter hinter ihrer Tochter über den Platz, auch ihr Gang war wie üblich nicht damenhaft gemessen, sondern federnd und flink – und mit einer stets darin liegenden Eile, die nicht immer einen Grund hatte. Hulda war ganz anders gestrickt als die Jo-Jo-Spieler, dachte Bert, die weiter in ihr Spiel vertieft an der Straßenecke standen. Nein, Hulda lebte nicht für den Moment, sondern hatte die Nasenspitze stets ein paar Zentimeter in der Zukunft.
Er verließ seinen Kiosk, ging etwas mühsam in die Knie und fing die atemlose Meta in seinen Armen auf. Die Schultüte bohrte sich schmerzhaft in seinen Oberschenkel.
«Langsam, Meta», rief er und drückte sie kurz an sich, «lass dich erst mal ansehen.» Er hielt das Mädchen ein Stück von sich weg und pfiff leise durch die Zähne. «Was sagt man dazu?»
Bewundernd musterte er das neue Kleid, die feine kleine Ledertasche, die sie an einem Gurt über der Brust trug, den Ranzen und die Tüte.
«Heißt das etwa, dass du jetzt ein richtiges Schulkind bist?»
«Ja!», jubelte Meta und begann eifrig, die Schleife oben an ihrer Schultüte aufzubinden. «Mama hat gesagt, ich soll mir die Tüte noch aufheben, damit ich sie dir zeigen kann.» Sie sah Bert bittend an. «Jetzt hast du sie ja gesehen, nicht?» Sie warf einen raschen Blick zu ihrer Mutter, die nun auch beim Zeitungskiosk angekommen war. «Darf ich sie endlich öffnen, Mama?»
«Natürlich», sagte Hulda, und Bert sah, wie sie sich ein Lachen verbiss. «Du hast wirklich lange ausgehalten, meine Große.»
Meta fuhr mit beiden Händen in die Papiertüte und zog eine Leckerei nach der anderen heraus: gestreifte Bonbons in einem Säckchen, einen noch eingeschlagenen kandierten Apfel, Nüsse, ein Lakritztütchen, aber auch ein paar nützliche Dinge wie eine kleine Schiefertafel und einen gestrickten roten Schal. Bei jedem Fund quietschte sie vor Freude, und Bert musste alles eingehend bewundern. Sie bot ihm und Hulda großzügig von ihren Süßigkeiten an, doch Bert behauptete, er habe zu viel zu Mittag gegessen und sei satt. Hulda dagegen schob sich genüsslich einen salzigen Lakritztaler in den Mund und lächelte zufrieden.
Irgendwann wurde es Meta jedoch zu langweilig mit den Erwachsenen, und sie drückte Hulda die geplünderte Schultüte in die Hände und trollte sich über den Marktplatz, um ihre Freunde zu suchen.
«Alles gut überstanden?», fragte Bert und musterte Huldas Gesicht. «Die werte Verwandtschaft ist wieder abgezogen?»
«Ja, zum Glück ist es vorbei», sagte Hulda.
Sie sah ein wenig erschöpft aus, fand er. «Die Wenckows haben sich wahrscheinlich nicht lumpen lassen?»
Hulda schüttelte den Kopf. «Wir waren nach der Schulfeier noch piekfein essen», sagte sie, «aber die Leberknödelsuppe liegt mir schwer im Magen.»
«Die Suppe oder die Konversation mit deiner verflossenen Fast-Schwiegermutter, Hulda?»
Sie kannten einander seit Ewigkeiten. Doch nach vielen Jahren hatten sie erst kürzlich beschlossen, sich endlich zu duzen. Das Du ging Bert noch immer nicht ganz leicht von den Lippen, aber er mochte die neue Vertrautheit. Hulda war wie eine Tochter für ihn, und eine Tochter sollte man dicht bei sich behalten, fand er. Besonders in diesen Zeiten.
Sie sah ihn schuldbewusst an. Doch als er lächelte, brach sie in erleichtertes Lachen aus.
«Du kennst mich zu gut, Bert», gluckste sie. «Tatsächlich ist beides schwer verdaulich. Aber ich will nicht undankbar sein. Meta hatte einen wirklich schönen Tag mit all ihren Großeltern.» Jetzt stand auch in ihrem Gesicht ein Lächeln. «Und du bist der krönende Abschluss.»
Bert spürte, wie sich seine Wangen vor Freude rot färbten. Hulda übersah es gnädig, vielmehr blickte sie sich jetzt nach dem dunklen Haarschopf ihrer Tochter um. Meta hüpfte drüben beim Gemüsefritzen auf und ab, sie spielte mit zwei Kameradinnen Himmel und Hölle auf dem Marktpflaster.
«Und ich bin stolz wie eine echte Glucke!», fuhr Hulda fort. «So glücklich ich mich auch schätze, dass ich all die Jahre einen guten Platz für sie im Kindergarten hatte … Es ist auch schön, dass sie nun langsam größer wird und zur Schule gehen darf.» Ihr Blick fiel auf das Café Winter mit den flatternden Wimpeln, und auf ihrer Stirn erschien eine feine Zornesfalte. «Obwohl ich Angst habe, dass nicht alle Kinder nett zu ihr sein werden, weil sie den Unsinn ihrer Eltern nachplappern.»
Auch Bert sah nachdenklich zur Caféterrasse hinüber, vorbei an dem Blumenstand, an dem Frau Grünmeier gerade Kübel um Kübel auf ihr Fuhrwerk lud. Das kurze, unerfreuliche Gespräch mit ihr lag ihm so schwer im Magen wie Hulda die Leberknödel, und er ahnte, was die resolute Verkäuferin neuerdings so besonders gegen ihn aufbrachte. Doch er wollte Hulda nicht unnötig Sorgen bereiten.
«Ja, die Gemüter sind zurzeit sehr erhitzt», sagte er und zwirbelte gedankenverloren seinen Schnauzbart. Dann fügte er begütigend hinzu: «Aber wenn erst diese unselige Reichspräsidentenwahl und die Landtagswahlen vorüber sind, werden hoffentlich wieder alle ein wenig aufatmen.»
Er war sich da keineswegs sicher, doch er wollte Hulda beruhigen – und vielleicht auch sich selbst. Denn vor knapp zwei Wochen war die Wahl des Reichspräsidenten zu einem Debakel geworden, als Hindenburg keine Mehrheit erreichen konnte. Bis zur Stichwahl zwischen dem Vierundachtzigjährigen und den anderen beiden Kandidaten – Thälmann für die KPD und Hitler für die NSDAP – hing das Land nun völlig in der Luft.
«Du wirst sehen, Hulda, die Feindseligkeit der Leute wird dann wieder weichen.»
Hulda zog zweifelnd ihre dunklen Augenbrauen hoch. Sie trug heute einen Glockenhut aus cremefarbenem Wollfilz mit braunem Lederband, der ihr hervorragend stand. Die schwarzen Haarspitzen ihres Bubikopfs lugten wie immer fröhlich unter der gebogenen Krempe hervor, doch zum ersten Mal bemerkte Bert ein paar feine silberne Fäden in ihrem dunklen Haar.
«Glaubst du das wirklich?», fragte sie leise und trat einen Schritt näher, als suche sie bei ihm Halt. «Und hängt das nicht auch vom Wahlergebnis ab?»
«Gewiss», gab Bert mit zusammengebissenen Zähnen zurück. «Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Menschen in Berlin irgendwann wieder Vernunft annehmen. Und am besten auch die Politiker im ganzen Land. Im Moment krakeelen doch alle Parteien nur aggressive Parolen herum, anstatt sich um die wirklichen Probleme der Menschen zu kümmern.»
Hulda deutete mit dem Kinn zum Café mit den Hakenkreuzwimpeln, vor dem Felix gerade bei einem Lastauto stand und den Lieferanten bezahlte, wobei er, wie es schien, bewusst den Blick zu Berts Kiosk mied.
«Sind Wahlkampfveranstaltungen über Ostern nicht verboten worden?», murmelte sie bitter.
«Ja, so stand es in der jüngsten Notverordnung», erwiderte Bert. «Aber ein Felix Winter muss sich daran offenbar nicht halten.»
«Er veranstaltet ja auch nur ein unschuldiges Kinderfest, richtig?» Sie sah wieder zu ihrer spielenden Tochter hinüber. «Auch, wenn längst nicht alle Kinder dabei willkommen sind.»
Hulda griff die Schultüte fester und drückte Bert einen flüchtigen Kuss auf die rasierte Wange.
«Ich gehe nach Hause, mein Lieber», sagte sie mit halb rauer, halb zärtlicher Stimme. «Max ist nicht da, und so muss ich wohl oder übel den Abwasch machen.»
Bert deutete eine Verbeugung an und sah ihr nach, wie sie mit stolzen Schritten zu ihrer Tochter hinüberging, um sie von den Hüpfekästchen und ihren Freundinnen loszueisen. Und auf einmal übermannte ihn die Erinnerung daran, wie Hulda selbst als kleines Mädchen ausgesehen hatte. Beinahe schien ihm kein Tag vergangen, seit sie mit hüpfendem Lederranzen auf dem Rücken zu seinem Pavillon gerannt war und ihn mit ihren etwas schief stehenden, graublauen Augen gemustert und eine Zeitung für ihre Mutter verlangt hatte.
Und doch war das Lichtjahre her. Die Welt hatte sich seitdem viele Male gedreht, sie hatten einen Krieg überlebt, viele Menschen verloren, aber auch neue Freiheiten gewonnen. Bert spürte eine seltsame Unruhe in sich, so unstet wie der Frühlingswind, der an seiner Jacke zerrte. Die Wolken schienen plötzlich über den Himmel zu jagen und das zarte Grün in den Linden ringsum nervös zu rascheln.
Woher wehte der Wind dieses Jahr? Was würden sie in den nächsten Wochen und Monaten verlieren – und was gewinnen?
Frau Grünmeiers Fuhrwerk mit den beiden Kaltblütern davor rollte mit Getöse und Gerumpel vom Platz, und Bert ging zurück in seinen Kiosk und zog die Tür fest hinter sich zu.
3.
Ostersonntag, 27. März 1932
«Schneller, schneller!», rief die Aufseherin. «Die Nächsten warten schon.»
Ihre Stimme hallte von den nackten Kacheln des Duschraums wider und ließ Anna zusammenzucken. Rasch seifte sie noch einmal ihr mittlerweile kinnlanges Haar ein und ließ das kalte Wasser schaudernd über ihren Kopf laufen, um alles auszuspülen. Man hatte ihr das Haar kurz nach ihrer Ankunft in der Barnimstraße knapp über den Ohren abgeschnitten und es mit einem scharfen Mittel entlaust, das Anna noch tagelang die Augen tränen ließ. Das war fast drei Wochen her, Anna kam es vor wie eine Ewigkeit.
Gurgelnd floss das schmutzige Wasser, vermengt mit Seifenresten, in den Ausguss zu ihren Füßen. Neben ihr wusch sich eine weitere Frau, schweigend, mit zusammengebissenen Zähnen. Sie stöhnte, während der kalte Wasserstrahl auf sie niederprasselte.
Anna spürte immer wieder die Blicke der anderen auf ihren vorgewölbten Bauch und versuchte instinktiv, sich zur Seite zu drehen, doch auch dort stand eine Frau unter dem Duschkopf und starrte sie neugierig an.
Seufzend strich sich Anna über den Leib und gab auf. Niemand konnte übersehen, dass sie kurz vor der Geburt ihres Kindes stand. Zwar sah man ihren Bauch unter den weiten Gefängniskleidern, über denen sie stets ein Schultertuch und eine weiße Schürze trug, nicht allzu deutlich, doch hier, nackt in der weiß gekachelten Gemeinschaftsdusche mit den Bleirohren, konnte niemand etwas verbergen. Privatsphäre gab es in der Barnimstraße nicht.
«Wir sind hier nicht bei der Schwimmfreizeit!», drang die Stimme der Aufseherin erneut von draußen herein.
Anna drehte den Hahn an der Dusche zu, griff nach einem der groben, grau verfärbten Handtücher, die bereitlagen, und trocknete sich hastig ab. Dann nahm sie ihre Sachen vom Haken, schlüpfte in frische Unterwäsche und das Kleid, legte sich das dreieckige Tuch über die Schultern und band sich schließlich die Schürze um.
Ihre Hände waren knallrot vom kalten Wasser, und Anna wurde nur langsam wieder warm. Doch es war ein herrliches Gefühl, sauber zu sein und gewaschene Haare zu haben. Feucht ringelten sie sich in ihrem Nacken, sie würden an der Luft rasch trocknen.
Sie durften nur einmal die Woche in die Duschräume, ansonsten war Katzenwäsche angesagt. Trotz des kalten Wassers und der zur Eile mahnenden Wärterinnen war dieses Ereignis also jedes Mal wieder ein Festtag.
Als Anna und die anderen Frauen aus dem Waschraum traten, wurde schon die nächste Gruppe in die Duschen geschickt. Davor wartete eine Aufseherin, der Annas kleiner Trupp jetzt durch den langen Gang hinterhertrottete.
Es war noch früh, und vor dem Mittagessen war auch am Sonntag erst einmal Arbeit angesagt, zumindest für die Küchenhilfen. Die Frauen, die an den Nähmaschinen, in der Wäscherei oder in der Werkstatt für Schnürösen eingeteilt waren, hatten sonntags frei, doch in der Küche standen die Räder niemals still.
In der ersten Woche hatte Anna noch in der Wäscherei Laken für die umliegenden Krankenhäuser gewaschen. Dann war sie wegen ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft von der schweren Plackerei befreit worden. Nun musste sie stattdessen in der Küche beim Gemüseputzen helfen.
Doch sie mochte diese Aufgabe. Man hatte ihr wegen ihres Zustands erlaubt, dabei auf einem Stuhl zu sitzen, und Anna fand eine gewisse Befriedigung darin, große Berge von Gemüse zu waschen und klein zu schneiden. Zwar gab es meistens nur Kartoffeln und verschrumpelte Rüben und ab und zu auch mal ein paar welke Köpfe Blumenkohl, aber all das duftete dennoch gut und wurde unter Annas geübten Händen rasant zu feinen Stückchen verarbeitet. Früher hatte sie als Köchin gearbeitet, sie war es daher gewohnt, schnell und effizient in Großküchen zu schuften. Es war noch nicht lange her, da hatte sie in einem berühmten Hotel für die Gäste gekocht, zwar nur als Hilfsköchin, aber immerhin!
Wenn sie am Arbeitstisch der Gefängnisküche saß und ihre Hände geschickt und sicher mit dem Messer schnitten und hackten, wenn sie den Dampf aus den riesigen Blechtöpfen einatmete und roch, wie das zwar billige und manchmal auch schon leicht ranzige Fett in den Pfannen schmolz, dann erlaubte sie sich bisweilen für wenige Momente, in ihren Erinnerungen zu schwelgen.
Die Küche im Hotel Kaiserhof am Wilhelmplatz war überwältigend gewesen und die Gäste, die dort in den noblen Zimmern und Suiten residierten, sehr anspruchsvoll. Es kam vor, dass sie mitten in der Nacht beim Portier eine Ananastorte oder ein Trüffelsoufflé bestellten. Und was immer sie wollten, musste auf der Stelle herbeigezaubert werden. Die Köche und die Küchenhilfen, die Patissiers und Kellner, die Serviermädchen und Butler – sie alle wirbelten nur so umher. Es zischte und blubberte, Eierkuchen flogen durch die Luft, Teller gingen zu Bruch, leuchtend rotes Fleisch wurde mit Beilen zerhackt und zu zarten Braten verarbeitet, Sahne in ganzen Wolken geschlagen, und stets war die Luft erfüllt vom Klappern der Töpfe und vom Zetern und Wüten des Küchenchefs. Doch egal, wie erschöpft Anna nach einer Arbeitsschicht auch war, egal, wie oft sie sich an der Ofenklappe die Arme verbrannte und vom Maître zur Schnecke gemacht wurde – sie hatte es geliebt. Sie hatte dort ihren Platz gehabt, wie ein Rädchen in einer großen, glänzenden, duftenden Maschine. Und niemals hätte sie von dort weggewollt.
Manchmal hatte sie sich ausgemalt, wie sie vielleicht eines Tages zur richtigen Köchin befördert werden würde, wie sie sogar eine eigene Kreation vorstellen durfte, einen Baumkuchen oder eine Cointreau-Torte, und man sie dafür loben würde. Ganz deutlich hatte sie das Bild vor sich gesehen. Die begeisterten Gäste hätten im Restaurant des Hotels nach ihr gefragt, und Anna hätte sich die schmutzige Schürze abgebunden und wäre in einem eleganten schwarzen Kleid und mit erhobenem Kopf nach vorne in den hell erleuchteten Festsaal gegangen, um die Glückwünsche entgegenzunehmen – offenkundig demütig, aber heimlich glühend vor Stolz.
Doch dann war alles ganz anders gekommen. Und niemand trug daran mehr Schuld als sie selbst.
Das Kind in ihrem Bauch trat sie schmerzhaft gegen die Rippen. Sie verbiss sich den Schmerzenslaut, der beinahe über ihre Lippen gekommen wäre, und bog auf einen Wink der Aufseherin hin in die Küche ab. Dort stapelten sich auf dem großen Tisch in der Mitte des Raums schon in hohen Bergen Zwiebeln und weiße Rüben, die heute in den immer gleichen Eintopf kommen würden. Mehrere Frauen standen am Herd, eine rührte in einem riesigen Bottich, eine andere weichte Linsen in einer Wasserschüssel ein. Auch hier stand eine Aufseherin bereit. Schweigend lehnte sie an der Wand und rauchte gelangweilt, ab und zu klapperte der große Schlüsselbund mit dem eisernen Ring, der an ihrem Rockbund befestigt war.
Niemand beachtete Anna besonders, und sie murmelte nur einen knappen Gruß und setzte sich an ihren Arbeitsplatz. Bisher war es ihr gelungen, so wenig wie möglich mit ihren Mitinsassinnen zu sprechen. Und das war ihr nur recht, denn so sehr Anna sich auch nach einer Vertrauten und etwas Gesellschaft sehnte, so groß war ihre Angst davor, was die anderen Frauen mit ihr machen würden, wenn sie den Grund erfuhren, weshalb sie hier einsaß. Bisher schienen die meisten eher Mitleid mit ihr wegen ihres Zustands zu haben, und wenn es nach Anna ging, konnte das ruhig so bleiben. Dann ließ man sie wenigstens in Ruhe.
Nur mit Ruth, der jungen Gefangenen mit dem kurzen Haar, hatte sie manchmal beim Essen ein paar Worte gewechselt. Einmal hatte Anna ihr sogar ein Buch ausgeliehen, eins der wenigen Dinge, die sie besaß, weil ihre Schwester es ihr ins Gefängnis geschickt hatte. Eine Wärterin hatte Ruth dafür in ihre Zelle gelassen. Das war eigentlich nicht erlaubt, aber die Aufseherinnen schienen Ruth, die sanft und genügsam war, gernzuhaben und gestatteten ihr hin und wieder ein kleines Privileg. Anna konnte das gut verstehen, auch sie mochte die junge Frau. Wenn sie sich auf dem Flur begegneten, nickten sie einander zu. Es war keine echte Freundschaft, aber besser als nichts.
Anna nahm das Küchenmesser zur Hand und begann mit der mühseligen Arbeit. Rübe für Rübe verwandelte sich unter ihren flinken Fingern zu Stückchen. Ihre Hände verrichteten die Arbeit automatisch, Anna musste nicht nachdenken, weil ihr die Bewegungen in Fleisch und Blut übergegangen waren. Sie zerteilte die Rüben mit einem kräftigen Schnitt einmal längs und zerkleinerte die Hälften dann eine nach der anderen rhythmisch und präzise. Währenddessen gingen ihre Gedanken auf Wanderschaft, in ihrer Phantasie trat sie erneut ins Hotel Kaiserhof ein. Sie sah die prächtige Empfangshalle vor sich, die teuren, schweren Teppiche, die geschnitzten Mahagonihandläufe der breiten Treppe, die glänzenden Schirme an den Mützen der Pagen. Überall hingen schwarz-weiß-rote Flaggen, denn das Grandhotel inmitten der Stadt war deutschnational eingestellt und sympathisierte mit den konservativen Kräften. So kamen auch die meisten Gäste aus den Kreisen der Großindustrie, des Adels und der NSDAP. Doch Politik hatte Anna nie sonderlich interessiert. Sie wusste zuerst nicht einmal genau, wer dieser Hitler überhaupt war, der seit ein paar Monaten im Hotel residierte und um den alle ein großes Gewese machten. Er sollte Reichspräsident werden, hatte ihr der Butler erzählt, doch Anna hatte nur eine ungenaue Vorstellung davon, was das bedeutete. Ihr erschien der kleine, unauffällige Mann mit dem hässlichen Schnurrbart eher durchschnittlich und gar nicht wie ein großer Staatsmann. Nein, sie schenkte dem ganzen Gerede über Politik nicht viel Beachtung – bis, ja, bis …
Anna schrie leise auf, als der Schmerz sie durchfuhr, und ließ das Messer fallen. Ein tiefer Schnitt ging über ihre Handfläche. Sofort trat Blut aus und tropfte auf den Arbeitstisch, sodass sich ein paar weiße Rüben rosig färbten.
Die Köpfe der anderen Frauen fuhren zu ihr herum.
«Was machen Sie denn?», rief die Aufseherin, die an der Wand gelehnt hatte. Sie warf ihre Zigarette fort und kam zu Anna herüber. «Können Sie nicht aufpassen?» Sie betrachtete kurz die Wunde und verzog das Gesicht. «Sie müssen ins Krankenzimmer», sagte sie knapp. «Gehen Sie schnell allein. Ich kann hier nicht weg.»
Suchend sah sie sich um und griff nach einem Stofflappen, der an einem Haken hing.
«Hier», sagte sie und reichte ihn Anna, «wickeln Sie das um die Hand, damit Sie nicht alles volltropfen.»
Anna tat, wie ihr geheißen, und stand auf. Ihr war flau, Sternchen tanzten vor ihren Augen.
Eine Mörderin, die kein Blut sehen konnte, dachte sie bitter, sie war wirklich eine lächerliche Gestalt.
Vorsichtig tappte sie aus der Küche und ging den Flur, der von einer anderen Aufseherin bewacht wurde, entlang in Richtung Krankenstube. Sie wusste, dass dort stets eine Schwester Bereitschaft hatte, die für kleinere Verletzungen und Krankheiten zurate gezogen wurde. Wenn es nötig war, wurde der Arzt aus einer benachbarten Praxis geholt. Nicht weit von dem Raum entfernt befanden sich zwei Krankenzellen und ein Kreißsaal mit benachbarten Mutter-Kind-Zellen. Dort würde auch Anna bald ihr Kind bekommen.
Manchmal erhaschte man einen Blick in eine der Zellen, in der eine Insassin ihr Kind stillte, und dann fragte Anna sich, wie lange man sie und das Baby zusammenlassen würde. Und was danach geschehen würde, wenn das Kind entwöhnt war. Doch jedes Mal, wenn sie dieser Gedanke streifte, schob sie ihn mit aller Willenskraft, die sie aufbieten konnte, zur Seite. Jetzt ist jetzt, und später ist später – das hatte ihre Mutter immer gesagt, und es war Annas Strohhalm, an den sie sich seit ihrer Verhaftung im vergangenen Herbst klammerte.
Sie kam zur Tür der Krankenstube, und auch hier saß eine Aufseherin auf ihrem Posten. Als Schließerin konnte sie an dieser Stelle sowohl das Erdgeschoss als auch den ersten Stock einsehen, denn oberhalb führte eine Stahlbrücke über den Korridor. Anna hob die verletzte Hand, und die Frau nickte ihr zu. Das Tuch war bereits blutgetränkt, und Anna bemühte sich, nicht hinzusehen, sondern klopfte rasch mit der freien Hand an die geschlossene Tür.
«Herein», rief eine weibliche Stimme von drinnen.
Anna trat ein. An einem großen Tisch in der Mitte des Raums saß eine Frau in einem weißen Kittel und mit einem Häubchen auf dem silberblonden Scheitel. Sie las ein Buch und blickte mit fragender Miene hoch. Beim Anblick von Annas blutender Hand stand sie wortlos auf, trat an einen Schrank mit Verbandszeug und nahm das Benötigte heraus.
«Machen Sie es sich bequem», sagte sie über die Schulter und deutete mit dem Kinn auf die Krankenliege, die an einer Seite des Zimmers aufgestellt war.
Anna legte sich hin und hielt ihre verletzte Hand von sich gestreckt. Die Krankenschwester kam zu ihr, wickelte vorsichtig die provisorische, blutgetränkte Bandage ab und betrachtete den Schnitt mit fachmännischem Blick.
«Küchenmesser?», fragte sie.
Anna nickte.
«Mit den Gedanken woanders gewesen?»
«Ja», hauchte Anna.
Die Frau seufzte leise, desinfizierte die Wunde und legte mit raschen, geübten Handgriffen einen Verband an.
«Zwei Tage freigestellt vom Dienst», sagte sie. Und mit Blick auf Annas Bauch fügte sie hinzu: «Das wird Ihnen ohnehin guttun, nicht wahr?»
Irritiert sah Anna in die hellgrauen Augen der Schwester. Halb erwartete sie, darin Spott zu finden oder den unausgesprochenen Vorwurf, sich die Verletzung selbst zugefügt zu haben. Das kam im Gefängnis öfter vor, immer wieder versuchten Gefangene, sich auf diese Art vor der anstrengenden, monotonen Arbeit zu drücken.
Doch Anna war beruhigt, als sie das teilnahmsvolle Lächeln sah, das um die Lippen der Krankenschwester spielte. Diese Frau unterstellte ihr nichts, sie wollte ihr wirklich helfen – ein seltener Umstand an einem Ort wie diesem, das hatte Anna inzwischen gelernt. Und sie spürte, wie ihre Lippen gegen ihren Willen zu zittern begannen, weil es sie so rührte, einem guten Menschen zu begegnen.
«Danke», brachte sie heraus und stand auf.
Die Schwester trat an den Tisch, schrieb etwas auf ein Formular und drückte es Anna in die Hand.
«Der Schein ist für die Küchenaufsicht», sagte sie. «Kommen Sie übermorgen am Vormittag zum Verbandswechsel. Dann tritt auch die neue Hebamme ihren Dienst an, die kann Sie dann gleich untersuchen.»
Anna nickte der Frau zu und verließ die Krankenstube. Eine Hebamme? Langsam rückte ihr Entbindungstermin immer näher, und beim Gedanken daran, was sie erwartete, wurde ihr wieder schwindelig. Doch erneut sagte sie sich die Formel ihrer Mutter stumm vor, jetzt ist jetzt, und eilte durch den Korridor.
Als sie bei der Fluraufsicht vorbeikam, spürte Anna auf einmal, dass sie auf die Toilette musste. Je schwerer ihr Bauch wurde und je mehr ihr Kind auf die Blase drückte, desto häufiger hatte sie das Bedürfnis. In jeder Zelle gab es einen Abort, doch weil dort nur dreimal am Tag zentral gespült wurde, bemühte sich Anna, stets die Gruppenwaschräume zu benutzen, die außerhalb der Zellen auf den Fluren lagen.
«Darf ich bitte zur Toilette gehen?», fragte sie.
Die Aufseherin nickte mit unbewegter Miene. «Aber beeilen Sie sich», fügte sie hinzu. «Ihre Kameradin ist auch schon ewig auf dem Örtchen.» Ungehalten schüttelte sie den Kopf. «Das sind alles diese sanften Methoden der neuen Direktorin», murmelte sie mehr zu sich selbst, «aber irgendwann wird Frau Helfers ihre Weichherzigkeit teuer zu stehen kommen.»
Anna verstand nicht, warum die Worte Beeilen Sie sich immer die automatischen Begleiter jeder Erlaubnis, jedes Handgriffs im Gefängnis waren. Hatten sie, die hier drinnen einsaßen, nicht alle Zeit der Welt? Das Gefängnis war ein Kosmos für sich, es gab wenig Verbindung zur Außenwelt. Mochte draußen die Hektik des Alltags toben oder Chaos ausbrechen, hier drin stand die Zeit still. Sicher, in der Wäscherei wurden Textilien für die umliegenden Betriebe und Hotels gesäubert und abgeholt, und in der Näherei fertigten die Frauen Kleidungsstücke und Abzeichen für die städtische Polizei und andere Beamte, doch wirkliche Eile war auch dabei nicht geboten. Und von welchen sanften Methoden sprach diese Frau überhaupt? Tatsächlich hatte Anna schon öfter etwas in dieser Richtung aufgeschnappt. Die älteren Wärterinnen waren der Meinung, dass die Direktorin den Gefangenen zu viel durchgehen ließ. Aber seine Notdurft in Ruhe zu verrichten, war das nicht einfach nur menschlich?
Anna eilte zu den Toiletten, froh, dass sie kurz allein sein konnte. Im Vorraum betrachtete sie einen Moment ihr