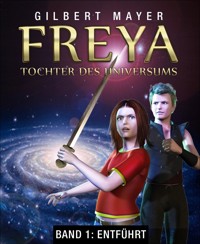
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Freya ist die Tochter eines Professorenehepaares, das seine ganze Zeit der Erforschung alter Kulturen, vor allem jener der Wikinger widmet. Freya träumt dagegen von Kulturen, die hunderte von Lichtjahren entfernt existieren. Vielleicht...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Freya - Tochter des Universums
Band1: Entführt
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenRuhe vor dem Sturm
"Freya! Kommst du bitte!“, meine Mutter rief mich zum Abendessen zum Haus zurück. Ich hatte meinen ersten Ferientag in einem Sommerhaus in Schweden mit der Erkundung der näheren Umgebung verbracht. Es war kurz zusammengefasst eintönig hier. Ein kleiner See umgeben von einem ziemlich dichten Wald. Unser buntes Holzhaus mit dem Bootssteg. Das war’s schon. Dass es schon Zeit fürs Abendessen war, hatte ich nicht bemerkt. Es blieb solange hell in den Sommernächten im Norden. Ich setzte mich an den einfachen Tisch auf der Veranda, der mit einem Plastiktischtuch wovor auch immer geschützt war und Mama stellte einen Teller vor mich hin. „Puh. Gebratener Fisch!“, entsetzte ich mich und hob das Tier mit der Gabel hoch, um einen Blick auf die Beilagen zu werfen. „Wir sind hier in Schweden…“, begann meine Mutter. „Warum sind wir nicht nach Italien gefahren, dann könnte ich eine Pizza essen?“ grummelte ich vor mich hin. „Italien ist nächsten Sommer dran. Da werde ich eine Vortragsreihe über römischen Handelsstrassen halten. Aber in diesem Jahr ist Papa am Zug. Da nimmt er an einer Grabung hier in Schweden teil. Und jetzt iss deinen Fisch.“ Meine Mutter beendete die Diskussion. Meine Eltern waren beide Wissenschaftler. Historiker, die an der Universität in unserer Stadt als Professoren ihre Vorlesungen hielten und die übrige Zeit auf Grabungen, Exkursionen oder Vortragsreisen waren. Es war nicht leicht, das Kind solcher Eltern zu sein. In der Schule gehörte ich nicht zu den hippen Mädchen, die den Ton in Sachen Partys und Mode angaben. Ich war ihnen zu schräg und vielleicht auch zu arrogant. Keine Ahnung. Lustlos kaute ich im Licht der nordischen Sonne auf meinem Fisch herum. Die Mücken waren eine elende Plage. Eine Hand an der Gabel, brauchte ich die andere, um ständig gegen meine nackten Arme oder Beine zu schlagen, was Mama mit einem vielsagenden Blick bestrafte. Papa sah von der schwedischen Zeitung auf, in die er die ganze Zeit über vertieft gewesen war. „Heute Nacht“, sagte er mit bedeutungsvoller Mine zu mir. „heute Nacht wird ein Meteoritenschauer erwartet. Sternschnuppen, weißt du Freya.“ „Ich weiss“, gab ich unwirsch zurück, wie jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, dass man mich wie ein kleines Kind behandelte. „Um diese Jahreszeit ist das nicht unüblich.“ „Wenn es in der Zeitung steht“, gab mein Vater zurück, ohne meine Unfreundlichkeit zu beachten. „Dann wird schon etwas mehr dahinter stecken, als die üblichen paar Glückssternchen. Meinst du nicht?“ Ich überlegte kurz. „Darf ich mit dem Ruderboot auf den See rausfahren? Von dort aus sieht man bestimmt den ganzen Himmel und das Licht vom Haus stört auch nicht!“ Mama holte tief Luft. „Du bist elf Jahre alt Freya.“ „Eben“, warf ich ein, bevor sie ihren Satz weiterführen konnte. „Ich bin elf Jahre alt, also bin ich alt genug, um vom See aus ein paar Sternschnuppen zu beobachten.“ „Freya hat Recht“, mischte sich Papa ein. „Was soll schon passieren. Sie sieht von jeder Stelle des Sees aus die Lichter von unserem Haus.“ Mama zögerte: „Wolltest du Freya nicht die Runenschrift erklären?“ „Das habe ich schon einige Male versucht.“, Papa zog sich wieder hinter seine Zeitung zurück. „Freya interessiert sich nicht für die Wikinger und deren Schriftzeichen. Sie hat bloss den Weltraum und ihre verrückten Ausserirdischen im Kopf.“ Ich blickte zu Mama und sah erfreut, dass sie aufgegeben hatte. „Schau, wir setzen uns auf die Veranda und planen unsere morgige Exkursion zu den Grabhügeln“, lockte Papa. „Da können wir ein Auge und ein Ohr bei Freya haben.“ „Na schön“, willigte Mama ein. Vermutlich war sie froh, den Abend ohne meine Geschichten von Ausserirdischen zu verleben und sich ganz den toten Wikingern in ihren Erdlöchern und Steinhügeln widmen zu können. Ich wartete nicht weiter ab, putzte rasch die Zähne und holte meinen Feldstecher und mein Forschungsbuch, auf dem das Bild eines typischen Aliens mit übergrossen Augen und hellgrüner Haut prangte. Schon sass ich im Ruderboot, winkte meinen Eltern auf der Veranda fröhlich zu und stiess ab. Nach zehn Minuten war ich zurück am Landesteg und eilte an meinen verdutzten Eltern vorbei. „Na schon genug gesehen?“, spöttelte mein Papa. „Nein, bloss das Mückenschutzmittel vergessen“, gab ich zurück und war auch schon wieder auf dem Weg zu meinem Beobachtungspunkt im Zentrum der inzwischen bereits unheimlich dunklen Wasserfläche. Da sass ich nun, wenn ich es recht bedachte, recht weit vom Haus mit seinen gemütlich erleuchteten Fenstern entfernt, in einem schwankenden Ruderboot. Ich konnte meine Eltern nicht mehr hören, denn die Stille der Nacht ist im Grunde genommen gar nicht so still. Die Grillen zirpten um die Wette, die Mücken surrten um mich herum und dann wieder weg, weil sie mein Schutzmittel rochen, ich hörte Fische springen und ins Wasser platschen. Nachtvögel schrien von Zeit zu Zeit aus der Tiefe des Waldes. Es war recht unheimlich und ich war froh, dass mein grosser Alien-Freund gleich neben mir auf der Ruderbank sass, die Laserkanone im Anschlag. Mein Alien-Freund begleitete mich stets überall hin, was mir bei meinen Schulkameraden unverständliche Blicke und Tuscheln hinter meinem Rücken eintrug. Sie fanden mich kindisch und sie hatten ja Recht. Aber diese Fantasiefigur gab mir Sicherheit. Mit meinem Alien-Freund traute ich mir viel mehr zu und ich machte Dinge, die ich alleine nie unternommen hätte. Zudem war er der einzige, der mir zuhörte, dem ich meine Geheimnisse und meine Wünsche verraten konnte, ohne dass ich befürchten musste, ausgelacht zu werden. Ich suchte mir eine bequeme. Am besten klappte es, wenn ich auf den Boden des Ruderbootes lag und den Kopf auf der Sitzbank aufstützte, sodass ich genau senkrecht in den Himmel blickte. All die unheimlichen Geräusche wichen jetzt dem beruhigenden Platschen kleiner Wellen an der Wand des Ruderbootes. Das hätte leicht schläfrig machen können. Aber ich war hellwach. Gespannt auf das Spektakel, das sich in dieser Nacht am Himmel abspielen würde.
Das Abenteuer beginnt
Natürlich passierte zunächst gar nichts. Das ist immer so, wenn man ganz gespannt auf etwas wartet. Wenige Minuten erscheinen einem wie eine Ewigkeit. Das Plätschern an der Bordwand entfaltete nach und nach seine Wirkung. Ich wurde unaufmerksam, begann mit meinen Gedanken immer weiter weg zu schweifen und am Ende schlief ich ein. Als ich wieder aufwachte, hatte ich das Gefühl, jemand oder besser etwas hätte mich geweckt. Schlaftrunken sah ich mich um. Wo war ich? Ach ja, mitten auf dem See, nicht weit vom Ferienhaus meiner Eltern. Aber wo war das Haus. Ich blickte in Richtung Ufer und konnte kein Licht entdecken. Vermutlich hatte sich das Boot gedreht. Ich kniete im Boot auf und starrte in die Dunkelheit der Nacht. Nichts. Kein Schimmer eines Lichts. Ich blickte nach oben. Aber der Himmel war dunkel und sternenlos. Vermutlich hatten sich die Wolken vom Nachmittag verdichtet und den ganzen Himmel bedeckt. Bis jetzt hatte ich mir noch keine Sorgen gemacht. Wenn man eben aufgewacht ist, gerät man nicht so leicht in Panik. Aber langsam wurde ich doch unruhig. In dieser Dunkelheit konnte ich nicht einmal mehr meinen Alien-Freund entdecken, der ja nie von meiner Seite wich. Ich zwang mich, klar zu denken. Klar und realistisch. Und da bekam ich erst richtig Angst. Denn realistisch gesehen hatte ich keinen Alien-Freund, der mich beschützte. Ich war ganz allein mitten auf dem See, wusste weder wo das Ufer lag und wie weit es entfernt war, noch konnte ich irgendein Lebenszeichen von meinen Eltern ausmachen. Zudem war es rund um mich herum völlig still geworden. Das Geschrei der Nachtvögel war verstummt. Die Grillen schienen gespannt auf etwas zu warten und machten keinen Pieps. Da riss urplötzlich der Himmel über mir auf und ein heller Lichtstrahl erleuchtete für einen Moment mein Boot und blendete mich so, dass meine Augen schmerzten. „Das muss das Nordlicht sein“, dachte ich, wurde aber im nächsten Augenblick eines Besseren belehrt. Das Licht stammte von gleißenden Bällen, die auf die Erde herabstürzten, wenige Handbreit über der Wasseroberfläche eine Kurve nach oben zogen und in alle Himmelsrichtungen davonstoben. „Sternschnuppen!“, jubelte ich innerlich. „Sie fallen also doch bis auf die Erde.“ Die Lichter waren jetzt im nahen Wald am Ufer verschwunden. Ich sah sie zwischen den Stämmen aufblitzen und wieder verschwinden. „Das können keine Sternschnuppen sein“, sagte ich kleinlaut zu mir selbst. „Sternschnuppen fallen zur Erde und verglühen, oder sie schlagen auf und treiben dabei einen Krater in die Erde. Also was sind das für Lichter?“ Da schossen vier Lichter aus dem Wald und genau auf mich zu. Ich warf mich ins Boot. Im selben Moment zischten die Dinger heulend über mich hinweg und flogen auf verschiedenen Flugbahnen zwischen die Bäume. „Wow!“ sagte ich mir. „Da geht echt was ab. Aber es geht bestimmt nicht mit rechten Dingen zu.“ Ich wagte nicht, wieder aufzusitzen, also beobachtete ich das Treiben auf dem Bauch liegend und nur soweit über den Bootsrand blickend, dass ich freie Sicht auf die Ereignisse hatte. Es fiel mir jetzt auf, dass nicht nur gleißend helles Licht, so wie von kleinen Sonnen zu sehen war, sondern dass diese glühenden Kugeln einen ordentlichen Lärm vollführten. Wenn sie senkrecht in die Luft schossen, gab es ein kreischendes Heulen, und wenn sie um die Bäume kurvten, klang es, als ob ein Rennauto mit 300 Sachen an einem vorbei rast. Jetzt sah ich plötzlich, dass zwischen den Kugeln Blitze zuckten, wenn sie sich näher kamen. Das knallte ganz ordentlich, wie Feuerwerk. Wieder flogen zwei Kugeln über den See. Die vordere vollführte wahre Kunststücke, flog im enge Kurven oder schlug Haken, um dem zweiten Ball zu entkommen. Aber der schien an ihm dran zu kleben. Er folgte ihm und machte alle Kapriolen mit. Und jetzt zuckten wieder diese Blitze zwischen den beiden. Plötzlich schoss der Verfolger senkrecht in die Höhe und ließ einen fürchterlichen Pfeifton hören, der mich fast taub werden ließ. Der erste Lichtball, der immer vorneweg geflogen war, schien außer Kontrolle geraten sein. Er flog in sinnlosen Kurven ganz nahe über dem Wasserspiegel. Was mich jedoch besonders beunruhigte: er torkelte genau auf mein Boot zu. Mit rasender Geschwindigkeit zischte das Ding wenige Zentimeter über dem Wasserspiegel auf mich zu. Ich konnte mich vielleicht mit einem Sprung ins Wasser retten, aber bis ich das nur fertig gedacht hatte, war die Kugel vor dem Boot. Instinktiv zuckte ich zurück und warf mich nach hinten, was mein Boot in eine gefährliche Schräglage brachte. Die Leuchtkugel schlug auf dem Wasser auf. Das war meine Rettung. Wie ein flacher Stein prallte der glühende Ball von der Wasseroberfläche ab und sprang um Haaresbreite über mich hinweg. Ich riss den Kopf herum und sah, wie er wieder und wieder auf dem Wasser aufschlug, bis er am Ufer zwischen den Bäumen verschwand. Es dauerte vielleicht noch eine Sekunde bis der Wald für einen kurzen Augenblick hell erleuchtet wurde, als würde er brennen. Im selben Moment hörte ich eine gewaltige Detonation und eine Druckwelle schleuderte mich ins Boot zurück, das sich so stark neigte, dass es mit Wasser vollschlug. Ich versuchte das Schwanken auszugleichen, indem ich mich wieder auf die andere Seite warf, aber das war keine gute Idee. Ich fiel kopfüber in den kalten See und wurde vom kenternden Ruderboot zugedeckt und unter Wasser gedrückt. Schwimmen war für mich kein Problem. Aber ich konnte nichts sehen und hatte unter Wasser die Orientierung verloren. Ich musste statt nach oben nach unten geschwommen sein, denn plötzlich verfingen sich meine Arme und Beine in schleimigen Tentakeln. Das dachte ich wenigstens. In Wirklichkeit waren es die Blätter von Wasserpflanzen. Ich geriet in Panik, schluckte Wasser vor Aufregung und schlug wild um mich. „Das war’s also. Ich werde hier elend ertrinken, nachdem ich gerade das aufregendste Abenteuer meines Lebens erlebt habe.“ So schoss es mir durch den Kopf. Aber ich beschloss, es nicht dabei zu belassen. „Nein!“ schrie ich mich selber an. „Du gibst nicht auf. Halt still und lass dich nach oben treiben. Wäre doch gelacht, wenn eine gute Schwimmerin wie ich in diesem lächerlichen See ertrinken würde.“ Tatsächlich berührten meine suchenden Hände kurz darauf etwas Hartes. Das umgekippte Ruderboot!. Ich spuckte Wasser und rang nach Atem. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich unter Wasser gewesen war. Aber ich wusste, dass ich gerettet war. Ich konnte mich am Boot festhalten und so trotz des unangenehm kalten Wassers lange genug schwimmen, um das rettende Ufer zu erreichen. Ich machte einen schwachen Lichtschein am Ufer aus und hielt genau darauf zu. Es mochten einige hundert Meter gewesen sein, die ich so an mein Boot geklammert zurücklegte. Als ich das Ufer erreichte, war ich völlig erschöpft und blieb einfach auf dem Bauch liegen. Ab und zu bekam ich einen Hustenanfall und etwas Seewasser fand seinen Weg aus meinen Lungen auf den feuchten Waldboden. Erst allmählich wurde mir bewusst, dass der ganze Lichterzauber mitsamt dem dazugehörenden Lärm aufgehört hatte. Der See lag still und dunkel vor mir und die Grillen hatten ihr Konzert wieder aufgenommen. Alles schien wie zuvor. Langsam wurde ich wieder ruhiger. Ich atmete nicht mehr, als ob ich am Ersticken wäre und ich begann die Geräusche und die Düfte des stillen Waldsees wieder wahr zu nehmen. Zu sehen gab es ohnehin nichts. Der Himmel war dunkel, von Wolken verhüllt und ich konnte kein Licht von unserem Haus ausmachen. Trotzdem schien es, als ob ein mattes Leuchten von irgendwoher käme, denn je länger ich mich an die Dunkelheit gewöhnte, desto mehr konnte ich die Umrisse von einigen hohen Tannen vor mir im Wald erkennen. Dort hinten, im Dickicht des Waldes schien etwas zu glühen. Ich musste wissen, was dahinter steckte. Viel zu schnell stand ich auf. Meine Knie waren weich von der großen Anstrengung und meine Lunge tat weh, vom heftigen atmen. Bevor ich losging, wollte ich noch meine Ausrüstung aus dem Boot bergen. Es kostete mich einige Mühe, das am Ufer liegende, umgekippte Boot umzudrehen. Ein Rumpeln sagte mir, dass zumindest einige schwere Sachen noch im Rumpf lagen. Ich hatte Glück. Mein Tagebuch, der Feldstecher und die Taschenlampe, die unter der Ruderbank verstaut waren, hatten sich beim Kentern verfangen. Sie waren unversehrt und ziemlich trocken geblieben. Ich hängte mir den Feldstecher um, klemmte mein Tagebuch unter den Arm und hielt mit der Rechten meine Taschenlampe. Ich tastete mich vorsichtig in den Wald hinein. Meine Turnschuhe voll schlammigem Seewasser und gaben bei jedem Schritt ein hässlich schmatzendes Geräusch von sich. Der Waldboden war weich und etwas feucht. Moos, Erde und verrottende Tannennadeln ließen mich wie auf einem Teppich gehen. Ich suchte den Boden mit der Taschenlampe ab, um nicht eine unangenehme Überraschung zu erleben. Wo wollte ich eigentlich genau hin? Was suchte ich hier im unbekannten Wald, wo ich doch eigentlich nur eines im Sinn haben sollte: so rasch als möglich nach Hause zurückzufinden. Meine Eltern machten sich bestimmt bereits die größten Sorgen. Aber da war dieses schwache Leuchten zwischen den Bäumen, das mich magisch anzog. Ich musste wissen, was da in den Wald geflogen und zerschellt war. Wenn es ein Meteorit gewesen war, fand ich vielleicht seine Bruchstücke und würde sie dem Museum an der Uni übergeben. Mein Name würde als Entdeckerin und Stifterin auf einem Metallschild prangen und ich wäre die berühmteste Person in meiner ganzen Schule. Das Leuchten war ein Hinweis darauf, dass der Stein noch heiß sein musste. Wie sollte ich ihn anfassen, ohne mir die Finger zu verbrennen. Ich hatte auch keine Ahnung, wie groß das Ding sein konnte. Die Kugel war so schnell über mich hinweg gerast, dass ich keine Zeit hatte, mir über die Größe Gedanken zu machen. Während ich über all diese Dinge nachdachte, war ich zu einer Stelle gekommen, wo eine Schneise aus abgebrochenen und verbrannten Ästen auf eine Lichtung führte, wo der leuchtende Gegenstand sich deutlich vom dunklen Waldboden abgrenzte. Die Bäume, die noch im Kreis um die Lichtung standen waren alle von der Hitze angesengt und hatten kahle Stellen. Mein Herz klopfte wie verrückt, als ich mich dem Gegenstand näherte. Er war nicht mehr als Kugel zu erkennen, schien vielmehr aus mehreren Teilen zu bestehen und lag wie eine halberloschene Feuerstelle am Boden. Ich war jetzt äußerst vorsichtig, denn mein Papa hatte mir auch schon erzählt, dass es gefährliche Strahlung gab, die einen in kürzester Zeit vergiften konnte, sodass man dann ein Leben lang krank und schwach blieb. Was sollte ich tun? Ich opferte mich für die Wissenschaft, brach noch einen der übriggebliebenen Zweige von einem Busch ab und ging zu dem glühenden Häufchen hin. Das Glühen war unheimlich, nicht einfach wie Kohle, es wurde heller und dunkler und das in regelmäßigen Abständen, als ob es atmete. Auch ein Geräusch war zu hören. Ein Sirren und Flirren, das wie das Glühen auch, zu- und abnahm. Ich erinnerte mich an die goldenen Regeln meiner Eltern, wenn sie eine archäologische Fundstätte entdeckten. Nicht berühren, bevor nicht die Lage aller Gegenstände festgehalten ist. Ich zückte also mein Tagebuch und skizzierte, so gut es im Schein einer Taschenlampe ging, Form und Lage der glühenden Gegenstände. Wenn man etwas abzeichnet, sieht man genauer hin und entdeckt Dinge, die man auf den ersten Blick übersehen hat. Mitten in dem glühenden Material entdeckte ich etwas Kleines, dunkles, das nicht zum Rest passen wollte. Es glühte nicht. Aber – nein das konnte unmöglich sein. Doch da sah ich es wieder. Es bewegte sich. Langsam zwar aber doch deutlich sichtbar. Vielleicht war es ein Käfer, der vom abstürzenden Meteoriten überrascht worden war und auf wundersame Weise die Explosion überlebt hatte. Aber das Ding sah nicht aus wie ein Käfer. Dazu fehlten ihm zwei Beine, denn dieses Tier hatte deutlich sichtbar zwei Beinchen und zwei Arme. Auch ein Kopf ließ sich ausmachen, obschon außer zwei riesigen Augen kaum etwas daran zu erkennen war. Ich stocherte mit meinem Zweig in den Trümmern, um das Tier freizulegen. Vorsichtig verschob ich Stück um Stück die glühenden Teile zur Seite, sodass das Ding am Ende von allem Unrat befreit alleine auf dem Waldboden lag. Es war etwa so groß wie eine Maus. So sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte mir keinen rechten Reim darauf machen. Ich musste es näher untersuchen. Vergessen war mein Meteorit, hier lag etwas Lebendiges und das war allemal interessanter, als ein toter Stein, selbst wenn er aus dem Weltall stammte. Vielleicht konnte mir mein Feldstecher bei der Untersuchung nützlich sein, wenn ich ihn wie eine Vergrößerungsglas einsetzte. Ich nahm ihn vor die Augen, behielt aber auch die Taschenlampe in der Hand und probierte aus, wie nahe ich an das Tier herangehen konnte, um noch etwas zu sehen. Dazu kniete ich mich hin und beugte mich immer weiter vor, bis ich noch wenige Zentimeter über dem Wesen verharrte. Ich hielt den Feldstecher weiter von den Augen weg und regelte so die Schärfe. Plötzlich schien es zu klappen, ich sah ein winziges Bild, im Feldstecher, das aber stark vergrößert war. Und ich blickte geradewegs in ein Gesicht, ohne Mund und ohne Nase, aber mit zwei großen Augen. Und die blickten mich derart böse an, dass ich eine eisige Kälte in mir hochsteigen fühlte.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















