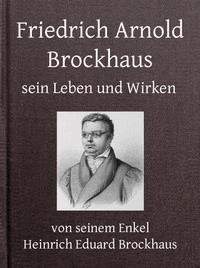
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 662
Ähnliche
Friedrich Arnold Brockhaus.
Erster Theil.
Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.
Friedrich Arnold Brockhaus.Sein Leben und Wirken
nach Briefen und andern Aufzeichnungen geschildert von seinem EnkelHeinrich Eduard Brockhaus.
Erster Theil.
Mit einem Bildniß nach Vogel von Vogelstein.
Leipzig:
F. A. Brockhaus.
1872.
Vorwort.
Am 4. Mai dieses Jahres sind hundert Jahre seit dem Tage verflossen, an welchem
Friedrich Arnold Brockhaus
geboren wurde. Dem Gedächtnisse des Verewigten sollen bei dieser Jubelfeier nachfolgende Blätter geweiht sein.
Kaum mehr als die Hälfte dieses Zeitraums war ihm zu leben vergönnt: am 20. August 1873 werden es funfzig Jahre, daß er im kräftigsten Mannesalter den Seinigen und seinem Wirken entrissen worden ist. Und nur achtzehn von den einundfunfzig Jahren seines Lebens wirkte er in dem Berufe, zu dessen hervorragendsten und verdientesten Vertretern er gehört.
Was er in dieser kurzen Spanne Zeit erstrebt und geschaffen, gibt ihm den Anspruch darauf, daß sein Gedächtniß in Ehren gehalten, sein Leben und Wirken der Nachwelt vorgeführt werde. Friedrich Arnold Brockhaus verdient ein Blatt in der Geschichte des deutschen Buchhandels, und der Versuch, ihm ein solches zu widmen, bedarf darum keiner Rechtfertigung.
Dagegen erscheint eine Erklärung nöthig, weshalb ein solcher Versuch nicht schon früher gemacht wurde.
Der Grund liegt hauptsächlich darin, daß für eine Biographie desselben nur ein ungenügendes, geringes und lückenhaftes Material vorhanden ist. Deshalb kam auch die bald nach seinem Tode von einem Freunde, Professor Friedrich Christian August Hasse in Dresden, gehegte Absicht, ihm ein literarisches Denkmal zu errichten, nicht zur Ausführung, obwol er vor Vielen dazu berufen und befähigt gewesen wäre. Aus gleichem Grunde trat in späterer Zeit der Gedanke an eine ausführlichere biographische Schilderung immer mehr in den Hintergrund, je weniger es trotz mehrfacher Bemühungen gelingen wollte, jene Lücken auszufüllen. Die an den Tagen des 13. und 14. Juli 1856 begangene Jubelfeier des funfzigjährigen Bestehens der Firma F. A. Brockhaus ließ den Wunsch nach einer Lebensschilderung ihres Begründers wieder lebhafter hervortreten, und sein hundertjähriger Geburtstag erschien als der passendste Zeitpunkt zur Ausführung.
Der Unterzeichnete, ein Enkel des Verstorbenen, übernahm die schwierige Aufgabe; er fühlt vor allem die Verpflichtung, sich wegen dieses Wagnisses zu entschuldigen, und muß dabei zunächst von sich selbst sprechen.
Wie mein Vater Heinrich Brockhaus, der seit dem Tode seines Vaters, bis 1850 zusammen mit seinem ältern Bruder Friedrich, an der Spitze des Geschäfts steht, und dessen funfzigjährige buchhändlerische Wirksamkeit wir gleichzeitig mit dem hundertjährigen Geburtstage seines Vaters feiern können, und wie mein jüngerer Bruder Heinrich Rudolf, habe ich es mir zur Lebensaufgabe gemacht, die Firma F. A. Brockhaus im Geiste ihres Gründers fortzuführen. Seit über 20 Jahren ihr angehörend, hegte ich von jeher den lebhaften Wunsch, mich mit dem Leben meines Großvaters näher bekannt zu machen und es dann auch Andern zu schildern. Meine hohe Achtung für ihn und sein Wirken als Buchhändler stieg immer mehr, je vertrauter ich mit seinen Schöpfungen wurde. Ich beschäftigte mich eingehend mit dem trotz der Lückenhaftigkeit sehr umfänglichen Material an Briefschaften sowie mit den Verlagsartikeln unserer Firma aus jener Zeit, und es gelang mir auch wenigstens von einigen Seiten wichtige Vervollständigungen jenes Materials zu erlangen. Als diese wichtige Vorarbeit beendigt war, erkannte ich freilich, daß es nur verhältnißmäßig Weniges sein würde, was ich daraus zusammenstellen könnte, doch aber mußte ich mir sagen, daß es zu bedauern wäre, sollte auch dieses Wenige verloren gehen. So ist es mir als Pflicht erschienen, lieber das zu geben, was ich geben konnte, als, vor der Schwierigkeit der Aufgabe zurückschreckend, die bessere Ausführung einer ungewissen Zukunft zu überlassen.
Denn auch die Ueberzeugung mußte ich bald gewinnen, daß ein ferner Stehender oder einer spätern Generation Angehörender noch weniger im Stande sein würde, ein einigermaßen treues Lebensbild meines Großvaters zu entwerfen. Ich habe ihn allerdings nicht mehr persönlich gekannt — er starb sechs Jahre vor meiner Geburt; aber außer meinem Vater theilte mir mein Onkel, Professor Hermann Brockhaus, der mich auch bei meiner Arbeit vielfach durch seinen Rath unterstützt hat, manches Nähere über mir sonst unbekannt gebliebene Verhältnisse mit, und ich konnte dadurch sowie durch mündlichen und schriftlichen Verkehr mit Männern, die ihn noch selbst gekannt hatten, jenen für einen Biographen stets mislichen Mangel einigermaßen ersetzen.
Als bloßen Versuch einer Biographie bitte ich aber meine Schilderung anzusehen und, wenn sie selbst geringe Erwartungen nicht befriedigen sollte, dies wenigstens zum Theil Umständen, die außer mir liegen, zuzuschreiben.
Ich bin nicht berufsmäßiger Schriftsteller, sondern praktischer Geschäftsmann; außer der selbst bei vollständiger Befähigung erforderlichen Uebung fehlte mir aber auch die zu einer bessern Lösung der Aufgabe nöthige Zeit.
Mit an der Spitze eines umfangreichen Geschäfts stehend, konnte ich nur die wenigen Stunden der Muße und die sonst der Erholung bestimmte Zeit zuerst auf die Lektüre der Tausende von Briefen sowie der einschlagenden Literatur, dann auf die Ausarbeitung verwenden. So habe ich auf dem Comptoir und zu Hause, auf dem Redactionsbureau und auf dem Reichstage, namentlich aber auf Erholungsreisen, in Dresden und Thüringen, im Seebade auf der Insel Wight und der Insel Sylt, seit Jahren fast jede freie Stunde, seltener einige Wochen, der Arbeit gewidmet. Eine zusammenhängende längere Zeit ausschließlich für sie zu gewinnen war mir unmöglich.
Meine nächste Absicht war ferner nur die: den Mitgliedern der Familie sowie den Angehörigen und Freunden unserer Firma ein Lebensbild von Friedrich Arnold Brockhaus darzubieten, aus seinen und aus den an ihn gerichteten Briefen das nach meiner Ansicht Wesentliche und Charakteristische mitzutheilen, und nur so viel, als zum bessern Verständniß desselben ganz nothwendig erschien, hinzuzufügen. Erst während der Arbeit gewann ich die Ansicht, daß meine Mittheilungen doch auch für weitere Kreise, zunächst für den deutschen Buchhandel, Interesse haben könnten, und ich entschloß mich deshalb, sie nicht, wie anfänglich beabsichtigt, blos als Manuscript für die Familie und für Freunde drucken zu lassen, sondern sie auch allgemein zugänglich zu machen. Ich hoffe damit zugleich meinerseits eine Anregung zu geben, daß auch andere Buchhandlungen künftig mehr als bisher Mittheilungen aus ihren Geschäftspapieren als Beiträge zu einer leider noch nicht geschriebenen Geschichte des deutschen Buchhandels veröffentlichen. Manche der abgedruckten Briefe und andern Actenstücke sowie die mit möglichster bibliographischer Genauigkeit angefertigten Uebersichten über die Verlagsthätigkeit meines Großvaters dürften wol auch auf ein literarhistorisches Interesse Anspruch machen. Bei letztern hat mir besonders der gleichzeitig mit diesem Buche von meinem Vater herausgegebene chronologische Katalog der von 1806 bis 1872 im Verlage der Firma F. A. Brockhaus erschienenen Werke, mit biographischen und literarischen Notizen, treffliche Dienste geleistet.
Was die bei meiner Arbeit befolgte Methode betrifft, so habe ich es mir zur Pflicht gemacht, die Auszüge aus Briefen und andern Aufzeichnungen meist mit den Worten der Verfasser wiederzugeben, nicht in Bearbeitung. Dieser wichtigste Bestandtheil der Arbeit ist von meinen mehr als verbindendes Glied dienenden Bemerkungen auch äußerlich durch den Druck unterschieden. Ich weiß, daß von Vielen die entgegengesetzte Art, die Verarbeitung von Briefen und sonstigen Actenstücken zu einer selbständigen neuen Schöpfung des Biographen, vorgezogen wird. »Friedrich Perthes' Leben« von dessen Sohne Clemens Theodor Perthes ist das mustergültige Beispiel einer in dieser Weise ausgeführten Biographie. Allein abgesehen davon, daß eine solche Behandlung einen Meister der Biographie verlangt, als welcher sich der Verfasser jenes Werks bewährt und dasselbe zu einer Zierde unserer Literatur gemacht hat, gestattete mir schon die Beschaffenheit meines Materials ein ähnliches Verfahren nicht. Aus manchen Lebensperioden meines Großvaters, zum Theil den wichtigsten, war so gut wie nichts vorhanden, über seine Jugend und sein erstes Mannesalter wesentlich nur ein von ihm selbst verfaßter Rückblick, während aus andern Jahren wieder zahlreichere Mittheilungen vorlagen. So blieb mir nach reiflicher Prüfung nichts Anderes übrig, als das Wenige, was ich fand, möglichst vollständig und wortgetreu zu veröffentlichen. Daraus erklärt und entschuldigt sich auch die größere Ausführlichkeit mancher minder wichtiger, die verhältnismäßige Kürze anderer wichtigerer Abschnitte.
Da ich den Namen Friedrich Perthes genannt habe, kann ich es mir nicht versagen, darauf hinzuweisen, daß der hundertjährige Geburtstag beider Männer beinahe zusammenfällt und daß ich diese Zeilen zum Gedächtniß von Friedrich Arnold Brockhaus gerade an dem hundertjährigen Geburtstage von Friedrich Perthes niederschreibe. Perthes und Brockhaus gehören unzertrennlich zueinander als zwei Männer, auf die der deutsche Buchhandel gleichmäßig stolz sein kann. Wie in ihrer Geburt, so berührten sie sich auch vielfach in ihrem Leben und Wirken als Buchhändler und als deutsche Patrioten; wie sie persönlich nahe befreundet waren, werden auch nach dem Tode ihre Namen zusammen fortleben.
Daß ich in dem von mir Geschilderten nicht allein den Gründer unserer Firma, sondern auch meinen Großvater verehre, hat mich nicht abgehalten, die erste Pflicht jedes gewissenhaften Biographen: immer die Wahrheit und zwar die volle Wahrheit zu sagen, auszuüben und obenan zu stellen. Ich habe dies auch in solchen Fällen gethan, wo die Erfüllung dieser Pflicht mir nicht leicht wurde, und alle entgegenstehenden Bedenken fallen lassen. Auch Privatverhältnisse glaubte ich nicht übergehen oder mich auf bloße Andeutungen darüber beschränken zu dürfen, wenn ihre Vorführung zur Schilderung des äußern Lebens oder zur Charakterisirung wesentlich erschien.
Auch einen andern Fehler, in den häufig Biographen verfallen, bin ich bestrebt gewesen zu vermeiden: den von mir oft empfundenen Uebelstand, daß der Geschilderte lediglich verherrlicht und als Mittelpunkt der ganzen Zeit, in der er gelebt und gewirkt, hingestellt wird.
Nur die Hälfte meiner Arbeit lege ich gegenwärtig vor und habe sie als ersten Theil bezeichnet, da sich während der Abfassung und nach schon begonnenem Drucke bald die Unthunlichkeit herausstellte, das Ganze in einem Bande und zu dem gebotenen Termine zu vollenden.
Dieser erste Theil schildert das Leben von Friedrich Arnold Brockhaus bis zu seiner Uebersiedelung nach Leipzig und zwar zunächst die Jugend und sein erstes Wirken in Dortmund, dann die Zeit in Amsterdam, darauf die Zwischenperiode vor seiner Niederlassung in Altenburg, endlich die in Altenburg verlebten Jahre. Das beigegebene Bildniß ist nach einem von dem Maler Vogel von Vogelstein in Dresden gezeichneten Porträt gestochen, das als sehr getroffen gilt.
Der zweite Theil ist dem leider nur sehr kurzen Wirken des Verewigten in Leipzig gewidmet und soll außer seiner dort entwickelten lebhaften Verlagsthätigkeit auch die zahlreichen literarischen Streitigkeiten schildern, in die er damals verwickelt wurde, seine Kämpfe gegen den Nachdruck und für eine gesetzliche Regelung der deutschen Preßgesetzgebung, die durch eine Recensur seines Verlags in Preußen entstandenen Schwierigkeiten, endlich die letzte Lebenszeit.
Diesen zweiten Theil hoffe ich dem ersten bald folgen lassen und damit das Werk vollständig vorlegen zu können.
Zum Schluß fühle ich noch die Verpflichtung, allen Denen zu danken, die mich durch Ueberlassung von Briefen, durch Ertheilung von Auskünften oder in anderer Weise bei meiner Arbeit unterstützt haben. Ihre Zahl ist so groß, daß ich darauf verzichten muß, ihnen hier einzeln meinen Dank auszusprechen.
Freilich kann ich aber auch nicht umhin, zugleich der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß mir aus Anlaß der Veröffentlichung dieses ersten Theils noch manche werthvolle Beiträge zur Ausfüllung der vorhandenen Lücken zufließen werden. Diese Ergänzungen sowie jede Berichtigung meiner Darstellung werde ich auf das gewissenhafteste und dankbarste benutzen.
Ich empfehle meine Arbeit dem Wohlwollen und der Nachsicht meiner Leser.
Leipzig, 21. April 1872.
Dr. Heinrich Eduard Brockhaus.
Inhalt des ersten Theils.
Erster Abschnitt. Anfänge.
1. Vorfahren.
Die Familie, welcher Friedrich Arnold Brockhaus entstammt, gehört Westfalen an, wo sie sich durch zwei Jahrhunderte verfolgen läßt; sie ist dort noch jetzt in mehrern Zweigen vertreten, während er selbst und die von ihm gegründete Firma sich in Leipzig niedergelassen haben.
Die Vorfahren von Friedrich Arnold Brockhaus waren fast sämmtlich geistlichen Standes, und unter ihnen befindet sich eine Reihe verdienter evangelischer Pastoren; auch viele Glieder der in ihrem Vaterlande gebliebenen Zweige der Familie haben sich diesem Berufe wieder gewidmet.
Der Erste des Namens Brockhaus, von dessen Leben etwas bekannt ist, war Adolf Heinrich Brockhaus, Pastor zu St.-Thomä in Soest, geboren in Altena (einer kleinen Stadt im westfälischen Sauerlande, nahe bei Lüdenscheid), 1699 ordinirt und 25 Jahre lang, bis 1724, in seinem Amte wirkend. Im Kirchenbuche wird gesagt, daß er ein sehr tüchtiger, fleißiger, ehrsamer, von Allen geliebter Pastor war und an seiner Beerdigung die ganze Gemeinde theilnahm. Er war verheirathet mit Margarethe Katharine Sybel, einer alten Predigerfamilie in Soest angehörend, mit welcher die Familie Brockhaus noch mehrfach in Verwandtschaftsverhältnisse trat.
Aus früherer Zeit ist über die Familie nichts Sicheres zu erfahren, da die ältern Kirchenbücher von Altena nicht mehr vorhanden sind. Wir wissen deshalb auch nicht, ob die Familie schon länger in Altena lebte oder von anderswoher dahin gekommen war. In Altena wird zwar noch ein Vorfahr, Eberhardt Brockhaus aus Unna, seit 1665 als Vicar (zweiter Prediger) genannt[1]; aber auch über ihn und seine Verwandtschaft mit dem Pastor Adolf Heinrich ist nichts bekannt. Nach Familientraditionen sollen die Vorfahren schon seit den Anfängen der Reformation lutherische Prediger in Westfalen gewesen sein.
Mit dem bekannten holländischen Philologen und Dichter Brockhusius (eigentlich Jan van Broekhuizen, gewöhnlich Janus Broukhusius genannt), geb. 20. November 1649 zu Amsterdam, gest. 15. December 1707, scheint die westfälische Familie Brockhaus in keinem Zusammenhang zu stehen. Die vielfach verbreitete Annahme, daß dies der Fall sei, beruht außer auf der Aehnlichkeit beider Namen wahrscheinlich nur darauf, daß Friedrich Arnold Brockhaus eine Zeit lang in Amsterdam gelebt hat.
Mit dem Geschlechte der Erp oder Erpp von Brockhauß (auch Brockhuß und Brockhausen geschrieben) läßt sich ebensowenig eine Verwandtschaft nachweisen, obwol sie wahrscheinlich ist, da diese Familie gleichfalls aus Westfalen zu stammen scheint. Der Bekannteste aus derselben ist Simon Anton Erp von Brockhauß oder Brockhausen, geb. 14. Mai 1611 zu Lemgo, 1647 Professor der Rechte am Gymnasium zu Bremen, 1650 Rathsherr, 1665 Gesandter auf dem Reichstage zu Regensburg, später Bürgermeister von Bremen, gest. 18. November 1682.[2] Auf dem Titel seiner 1640 in Helmstedt gedruckten Doctordissertation: »De litis contestatione«, ist er ausdrücklich als Westfale bezeichnet. Nach mehrern auf der Bibliothek zu Bremen aufbewahrten Fliegenden Blättern hieß sein Vater Johann Erp von Brockhauß und war »Utriusque juris Doctor, der fürstlichen Aebtissin zu Hervord, Gräflich Bentheim-Tecklenburg'scher und Lippe'scher Geheimrath und Hofgerichtsassessor«, sein Großvater Tilemann Erp von Brockhauß war »Hochgräflich Hoy'scher und Lippe'scher Geheimrath und Drost zu Hoya, Ucht und Freudenberg«. Jahreszahlen sind bei Beiden nicht angegeben. Simon Anton hinterließ keine Söhne, nur zwei Töchter, sodaß mit ihm der Mannesstamm erlosch. Dagegen ist auf einer juristischen Dissertation aus Helmstedt: »De nuptiis«, 1654 gedruckt, als Verfasser Anton Christian Erp Brockhuß genannt, mit dem Zusatz Old. (aus Oldenburg), jedenfalls der Abkömmling eines andern oldenburger Zweigs der Familie.
In keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu der westfälischen Familie Brockhaus scheint das pommersche Geschlecht Brockhausen zu stehen, das in alten Urkunden Brockhuß, später aber auch Bruckhausen und Brockhusen geschrieben wird. Der erste 1511 urkundlich Genannte dieses Geschlechts ist Jürgen Brockhuß zu Groß-Justin im Kreise Cammin. Ein Nachkomme desselben war der preußische Staatsminister Karl Friedrich Christian Georg von Brockhausen (gest. 1829).
Ein Sohn des zuersterwähnten Pastors zu St.-Thomä in Soest, ebenfalls mit Namen Adolf Heinrich Brockhaus, wurde 1740 von einer andern Gemeinde der Stadt Soest, der zu St.-Walpurgis, zum Pastor gewählt. Seine Tochter Josina verheirathete sich mit einem Pastor Sybel in Soest; ihr Enkel ist der Geschichtschreiber Heinrich von Sybel in Bonn.
Ein anderer, wahrscheinlich älterer Sohn des Pastors zu St.-Thomä, Johann Diederich Melchior Brockhaus, geb. 1. Februar 1706, wurde mit 23 Jahren, am 1. December 1728, zum Pastor in Meyerich bei Kirch-Welver erwählt (beide Orte liegen zwischen Soest und Hamm, das Dorf Meyerich westlich, die Kirche zu Welver östlich, von schönem Eichenwald umgeben; in Meyerich befindet sich das Pfarrhaus, während die Kirche der Gemeinde in Welver steht). Er starb 70 Jahre alt, am 16. November 1775, nachdem er sein Amt 47 Jahre lang bekleidet hatte.
Johann Diederich Melchior Brockhaus hat in dem Kirchenbuche von Welver außer den kirchlichen Notizen hier und da besondere Ereignisse aus seiner amtlichen Thätigkeit verzeichnet, die ihn selbst trefflich charakterisiren und zugleich als interessante Beiträge zur Zeit- und Sittengeschichte aufbewahrt zu werden verdienen.
Die erste und ausführlichste Mittheilung, durch die Ueberschrift »In memoriam successorum« als ein Fingerzeig für seine Amtsnachfolger bezeichnet, betrifft einen Conflict des eifrig protestantisch gesinnten Pastors mit einem katholischen Kloster. Dieses, ein Nonnenkloster, befand sich ganz in der Nähe der Kirche zu Welver, und seine Nachbarschaft scheint dem würdigen Pastor Melchior viel Sorge und Kampf bereitet zu haben.
Ueber die kirchlichen Verhältnisse daselbst sagt ein competenter Geschichtschreiber[3]:
Die Reformation ward in Welver definitiv im Jahre 1565 eingeführt. Freilich werden schon vorher evangelische Prediger genannt; allein die Gemeinde war erst seit dem genannten Jahre dem evangelischen Bekenntniß entschieden zugethan. Nur das in Welver befindliche freiadeliche Cistercienserinnenkloster, welches über die Pfarrei das Collationsrecht hatte, blieb katholisch. Der evangelischen Gemeinde erwuchsen hieraus oft die schwersten Bedrängnisse. Namentlich hatte dieselbe zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs zu leiden, indem ihr durch Militärgewalt die Kirche entzogen und in derselben der katholische Gottesdienst restaurirt wurde. Doch bald nach dem Friedensschluß wurde am 19. December 1649 auf Befehl des Kurfürsten Friedrich Wilhelm durch den Drosten von Neuhoff zu Altena und den Richter Dr. Zahn zu Unna unter Hinzuziehung des Magistrats von Soest den Evangelischen die Pfarrkirche wieder überwiesen.
Späterhin machte das Kloster wiederholt den Versuch, durch seinen Beichtiger in der Gemeinde Parochialhandlungen verrichten zu lassen. Ein hierdurch veranlaßter heftiger Rechtsstreit wurde endlich durch ein Decret vom 1. September 1709 dahin entschieden, daß dem Kloster nur das Recht, innerhalb seiner Ringmauern (aber nicht außerhalb derselben) Ministerialhandlungen verrichten zu lassen, zuerkannt wurde.
Aus Anlaß dieser Verhältnisse entstanden natürlich häufige Reibungen zwischen dem evangelischen Pastor und der Aebtissin des katholischen Klosters. Die erwähnte eigenhändige Mittheilung des Pastors Melchior lautet:
Nachdem der zeitige evangelisch-lutherische Prediger zu Welver, Johann Diederich Melchior Brockhaus, vernommen, daß die Nonnen zu Welver bei ihrer abgöttischen Procession ihre Knechte pflegten zu gebrauchen, daß sie den sogenannten Himmel (worunter das abominabile[4] getragen wird) und die Fahnen (die vorhergetragen werden) müssen tragen, und anno 1732 vier lutherische Knechte aus hiesiger Gemeinde im Kloster wohnen, so habe ich als ihr Seelsorger dieselben Knechte zu vier verschiedenen Malen gewarnt, sich dieser Abgötterung nicht theilhaftig zu machen, auch bedroht, daß ich sie im Contraventionsfalle ohne vorhergehende Kirchenbuße nicht zum heiligen Nachtmahl administriren würde, nämlich 1) privatim, 2) im Beichtstuhl, 3) ordentlich auf der Kanzel Dom. VI. p. pascha und 4) am heiligen Pfingsttage nach der Nachmittagspredigt auf der Kanzel. Demungeachtet aber hat die damalige unruhige abdissin Biscopime zwei von diesen Knechten durch 4 Butten Bier dazu persuadirt oder gezwungen (wie so hernach coram protocollo ecclesiastico gestanden), daß Einer die Fahne, die Anderen den blauen Himmel tragen sollten und sind vor der monstrance in die Knie gefallen. Wie ich nun am folgenden Sonntage die Bosheit dieser Knechte öffentlich bestrafte und sie 2 mal ins Kirchengebet geschlossen, schickte die verwegene abdissin 3 Kerls zu mir ins Haus und ließ mich fragen, warum ich gegen ihre Knechte so scharf gepredigt. Darauf ich aber die Antwort gab, sie sollten den Nonnen wiedersagen, sie haben sich um mein Amt gar nicht zu kümmern und wäre ich allein verbunden Gott und unserm Könige Rechenschaft davon zu geben. Darauf fragte ich die 3 Kerls, wie sie daran kämen, daß sie mich in meinem Hause zur Rede stellten, nahm den Besen und jagte sie zum Hause heraus.
Wie nun nach einiger Zeit die Knechte zum heiligen Abendmahl gingen, mußten sie sich erst ordentlich durch die Kirchenbuße mit der Gemeinde aussöhnen.
Darauf wurde nun diese Sache in Cleve anhängig gemacht, da denn sowohl an den Großrichter, als an den Magistrath ein rescript kam, die Sache genau zu untersuchen und die interessirten persohnen eidlich abzuhören, damit die abdissine sich nicht zu beschweren habe.
Wie nun kurz darauf diese unruhige abdissine wegging und ich bei Installation der neuen abdissine ins Kloster zu Meßen genöthigt wurde, begehrte der Praelate von Campen nebst den Nonnen von mir, daß ich mich doch bemühen möchte, die Sache gütlich abzuthun. Die vorige abdissine sei eine unruhige Persona gewesen, sie wollten dergleichen nicht wieder anfangen. Darauf antwortete ich ihnen, wenn sie mir die Kosten wollten wiedergeben, die an diesen process gelegt, und daß sie es nicht wiederthun wollten, könnte die Sache liegenbleiben. Kurz darauf haben sie mir 10 Reichsthaler rechtlich ausbezahlt.
Nach einer Küsterwahl, die nicht nach seinem Willen erfolgte, schreibt Pastor Melchior ins Kirchenbuch:
Wenn nun dieser junge Mensch seinem Amte keine Genüge thun sollte und sonderlich die Jungens in der information versäumen, so fordere ich, daß die Verwahrlos'ten von meinen Händen nicht gefordert werden. Dem allwissenden Gott, wie auch meiner ganzen Gemeinde ist bekannt, daß ich auf ein tüchtiges subjectum sehe, nämlich auf den Schulmeister in Catrop. Ich habe aber der Gewalt weichen müssen. Was nun verwahrlos't und versäumt wird, das kommt auf die Menschen, welche diesem jungen Menschen dazu behülflich gewesen.
Bei einer andern Küsterwahl trägt der Pastor mit Stolz ins Kirchenbuch ein, daß er das katholische Kloster durch ein drastisches Mittel, wie er sie überhaupt geliebt zu haben scheint, verhinderte, an derselben theilzunehmen:
Das Kloster schickte (wie das wohl geschehen sollte) den Vogt in die evangelische Kirche, daß er im Namen des Klosters votiren sollte. Ich fragte ihn, was er wollte? Nichts. Darauf nahm ich den Chorstock[5] und trieb ihn vor mir her zum großen Gelächter der ganzen Gemeinde aus der Kirche und ließ die Kirche zuschließen.
Ist also dieser Küster ohne consens und collation des Klosters erwählt, es ist auch bei der Wahl Niemand vom Rathhause zugegen gewesen; auch über 1½ Jahr von mir allein in Gegenwart des Lehnherrn auf dem Chor eingeführt und ist kein Vogt dabei gewesen.
Endlich hat der Pastor Melchior auch einen geheimnißvollen Vorfall verzeichnet, ohne hinzuzufügen, was er selbst davon halte:
1757, den 7. October, hat sich des Abends um 7 Uhr Folgendes in unserer Kirche zugetragen.
Wie die Fräuleins des Klosters Welver um bemerkte Zeit in ihre Kirche gehen wollten, sehen sie, daß es in unserer Kirche helle ist.
Wie sie nun vermuthen, es möchten Diebe in der Kirche sein, müssen nicht nur alle Bediente des Klosters, sondern auch die Leute, so zu Welver am Kirchhofe wohnen, unsere Kirche besetzen. Die auch sämmtlich das Licht in unsrer Kirche gesehen.
Wie nun der Küster gezwungen wird, die Kirche zu öffnen, ist das Licht auf einmal verschwunden. Die Leute sind durch die ganze Kirche gegangen, ob etwas darin wäre, haben aber nichts verspürt. Ob nun dieses eine Vorgeschichte ist, ob und wann es soll erfüllt werden, wird die Zeit lehren; Gott wende Alles zum Besten.
Einige nähere Lebensumstände dieses Mannes, des Großvaters von Friedrich Arnold Brockhaus und jedenfalls des hervorragendsten unter dessen Vorfahren, sind durch ein altes Buch erhalten, in das er außer seinen Ausgaben (aus deren Verzeichnung hervorgeht, daß er auch ein tüchtiger Oekonom und guter Haushalter war) dann und wann Nachrichten über seine Erlebnisse einschrieb.[6]
Pastor Melchior verzeichnet darin zunächst den Tag seiner Geburt und Taufe und macht bei Nennung eines seiner Pathen, einer adelichen Dame, die Bemerkung: »welche aber nach der Zeit zum pabtum abgefallen und ihren eigenen Taufbund gebrochen«. Dann fährt er fort:
Gott gebe, daß mein nahme im Himmel unter der Zahl der außerwehlten auch möge angeschrieben stehen. Habe Dank, Du frommer Gott, daß Du mich wunderbarlich im mutterleibe gebildet, mit einer vernünftigen Seele und gesunden Gliedmaßen von frommen Eltern hast lassen gebohren werden und sonderlich in der heiligen Taufe einen ewigen Bund mit mir gemacht. Gib gnade, mein Gott, daß ich in diesem Bunde leben, leyden und sterben möge.
Darauf erwähnt er seiner Studienzeit. Er ging im Februar 1724 (also 18 Jahre alt) nach Halle, aber schon am 6. Juli dieses Jahres nach Jena: »weil mir die collegia theologica in Halle nicht anstehen wollten«; von da reiste er am 2. August 1726 nach Leipzig und kam am 20. August 1727 über Frankfurt a. M., Köln und Altena (wo er einmal predigte, wahrscheinlich weil diese Stadt der Geburtsort seines inzwischen als Pastor in Soest verstorbenen Vaters war und dort noch Verwandte von ihm lebten) nach Hause zurück. Er machte sein Examen und predigte mehrmals, bezog indeß im Sommer 1728 nochmals die Universität Halle »wegen des königlichen Befehls, daß niemand sollte befördert werden, der nicht zuletzt in Halle studirt«. Am 28. August 1728 wieder in Soest angelangt, wurde er am 1. December zum Prediger nach Meyerich berufen, am 8. examinirt, am 9. ordinirt und am 12. December installirt.
Ueber seine Studienzeit schreibt er folgende Selbstanklage nieder, die indeß gleich der folgenden wol nicht ganz wörtlich zu nehmen ist:
Wie ich nun mein Universitätsleben zugebracht, ist dem allwissenden Gott am besten bekannt. Viel gutes habe ich daselbst gelernt, aber auch durch Müßiggang, Verschwendung und auf andere Gott allein bewußte Weise mich schwerlich versündiget.
Dann fährt er fort, nach Erwähnung seiner Anstellung:
Ob es mir nun gleich an genugsamer geschicklichkeit fehlet, ich auch leyder sonderlich im Anfang meines ambtes Vieles versehen und also Blutschulden auf meine arme Seele geladen (!), so verspreche ich doch inskünftige zu verbessern, was ich bißanhero versehen habe, und glaube festiglich, daß mein getreuer Erlöser Jesus Christus mit seinem theuern Blut meine Blutschulden tilgen werde.
Die übrigen Notizen des Tagebuchs beziehen sich meist auf Ereignisse in seiner Familie. Er war dreimal verheirathet und hatte funfzehn Kinder (sechs Söhne und neun Töchter), von denen neun noch vor ihm starben, meist in sehr zartem Alter. Seine erste Frau starb im ersten Wochenbett und zwar, wie er bemerkt: »an eben dem Tage und in eben der Stunde, darinnen wir vorm Jahre waren copuliret; so war sie auch an eben demselben Tage vor 25 Jahren gebohren«; er fügt hinzu: »Gott gebe allen frommen Christen eine solche dreifach glückselige Stunde!« Mit seiner zweiten Frau, Maria Elisabeth, Tochter des Pastors Hennecke in Soest, war er fast zwanzig Jahre verheirathet und sie wurde die Mutter von zehn Kindern, darunter die beiden Söhne, die seinen Namen fortpflanzten. Zum dritten male verheirathete er sich in seinem funfzigsten Jahre mit Klara Dorothea Quante und lebte mit ihr ebenfalls fast zwanzig Jahre, bis an seinen Tod (1775), während seine Witwe, die ihm vier Kinder geboren hatte, erst 1808, 83 Jahre alt, starb.
Noch einige Aeußerungen des Pastors Melchior in seinem Tagebuche seien zu seiner Charakterisirung hier verzeichnet.
Beim Verlust eines dreijährigen Töchterchens schreibt er:
Mein halbes Herz ist mit ihr in die Erde gescharrt. Gott gebe, daß wir in kurzer Zeit im Himmel uns mögen wiedersehen.
Und bei einem ähnlichen Verluste:
Der Herr bescheere mir ein baldiges freudiges Wiedersehen dieses und meiner übrigen in der Herrlichkeit triumphirenden Kinder, nach seinem gnädigen Willen. Dulce meum terra tegit. Ich habe hier wenig guter Tag u. s. w.
Kaum 30 Jahre alt, wurde er von heftigen Leiden am Fuße heimgesucht; diese verloren sich nach einigen Jahren und er erreichte dann das Alter von 70 Jahren. Während seiner Leiden schreibt er einmal:
Doch ich will schweigen und meinen Mund nicht aufthun, der Herr wirds wohl machen! Ich werde doch gewiß endlich, wo nicht in dieser Zeit doch gewiß in der ewigkeit zu Gottes größe sagen: der Herr hat alles wohl gemacht!
Und nach seiner Genesung schreibt er:
Gelobet sei der Herr täglich, Er leget uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.
Der unmittelbare Amtsnachfolger dieses ersten Pastors in Meyerich war sein zweiter Sohn Ludolph Wolrath (oder Wohlrath) Arnold Brockhaus, geb. am 6. September 1744, eine Zeit lang Lehrer am Gymnasium zu Soest, zum Pastor in Meyerich erwählt am 26. December 1775, also kaum sechs Wochen nach dem Tode seines Vaters. Er trat sein Amt 1776 am Sonntage Sexagesimä (11. Februar) an und bekleidete es 46 Jahre lang, bis 1822, wo er es, 78 Jahre alt, wegen Altersschwäche niederlegte; er starb am 6. Februar 1823.
Diese beiden Pastoren, Vater und Sohn, haben also zusammen fast ein volles Jahrhundert (93 Jahre lang) derselben Gemeinde vorgestanden. Sie sind auch Beide in der kleinen Kirche zu Welver beerdigt, wo ihre Grabstätten durch Leichensteine bezeichnet sind. Zu ihrem Gedächtniß hat Heinrich Brockhaus (der zweite Sohn von Friedrich Arnold) im Jahre 1869 der Kirche zu Welver ein von Professor Andreae in Dresden gemaltes Altarbild geschenkt.
Der zweite Pastor zu Meyerich, Ludolph Wolrath Arnold Brockhaus, hatte zwei Söhne, die sich beide gleichfalls dem geistlichen Berufe widmeten und zwar nicht in Meyerich, aber in andern westfälischen Gemeinden angestellt wurden: Ludolph Brockhaus, geb. am 28. September 1778, Pastor in Lüdenscheid, und Theodor Brockhaus, geb. am 18. Mai 1780, Pastor in Kierspe; Söhne und Enkel von ihnen wirken noch jetzt als Pastoren in westfälischen Gemeinden.
Ein zweiter Sohn des ersten Pastors zu Meyerich, der ältere Bruder des zweiten Pastors (die übrigen vier Söhne waren noch als Kinder gestorben) wurde der Stammvater des nicht-theologischen, kaufmännischen und buchhändlerischen Zweigs der Familie Brockhaus. Es war dies der Vater von Friedrich Arnold Brockhaus, Johann Adolf Heinrich (oder Henrich) Brockhaus, geb. zu Meyerich am 21. Mai 1739. Derselbe erlernte die Handlung in Hamm und zog dann nach der damals Freien Reichsstadt Dortmund, wo er 1767 Katharina Elisabeth Davidis (geb. am 22. März 1736), Witwe des Dr. med. Kirchhoff, heirathete und ein Materialwaarengeschäft begründete. Er war Mitglied des Raths und überhaupt in seiner Vaterstadt angesehen, wo er am 26. März 1811 starb.
Johann Adolf Heinrich Brockhaus hatte zwei Söhne, die er für seinen Beruf, den kaufmännischen, bestimmte.
Der ältere, Gottlieb Brockhaus, geb. am 4. September 1768, übernahm das väterliche Geschäft und blieb bis an sein Lebensende (30. Mai 1828) in Dortmund.
Der jüngere Sohn war Friedrich Arnold Brockhaus, dessen Leben und Wirken die nachfolgenden Blätter gewidmet sind.
2. Jugendzeit und erstes Mannesalter.
Friedrich Arnold Brockhaus wurde zu Dortmund am 4. Mai 1772 geboren. Nach dem Kirchenbuche der evangelischen Sanct-Reinoldi-Kirche daselbst (bei welcher sein Vater das Amt eines Diakonen bekleidete) erhielt er in der am 8. Mai im Hause des Predigers Mellmann vollzogenen Taufe die Namen David Arnold Friederich, doch scheint er den erstern Vornamen nie geführt zu haben und die beiden andern gebrauchte er in umgekehrter Reihenfolge; sein Rufname war Arnold. Taufzeugen waren: David Friedrich Davidis, Subdelegatus und Pastor zu Wennigern (wahrscheinlich der Bruder seiner Mutter), Ludolph Wolrath Arnold Brockhaus, Lector an dem Gymnasium zu Soest (der spätere Pastor zu Meyerich, ein jüngerer Bruder seines Vaters) und Jungfrau Maria Elisabeth Davidis (vermuthlich eine Schwester seiner Mutter).
Seine Jugendzeit verlebte er in Dortmund. Für den Kaufmannsstand, zu dem ihn sein Vater bestimmt hatte, zeigte er anfangs keine besondere Neigung, dagegen von frühester Jugend an das lebhafteste Interesse für die Literatur. Sein Vater suchte diese Neigung auf alle Art zu unterdrücken und stellte ihn deshalb, während er ihn das dortige Gymnasium besuchen ließ, in den Freistunden in seinem Verkaufsladen mit an. Mit 16 Jahren, 1788, gab er ihn nach Düsseldorf in die Lehre zu einem Kaufmanne Namens Friedrich Hoffmann, bei dem er die »Handlung« erlernen sollte. Dieser Aufenthalt dauerte fünf bis sechs Jahre und wurde von dem jungen Manne gut benutzt, sodaß ihn sein Principal trotz seiner Jugend bald zu größern Handlungsreisen verwendete und ihm nach und nach die wichtigsten Arbeiten übertrug. Derselbe scheint selbst die Absicht gehabt zu haben, ihn zu seinem Compagnon zu machen, und mit seiner Nichte, Maria Siebel, zu verheirathen; doch kam es zu einem Zerwürfniß zwischen Principal und Gehülfen, und Brockhaus verließ infolge dessen seine Stellung in Düsseldorf.
Mit 21 Jahren, 1793, ins älterliche Haus nach Dortmund zurückgekehrt, wo inzwischen (am 15. August 1789) seine von ihm stets hochverehrte Mutter gestorben war, wurde er vom Vater wieder in dessen Materialwaarenhandlung beschäftigt, fand aber an dem Verkehr mit den nach der Stadt kommenden Bauern, dem Abwiegen von Kaffee und Zucker begreiflicherweise jetzt noch weniger Gefallen als früher. Er hatte auf seinen Geschäftsreisen weitere Gesichtspunkte erhalten, die ihm die kleinbürgerlichen Verhältnisse seiner Vaterstadt und das Detailgeschäft seines Vaters verleideten; er fühlte, daß ihm für seinen künftigen Beruf als Kaufmann — denn mit diesem schien er sich jetzt doch ausgesöhnt zu haben — noch Vieles fehle, was er in Dortmund nicht erlernen könne, und bat deshalb den Vater, ihn in die Fremde ziehen zu lassen. Und welchen Ort wählte er aus? Keinen andern als den Schauplatz seiner spätern Hauptwirksamkeit als Buchhändler: Leipzig. Freilich dachte er dabei wol nicht an den Mittelpunkt des deutschen Buchhandels, sondern an die Handelsstadt, an die berühmten leipziger Messen, die auch von den dortmunder Kaufleuten regelmäßig besucht wurden. Aber gewiß hatte Leipzig als Buchhändlerstadt für ihn noch einen besondern Zauber, und daß dort zugleich eine Universität war, fiel auch mit in die Wagschale. Ja nach seinen eigenen Aeußerungen scheint es, daß er geradezu die Absicht hatte, auf der dortigen Universität zu studiren. Der Vater gab den Bitten des Sohnes nach. Vielleicht hatte er auch noch einen besondern Grund, den Sohn für einige Zeit aus Dortmund zu entfernen: ein Liebesverhältniß des Sohnes, das fast ein tragisches Ende genommen hätte.
Als der einundzwanzigjährige Jüngling aus der düsseldorfer Lehre zurückkehrte, traf er im älterlichen Hause eine Cousine aus dem benachbarten Soest, die Tochter der an einen dortigen Kaufmann verheiratheten Schwester seines Vaters, von dem Onkel zum längern Besuch eingeladen. Die beiden jungen Leute fanden aneinander Gefallen und besonders schien der junge Mann, der unter seinen Altersgenossen durch lebhaften Geist, höhere Bildung und Interesse an Kunst und Literatur hervorragte und viel von Düsseldorf und seinen Reisen zu erzählen wußte, einen tiefen Eindruck auf das Gemüth des in den einfachsten Verhältnissen aufgewachsenen Mädchens zu machen. Nach ihren eigenen Erzählungen in spätern Lebensjahren sprudelte er damals von Frohsinn und Lebensmuth über und hatte stets ein französisches Chanson auf der Zunge. Sein Vater war natürlich der Ansicht, daß der Sohn noch nicht ans Heirathen denken dürfe, und schritt energisch ein. Das Mädchen nahm sich die Sache sehr zu Herzen: sie stürzte sich aus Verzweiflung in den offenen Brunnen auf dem dortmunder Markte! Glücklich gerettet und zu ihren Aeltern nach Soest gebracht, zog sie sich bald tiefsinnig in ein dortiges Frauenstift zurück; später, nach Auflösung der Klöster und Stifter unter Napoleon's Herrschaft, trat sie indeß ins bürgerliche Leben zurück und heirathete 1809 (also erst in reiferm Alter, 16 Jahre nach dem Liebesverhältniß mit dem jungen Vetter) einen Kaufmann in Soest, wo sie 1843 starb. In ihrem Alter weilte sie immer gern bei der Erinnerung an jene Zeit und erkundigte sich mit Interesse nach allen Verhältnissen ihres verstorbenen Vetters. Wie auf diesen die vom Vater getroffene Entscheidung, die Verzweiflungsthat des Mädchens und ihr Schicksal eingewirkt, ist uns nicht bekannt. In spätern Jahren erkundigte auch er sich oft nach seiner Cousine, ohne sie indeß je wiederzusehen.
Im Sommer 1793 ging Brockhaus nach Leipzig und blieb dort fast anderthalb Jahre, bis Ende 1794. Mit regem Eifer widmete er sich seiner weitern Ausbildung: der Vervollkommnung in den neuern Sprachen sowie dem Studium der allgemeinen Wissenschaften, obwol er unsers Wissens weder in einem kaufmännischen Geschäft angestellt war, noch sich unter die Studirenden aufnehmen lassen konnte. Von Professoren der Universität, deren Vorlesungen er gehört, nennt er den Philosophen Ernst Platner, den Mathematiker und Physiker Hindenburg und den Chemiker Eschenbach. Auch an dem literarischen und buchhändlerischen Leben Leipzigs nahm er das lebhafteste Interesse. Sehr oft besuchte er unter anderm die Köhler'sche Buchhandlung, mit deren Besitzer er durch die mit diesem nahe befreundete dortmunder Familie Varnhagen in Berührung gekommen war, fleißig die neu erschienenen Bücher durchmusternd.
Nur ein einziger Brief von ihm ist aus dieser Zeit erhalten, der aber ein um so merkwürdigeres Actenstück bildet. Es ist dies ein förmlicher Verlagsantrag des noch nicht ganz 22 Jahre zählenden jungen Kaufmanns und Studenten an eine angesehene leipziger Verlagshandlung. Und daß dieser Verlagsantrag kein bloßes Project war, auch keine Gedichtsammlung oder kein Drama, wie sie mancher junge Mann dem Buchhändler als Erstlingswerk anbietet, sondern ein größeres ernstes Werk betraf, geht daraus hervor, daß er dem Briefe einen vollständigen »Plan« des auf 20 Druckbogen berechneten Buchs in Form eines »Prospectus« und sogar einen Theil des fertigen Manuscripts hinzufügt!
Der Brief lautet wörtlich folgendermaßen:
An die Herren Voß und Comp.
Meine Herren!
Aus dem auf der andern Seite folgenden Prospectus werden Sie den Plan und aus den beifolgenden acht Bogen Manuscript die Behandlung eines Buchs sehen, das ich diese Ostermesse — etwa 20 Bogen in 8. stark — herausgeben möchte.
Ich biete es Ihnen zum Verlag an; muß Sie aber ersuchen, mir bis morgen Ihre Entscheidung darüber zukommen zu lassen; — sollten Sie mündlich mit mir darüber sprechen wollen, so wird mir Ihr Besuch morgen früh in der Zeit von 10-12 Uhr sehr angenehm sein.
Die hier erwähnte »andere Seite« dieses Briefs mit dem »Plan« des Werks findet sich leider in dem Archiv der noch jetzt bestehenden Buchhandlung (die den Brief erst vor einigen Jahren auffand und der Firma F. A. Brockhaus freundlich überließ) ebenso wenig, als die acht Bogen des vermuthlich »Manuscript« gebliebenen Manuscripts vorhanden sind; wir würden daraus wenigstens ersehen haben, auf welche Gegenstände die Studien des jungen Autors in Leipzig vorzugsweise gerichtet waren. Vermuthlich ist ihm von Herrn Voß Beides zurückgegeben worden, und wahrscheinlich im Comptoir der Buchhandlung, nicht in seiner Wohnung, wohin er naiverweise seinen künftigen Verleger bestellt hatte. Ueberhaupt ist der Ton des Briefs, die Sicherheit des Auftretens, das Verlangen einer Entscheidung »bis morgen«, die kurze geschäftsmäßige Form charakteristisch für den Briefschreiber. Derselbe mochte damals nicht ahnen (wie es in der Festrede von Heinrich Brockhaus beim funfzigjährigen Jubiläum der Firma F. A. Brockhaus heißt), »daß er selbst und eine von ihm gegründete Buchhandlung im Laufe der Zeiten selbst so viele Verlagsanträge anzunehmen und — abzulehnen haben würde.«
In Leipzig knüpfte er mit dem Vertreter eines Hauses in Manchester an und wurde von diesem gegen Ende 1794 engagirt, einer in Livorno zu errichtenden Filiale jenes Hauses vorzustehen. In Amsterdam sollte er mit dem Engländer zusammentreffen und zuvor wollte er nur seinen Vater in Dortmund begrüßen. Da brach der Krieg zwischen Frankreich und Italien aus und das englische Haus vertagte seinen Plan auf günstigere Zeiten. Ein Anerbieten desselben, inzwischen eine Stelle auf dem Comptoir in Manchester anzunehmen, lehnte er ab und beschloß, vorläufig in Dortmund zu bleiben. Er etablirte sich auch bald darauf selbständig als Kaufmann, zuerst in Dortmund, dann in Arnheim und endlich in Amsterdam. Diese kaufmännische Wirksamkeit umfaßt die Jahre 1796-1805, also sein dreiundzwanzigstes bis dreiunddreißigstes Lebensjahr.
Brockhaus errichtete in Dortmund ein En-gros-Geschäft in englischen Manufacturen, besonders groben Wollenstoffen, und verband sich dazu mit einem Freunde, Wilhelm Mallinckrodt; Beide nahmen bald darauf noch einen dritten jungen Dortmunder, Gottfried Wilhelm Hiltrop, zum Associé an, und so wurde zwischen ihnen am 15. September 1796 ein Societätsvertrag abgeschlossen. Ihr Geschäft unter der Firma: »Brockhaus, Mallinckrodt und Hiltrop«, nahm bald den erfreulichsten Aufschwung; Brockhaus leitete das Comptoirgeschäft, Mallinckrodt machte die Reisen und hatte das Waarenlager unter sich, während Hiltrop von Anfang an nur eine untergeordnete Rolle spielte. Bald beschlossen denn auch die beiden Freunde, sich von Hiltrop, den sie wesentlich seines bedeutenden Vermögens halber zum Associé genommen hatten, wieder zu trennen, zumal er ihnen seines unverträglichen Charakters wegen lästig geworden war. Sie kündigten ihm im Jahre 1798, zahlten ihm seinen Antheil heraus und zeichneten ihre Firma nunmehr, vom 1. Januar 1799 an: »Brockhaus und Mallinckrodt«; Hiltrop gründete ein eigenes Geschäft gleicher Art in Dortmund. Bald darauf errichteten sie ein zweites Haus in Arnheim unter der Firma: »Mallinckrodt und Compagnie«, und Mallinckrodt zog zu dessen Leitung im Jahre 1801 nach Arnheim, während Brockhaus in Dortmund verblieb. Das Haus in Arnheim war besonders deshalb gegründet worden, weil der Hauptabsatz des dortmunder Geschäfts nach Holland stattfand. Ihr Geschäft nahm einen immer größern Umfang an und die beiden jungen Kaufleute erwarben in wenig Jahren ein bedeutendes Vermögen.
In diese Zeit fällt Beider Verheirathung. Brockhaus vermählte sich am 30. September 1798 mit der Tochter eines der angesehensten dortmunder Patricier, des Senators und Professors Johann Friedrich Beurhaus: Sophie Wilhelmine Arnoldine, geb. 24. December 1777; Mallinckrodt mit einer Freundin derselben. Brockhaus nannte später die ersten drei Jahre seiner Ehe (1798-1800) die glücklichsten seines Lebens. Am 17. Juli 1799 wurde ihm sein erstes Kind geboren: eine Tochter, Auguste; am 23. September 1800 sein erster Sohn: Friedrich.
Dieses Glück sollte aber nicht lange dauern und die Veranlassung dazu bildete der frühere Associé Beider, Hiltrop, obwol derselbe, als ein Verwandter der Familie Beurhaus, mit Brockhaus verwandt geworden war und später sogar sein Schwager wurde, indem er Elisabeth Beurhaus, eine Schwester von Brockhaus' Frau, heirathete. Aus einer geschäftlichen Angelegenheit entwickelten sich bald Verhältnisse der unangenehmsten Art, die zunächst auf Brockhaus' äußeres Leben entscheidenden Einfluß übten. Sie wurden die Ursache, daß er Dortmund verließ und nach Holland zog, ja selbst, daß er sich dort später dem Buchhandel widmete, dem er sich bei seinem Verbleiben in Dortmund schwerlich zugewendet haben würde.
Brockhaus wurde nebst seinem Associé Mallinckrodt von Hiltrop in einen Proceß verwickelt, der unter den Fehden und Anfechtungen, an denen sein Leben reich war, eine der hervorragendsten Stellen einnimmt und ihn mit kürzern oder längern Unterbrechungen bis an sein Lebensende verfolgte. Da der Proceß in dieser Zeit seinen Ursprung hat und mit ihm die nächsten Lebensschicksale von Brockhaus verknüpft sind, so müssen wir denselben jetzt im Zusammenhange erzählen, wenn dadurch auch der Zeit mehrfach vorgegriffen wird.
3. Der Hiltrop'sche Proceß.
Die beste Grundlage zu einer Schilderung dieses Processes, dessen vollständige Darstellung in vieler Hinsicht interessant wäre, hier aber zu weit führen würde, bietet eine von Brockhaus kaum ein Jahr vor seinem Tode veranstaltete und als Manuscript gedruckte Sammlung der darauf bezüglichen wichtigsten Actenstücke, die sowol seine eigenen Eingaben als die ergangenen Urtel, Gutachten u. s. w. enthält und somit ein unparteiisches Urtheil ermöglicht.[7]
Der Ursprung des Processes und sein erster Verlauf war in Kürze folgender.
Im October 1799 fallirte das Bankhaus Simon Moritz Bethmann in London, mit dem sowol Hiltrop als die Firma Brockhaus & Mallinckrodt in Geschäftsverbindung (Wechselgeschäften) standen. Hiltrop hatte an Bethmann vom April bis September 1799 circa 2800 Pfd. St. remittirt und dagegen Fabrikanten und Kaufleute im Innern von England angewiesen, für Waaren, die sie ihm lieferten, auf Bethmann zu ziehen. Mehrere solche Wechsel waren auch gezogen und bezahlt worden, Hiltrop's Guthaben an Bethmann betrug aber bei Ausbruch des Concurses noch 1806 Pfd. St. Die Firma Brockhaus & Mallinckrodt, welche ebenfalls in einem längern Geschäftsverkehr mit Bethmann gestanden hatte, schuldete dagegen diesem Hause eine Summe von 2204 Pfd. St., die sich aber auf 774 Pfd. St. reducirte, da Bethmann ihnen mehrere Wechsel im Betrage von zusammen 1429 Pfd. St. zurückgegeben oder sie von den daraus entstandenen Verbindlichkeiten gegen die Masse von W. L. Popert u. Comp. in Hamburg (die in der damaligen allgemeinen Handelskrisis ebenfalls fallirten) liberirt hatte. Brockhaus & Mallinckrodt gaben Hiltrop aus freien Stücken Kenntniß von diesem Stande ihrer Rechnung mit Bethmann, um ihm dadurch zur Rettung eines Theils seines Verlustes behülflich zu sein. Hiltrop benutzte dies aber, um sofort unterm 25. November 1799 auf die Forderung der Bethmann'schen Masse an Brockhaus & Mallinckrodt gerichtlich Arrest legen zu lassen. Der Magistrat zu Dortmund bestätigte diese Maßregel.
Brockhaus & Mallinckrodt appellirten hiergegen an die höhern Reichsgerichte, besonders aus Rücksicht auf Bethmann in London, da diesem z. B. nur sechs Wochen Zeit zu Einreden gegeben wurde, während in dem damaligen harten Winter von 1799 auf 1800 der Postenlauf zwischen Cuxhaven und Harwich mehrere Monate lang unterbrochen war. Außerdem waren sie inzwischen von der Firma Gebrüder Bethmann in Frankfurt a. M. (Verwandte des londoner Hauses) beauftragt worden, eine Forderung an Hiltrop im Betrage von 8000 Thlr. frankfurter Wechselgeld (10000 Thlr. Berg. Courant) einzukassiren, und diese Forderung war ihnen selbst zu diesem Zweck cedirt worden: gewiß ein Beweis großen Vertrauens zu der jungen Firma von seiten jenes großen Hauses. Infolge alles dessen entschloß sich Hiltrop, der trotz seines frühern großen Vermögens infolge seiner geschäftlichen Unfähigkeit rasch in finanzielle Verlegenheiten gerathen war und auch von andern Gläubigern hart bedrängt wurde, zu einem gütlichen Vergleich, der durch Vermittelung des gemeinschaftlichen Schwagers von Hiltrop und Brockhaus, Erbsaß (später Justizcommissar) Heinrich Beurhaus zu Dortmund, unterm 24. April 1800 abgeschlossen wurde. Danach sollte der Proceß von Gebrüder Bethmann in Frankfurt gegen Hiltrop bis zur Erledigung des Processes von Hiltrop gegen Bethmann in London sistirt werden, Hiltrop von Brockhaus ein »Darlehn« von 1200 Pfd. St., das er ebenfalls erst nach Austrag dieser Sache zurückerstatten sollte, empfangen, Letzterm dagegen (resp. Beurhaus) seine Forderung an Bethmann in London cediren und für den Rest seiner Schuld bei Gebrüder Bethmann in Frankfurt Waaren an Zahlungsstatt geben, auch sein Conto-Corrent mit Bethmann in London als richtig anerkennen.
Schon fünf Monate nach Abschluß dieses Vergleichs machte indeß Hiltrop den Versuch, denselben umzustoßen, und zwar wieder auf eine ihm von Brockhaus vertraulich gemachte Mittheilung hin: daß die Bethmann'schen Massecuratoren in London jenen Vergleich nicht genehmigen wollten. Er fand an dem gegen Brockhaus sehr feindselig gesinnten Bürgermeister Schäffer in Dortmund einen bereitwilligen Helfer, der bei dem traurigen Zustand der damaligen reichsstädtischen Verfassung eigenmächtig verfahren konnte; durch ihn erreichte er, daß sein wiederholtes Arrestgesuch vom 15. September 1800 genehmigt und das Waarenlager von Brockhaus & Mallinckrodt (das einen Werth von mindestens 100000 Thlr. hatte) mit Arrest belegt und versiegelt wurde. Da alle Remonstrationen gegen diese, wie Brockhaus sich ausdrückt, »fürchterlichen, im höchsten Grade ungerechten Maßregeln, die den bürgerlichen Ruin der Beklagten augenblicklich nach sich ziehen mußten«, erfolglos blieben, so wendeten sich letztere an die höchsten Reichsgerichte um Schutz gegen Unterdrückung und forderten Genugthuung sowie Schadenersatz. Da schien endlich Hiltrop sein Unrecht einzusehen; er bat um Verzeihung für sein »kränkendes und übereiltes Betragen« und versprach, in Zukunft nur in dem ordentlichen Wege Rechtens gegen die Beklagten vorzugehen.
Das Verdienst, dieses Resultat herbeigeführt zu haben, durch welches die Angelegenheit wenigstens ihren gehässigen Charakter verlor, gebührt Hiltrop's Frau, Elisabeth, einer Schwester von Brockhaus' Frau. Sie wandte sich direct an Brockhaus, den von ihrem Manne so vielfach und so empfindlich Gekränkten, und bat ihn, das Verfahren ihres Mannes zu entschuldigen: gewiß ebenso ein Zeichen ihres richtigen Gefühls als Frau, wie der wahren Achtung und des vollen Vertrauens, das sie zu ihrem Schwager als einem Ehrenmanne hatte.
Sie schreibt in diesem Briefe, dessen Datum uns nicht bekannt ist:
Brockhaus! Brockhaus! Ich fordere Sie auf, mich anzuhören. Sehen Sie, mein Herz ist voll trüben Gedenkens über eine Geschichte, welche nie hätte geschehen müssen, und ich weiß mich an Niemand sicherer zu wenden als an Sie selbst. Sie beurtheilen die Sache gewiß richtig, davon bin ich überzeugt, und ich weiß auch, daß Sie glauben: Uebereilung ist kein Verbrechen. Dieses hat sich Hiltrop zu Schulden kommen lassen .... Brockhaus, Brockhaus, ich ahndete nichts von Allem, was geschehen ist, und flehe ich zu Ihnen, mich und mein armes Kind nicht unglücklich zu machen, da dieses doch jetzt nur einzig von Ihnen abhängt. Verzeihen Sie Hiltrop, der sich hat bereden lassen und leider jetzt mit Schaden einsehen muß, wie wenig man Leuten trauen darf. Es thut ihm auch für mich leid und er glaubt es sich nicht vergeben zu können, mir solche Unruhe zu machen, und hat mir deswegen gesagt, ich könnte die Sache ganz nach meinem Wunsche einrichten. Theurer Brockhaus, mein Herz will keine Feindschaft gegen Sie und Sophie, die immer mehr meine Freundin als Schwester war. Jetzt, ich weiß es, sind Sie aufgebracht gegen Hiltrop und über sonstiges Verfahren und wollen die Sache nach Wetzlar berichten. Brockhaus, Gott! dieses können und werden Sie nicht wollen. Lassen Sie Vergebung über Ihren gerechten Zorn siegen! Denken Sie, daß es Uebereilung ist, welches mein armes Mädchen noch so schwer büßen sollte; geben Sie mir Ihre Hand darauf, so nicht zu verfahren, und im voraus danke ich Ihnen für Ihre Güte. Daß es Güte ist, bin ich fähig zu fühlen ....
Brockhaus erfüllte die Bitte seiner Schwägerin; er verzichtete auf Genugthuung und Schadenersatz, wogegen Hiltrop am 3. October 1801 auf Cassation aller Maßregeln gegen die Firma Brockhaus & Mallinckrodt beim dortmunder Magistrat antrug, während der Proceß selbst seinen Fortgang hatte.
Indessen war Brockhaus der Aufenthalt in Dortmund durch die widrigen Erlebnisse der beiden letzten Jahre so verleidet worden, daß er mit dem Gedanken umging, das dortmunder Geschäft ganz aufzulösen und zu Mallinckrodt nach Arnheim zu ziehen. Er hatte deshalb schon im Sommer des Jahres 1801 eine Reise nach Holland gemacht, und als er im August von dort zurückkehrte, verbreitete sich in Dortmund das Gerücht, daß er die Stadt verlassen und nach Holland übersiedeln wolle. Die Sache war damals indeß nur ein Project, das, wie Brockhaus selbst sagt, »wahrscheinlich nie wäre ausgeführt worden«. Hiltrop wurde aber gerade dadurch veranlaßt, seinen Arrestantrag zu wiederholen, Brockhaus mußte eine bedeutende Caution stellen und wurde selbst persönlich verhaftet. Dies veranlaßte ihn, sein Vorhaben wirklich auszuführen. Er verließ seine Vaterstadt und zog noch im Spätherbst 1801 nach Arnheim, der am Rhein (Leck) gelegenen Hauptstadt der Provinz Geldern, wo er mit Mallinckrodt bereits ein Jahr vorher ein Haus errichtet hatte.
Arnheim bildete übrigens blos einen kurzen Durchgangspunkt für ihn. Die Hauptstadt und erste Handelsstadt Hollands, Amsterdam, schien ihm ein geeigneterer Wirkungskreis für seine Handelsspeculationen, besonders seinen Verkehr mit England, und so zog er schon im Winter von 1801 auf 1802 dorthin. Vorher trennte er sich geschäftlich von Mallinckrodt, um sein Glück allein weiter zu versuchen, und auch wol, weil Mallinckrodt ihm die durch Hiltrop verschuldete Störung ihres Geschäfts zum Vorwurf machte. Mallinckrodt blieb in Arnheim zurück und setzte das bisherige Geschäft allein fort, scheint aber seinen Associé, der ihn jedenfalls geistig bedeutend überragte, sehr vermißt zu haben. Er bewahrte für diesen stets regstes Interesse und vollste Hochachtung und besuchte ihn später in Leipzig. Durch Hiltrop's fortgesetzte Machinationen scheint er mehr noch als Brockhaus gelitten zu haben und dadurch in seinem Geschäfte wesentlich gestört worden zu sein. Hiltrop ging indeß erst in späterer Zeit, 1815, direct und separat gegen Mallinckrodt vor, als er in seinem Verfahren gegen Brockhaus nichts erreichen konnte. Er brachte es im Sommer 1822 bis zur Execution gegen Mallinckrodt, gewann dadurch aber nichts, da die hypothekarischen Gläubiger desselben den Ertrag der auf diese Weise verkauften Mallinckrodt'schen Grundstücke, Waaren und Mobilien völlig in Anspruch nahmen. So hatte Hiltrop die traurige Genugthuung erlebt, wenigstens den einen der von ihm Verfolgten geschäftlich und bürgerlich ruiniert zu haben, während Brockhaus' reger Geist sich bald andern Bahnen zuwandte, auf denen ihn Hiltrop zwar stören, aber nicht, wie es seine Absicht war, ebenfalls ruiniren konnte.
Denn allerdings ließ Hiltrop nicht nach in seinem Vorgehen gegen Brockhaus, das er, nachdem seine eigene bürgerliche und geschäftliche Stellung dadurch empfindlich gelitten hatte, zum alleinigen traurigen Geschäft seines Lebens gemacht zu haben scheint. Wir müssen deshalb hier wieder anknüpfen an den oben geschilderten ersten Verlauf dieses Processes und die weitern Stadien desselben vorführen.
Trotz der durch Hiltrop's Frau in so richtigem Gefühle angestrebten Aussöhnung und Hiltrop's Selbstdemüthigung war der Proceß über die Gültigkeit des am 24. April 1800 abgeschlossenen Vergleichs in Dortmund anhängig geblieben, während Mallinckrodt und Brockhaus seitdem in Arnheim und Amsterdam lebten. Die Acten sollten verschickt sein, waren aber von der dortmunder Behörde verloren worden! Erst im August 1805 wurden sie aus den Manualacten der Sachwalter wieder nothdürftig ergänzt und am 19. Juli 1806 erfolgte ein Rechtsspruch der göttinger Facultät, in welchem dem Kläger der Beweis, daß dem Verfahren der Beklagten gegen ihn ein »Betrug«(!) zu Grunde liege, nachgelassen wurde. Hiltrop trat die übrigen ihm auferlegten Beweise an; der Sachwalter der Beklagten, obwol sonst ein geschickter Jurist, wußte sich in diese kaufmännischen Verhältnisse nicht zu finden und übergab einen durchaus verfehlten Gegenbeweis, doch hatten die Beklagten selbst ein Promemoria darüber entworfen. Unterm 16. November 1809 wurde das den Beklagten ungünstige erste Urtheil seitens der herzoglich bergischen Regierung gefällt, verfaßt von dem Oberbergrichter Bölling in Essen. Es nahm den Beweis für geführt an und verurtheilte die Beklagten, an Hiltrop 606 Pfd. St. nebst Zinsen und Proceßkosten zu zahlen. Gegen dieses Erkenntniß appellirten Brockhaus und Mallinckrodt und ließen eine von Brockhaus selbst verfaßte »Rechtfertigung« dieser Appellation unterm 28. Februar 1810 (in Amsterdam) für ihre Freunde drucken. Sie belegten durch zwei Parere, von der Kaufmannschaft zu Leipzig (vom 6. April 1800, verfaßt vom Kramerconsulent Dr. Bahrt) und von der Kaufmannschaft zu Elberfeld (vom November 1801, verfaßt von dem Syndikus derselben, Dr. Brüninghaus), daß ihr Verfahren der Lage der Sache und dem kaufmännischen Geschäftsgange durchaus angemessen gewesen sei. Später erfolgten noch zwei Gutachten, welche sie ebenfalls von dem frivolen Vorwurfe eines »Betrugs« vollkommen freisprachen: das eine von dem Professor Dr. Dabelow in Halle, später in Dorpat, datirt Leipzig, 16. Juli 1810, das andere von der Juristenfacultät zu Halle vom Januar 1813. Dennoch wurde von dem neuerrichteten bergischen Appellationsgerichtshofe zu Düsseldorf unterm 24. November 1813 das Erkenntniß erster Instanz lediglich bestätigt. Dieses Urtheil kam jedoch nie zur Vollstreckung, vielleicht infolge der eingetretenen politischen Ereignisse; es wurde sogar dem inzwischen von Amsterdam nach Altenburg und später nach Leipzig übergesiedelten Brockhaus gar nicht publicirt, wie durch eine Bescheinigung der herzoglich sächsischen Landesregierung zu Altenburg vom 16. März 1822 ausdrücklich beglaubigt wird.
Hiltrop beruhigte sich aber nicht und reichte nach Verlauf mehrerer Jahre, am 17. August 1819, eine neue Klage gegen Brockhaus ein. Damit beginnt das dritte und letzte Stadium dieses langwierigen Processes. Das königlich preußische Oberlandesgericht zu Hamm bestätigte durch ein Erkenntniß vom 5. Januar 1822 die für den Beklagten ungünstigen Urtheile von 1809 und 1813, während es unterm 30. März 1822 eine von Brockhaus gegen einen Arrest auf ein Erbtheil seiner minorennen Kinder erhobene Klage im wesentlichen zu seinen Gunsten entschied. Gegen diese Erkenntnisse, insbesondere das erste, appellirte Brockhaus. Er verfaßte für den Justizcommissar Cappel in Hamm selbst eine ausführliche »Instruction« (worin er unter anderm sagt, daß diese Erkenntnisse »sich ebenso wenig mit den anerkanntesten Sätzen des Völkerrechts als mit dem Geiste der preußischen Proceßgesetzgebung, diesem Meisterstücke einer legislativen Weisheit, vereinbaren lassen«) und ließ die obenerwähnte »Sammlung von eilf Actenstücken« für das Gericht und für seine Freunde drucken (das Vorwort dazu ist aus Leipzig vom 1. Juli 1822 datirt). Indeß betätigte der zweite Senat des Oberlandesgerichts zu Münster unterm 28. September 1822 lediglich die frühern Erkenntnisse. Brockhaus gab sich aber noch immer nicht für besiegt, obwol er damals eben eine lebensgefährliche Krankheit überstanden hatte, deren Wiederholung er kaum ein Jahr darauf erlag: er ergriff das letzte Mittel, das ihm übrigblieb, und wandte sich an das Geheime Obertribunal zu Berlin mit der Bitte um Cassation, resp. Revision des Erkenntnisses von 1813. In dem von ihm selbst wieder verfaßten »Revisionsbericht« (der kein Datum hat, aber jedenfalls noch im Spätherbst 1822 geschrieben ist) betont er, daß ihn zu diesem Antrage außer dem bedeutenden Objecte des Processes (zuletzt gegen 10000 Thlr.) besonders der Umstand bestimme, wegen eines vermeintlichen »Betrugs« und infolge eines irrigerweise für »rechtskräftig« angenommenen Erkenntnisses verurtheilt zu werden.
Noch ehe die Antwort von Berlin erfolgt war, starb Brockhaus. Erst mehrere Jahre nach seinem Tode (1828) wurde der Proceß endlich von seinen Erben durch einen Vergleich mit Hiltrop beendigt; letzterer starb am 2. April 1845.
Das Urtheil des Geheimen Obertribunals in Berlin vom 2. April 1824 hatte die frühern Erkenntnisse bestätigt, doch war den Stadtgerichten zu Leipzig durch ein allerhöchstes Rescript der königlich sächsischen Landesregierung zu Dresden vom 23. October 1824 die Befolgung der betreffenden Requisitionen untersagt worden. Hiltrop ruhte trotzdem noch immer nicht, und um ihr in Preußen befindliches Eigenthum vor ihm zu schützen, sah sich die Firma F. A. Brockhaus veranlaßt, ihre Rechnung mit den preußischen Buchhandlungen in der Zeit vom 15. November 1824 bis 21. November 1828 unter der Firma »Literatur-Comptoir in Altenburg La B« zu führen, wozu der mit ihr seit langem befreundete Besitzer dieser Firma, Johann Friedrich Pierer in Altenburg, bereitwillig die Hand bot.
Dieser Proceß mußte hier, obwol er Brockhaus' Hauptthätigkeit, die buchhändlerische, nicht berührt, ausführlicher dargestellt werden, weil er ihn während seines ganzen Lebens beschäftigte und von ihm persönlich mit der größten Energie und Ausdauer betrieben wurde. Es war in der That, wie er sich selbst später ausdrückte, der »blutige Faden«, der sich durch sein ganzes Leben hindurchzog und auf dasselbe mehrfach entscheidend einwirkte: er hatte die Familie entzweit (obwol selbst fast alle Verwandten Hiltrop's auf Brockhaus' Seite traten und dessen Verfahren misbilligten); er hatte ihn aus seiner Vaterstadt vertrieben und war die Veranlassung, daß er diese nur noch einmal (1811) besuchte; er verfolgte ihn überallhin: nach Amsterdam, Altenburg und Leipzig, und nöthigte ihn gerade auch in den, durch andere Aufregungen ihm schon so verbitterten, letzten Jahren seines Lebens zu eigener aufreibender Thätigkeit.
Die Frage liegt hier nahe, ob denn im Laufe der 22 Jahre, die dieser Proceß dauerte, nie Versuche zu Vergleichen gemacht worden seien. Allerdings ist das geschehen und zwar — zur Ehre und Rechtfertigung von Brockhaus muß dies hervorgehoben werden — insbesondere von seiner Seite, jedoch, wie er selbst sagt, »von diesem einzig und allein nur aus dem Grunde, daß er gewünscht hat, Ruhe zu gewinnen und sich von dem Odiösen, was mit der Führung eines solchen Processes überhaupt und besonders in weiten Entfernungen verbunden ist, völlig befreit zu sehen: nie aber, daß er durch einen Vergleich habe anerkennen wollen, als ob seitens Brockhaus und Mallinckrodt je etwas in dieser Sache geschehen, was auf irgendeine Weise gegen kaufmännische Sitte und Ehre und gegen kaufmännische Ordnung oder gegen kaufmännisches Recht gewesen«. Abgesehen von dem unterm 24. April 1800 abgeschlossenen, aber bald wieder von Hiltrop umgestoßenen Vergleiche sowie davon, daß Brockhaus, wie früher berichtet, auf die Bitte von Hiltrop's Frau die Klage gegen diesen beim Reichskammergericht in Wetzlar unterließ, bot er 1816 oder 1817 Hiltrop zur Niederschlagung alles Zwistes eine jährliche Rente von 200 Thlr. an, die nach seinem Tode auf seine Kinder bis zur Volljährigkeit des jüngsten übergehen solle. Und als Hiltrop dies ablehnte, wollte sich Brockhaus 1821 selbst zur terminlichen Zahlung von 4000 Thlr. verstehen, einer Summe, die das, was Hiltrop ursprünglich an Bethmann in London verloren, bedeutend überstieg. Aber auch dieses Anerbieten war von Hiltrop unangenommen und sogar unbeachtet geblieben. Selbst noch 1822 erklärte er sich bereit, »wesentliche, wenn auch bei veränderter und günstigerer Lage der Sache nicht mehr so bedeutende Opfer zu bringen, wenn ihm dazu auf angemessene Weise die Hand geboten würde und der Gegner damit nicht zu lange warte«. So kann Brockhaus sicherlich nicht der Vorwurf der Unversöhnlichkeit, Streitsucht oder Rechthaberei gemacht werden. Eher könnte man ihn deshalb tadeln, daß er, zunächst aus Theilnahme für seinen frühern Associé Hiltrop und um diesen vor einem Verlust zu bewahren, sich in eine ihm ganz fremde Angelegenheit gemischt und dann im Anfange des Processes dem Gegner mehrfach selbst die Waffen gegen sich geliefert habe; er fühlte dies auch selbst und that in dieser Beziehung die für ihn charakteristische, aber gewiß nur ehrenvolle Aeußerung: es sei dies von seiner und Mallinckrodt's Seite besonders geschehen »aus Ueberspanntheit, da wir die Welt noch nicht nahmen, wie sie ist, sondern wie sie sein sollte, und die wir damals noch so einfältig waren, zu glauben, als ernte man von dem Haufen der Menschen für große und rechtschaffene Handlungen Dank ein.«
Der Hiltrop'sche Proceß hat übrigens, wie aus Vorstehendem wol hervorgegangen sein dürfte, außer dem persönlichen auch ein mannichfaltiges allgemeineres Interesse, und es mögen deshalb zum Schluß einige Stellen aus der mehrerwähnten Schrift folgen, die Brockhaus über den Proceß 1822 zusammenstellte, in der Hoffnung, daß sie »dem Sachkenner genügen werden, um sich über den Charakter der darin handelnden Personen und über die Natur der stattgefundenen und obschwebenden Verhältnisse zu orientiren«.





























