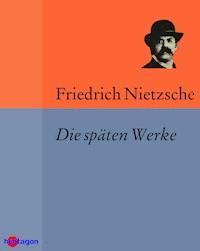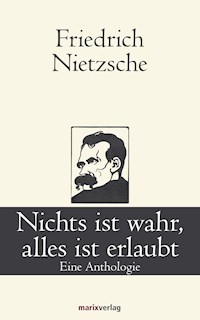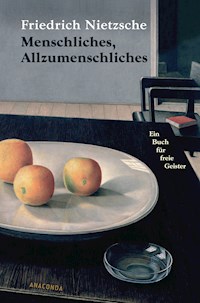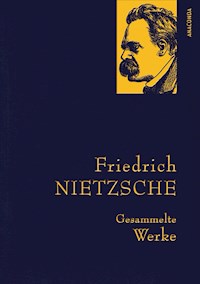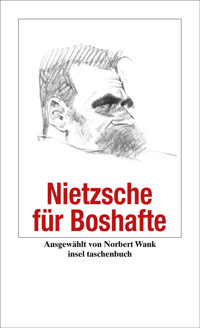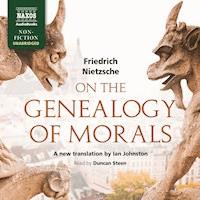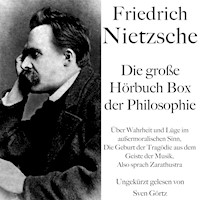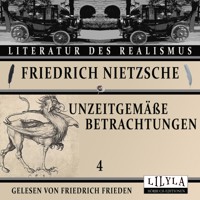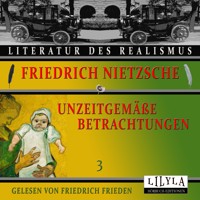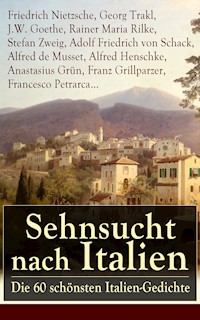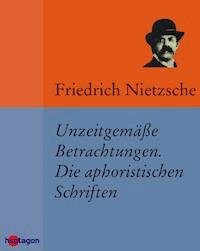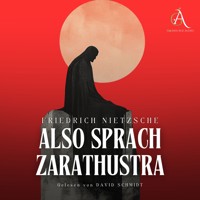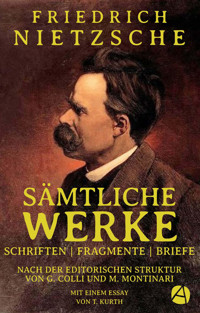
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese vom apebook Verlag anlässlich des 125. Todestages des großen Philosophen 2025 neu herausgegebene Ausgabe versammelt sämtliche Werke von Friedrich Nietzsche sowie die nachgelassenen Schriften, Fragmente und Briefe. Sie folgt dabei der editorischen Struktur der von Giorgio Colli und Mazzino Montinari herausgegebenen Kritischen Gesamtausgabe. Im Vordergrund dieser Edition steht das Bemühen, das umfangreiche Textkonvolut in seiner digitalen Form bei gleichzeitiger Vollständigkeit und philologischer Korrektheit möglichst übersichtlich zu gestalten und komfortabel handhabbar zu machen – woran es bei vielen vorhandenen Gesamtausgaben leider mangelt. Mit einem vorangestellten Essay des Herausgebers. IN DIESER AUSGABE ENTHALTEN: Essay: Nietzsche als ästhetisches Phänomen VERÖFFENTLICHTE WERKE UND PRIVATDRUCKE Sokrates und die griechische Tragoedie. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Unzeitgemässe Betrachtungen. I–IV Ein Neujahrswort an den Herausgeber der Wochenschrift „Im neuen Reich“. Menschliches, Allzumenschliches. Erster und zweiter Band. Morgenröthe. Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wissenschaft. Also sprach Zarathustra. I–IV Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral. Der Fall Wagner. Götzen-Dämmerung. Nietzsche contra Wagner. AUTORISIERTE SCHRIFTEN Der Antichrist. Ecce homo. Dionysos-Dithyramben. NACHGELASSENE SCHRIFTEN Zwei öffentliche Vorträge über die griechische Tragoedie. Die dionysische Weltanschauung. Die Geburt des tragischen Gedankens. Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern. Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. Mahnruf an die Deutschen. NACHGELASSENE FRAGMENTE 1869–1889 BRIEFE 1850–1889 Friedrich Nietzsche (1844–1900) gilt als einer der einflussreichsten und zugleich umstrittensten Philosophen der Moderne. Geboren in Röcken bei Lützen als Sohn eines lutherischen Pfarrers, wuchs er nach dem frühen Tod des Vaters in einem weiblich geprägten Umfeld auf. Früh zeigte sich seine außergewöhnliche Begabung, die ihn 1869 bereits mit 24 Jahren auf einen Lehrstuhl für klassische Philologie in Basel brachte. Dort lehrte er, bis ihn zunehmende gesundheitliche Probleme – insbesondere Migräneanfälle und ein schwaches Augenlicht – 1879 zum Rücktritt zwangen. Fortan lebte er als freier Schriftsteller, meist in der Schweiz oder Italien, wo er seine bedeutendsten Werke verfasste. 1889 erlitt Nietzsche in Turin einen geistigen Zusammenbruch, von dem er sich nicht mehr erholte; er verbrachte seine letzten Lebensjahre, von seiner Mutter und später von seiner Schwester gepflegt, bis zu seinem Tod 1900 in Weimar. Nietzsches Werk ist breit gefächert und verbindet Philosophie, Literatur, Psychologie und Kulturkritik. Früh trat er mit „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ (1872) hervor, wo er die Polarität von Apollinischem und Dionysischem in der griechischen Kultur herausarbeitete. Spätere Schriften wie „Menschliches, Allzumenschliches“ oder „Die fröhliche Wissenschaft“ kennzeichnen seinen Bruch mit Metaphysik und Religion. Zentral sind die Ideen des „Willens zur Macht“, der „Umwertung aller Werte“ und der Figur des „Übermenschen“, die er besonders in „Also sprach Zarathustra“ (1883–85) entfaltete. Der oft zitierte Satz „Gott ist tot“ markiert dabei keine bloße Provokation, sondern die Diagnose einer kulturellen und moralischen Krise Europas. Die Rezeption Nietzsches war vielschichtig und teils widersprüchlich. Zu Lebzeiten blieb er weitgehend unverstanden und isoliert. Erst nach seinem Tod fand er breite Resonanz – sowohl in der Philosophie als auch in Literatur, Kunst und Politik. Seine Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche trug maßgeblich zur Verbreitung seines Werkes bei, verzerrte es aber durch ideologische Instrumentalisierung im nationalistischen Sinn. Im 20. Jahrhundert wurde Nietzsche fälschlicherweise von den Nationalsozialisten vereinnahmt, obwohl seine Schriften mit antisemitischen und völkischen Ideen nicht vereinbar sind. Nietzsches Einfluss reicht bis heute weit: Existentialisten wie Jean-Paul Sartre und Albert Camus, Psychoanalytiker wie Sigmund Freud, aber auch postmoderne Denker wie Michel Foucault und Jacques Derrida knüpften an seine radikale Kritik traditioneller Werte und Denkweisen an. Seine literarische Sprache und seine provokativen Bilder machten ihn zugleich zu einem inspirierenden Autor für Künstler und Schriftsteller. Nietzsche gilt damit als Wegbereiter einer Philosophie, die das Individuum, die Kreativität und die Selbstüberwindung ins Zentrum rückt – und bleibt ein Denker, der gleichermaßen fasziniert wie irritiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 13269
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Friedrich Nietzsche
Sämtliche Werke
Schriften | Fragmente | Briefe
Nach der editorischen Struktur
von G. Colli und M. Montinari
Mit einem Essay
von T. Kurth
FRIEDRICH NIETZSCHE: SÄMTLICHE WERKE wurde in der hier gefolgten editorischen Struktur zuerst 1967ff. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari herausgegeben.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2025
V 2.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-688-6
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
Inhaltsverzeichnis
NIETZSCHE: SÄMTLICHE WERKE. Schriften | Fragmente | Briefe
Impressum
Essay: Nietzsche als ästhetisches Phänomen
Sokrates und die griechische Tragoedie.
I
II
III
DIE GEBURT DER TRAGÖDIE.
Versuch einer Selbstkritik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vorwort an Richard Wagner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
UNZEITGEMÄSSE BETRACHTUNGEN.
Unzeitgemässe Betrachtungen I. David Strauss der Bekenner und Schriftsteller.
Unzeitgemässe Betrachtungen II. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben.
Unzeitgemässe Betrachtungen III. Schopenhauer als Erzieher.
Unzeitgemässe Betrachtungen IV. Richard Wagner in Bayreuth
Ein Neujahrswort an den Herausgeber der Wochenschrift „Im neuen Reich“.
MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES. Erster Band.
Vorrede.
Erstes Hauptstück. Von den ersten und letzten Dingen.
Von den ersten und letzten Dingen. Fortsetzung
Zweites Hauptstück. Zur Geschichte der moralischen Empfindungen.
Zur Geschichte der moralischen Empfindungen. Fortsetzung
Drittes Hauptstück. Das religiöse Leben.
Das religiöse Leben. Fortsetzung
Viertes Hauptstück. Aus der Seele der Künstler und Schriftsteller.
Aus der Seele der Künstler und Schriftsteller. Fortsetzung
Fünftes Hauptstück. Anzeichen höherer und niederer Cultur.
Anzeichen höherer und niederer Cultur. Fortsetzung
Sechstes Hauptstück. Der Mensch im Verkehr.
Der Mensch im Verkehr. Fortsetzung
Siebentes Hauptstück. Weib und Kind.
Weib und Kind. Fortsetzung
Achtes Hauptstück. Ein Blick auf den Staat.
Ein Blick auf den Staat. Fortsetzung
Neuntes Hauptstück. Der Mensch mit sich allein.
Der Mensch mit sich allein. Fortsetzung
Unter Freunden. Ein Nachspiel.
MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES. Zweiter Band..
Vorrede.
Erste Abtheilung: Vermischte Meinungen und Sprüche.
Vermischte Meinungen und Sprüche. Abschnitte 50-99
Vermischte Meinungen und Sprüche. Abschnitte 100-149
Vermischte Meinungen und Sprüche. Abschnitte 150-199
Vermischte Meinungen und Sprüche. Abschnitte 200-249
Vermischte Meinungen und Sprüche. Abschnitte 250-299
Vermischte Meinungen und Sprüche. Abschnitte 300-349
Vermischte Meinungen und Sprüche. Abschnitte 350-408
Zweite Abtheilung: Der Wanderer und sein Schatten.
Der Wanderer und sein Schatten. Abschnitte 50-99
Der Wanderer und sein Schatten. Abschnitte 100-149
Der Wanderer und sein Schatten. Abschnitte 150-199
Der Wanderer und sein Schatten. Abschnitte 200-249
Der Wanderer und sein Schatten. Abschnitte 250-299
Der Wanderer und sein Schatten. Abschnitte 300-350
MORGENRÖTHE.
Vorrede.
Erstes Buch.
Zweites Buch.
Drittes Buch.
Viertes Buch.
Fünftes Buch.
IDYLLEN AUS MESSINA.
Prinz Vogelfrei.
Die kleine Brigg, genannt „das Engelchen“.
Lied des Ziegenhirten.
Die kleine Hexe.
Das nächtliche Geheimniss.
„Pia, caritatevole, amorosissima“.
Vogel Albatross.
Vogel-Urtheil.
DIE FRÖHLICHE WISSENSCHAFT.
Vorrede zur zweiten Ausgabe.
“Scherz, List und Rache.” Vorspiel in deutschen Reimen.
Erstes Buch.
Zweites Buch.
Drittes Buch.
Viertes Buch. Sanctus Januarius.
Fünftes Buch. Wir Furchtlosen.
Anhang: Lieder des Prinzen Vogelfrei.
ALSO SPRACH ZARATHUSTRA.
Also sprach Zarathustra. Erster Teil.
Zarathustra’s Vorrede.
Die Reden Zarathustra’s.
Also sprach Zarathustra. Zweiter Teil.
Das Kind mit dem Spiegel.
Auf den glückseligen Inseln.
Von den Mitleidigen.
Von den Priestern.
Von den Tugendhaften.
Vom Gesindel.
Von den Taranteln.
Von den berühmten Weisen.
Das Nachtlied.
Das Tanzlied.
Das Grablied.
Von der Selbst-Ueberwindung.
Von den Erhabenen.
Vom Lande der Bildung.
Von der unbefleckten Erkenntniss.
Von den Gelehrten.
Von den Dichtern.
Von grossen Ereignissen.
Der Wahrsager.
Von der Erlösung.
Von der Menschen-Klugheit.
Die stillste Stunde.
Also sprach Zarathustra. Dritter Teil.
Der Wanderer.
Von Gesicht und Räthsel.
Von der Seligkeit wider Willen.
Vor Sonnen-Aufgang.
Von der verkleinernden Tugend.
Auf dem Oelberge.
Vom Vorübergehen.
Von den Abtrünnigen.
Die Heimkehr.
Von den drei Bösen.
Vom Geist der Schwere.
Von alten und neuen Tafeln.
Der Genesende.
Von der grossen Sehnsucht.
Das andere Tanzlied.
Die sieben Siegel. (Oder: das Ja- und Amen-Lied.)
Also sprach Zarathustra. Vierter Teil.
Das Honig-Opfer.
Der Nothschrei.
Gespräch mit den Königen.
Der Blutegel.
Der Zauberer.
Ausser Dienst.
Der hässlichste Mensch.
Der freiwillige Bettler.
Der Schatten.
Mittags.
Die Begrüssung.
Das Abendmahl.
Vom höheren Menschen.
Das Lied der Schwermuth.
Von der Wissenschaft.
Unter Töchtern der Wüste.
Die Erweckung.
Das Eselsfest.
Das Nachtwandler-Lied.
Das Zeichen.
JENSEITS VON GUT UND BÖSE.
Vorrede.
Erstes Hauptstück: von den Vorurtheilen der Philosophen.
Zweites Hauptstück: der freie Geist.
Drittes Hauptstück: das religiöse Wesen.
Viertes Hauptstück: Sprüche und Zwischenspiele.
Fünftes Hauptstück: zur Naturgeschichte der Moral.
Sechstes Hauptstück: Wir Gelehrten.
Siebentes Hauptstück: unsere Tugenden.
Achtes Hauptstück: Völker und Vaterländer.
Neuntes Hauptstück: was ist vornehm?
Aus hohen Bergen. Nachgesang
ZUR GENEALOGIE DER MORAL.
Vorrede.
Erste Abhandlung: „Gut und Böse“, „Gut und Schlecht“.
Zweite Abhandlung: „Schuld“, „schlechtes Gewissen“ und Verwandtes.
Dritte Abhandlung: Was bedeuten asketische Ideale?
DER FALL WAGNER.
Vorwort.
Der Fall Wagner. Turiner Brief vom Mai 1888.
Nachschrift.
Zweite Nachschrift.
Epilog.
GÖTZEN-DÄMMERUNG.
Vorwort.
Sprüche und Pfeile.
Das Problem des Sokrates.
Die „Vernunft“ in der Philosophie.
Wie die „wahre Welt“ endlich zur Fabel wurde.
Moral als Widernatur.
Die vier grossen Irrthümer.
Die „Verbesserer“ der Menschheit.
Was den Deutschen abgeht.
Streifzüge eines Unzeitgemässen.
Was ich den Alten verdanke.
Der Hammer redet.
NIETZSCHE CONTRA WAGNER.
Vorwort.
Wo ich bewundere.
Wo ich Einwände mache.
Intermezzo.
Wagner als Gefahr.
Eine Musik ohne Zukunft.
Wir Antipoden.
Wohin Wagner gehört.
Wagner als Apostel der Keuschheit.
Wie ich von Wagner loskam.
Der Psycholog nimmt das Wort.
Epilog.
Von der Armuth des Reichsten.
DER ANTICHRIST.
Vorwort.
Abschnitte 1-62.
[Gesetz]
ECCE HOMO.
Vorwort.
[Geleitwort]
Warum ich so weise bin.
Warum ich so klug bin.
Warum ich so gute Bücher schreibe.
Die Geburt der Tragödie.
Die Unzeitgemässen.
Menschliches, Allzumenschliches.
Morgenröthe.
Die fröhliche Wissenschaft.
Also sprach Zarathustra.
Jenseits von Gut und Böse.
Genealogie der Moral.
Götzen-Dämmerung.
Der Fall Wagner.
Warum ich ein Schicksal bin.
Kriegserklärung.
Der Hammer redet.
DIONYSOS-DITHYRAMBEN.
Nur Narr! Nur Dichter!
Unter Töchtern der Wüste.
Letzter Wille.
Zwischen Raubvögeln.
Das Feuerzeichen.
Die Sonne sinkt.
Klage der Ariadne.
Ruhm und Ewigkeit.
Von der Armut des Reichsten.
Zwei öffentliche Vorträge über die griechische Tragoedie.
Erster Vortrag. Das griechische Musikdrama.
Zweiter Vortrag. Socrates und die Tragoedie.
Die dionysische Weltanschauung.
1.
2.
3.
4.
Die Geburt des tragischen Gedankens.
[1]
[2]
[3]
Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten.
Einleitung.
Vorrede, zu lesen vor den Vorträgen, obwohl sie sich eigentlich nicht auf sie bezieht.
Vortrag I
Vortrag II
Vortrag III
Vortrag IV
Vortrag V
Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern.
1. Ueber das Pathos der Wahrheit.
2. Gedanken über die Zukunft unserer Bildungsanstalten.
3. Der griechische Staat.
4. Das Verhältniss der Schopenhauerischen Philosophie zu einer deutschen Cultur.
5. Homer’s Wettkampf.
Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen.
[Einleitung]
[Einleitung 2]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne.
1.
2.
Mahnruf an die Deutschen.
Fragmente 1869–1874
Herbst 1869
Winter 1869–70 bis Frühjahr 1870 [1]
Winter 1869–70 bis Frühjahr 1870 [2]
August–September 1870
September 1870 bis Januar 1871
Ende 1870
Ende 1870 bis April 1871
Winter 1870–71 bis Herbst 1872
1871
Anfang 1871
Februar 1871
Frühjahr 1871
Frühjahr bis Herbst 1871
Frühjahr 1871 bis Anfang 1872
Juli 1871
Sommer 1871 bis Frühjahr 1872
September bis Oktober 1871
Ende 1871 bis Frühjahr 1872
Sommer 1872 bis Anfang 1873 [1]
Sommer 1872
Sommer 1872 bis Anfang 1873 [2]
September 1872
Winter 1872–73 [1]
Winter 1872–73 [2]
Winter 1872–73 [3]
Frühjahr 1873
Frühjahr bis Herbst 1873 [1]
Frühjahr bis Herbst 1873 [2]
Sommer bis Herbst 1873
Herbst 1873 bis Winter 1873–74 [1]
Herbst 1873 bis Winter 1873–74 [2]
Anfang 1874 bis Frühjahr 1874
Januar bis Februar 1874
Frühjahr bis Sommer 1874 [1]
Frühjahr bis Sommer 1874 [2]
Mai 1874
Ende 1874 [1]
Ende 1874 [2]
Fragmente 1875–1879
Winter bis Frühling 1875
Bis Anfang März 1875
März 1875
Frühling 1875
Frühling bis Sommer 1875
Sommer(?) 1875
1875
Sommer 1875 [1]
Sommer 1875 [2]
Sommer 1875 [3]
Sommer 1875 [4]
Sommer bis Ende September 1875
Sommer bis Herbst 1875
Herbst 1875 bis Frühling 1876
Frühling 1876(?)
1876
Sommer 1876
September 1876
Oktober bis Dezember 1876
Winter 1876 bis 1877
Ende 1876 bis Sommer 1877 [1]
Frühling bis Sommer 1877
Ende 1876 bis Sommer 1877 [2]
Herbst 1877 [1]
Herbst 1877 [2]
Winter 1877 bis 1878
Frühling bis Sommer 1878 [1]
Frühling bis Sommer 1878 [2]
Sommer 1878 [1]
Sommer 1878 [2]
Sommer 1878 [3]
Herbst 1878 [1]
Herbst 1878 [2]
Herbst 1878 [3]
Herbst 1878 [4]
Herbst 1878 [5]
November 1878
November bis Dezember 1878
1878 bis Juli 1879
Juni bis Juli 1879
Juli 1879
Juli bis August 1879 [1]
Juli bis August 1879 [2]
August 1879 [1]
August 1879 [2]
September bis Oktober 1879
September bis November 1879
Fragmente 1880–1882
Anfang 1880
Frühjahr 1880 [1]
Frühjahr 1880 [2]
Sommer 1880 [1]
Sommer 1880 [2]
Herbst 1880
Ende 1880
Winter 1880 bis 1881 [1]
Winter 1880 bis 1881 [2]
Frühjahr 1880 bis Frühjahr 1881
Frühjahr bis Herbst 1881 [1]
Frühjahr bis Herbst 1881 [2]
Frühjahr bis Herbst 1881 [3]
Frühjahr bis Herbst 1881 [4]
Herbst 1881 [1]
Herbst 1881 [2]
Herbst 1881 [3]
Herbst 1881 [4]
Dezember 1881 bis Januar 1882
Anfang 1882
Februar bis März 1882
Frühjahr 1882
Frühjahr bis Sommer 1882
Sommer 1882
[Fragmente 1882–1884]
Juli bis August 1882
Sommer bis Herbst 1882 [1]
Sommer bis Herbst 1882 [2]
November 1882 bis Februar 1883 [1]
November 1882 bis Februar 1883 [2]
Winter 1882 bis 1883
Frühjahr bis Sommer 1883
Sommer 1883 [1]
Mai bis Juni 1883
Juni bis Juli 1883 [1]
Juni bis Juli 1883 [2]
Sommer 1883 [2]
Sommer 1883 [3]
Sommer 1883 [4]
Sommer bis Herbst 1883
Herbst 1883 [1]
Herbst 1883 [2]
Herbst 1883 [3]
Herbst 1883 [4]
Herbst 1883 [5]
Herbst 1883 [6]
Ende 1883 [1]
Ende 1883 [2]
Winter 1883 bis 1884
Fragmente 1884–1885
Frühjahr 1884 [1]
Frühjahr 1884 [2]
Frühjahr 1884 [3]
Frühjahr 1884 [4]
Frühjahr 1884 [5]
Sommer bis Herbst 1884 [1]
Sommer bis Herbst 1884 [2]
Herbst 1884
Herbst 1884 bis Anfang 1885 [1]
Herbst 1884 bis Anfang 1885 [2]
Winter 1884 bis 1885 [1]
Winter 1884 bis 1885 [2]
Winter 1884 bis 1885 [3]
April bis Juni 1885
Mai bis Juli 1885
Juni bis Juli 1885 [1]
Juni bis Juli 1885 [2]
Juni bis Juli 1885 [3]
August bis September 1885 [1]
August bis September 1885 [2]
August bis September 1885 [3]
August bis September 1885 [4]
Herbst 1885 [1]
Herbst 1885 [2]
Herbst 1885 [3]
Fragmente 1885–1887
Herbst 1885 bis Frühjahr 1886
Herbst 1885 bis Herbst 1886
Anfang 1886 bis Frühjahr 1886 [1]
Anfang 1886 bis Frühjahr 1886 [2]
Sommer 1886 bis Herbst 1887
Sommer 1886 bis Frühjahr 1887
Ende 1886 bis Frühjahr 1887
Sommer 1887
Herbst 1887 [1]
Herbst 1887 [2]
Fragmente 1887–1889
November 1887 bis März 1888 [1]
November 1887 bis März 1888 [2]
November 1887 bis März 1888 [3]
November 1887 bis März 1888 [4]
Anfang 1888
Anfang 1888 bis Frühjahr 1888
Frühjahr 1888 [1a]
Frühjahr 1888 [1b]
Frühjahr 1888 [1c]
Frühjahr 1888 [1d]
Frühjahr 1888 [1e]
Frühjahr 1888 [2]
Frühjahr bis Sommer 1888
Mai bis Juni 1888
Juli bis August 1888
September 1888
Sommer 1888
Herbst 1888
September bis Oktober 1888
Oktober 1888
Oktober bis November 1888
Dezember 1888 bis Anfang Januar 1889
Briefe 1850
Briefe 1851
Briefe 1854
Briefe 1855
Briefe 1856
Briefe 1857
Briefe 1858
Briefe 1859
Briefe 1860
Briefe 1861
Briefe 1862
Briefe 1863
Briefe 1864
Briefe 1865
Briefe 1866
Briefe 1867
Briefe 1868
Briefe 1869
Briefe 1870
Briefe 1871
Briefe 1872 (a)
Briefe 1872 (b)
Briefe 1872 (c)
Briefe 1872 (d)
Briefe 1873
Briefe 1874
Briefe 1875
Briefe 1876
Briefe 1877
Briefe 1878
Briefe 1879
Briefe 1880
Briefe 1881
Briefe 1882 (a)
Briefe 1882 (b)
Briefe 1882 (c)
Briefe 1882 (d)
Briefe 1883 (a)
Briefe 1883 (b)
Briefe 1883 (c)
Briefe 1883 (d)
Briefe 1884
Briefe 1885
Briefe 1886 (a)
Briefe 1886 (b)
Briefe 1886 (c)
Briefe 1886 (d)
Briefe 1887 (a)
Briefe 1887 (b)
Briefe 1887 (c)
Briefe 1887 (d)
Briefe 1888 (a)
Briefe 1888 (b)
Briefe 1888 (c)
Briefe 1888 (d)
Briefe 1888 (e)
Briefe 1888 (f)
Briefe 1889
Fussnoten
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
N e w s l e t t e r
Links
Zu guter Letzt
Nietzsche als ästhetisches Phänomen
Von
Tobias Kurth
[Dieser Essay beruht auf dem Vortrag “Nietzsche als Vorläufer einer Großrevolution der Kunst”, gehalten beim Internationalen Nietzsche-Kongress in Naumburg (Saale) am 28.08.2009.]
Der nachfolgende Beitrag möchte nicht in erster Linie vermeintlich annähernd objektiven wissenschaftlichen Standards genügen, sondern zuallererst Ausdruck einer möglicherweise sehr subjektiven Auffassung sein, resultierend aus einer mittlerweile relativ lang anhaltenden, aus einem persönlichen Impuls bzw. Interesse entstandenen und geleiteten Beschäftigung mit Nietzsche.
Nietzsche ist nach der hier vertretenen Auffassung in mindestens doppelter Hinsicht eine Figur der Zukunft. Einerseits hat Nietzsche, sensibel für kulturelle Strömungen wie er war, später offen zutage tretende gesellschaftliche Entwicklungen antizipiert, andererseits steht er selbst für eine Art von Lebensform, für einen Figurentypus, dessen zukünftiges Heraufkommen und letztlich Machtübernahme er sich herbeiwünschte und verkündete. Doch damit sind keinesfalls jene tumben und primitiven Größenphantasien der Nazis gemeint, die in ihrem gesamten Sein eher das genaue Gegenteil dessen gewesen sein dürften, was Nietzsche vorgeschwebt haben mag.
Nietzsches Leben scheint, zumindest aus der Distanz betrachtet, ganz seinem eigenen Credo zu entsprechen, nämlich, dass das Leben nur als ästhetisches Phänomen zu rechtfertigen sei. Es gibt wohl kaum ein drastischeres Beispiel für das Verschmelzen von ´Fiktion´ und ´Realität´ als das des Erschaffers des Zarathustra und des Mythos vom „Übermenschen“, welcher im fortgeschrittenen Stadium der bei ihm diagnostizierten progressiven Paralyse seine Briefe mitunter als „Dionysos“ oder „Der Gekreuzigte“ unterzeichnet und vollends eins zu werden scheint mit seinen bis dahin geschaffenen Werken und Figuren.
Diese ´Symbiosen´ Nietzsches finden zwar ihren stärksten Ausdruck nach dessen geistigem Zusammenbruch; im Wahnsinn werden jedoch die zuvor ohnehin nur scheinbar existenten Grenzen wie selbstverständlich aufgehoben, und beinahe wirkt diese vollständige Auflösung nichts anderes als konsequent. Es tritt das ein, was Nietzsche früh antizipiert zu haben scheint, und das, was er Zeit seines Lebens gefürchtet hat: er fällt in geistige Umnachtung, er stirbt einen frühen Tod. Wenngleich es eine Vielzahl von Ansätzen zur medizinischen oder psychologischen Erklärung seines geistigen Zusammenbruchs gegeben hat , konnte keine dieser Annahmen durch klinische Befunde tatsächlich einwandfrei bewiesen werden. Es handelt sich bei diesen Erklärungsversuchen durchweg um Deutungen, die aber immer den Anschein erwecken, das Phänomen nicht vollständig fassen zu können.
Gemäß einer hier vertretenen Logik des Dritten, ist die Ursache des angesprochenen Sachverhalts in einem Dazwischen zu suchen. Die Frage nach ´Krankheit´ als alleiniger Erklärung stellt sich in diesem Zusammenhang im Grunde überhaupt nicht.
Im späteren deliranten Zustand zeigt sich bei Nietzsche lediglich in ungefilterter und somit reineren Form, sozusagen in einer freien Zirkulation der Diskurse, was auch schon zuvor immer vorhanden war, nämlich der mögliche Übergang von der vermeintlichen Fiktion zur vermeintlichen Realität und umgekehrt, die Entwicklung von Symbiosen und Figurationen des Dritten jenseits aller dualistischen Ordnungsprinzipien.
Nietzsches ganze Philosophie zielt auf die Überwindung des Nihilismus´, wohlgemerkt als psychologischer Zustand , welcher den Menschen bedroht, wenn ihm die absolute Absurdität des Daseins in ihrer ganzen Tragweite bewusst wird. Und wodurch würde dies deutlicher werden, als durch die Erkenntnis der eigenen Vergänglichkeit, des ´Alles-ist-umsonst´? Der Aspekt des Todes verlangt, wenn es um Nietzsches ´Wahnsinn´ geht, nach eingehender Betrachtung.
Der erschütternde Einschlag der absoluten Sinnlosigkeit des Seins in Anbetracht des Missverhältnisses zwischen der Endlichkeit des menschlichen Lebens (traumatische Erfahrung des Todes im Leben des Kindes Nietzsche; er verlor als Vier- und Fünfjähriger in kurzer Folge Vater und Bruder ) und der Unendlichkeit von Raum und Zeit und die immer stärker stattfindende Ästhetisierung des Lebens bzw. die Entfremdung vom Vorhandenen und die Konstruktion eines individuellen Weltbildes, als ein Versuch, der drohenden Auflösung des Ichs (sei es durch narzisstische Kränkung, Angst, Wahnsinn oder durch das Nichts, den Tod selbst) eine – sozusagen kompensierende – poetische Verdichtung entgegenzusetzen, stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Die Verinnerlichung des Todes und der Begrenztheit der eigenen Existenz, dies ist die zugrunde liegende These des hier vertretenen Ansatzes, hat – wie nichts anderes – Einfluss genommen auf Nietzsches Verhältnis zum Leben und seine gesamte Philosophie zur Überwindung des Nihilismus´. Wenn man die eigene Vergänglichkeit verinnerlicht hat, sich die Unendlichkeit eigener Nicht-Existenz sozusagen Bahn bricht in die Endlichkeit der eigenen Existenz und sich dort verankert, so nimmt dies Einfluss auf alles, was man von da an mit seinem begrenzten Leben anstellt, und darauf, wie man die Welt betrachtet.
Eine Figur wie Nietzsche, die einmal das Absolute der Unendlichkeit, das Unabänderbare der eigenen Vergänglichkeit und die totale Gleichgültigkeit der menschlichen Existenz in seinem wirklichen Ausmaß erfasst und ein Sensorium entwickelt hat für die Bemühungen der Menschheit, all dies zu verschleiern und zu übertünchen, eine solche Figur gelangt schließlich zwangsläufig zu einer Anschauung der im Grunde rein fiktionalen Konstruktionsmechanismen lebensweltlicher Wirklichkeit. Scheinbar verbindliche (insbesondere dualistisch geprägte) Ordnungen werden im Grunde völlig obsolet. Die Wahrheit liegt jeweils immer in einem Dazwischen, in einem Dritten, und jeglicher ´Realismus´ kann in Frage gestellt werden. Wie kann sich das Individuum nun noch retten, wenn auch mögliche Tröstungen, wie die der Religionen oder andere Heilsangebote, nicht mehr verfangen, weil sie als reine Erfindung durchschaut worden sind? Man muss eine neue, eine subjektiv besser funktionierende sinnstiftende Fiktion entwerfen.
Der ´Übermensch´ ist das letzte Prinzip, das Nietzsche dem fortschreitenden Nihilismus entgegensetzt. Obwohl es augenscheinlich keinen höheren Sinn im Leben gibt, bejaht der Übermensch es in seiner Absurdität; das Ideal des Übermenschen, als letzte Möglichkeit wahren Menschtums, wird für Nietzsche zum Sinn des Lebens, der in der finalen Krise der abendländischen Kultur den durch die wahrheitssuchende Aufklärung „getöteten Gott“ ersetzen muss, denn durch den „Tod Gottes“, einer universellen menschheitsgeschichtlichen ´Leistung´, deren Vollzug aber im Leben der Menschen eine große metaphysische Lücke erzeugt hat, droht der Rückfall der Menschheit in die Barbarei, solange sich die Menschen nicht nachträglich dieser Tötung als würdig erweisen, indem sie selbst sozusagen zu „Göttern“, zu Schaffenden werden, zu „Übermenschen“. Die Idee vom Übermenschen kann verstanden werden als das Dritte zwischen Mensch und Gott, aber auch als das ins Höchste strebende kulturelle Potential einerseits wie gleichwohl das möglichst ungefilterte Ausleben natürlicher Instinkte und Triebzustände andererseits.
Der Übermensch ist jedoch ein rein ästhetisches Konstrukt, welches niemals zur Vollendung, zur realen Umsetzung gelangen wird. Es ist reinste Metaphysik. Nietzsche geht es um den Figurentypus, der in Richtung dieses Ideals strebt und damit „ein Ziel erstrebt, gegen welches er gar nicht mehr in Betracht kommt“ , also ein Ziel, das weit über ihn hinausgeht – so weit, dass es unerreichbar bleiben muss. Dieser Heroismus, dieses sich selbst nicht schonende Streben nach dem Unerreichbaren, ist ein Drittes zwischen Sieg und Untergang, der Weg zwischen Krankheit und Gesundheit, es ist die Genesung, die Selbstüberwindung. Es geht Nietzsche darum, den positiven Charakter des Fehlens einer klaren Zielvorgabe im Dasein zu erleben. Die vermeintliche Lücke wird zum eigentlichen Ziel, das Denken verlässt die tradierten Bahnen und öffnet sich der Unsicherheit und damit einer beinahe unendlichen Vielfalt an Möglichkeiten. – Das Leben hat keinen ´von oben´ eingegebenen Sinn. – Aber wozu braucht es einen solchen Sinn? Wenn es keinen von oben oder woher auch immer eingegebenen Sinn gibt, gibt es auch keine verbindlichen Vorgaben, die zu erfüllen wären, und das bedeutet: Freies Aufspielen. Nur so ist großes Leben denkbar.
So wie sich der Zögling vom Erzieher loslösen und der Selbsterziehung zuwenden soll, so sollte sich das Individuum von den staatlich anerzogenen Gewohnheiten, den gesellschaftlichen Zwängen, der Bedenkenträgerei und dem indoktrinierten Sicherheitsdenken loslösen. Sicherheit ist immer nur vorgegaukelt. Es gibt keine letzten Sicherheiten, so wie es auch keine Letztbegründung des Seins gibt.
Der Sinn des Lebens obliegt jedem Einzelnen selber – man muss in der Lage sein, sich selbst die Frage zu beantworten, sich gegenüber dem eigenen Ideal zu rechtfertigen, warum man gerade auf die gewählte Weise lebt und nicht anders. Es gibt keine vorgegebenen Ziele, und man muss, kann, darf und soll sich den Weg in jedem Moment durch eigene Entscheidungen selber schaffen. Der Gefahr einer gewissen Orientierungslosigkeit hierbei und dem drohenden Nihilismus wird Intensität entgegengesetzt. Zentral hierfür ist die ästhetische Kategorie der ´Potenzierung´: das eigene Leben wird mit Bedeutung aufgeladen, es wird keine Sicherheit gesucht, sondern ausschließlich Intensität. Nicht unbedingt lange leben wollen, sondern auf die eigene Weise: Der Figurentypus, der diesem Bild am ehesten entspricht und zudem auch in der Lebenswelt anzutreffen ist, möchte mitspielen, nicht nur staunend oder hilflos davor stehen bleiben, sondern sich eine eigene Welt schaffen, zumindest aber die vorhandene nach eigenen Vorstellungen abändern. Die Art und Weise, wie man in der Welt lebt, wie man der Welt den eigenen Maßstab anlegt, wird zu einer Frage des eigenen Geschmacks. Es geht darum, die Welt durch das eigene Sein und Handeln zu verändern und zur eigenen Welt zu machen. Und Nietzsche traut der Kunst und sich selbst in dieser Hinsicht alles zu.
Es ließe sich zum Beispiel der Spur nachgehen, dass Nietzsche die Figur Zarathustra wählte, um durch eine Umwandlung des historischen Zarathustra und dessen Lehre, durch „Selbstüberwindung der Moral aus Wahrhaftigkeit, die Selbstüberwindung des Moralisten in seinen Gegensatz“, sich chronologisch vor die Entwicklung des Christentums (dessen Lehre deutliche Parallelen zu der des historischen Zarathustra aufweist und im Übrigen genealogisch mit jener verknüpft sein könnte ) zu setzen und durch seine ´Anti-Bibel´ möglicherweise den fiktiven Versuch unternimmt, sozusagen durch eine Art „Interventionsphantasie“, die christliche Geschichte ungeschehen zu machen – oder, in einer auf den ersten Blick ebenso wahnwitzig anmutenden Annahme, davon ausgeht, durch diesen Text radikal kulturstiftend wirken zu können und so die Geschichte der christlichen Kirche zu einem Ende zu bringen. Auch hier zeigt sich, wie die vermeintlich klaren Grenzen von ´Fiktion´ und ´Realität´ verwischen. An die Stelle des getöteten Gottes tritt bei Zarathustra bzw. Nietzsche der Übermensch, als repräsentatives Modell der „Artisten-Metaphysik“. Der Zarathustra soll Nietzsches Anti-Bibel und Artisten-Evangelium sein und die Menschheitsgeschichte im Sinne seines Schöpfers abändern.
Diese Vision erscheint auf den ersten Blick völlig albern. Aus einer Logik des Dritten heraus ist es aber eine durchaus absolut berechtigte Frage, warum der eine Text/die eine Fiktion (nämlich “Das Neue Testament”) kulturstiftend wirkt und dies als vollkommene Selbstverständlichkeit betrachtet und hingenommen wird, während ein solches für den anderen Text/die andere Fiktion (nämlich “Also sprach Zarathustra”) aus Sicht der meisten Menschen jedoch sicherlich außerhalb des Vorstellbaren liegt. Für Nietzsche aber bestehen derartige Selbstverständlichkeiten, die allein auf regulativen Konventionen und tradierten, dualistisch geprägten (Denk-)Gewohnheiten beruhen, nicht. Er überschreitet die willkürlich gesetzte Grenzschwelle zur Fiktion, übersetzt sich selbst in das Medium der Literatur und gestaltet sich und sein Leben zum Kunstwerk.
Wenn man sich jenseits einer Unterscheidung von ´Realität´ und ´Fiktion´ befindet, es keine wirklichen Verbindlichkeiten gibt, da diese nicht mehr über ihre eigene Bedingtheit hinwegzutäuschen vermögen, dann wird das Leben zum freien Versuchsfeld, das eigene Dasein zur kreativen „Experimental-Existenz“ , zum ästhetischen Phänomen.
In dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Hauptwerk von Ernest Becker “The Denial of Death” findet sich eine Passage, die sich beinahe eineindeutig auf Nietzsche zu beziehen scheint, obwohl dem meines Wissens nicht so ist:
The key to the creative type is that he is separated out of the common pool of shared meanings. There is something in his life experience that makes him to take in the world as a problem; as a result he has to make personal sense out of it. This holds true for all creative people to a greater or lesser extent, but it is especially obvious with the artist. Existence becomes a problem that needs an ideal answer; but when you no longer accept the collective solution to the problem of existence, then you must fashion your own. The work of art is, then, the ideal answer of the creative type to the problem of existence as he takes it in – not only existence of the external world, but especially his own: who he is as a painfully separate person with nothing shared to lean on. He has to answer to the burden of his extreme individuation, his so painful isolation. He wants to know how to earn immortality as a result of his own unique gifts. His creative work is at the same time the expression of his heroism and the justification of it. It is his “private religion” […]. Its uniqueness gives him personal immortality; it is his own “beyond” and not that of others.
(Ernest Becker: The Denial of Death. New York 1973, S. 171.)
Die Figur Nietzsche steht stellvertretend für eine Lebensform, die die aufklaffende metaphysische Lücke, welche ehemals durch die nun nicht mehr hinreichend greifenden Religionen oder sonstigen Weltanschauungen besetzt war, mit Kunst auffüllt. Die Kunst ist hier das Letzte, das bleibt, wenn nichts anderes mehr verfängt.
Nietzsche als Vorläufer einer Großrevolution der Kunst – wäre es nicht denkbar, dass Nietzsches Werk und er selbst erst jetzt, allmählich, im 21. Jahrhundert, die Leser und Nachfolger findet und finden kann, welche in der Lage sind, nicht nur ihm zu folgen, sondern über ihn hinaus zu gehen, wie er es selbst mancherorts vermutete? Figuren, die – gleich ihm – ihr eigenes Leben als Experimental-Existenz verstehen und gestalten, die sich nicht um verkündete Wirtschaftskrisen, um gesellschaftlich vorgegebene Lebenslaufschablonen oder gar die lächerliche, infiltrierende und das System stabilisierende Lehre von der Notwendigkeit einer Altersvorsorge schon mit 20 kümmern? – Es gibt keine Sicherheiten. Aber es gibt Menschen und wird sicher zunehmend mehr Menschen geben, denen die von der Gesellschaft ´zur Verfügung gestellten´ Fiktionen einer durchdigitalisierten Plastikwelt nicht hinreichend konsistent oder sinnstiftend erscheinen, um über die Absurdität des Daseins hinwegzutäuschen, und daher einer eigenen allumfassenden Fiktion bedürfen, eines entrückten Gegenentwurfes, einer Alternative zum Vorhandenen.
Die einzige Form der Fiktion, die hier noch in Betracht kommt, nachdem alles andere versagt hat, ist die des destabilisierenden Potentials der Kunst, eine Form der Fiktion, die vermeintlich starre Grenzen und Gesetzmäßigkeiten aus den Angeln hebt und viel mehr als das Vorhandene möglich macht.
Die Menschen erfinden und nutzen Bilder; sie leben schließlich in nichts anderem als einer institutionalisierten Fiktion, in der sich tradierte Vorstellungen und Begriffe wechselseitig geltend machen und über ihre mangelnde Legitimierung mittels eines übergeordneten Autors hinwegtäuschen müssen, um weiterhin ihre Gültigkeit als regulative Fiktion bewahren zu können; nur eben ist ihr Ausdruck überwiegend der des Einfallslosen, der grauen Tristesse, des Eindimensional-Ausschließenden, des Intoleranten und Diskriminierenden. Es gilt also, letztlich andere Möglichkeiten der Fiktion respektive Poesie stark zu machen. Die Kunst, als letzte Alternative, bietet diese Möglichkeiten zur Veränderung der Welt.
Der Figurentypus, der zu einer Metamorphose der Wirklichkeit durch die Einflussnahme der Kunst führen kann und von der Figur Nietzsche vorweggenommen wird, ist derjenige der Experimental-Existenzen. Und diese Menschen müssen noch nicht einmal unbedingt etwas mit Kunstproduktion im eigentlichen bzw. herkömmlichen Sinne zu tun haben. Denn es sind damit nicht notwendigerweise diejenigen gemeint, die womöglich als Künstler gelten, bloß weil sie Bilder oder ähnliches zu horrenden Preisen verkaufen können, weil es ihnen die Gesetzmäßigkeiten des Marktes erlauben; sondern es sind die wirklichen Künstler gemeint, deren mögliche Kunstproduktion – wenn stattfindend – eher als eine Neben- und Begleiterscheinung zu betrachten ist, die ihr gesamtes Leben zu einem Kunstwerk gestalten, allein weil sie die Welt mit ästhetischen Augen betrachten – und auch gar nicht anders können, unter den gegebenen Umständen.
Solcherart Mensch ist sich des Scheincharakters des ´Wirklichen´, des Fehlens mit Gewissheit erkennbarer Wahrheiten genauso bewusst wie seines eigenen begrenzten Lebens als einzige vorhandene und letzte Gelegenheit. So entsteht eine Experimental-Existenz, die einfach macht, anstatt zu zögern, für die es keine Unmöglichkeiten gibt, die ungewisse Wege einschlägt, die nicht einfach nur staunend vor den Dingen stehen bleibt oder rational zu erklären versucht, sondern mitspielt, ein Mitspieler im Spiel der Welt sein möchte, einen eigenen Beitrag leistet – wie eigenartig auch immer der aussehen mag.
U n s e r e l e t z t e D a n k b a r k e i t g e g e n d i e K u n s t. – Hätten wir nicht die Künste gut geheissen und diese Art von Cultus des Unwahren erfunden: so wäre die Einsicht in die allgemeine Unwahrheit und Verlogenheit, die uns jetzt durch die Wissenschaft gegeben wird – die Einsicht in den Wahn und Irrthum als eine Bedingung des erkennenden und empfindenden Daseins −, gar nicht auszuhalten. Die R e d l i c h k e i t würde den Ekel und den Selbstmord im Gefolge haben. Nun aber hat unsere Redlichkeit eine Gegenmacht, die uns solchen Consequenzen ausweichen hilft: die Kunst, als den g u t e n Willen zum Scheine. Wir verwehren es unserm Auge nicht immer, auszurunden, zu Ende zu dichten: und dann ist es nicht mehr die ewige Unvollkommenheit, die wir über den Fluss des Werdens tragen – dann meinen wir, eine
G ö t t i n zu tragen und sind stolz und kindlich in dieser Dienstleistung. Als ästhetisches Phänomen ist uns das Dasein immer noch e r t r ä g l i c h, und durch die Kunst ist uns Auge und Hand und vor Allem das gute Gewissen dazu gegeben, aus uns selber ein solches Phänomen machen zu k ö n n e n.
(Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. (KSA) Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Bd. 3: Die fröhliche Wissenschaft, Zweites Buch (107). Berlin/New York 1999, S. 464.)
Sokrates und die griechische Tragoedie.
VonDr Friedrich Nietzsche.Professor in Basel.
Basel.1871.
I
Die griechische Tragoedie ist anders zu Grunde gegangen als sämmtliche ältere schwesterlichen Kunstgattungen; sie starb durch Selbstmord, in Folge eines unlösbaren Confliktes, also tragisch, während jene alle in hohem Alter des schönsten und ruhigsten Todes verblichen sind. Wenn es nämlich einem glücklichen Naturzustande gemäss ist, mit schöner Nachkommenschaft und ohne Krampf vom Leben zu scheiden, so zeigt uns das Ende jener älteren Kunstgattungen einen solchen glücklichen Naturzustand: sie tauchen langsam unter, und vor ihren ersterbenden Blicken steht schon ihr schönerer Nachwuchs und reckt mit muthiger Gebärde ungeduldig das Haupt. Mit dem Tode der griechischen Tragoedie dagegen entstand eine ungeheure, überall tief empfundene Leere; wie einmal griechische Schiffer zu Zeiten des Tiberius an einem einsamen Eiland den erschütternden Schrei hörten: „der grosse Pan ist todt“: so klang es jetzt wie ein schmerzlicher Klageton durch die hellenische Welt: „die Tragoedie ist todt! Die Poesie selbst ist mit ihr verloren gegangen! Fort, fort mit euch verkümmerten, abgemagerten Epigonen! Fort in den Hades, damit ihr euch dort an den Brosamen der vormaligen Meister einmal satt essen könnt!“
Als aber nun doch noch eine neue Kunstgattung aufblühte, die in der Tragoedie ihre Vorgängerin und Meisterin verehrte, da war mit Schrecken wahrzunehmen, dass sie allerdings die Züge ihrer Mutter trage, aber dieselben, die jene in ihrem langen Todeskampfe gezeigt hatte. Diesen Todeskampf der Tragoedie kämpfte Euripides; jene spätere Kunstgattung ist als neuere attische Komoedie bekannt. In ihr lebte die entartete Gestalt der Tragoedie fort, zum Denkmale ihres überaus mühseligen und gewaltsamen Hinscheidens.
Bei diesem Zusammenhange ist die leidenschaftliche Zuneigung begreiflich, welche die Dichter der neueren Komoedie zu Euripides empfanden; so dass der Wunsch des Philemon nicht weiter befremdet, der sich sogleich aufhängen lassen mochte, nur um den Euripides in der Unterwelt aufsuchen zu können: wenn er nur überhaupt überzeugt sein dürfte, dass der Verstorbene auch jetzt noch bei Verstande sei. Will man aber in aller Kürze und ohne den Anspruch, damit etwas Erschöpfendes zu sagen, dasjenige bezeichnen, was Euripides mit Menander und Philemon gemein hat und was für jene so aufregend-vorbildlich wirkte: so genügt es zu sagen, dass der Zuschauer von Euripides auf die Bühne gebracht worden ist. Wer erkannt hat, aus welchem Stoffe die prometheischen Tragiker vor Euripides ihre Helden formten und wie ferne ihnen die Absicht lag, die treue Maske der Wirklichkeit auf die Bühne zu bringen, der wird auch über die gänzlich abweichende Tendenz des Euripides im Klaren sein. Der Mensch des alltäglichen Lebens drang durch ihn aus den Zuschauerräumen auf die Scene, der Spiegel, in dem früher nur die grossen und kühnen Züge zum Ausdruck kamen, zeigte jetzt jene peinliche Treue, die auch die misslungenen Linien der Natur gewissenhaft wieder gibt. Odysseus, der typische Hellene der ältern Kunst, sank jetzt unter den Händen der neuern Dichter zur Figur des Graeculus herab, der von jetzt ab als gutmüthig-verschmitzter Haussklave im Mittelpunkte des dramatischen Interesses steht. Was Euripides sich in den aristophanischen Fröschen zum Verdienst anrechnet, dass er die tragische Kunst durch seine Hausmittel von ihrer pomphaften Beleibtheit befreit habe, das ist vor allem an seinen tragischen Helden zu spüren. Im Wesentlichen sah und hörte jetzt der Zuschauer seinen Doppelgänger auf der euripideischen Bühne und freute sich, dass jener so gut zu reden verstehe. Bei dieser Freude blieb es aber nicht: man lernte selbst bei Euripides sprechen, und dessen rühmt er sich selbst im Wettkampfe mit Aeschylus: wie durch ihn jetzt das Volk kunstmässig und mit den schlausten Sophistikationen zu beobachten, zu verhandeln und Folgerungen zu ziehen gelernt habe. Durch diesen Umschwung der öffentlichen Sprache hat er überhaupt die neuere Komoedie möglich gemacht. Denn von jetzt ab war es kein Geheimniss mehr, wie und mit welchen Sentenzen die Alltäglichkeit sich auf der Bühne vertreten könne. Die bürgerliche Mittelmässigkeit, auf die Euripides alle seine politischen Hoffnungen gründete, kam jetzt zu Wort, nachdem bis dahin in der Tragoedie der Halbgott, in der Komoedie der betrunkene Satyr oder der Halbgott den Sprachcharakter bestimmt hatten. Und so hebt der aristophanische Euripides zu seinem Preise hervor, wie er das allgemeine, allbekannte, alltägliche Leben und Treiben dargestellt habe, über das ein Jeder zu urtheilen befähigt sei. Wenn jetzt die ganze Masse philosophiere und mit unerhörter Klugheit Land und Gut verwalte, Processe führe, u.s.w., so sei dies sein Verdienst und der Erfolg der von ihm dem Volke eingeimpften Weisheit.
An eine derartig zubereitete und aufgeklärte Masse durfte sich jetzt die neuere Komoedie wenden, für die Euripides gewissermassen der Chorlehrer geworden ist; nur dass diesmal der Chor der Zuschauer eingeübt werden musste. Sobald dieser in der euripideischen Tonart zu singen geübt war, erhob sich die schachspielartige Gattung des Schauspiels, die neuere Komoedie mit ihrem fortwährendem Triumphe der Schlauheit und Verschlagenheit. Euripides aber — der Chorlehrer — wurde unaufhörlich gepriesen: ja man würde sich getödtet haben, um noch mehr von ihm zu lernen, wenn man nicht gewusst hätte, dass die tragischen Dichter eben so todt seien als die Tragoedie. Mit ihr aber hatte der Hellene den Glauben an seine Unsterblichkeit aufgegeben, nicht nur den Glauben an eine ideale Vergangenheit, sondern auch den Glauben an eine ideale Zukunft. Das Wort aus der bekannten Grabschrift „als Greis leichtsinnig und grillig“ gilt auch vom greisen Hellenenthume. Der Augenblick, der Witz, der Leichtsinn, die Laune sind seine höchsten Gottheiten; der fünfte Stand, der des Sklaven, kommt, wenigstens der Gesinnung nach, jetzt zur Herrschaft: und wenn jetzt überhaupt noch von „griechischer Heiterkeit“ die Rede sein darf, so ist es die Heiterkeit des Sklaven, der nichts Schweres zu verantworten, nichts Grosses zu erstreben, nichts Vergangenes oder Zukünftiges höher zu schätzen weiss als das Gegenwärtige. Dieser Schein der „griechischen Heiterkeit“ war es, der die tiefsinnigen und furchtbaren Naturen der vier ersten Jahrhunderte des Christenthums so empörte: ihnen erschien diese weibische Flucht vor dem Ernst und dem Schrecken, dieses feige sich Genügenlassen am bequemen Genuss nicht nur verächtlich, sondern als die eigentlich antichristliche Gesinnung. Und ihrem Einfluss ist es zuzuschreiben, dass die durch Jahrhunderte fortlebende Anschauung des griechischen Alterthums mit fast unüberwindlicher Zähigkeit jene blassrothe Heiterkeitsfarbe festhielt — als ob es nie ein sechstes Jahrhundert mit seiner Geburt der Tragoedie, seinen Mysterien, seinen Empedocles und Heraclit gegeben habe, ja als ob die Kunstwerke der grossen Zeit gar nicht vorhanden seien, die doch — jedes für sich — aus dem Boden einer solchen greisenhaften und sklavenmässigen Daseinslust und Heiterkeit gar nicht zu erklären sind und auf eine völlig andere Weltbetrachtung als ihren Existenzgrund hinweisen.
Wenn zuletzt behauptet wurde, dass Euripides den Zuschauer auf die Bühne gebracht habe, um zugleich damit den Zuschauer zum Urtheil über das Drama erst wahrhaft zu befähigen, so entsteht der Schein, als ob die ältere tragische Kunst aus einem Missverhältniss zum Zuschauer nicht herausgekommen sei: und man möchte versucht sein, die radikale Tendenz des Euripides, ein entsprechendes Verhältniss zwischen Kunstwerk und Publikum zu erzielen, als einen Fortschritt über Sophokles hinaus zu preisen. Nun aber ist „Publikum“ nur ein Wort und durchaus keine gleichartige und in sich verharrende Grösse. Woher soll dem Künstler die Verpflichtung kommen, sich einer Kraft zu akkommodiren, die ihre Stärke nur in der Zahl hat? Und wenn er sich, seiner Begabung und seinen Absichten nach, über jeden Einzelnen dieser Zuschauer erhaben fühlt, wie dürfte er vor dem gemeinsamen Ausdruck aller dieser ihm untergeordneten Kapacitäten mehr Achtung empfinden als vor dem relativ höchst begabten einzelnen Zuschauer? In Wahrheit hat kein griechischer Künstler mit grösserer Verwegenheit und Selbstgenugsamkeit sein Publikum durch ein langes Leben hindurch behandelt als gerade Euripides: er, der selbst da noch, als die Masse sich ihm zu Füssen warf, in erhabenem Trotze seiner eigenen Tendenz öffentlich in’s Gesicht schlug, derselben Tendenz, mit der er über die Masse gesiegt hatte. Wenn dieser Genius die geringste Ehrfurcht vor dem Pandämonium des Publikums gehabt hätte, so wäre er unter den Keulenschlägen seiner Misserfolge längst vor der Mitte seiner Laufbahn zusammengebrochen. Wir sehen bei dieser Erwägung, dass unser Ausdruck, Euripides habe den Zuschauer auf die Bühne gebracht, um den Zuschauer wahrhaft urtheilsfähig zu machen, nur ein provisorischer war, und dass wir nach einem tieferen Verständniss seiner Tendenz zu suchen haben. Umgekehrt ist es ja allerseits bekannt, wie Aeschylus und Sophokles Zeit ihres Lebens, ja weit über dasselbe hinaus, im Vollbesitze der Volksgunst standen, wie also bei diesen Vorgängern des Euripides keineswegs von einem Missverhältniss zwischen Kunstwerk und Publikum die Rede sein kann. Was trieb den reichbegabten und unablässig zum Schaffen gedrängten Künstler so gewaltsam von dem Wege ab, über dem die Sonne der grössten Dichternamen und der unbewölkte Himmel der Volksgunst leuchteten? Welche sonderbare Rücksicht auf den Zuschauer führte ihn dem Zuschauer entgegen? Wie konnte er aus zu hoher Achtung vor seinem Publikum — sein Publikum nicht achten?
Euripides fühlte sich — das ist die Lösung des eben dargestellten Räthsels — als Dichter wohl über die Masse, nicht aber über zwei seiner Zuschauer erhaben: die Masse brachte er auf die Bühne, jene beiden Zuschauer verehrte er als die allein urtheilsfähigen Richter und Meister aller seiner Kunst: ihren Weisungen und Mahnungen folgend übertrug er die ganze Welt von Empfindungen, Leidenschaften und Zuständen, die bis jetzt auf den Zuschauerbänken als unsichtbarer Chor zu jeder Festvorstellung sich einstellten, in die Seelen seiner Bühnenhelden, ihren Forderungen gab er nach, als er für diese neuen Charaktere auch das neue Wort und den neuen Ton suchte, in ihren Stimmen allein hörte er die gültigen Richtersprüche seines Schaffens ebenso wie die siegverheissende Ermuthigung, wenn er von der Justiz des Publikums sich wieder einmal verurtheilt sah.
Von diesen beiden Zuschauern ist der Eine — Euripides selbst, Euripides als Denker, nicht als Dichter. Von ihm könnte man sagen, dass die ausserordentliche Fülle seines kritischen Talentes, ähnlich wie bei Lessing, einen produktiv künstlerischen Nebentrieb wenn nicht erzeugt, so doch fortwährend befruchtet habe. Mit dieser Begabung, mit aller Helligkeit und Behendigkeit seines kritischen Denkens hatte Euripides im Theater gesessen und sich angestrengt, an den Meisterwerken seiner grossen Vorgänger wie an dunkelgewordenen Gemälden Zug um Zug, Linie um Linie wieder zu erkennen. Und hier nun war ihm begegnet, was dem in die tieferen Geheimnisse der äschyleischen Tragoedie Eingeweihten nicht unerwartet sein darf: er gewahrte etwas Incommensurables in jedem Zug und in jeder Linie, eine gewisse täuschende Bestimmtheit und zugleich eine räthselhafte Tiefe, ja Unendlichkeit des Hintergrundes. Die klarste Figur hatte immer noch einen Kometenschweif an sich der in’s Ungewisse, Unaufhellbare zu deuten schien. Dasselbe Zwielicht lag über dem Bau des Drama’s, zumal über der Bedeutung des Chors. Und wie zweifelhaft blieb ihm die Lösung der ethischen Probleme! Wie fragwürdig die Behandlung der Mythen! Wie ungleichmässig die Vertheilung von Glück und Unglück! Selbst in der Sprache der ältern Tragoedie war ihm vieles anstössig, mindestens räthselhaft; besonders fand er zuviel Pomp für einfache Verhältnisse, zuviel Tropen und Ungeheuerlichkeiten für die Schlichtheit der Charaktere. So sass er unruhig grübelnd im Theater, und er der Zuschauer, gestand sich, dass er seine grossen Vorgänger nicht verstehe. Galt ihm aber der Verstand als die eigentliche Wurzel alles Geniessens und Schaffens, so musste er fragen und um sich schauen, ob denn Niemand so denke wie er und sich gleichfalls jene Incommensurabilität eingestehe. Aber die Vielen und mit ihnen die besten Einzelnen hatten nur ein misstrauisches Lächeln für ihn; erklären aber konnte ihm Keiner, warum seinen Bedenken und Einwendungen gegenüber die grossen Meister doch im Rechte seien. Und in diesem qualvollen Zustande fand er den andern Zuschauer, der die Tragoedie nicht begriff und desshalb nicht achtete. Mit diesem im Bunde durfte er es wagen, aus seiner Vereinsamung heraus den ungeheuren Kampf gegen die Kunstwerke des Aeschylus und Sophokles zu beginnen — nicht mit Streitschriften, sondern als dramatischer Dichter, der seine Vorstellung von der Tragoedie der überlieferten entgegenstellt. —
Bevor wir diesen anderen Zuschauer bei Namen nennen, verharren wir hier einen Augenblick, um uns jenen Eindruck des Zwiespältigen und Incommensurabeln im Wesen der aeschyleischen Tragoedie selbst in’s Gedächtniss zurückzurufen. Denken wir an unsere eigene Befremdung dem Chore und dem tragischen Helden jener Tragoedie gegenüber, die wir mit unseren Gewohnheiten ebenso wenig als mit der Ueberlieferung zu reimen wussten — bis wir jene Doppelheit selbst als Ursprung und Wesen der griechischen Tragoedie wiederfanden, als den Ausdruck zweier in einander gewobenen Kunsttriebe, des Apollinischen und des Dionysischen.
Nach dieser Erkenntniss haben wir die griechische Tragoedie als den dionysischen Chor zu verstehen, der sich immer von neuem wieder in einer apollinischen Bilderwelt entladet. Jene Chorpartieen, mit denen die Tragoedie durchflochten ist, sind also gewissermassen der Mutterschooss des ganzen sogenannten Dialogs, d.h. der gesammten Bühnenwelt, des eigentlichen Drama’s. In mehreren auf einander folgenden Entladungen strahlt dieser Urgrund der Tragoedie jene Vision des Drama’s aus: die durchaus Traumerscheinung und insofern epischer Natur ist, andrerseits aber, als Objektivation eines dionysischen Zustandes, nicht die apollinische Erlösung im Scheine, sondern im Gegentheil das Zerbrechen des Individuums und sein Einswerden mit dem Ursein darstellt. Somit ist das Drama die apollinische Versinnlichung dionysischer Erkenntnisse und Wirkungen und dadurch wie durch eine ungeheure Kluft vom Epos abgeschieden.
Der Chor der griechischen Tragoedie, das Symbol der gesammten dionysisch erregten Masse, findet an dieser unserer Auffassung seine volle Erklärung. Während wir, mit der Gewöhnung an die Stellung eines Chors auf der modernen Bühne, zumal eines Opernchors, gar nicht begreifen konnten, wie jener tragische Chor der Griechen älter, ursprünglicher, ja wichtiger sein sollte, als die eigentliche „Aktion“, — wie dies doch so deutlich überliefert war — während wir wiederum mit jener überlieferten hohen Wichtigkeit und Ursprünglichkeit nicht reimen konnten, warum er doch nur aus niedrigen dienenden Wesen, ja zuerst nur aus bocksbeinigen Satyrn zusammengesetzt worden sei, während uns die Orchestra vor der Scene immer ein Räthsel blieb, sind wir jetzt zu der Einsicht gekommen, dass die Scene sammt der Aktion im Grunde und ursprünglich nur als Vision gedacht wurde, dass die einzige „Realität“ eben der Chor ist, der die Vision aus sich erzeugt und von ihr mit der ganzen Symbolik des Tanzes, des Tones und des Wortes redet. Dieser Chor schaut in seiner Vision seinen Herrn und Meister Dionysus und ist darum ewig der dienende Chor: er sieht wie dieser, der Gott, leidet und sich verherrlicht, und handelt desshalb selbst nicht. Bei dieser, dem Gotte gegenüber durchaus dienenden Stellung ist er doch der höchste, nämlich dionysische Ausdruck der Natur und redet darum, wie diese, in der Begeisterung Orakel- und Weisheitssprüche: als der mitleidende ist er zugleich der weise, aus dem Herzen der Welt die Wahrheit verkündende. So entsteht denn jene phantastische und so anstössig scheinende Figur des weisen und begeisterten Satyrs, der zugleich „der tumbe Mensch“ im Gegensatz zum Gotte ist: Abbild der Natur und ihrer stärksten Triebe, ja Symbol derselben und zugleich Verkünder ihrer Weisheit und Kunst: Musiker, Dichter, Tänzer, Geisterseher in einer Person.
Dionysus, der eigentliche Bühnenheld und Mittelpunkt der Vision, ist gemäss dieser Erkenntniss und gemäss der Ueberlieferung, zuerst, in der allerältesten Periode der Tragoedie, nicht wahrhaft vorhanden, sondern wird nur als vorhanden vorgestellt: d.h. ursprünglich ist die Tragoedie nur „Chor“ und nicht „Drama“. Später ward nun der Versuch gemacht, den Gott als einen realen zu zeigen und die Visionsgestalt sammt der verklärenden Umrahmung als jedem Auge sichtbar darzustellen: damit beginnt das „Drama“ im engern Sinne. Jetzt bekommt der dithyrambische Chor die Aufgabe, die Stimmung der Zuhörer bis zu dem Grade dionysisch anzuregen, dass sie, wenn der tragische Held auf der Bühne erscheint, nicht etwa den unförmlich maskirten Menschen sehen, sondern eine gleichsam aus ihrer eignen Verzückung geborene Visionsgestalt. Denken wir uns Admet mit tiefem Sinnen seiner jüngst abgeschiedenen Gattin Alcestis gedenkend und ganz im geistigen Anschauen derselben sich verzehrend — wie ihm nun plötzlich eine ähnlich gestaltete, ähnlich schreitende Frauengestalt in Verhüllung entgegengeführt wird: denken wir uns seine plötzliche zitternde Unruhe, sein stürmisches Vergleichen, seine instinktive Ueberzeugung — so haben wir ein Analogon zu der Empfindung, mit der der dionysisch erregte Zuschauer den Gott auf der Bühne heranschreiten sah, mit dessen Leiden er bereits eins geworden ist. Unwillkürlich übertrug er das ganze magisch vor seiner Seele zitternde Bild des Gottes auf jene maskirte Gestalt und löste ihre Realität gleichsam in eine geisterhafte Unwirklichkeit auf. Diess ist der apollinische Traumzustand, in dem die Welt des Tages sich verschleiert und eine neue Welt, deutlicher, verständlicher, ergreifender als jene und doch schattengleicher, in fortwährendem Wechsel sich unserem Auge neu gebiert. Demgemäss erkennen wir in der Tragoedie einen durchgreifenden Stilgegensatz: Sprache, Farbe, Beweglichkeit, Dynamik der Rede treten in der dionysischen Lyrik des Chors und andrerseits in der apollinischen Traumwelt der Scene als völlig gesonderte Sphären des Ausdrucks auseinander. Die apollinischen Erscheinungen, in denen sich Dionysus objektivirt, sind nicht mehr „ein ewiges Meer, ein wechselnd Weben, ein glühend Leben“, wie es die Musik des Chors ist, nicht mehr jene nur empfundenen, nicht zum Bilde verdichteten Kräfte, in denen der begeisterte Dionysusdiener die Nähe des Gottes spürt: jetzt spricht, von der Scene aus, die Deutlichkeit und Festigkeit der epischen Gestaltung zu ihm, jetzt redet Dionysus nicht mehr durch Kräfte, sondern als epischer Held, fast mit der Sprache Homers.
II
Alles, was im apollinischen Theile der griechischen Tragoedie, im Dialoge, auf die Oberfläche kommt, sieht einfach, durchsichtig, schön aus. In diesem Sinne ist der Dialog ein Abbild des Hellenen, dessen Natur sich im Tanze offenbart, weil im Tanze die grösste Kraft nur potenziell ist, aber sich in der Geschmeidigkeit und Ueppigkeit der Bewegung verräth. So überrascht uns die Sprache des sophokleischen Helden durch ihre apollinische Bestimmtheit und Helligkeit, so dass wir sofort bis in den innersten Grund ihres Wesens zu blicken wähnen, mit einigem Erstaunen, dass der Weg bis zu diesem Grunde so kurz ist. Sehen wir aber einmal von dem auf die Oberfläche kommenden und sichtbar werdenden Charakter des Helden ab — der im Grunde nichts mehr ist als das auf eine dunkle Wand geworfene Lichtbild d.h. Erscheinung durch und durch — dringen wir vielmehr in den Mythus ein, der in diesen hellen Spiegelungen sich projicirt, so erleben wir plötzlich ein Phänomen, das ein umgekehrtes Verhältniss zu einem bekannten optischen hat. Wenn wir bei einem kräftigen Versuch die Sonne in’s Auge zu fassen, uns geblendet abwenden, so haben wir dunkle farbige Flecken gleichsam als Heilmittel vor den Augen: umgekehrt sind jene Lichtbilderscheinungen des sophokleischen Helden, kurz das Apollinische der Maske, nothwendige Erzeugungen eines Blickes in’s Innere und Schreckliche der Natur, gleichsam leuchtende Flecken zur Heilung des von grausiger Nacht versehrten Blickes. Nur in diesem Sinne dürfen wir glauben, den ernsthaften und bedeutenden Begriff der „griechischen Heiterkeit“ richtig zu fassen; während wir allerdings den falsch verstandenen Begriff dieser Heiterkeit im Zustande ungefährdeten Behagens auf allen Wegen und Stegen der Gegenwart antreffen.
Die leidvollste Gestalt der griechischen Bühne, der unglückselige Oedipus ist von Sophokles als der edle Mensch verstanden worden, der zum Irrthum und zum Elend trotz seiner Weisheit bestimmt ist, der aber am Ende durch sein ungeheures Leiden eine magische segensreiche Kraft um sich ausübt, die noch über sein Verscheiden hinaus wirksam ist. Der edle Mensch sündigt nicht, will uns der tiefsinnige Dichter sagen: durch sein Handeln mag jedes Gesetz, jede natürliche Handlung, ja die sittliche Welt zu Grunde gehen, eben durch dieses Handeln wird ein höherer magischer Kreis von Wirkungen gezogen, die eine neue Welt auf den Ruinen der umgestürzten alten gründen. Das will uns der Dichter, insofern er zugleich religiöser Denker ist, sagen: als Dichter zeigt er uns zuerst einen wunderbar geschürzten Prozessknoten, den der Richter langsam, Glied für Glied, zu seinem eigenen Verderben löst; die echt hellenische Freude an dieser dialektischen Lösung ist so gross, dass hierdurch ein Zug von überlegener Heiterkeit über das ganze Werk kommt, der den schauderhaften Voraussetzungen jenes Prozesses überall die Spitze abbricht. Im „Oedipus auf Kolonos“ treffen wir diese selbe Heiterkeit, aber in eine unendliche Verklärung emporgehoben: dem vom Uebermaasse des Elends betroffenen Greise gegenüber, der allem, was ihn trifft, rein als Leidender preisgegeben ist — steht die überirdische Heiterkeit, die aus göttlicher Sphaere herniederkommt und uns andeutet, dass der traurige Held in seinem rein passiven Verhalten seine höchste Aktivität erlangt, die weit über sein Leben hinausgreift, während sein bewusstes Tichten und Trachten im früheren Leben ihn nur zur Passivität geführt hat. So wird der für das sterbliche Auge unauflöslich verschlungene Prozessknoten der Oedipusfabel langsam entwirrt — und die tiefste menschliche Freude überkommt uns bei diesem göttlichen Gegenstück der Dialektik. Wenn wir mit dieser Erklärung dem Dichter gerecht geworden sind, so kann doch immer noch gefragt werden ob damit der Inhalt des Mythus erschöpft ist: und hier zeigt sich, dass die ganze Auffassung des Dichters nichts ist als eben jenes Lichtbild, welches uns, nach einem Blick in den Abgrund, die heilende Natur vorhält. Oedipus, der Mörder seines Vaters, der Gatte seiner Mutter, Oedipus der Räthsellöser der Sphinx! Was sagt uns die geheimnissvolle Dreiheit dieser Schicksalsthaten? Es gibt einen uralten, besonders persischen Volksglauben, dass ein weiser Magier nur aus Incest geboren werden könne: was wir uns, im Hinblick auf den räthsellösenden und seine Mutter freienden Oedipus, sofort so zu interpretieren haben, dass dort, wo durch weissagende und magische Kräfte der Bann von Gegenwart und Zukunft, das starre Gesetz der Individuation, und überhaupt der eigentliche Zauber der Natur gebrochen ist, eine ungeheure Naturwidrigkeit — wie dort der Incest — als Ursache vorausgegangen sein muss; denn wie könnte man die Natur zum Preisgeben ihrer Geheimnisse zwingen, wenn nicht dadurch, dass man ihr siegreich widerstrebt, d.h. durch das Unnatürliche? Diese Erkenntniss sehe ich in jener entsetzlichen Dreiheit der Oedipusschicksale ausgeprägt: derselbe, der das Räthsel der Natur — jener doppelgearteten Sphinx — löst, muss auch als Mörder des Vaters und Gatte der Mutter die heiligsten Naturordnungen zerbrechen. Ja, der Mythus scheint uns zuraunen zu wollen, dass die Weisheit und gerade die dionysische Weisheit ein naturwidriger Greuel sei, dass der, welcher durch sein Wissen die Natur in den Abgrund der Vernichtung stürzt, auch an sich selbst die Auflösung der Natur zu erfahren habe. „Die Spitze der Weisheit kehrt sich gegen den Weisen: Weisheit ist ein Verbrechen an der Natur“: solche schreckliche Sätze ruft uns der Mythus zu: der hellenische Dichter aber berührt wie ein Sonnenstrahl die erhabene und furchtbare Memnonssäule des Mythus, so dass er plötzlich zu tönen beginnt — in sophokleischen Melodieen!
Der Glorie der Passivität stelle ich jetzt die Glorie der Aktivität gegenüber, welche den Prometheus des Aeschylus umleuchtet. Was uns hier der Denker Aeschylus zu sagen hatte, was er aber als Dichter durch sein gleichnissartiges Bild uns nur ahnen lässt, das hat uns der jugendliche Goethe in den verwegenen Worten seines Prometheus zu enthüllen gewusst:
„Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu geniessen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!“
Der Mensch, in’s Titanische sich steigernd, erkämpft sich selbst seine Kultur und zwingt die Götter sich mit ihm zu verbinden, weil er in seiner selbsteignen Weisheit die Existenz und die Schranken der Götter in seiner Hand hat. Das Wunderbarste an jenem Prometheusgedicht, das seinem Grundgedanken nach der eigentliche Hymnus der Unfrömmigkeit ist, ist aber der tiefe aeschyleische Zug nach Gerechtigkeit: das unermessliche Leid des kühnen „Einzelnen“ auf der einen Seite, und die göttliche Noth, ja Ahnung einer Götterdämmerung auf der andern, die zur Versöhnung, zum metaphysischen Einssein zwingende Macht jener beiden Leidenswelten — dies alles erinnert auf das Stärkste an den Mittelpunkt und Hauptsatz der aeschyleischen Weltbetrachtung, die über Göttern und Menschen die Moira als ewige Gerechtigkeit thronen sieht. Bei der erstaunlichen Kühnheit, mit der Aeschylus die olympische Welt auf seine Gerechtigkeitswagschalen stellt, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass der tiefsinnige Grieche einen unverrückbar festen Untergrund des metaphysischen Denkens in seinen Mysterien hatte, und dass sich an den Olympiern alle seine sceptischen Anwandelungen entladen konnten. Der griechische Künstler insbesondere empfand im Hinblick auf diese Gottheiten ein dunkles Gefühl wechselseitiger Abhängigkeit: und gerade im Prometheus des Aeschylus ist dieses Gefühl symbolisirt. Der titanische Künstler fand in sich den trotzigen Glauben, Menschen schaffen und olympische Götter wenigstens vernichten zu können: und diess durch seine höhere Weisheit, die er freilich durch ewiges Leiden zu büssen gezwungen war. Das herrliche „Können“ des grossen Genius, das selbst mit ewigem Leide zu gering bezahlt ist, der herbe Stolz des Künstlers — das ist Inhalt und Seele der aeschyleischen Dichtung, während Sophokles in seinem Oedipus das Siegeslied des Heiligen präludirend anstimmt. Aber auch mit jener Deutung, die Aeschylus dem Mythus gegeben hat, ist dessen erstaunliche Schreckenstiefe nicht ausgemessen: vielmehr ist die Werdelust des Künstlers, die jedem Unheil trotzende Selbstgenugsamkeit des künstlerischen Schaffens nur ein lichtes Wolken- und Himmelsbild, das sich auf einem schwarzen See der Traurigkeit spiegelt. Die Prometheussage ist ein ursprüngliches Eigenthum der gesammten arischen Völkergemeinde und ein Dokument für deren Begabung zum Tiefsinnig-Tragischen, ja es möchte nicht ohne Wahrscheinlichkeit sein, dass diesem Mythus für das arische Wesen eben dieselbe charakteristische Bedeutung innewohnt, die der Sündenfallmythus für das semitische hat, und dass zwischen beiden Mythen ein Verwandtschaftsgrad existirt, wie zwischen Bruder und Schwester. Die Voraussetzung jenes Prometheusmythus ist der überschwengliche Werth, den eine naive Menschheit dem Feuer beilegt als dem wahren Palladium jeder aufsteigenden Kultur: dass aber der Mensch frei über das Feuer waltet und es nicht nur durch ein Geschenk vom Himmel, als zündenden Blitzstrahl oder wärmenden Sonnenbrand empfängt, erschien jenen beschaulichen Urmenschen als ein Frevel, als ein Raub an der göttlichen Natur. Und so stellt gleich das erste philosophische Problem einen peinlichen unlösbaren Widerspruch zwischen Mensch und Gott hin und rückt ihn wie einen Felsblock an die Pforte jeder Kultur. Das Beste und Höchste, dessen die Menschheit theilhaftig werden kann, erringt sie durch einen Frevel und muss nun wieder seine Folgen dahinnehmen, nämlich die ganze Fluth von Leiden und von Kümmernissen, mit denen die beleidigten Himmlischen das edel emporstrebende Menschengeschlecht heimsuchen — müssen: ein herber Gedanke, der durch die Würde, die er dem Frevel ertheilt, seltsam gegen den semitischen Sündenfallmythus absticht; in welchem die Neugierde, die lügnerische Vorspiegelung, die Verführbarkeit, die Lüsternheit, kurz eine Reihe vornehmlich weiblicher Affektionen als der Ursprung des Uebels angesehen werden. Das, was die arische Vorstellung auszeichnet, ist die erhabene Ansicht von der aktiven Sünde als der eigentlich prometheischen Tugend: womit zugleich der ethische Untergrund der pessimistischen Tragoedie gefunden ist, als die Rechtfertigung des menschlichen Uebels, und zwar sowohl der menschlichen Schuld als des dadurch verwirkten Leidens. Das Unheil im Wesen der Dinge — das der beschauliche Arier nicht geneigt ist weg zu deuteln — der Widerspruch im Herzen der Welt offenbart sich ihm als ein Durcheinander verschiedener Welten, z.B. einer göttlichen und einer menschlichen, von denen jede als Individuum im Recht ist, aber als Einzelne neben einer andern für ihre Individuation zu leiden hat. Bei dem heroischen Drange des Einzelnen in’s Allgemeine, bei dem Versuche, über den Bann der Individuation hinauszuschreiten und das eine Weltwesen selbst sein zu wollen, erleidet er an sich den in den Dingen verborgenen Urwiderspruch d.h. er frevelt und leidet. So wird von den Ariern der Frevel als Mann, von den Semiten die Sünde als Weib verstanden, so wie auch der Urfrevel vom Manne, die Ursünde vom Weibe begangen wird. Uebrigens sagt der Hexenchor:
„Wir nehmen das nicht so genau:
Mit tausend Schritten macht’s die Frau;
Doch wie sie auch sich eilen kann,
Mit einem Sprunge macht’s der Mann“.
Wer jenen innersten Kern der Prometheussage versteht — nämlich die dem titanisch strebenden Individuum gebotene Nothwendigkeit des Frevels — der muss auch zugleich das Unapollinische dieser pessimistischen Vorstellung empfinden: denn Apollo will die Einzelwesen gerade dadurch zur Ruhe bringen, dass er Grenzlinien zwischen ihnen zieht und dass er immer wieder an diese als an die heiligsten Weltgesetze mit seinen Forderungen der Selbsterkenntniss und des Maasses erinnert. Damit aber bei dieser apollinischen Tendenz die Form nicht zu aegyptischer Steifigkeit und Kälte erstarre, damit nicht unter dem Bemühen, der einzelnen Welle ihre Bahn und ihr Bereich vorzuschreiben, die Bewegung des ganzen See’s ersterbe, zerstört von Zeit zu Zeit wieder die hohe Fluth des Dionysischen alle jene kleinen Zirkel, in die der einseitig apollinische „Wille“ das Hellenenthum zu bannen sucht. Jene plötzlich anschwellende Fluth des Dionysischen nimmt dann die einzelnen kleinen Wellenberge der Individuen auf ihren Rücken, wie der Bruder des Prometheus, der Titan Atlas die Erde. Dieser titanische Drang, gleichsam der Atlas aller Einzelnen zu werden und sie mit breitem Rücken höher und höher, weiter und weiter zu tragen, ist das Gemeinsame zwischen dem Prometheischen und dem Dionysischen. Der aeschyleische Prometheus ist in diesem Betracht eine dionysische Maske, während in jenem vorhin erwähnten tiefen Zuge nach Gerechtigkeit Aeschylus seine väterliche Abstammung von Apollo, dem Gotte der Individuation und der Gerechtigkeitsgrenzen, dem Einsichtigen verräth. Und so möchte das Doppelwesen des aeschyleischen Prometheus, seine zugleich dionysische und apollinische Natur in begrifflicher Formel so ausgedrückt werden können — zum Erstaunen des Logikers Euripides: „alles Vorhandene ist gerecht und ungerecht und in beidem gleich berechtigt“.
Das ist deine Welt! Das heisst eine Welt! —
Es ist eine unanfechtbare Ueberlieferung, dass die griechische Tragoedie in ihrer ältesten Gestalt nur die Leiden des Dionysus zum Gegenstand hatte, und dass der längere Zeit hindurch einzig vorhandene Bühnenheld eben Dionysus war. Aber mit der gleichen Sicherheit darf behauptet werden, dass niemals bis auf Euripides Dionysus aufgehört hat, der tragische Held zu sein, sondern dass alle die berühmten Figuren der griechischen Bühne, Prometheus, Oedipus u.s.w. nur Masken jenes ursprünglichen Helden Dionysus sind. Dass hinter allen diesen Masken eine Gottheit steckt, das ist der eine wesentliche Grund für die so oft angestaunte typische „Idealität“ jener berühmten Figuren. Es hat ich weiss nicht wer behauptet, dass alle Individuen als Individuen komisch und damit untragisch seien: woraus zu entnehmen wäre, dass die Griechen überhaupt Individuen auf der tragischen Bühne nicht ertragen konnten. In der That scheinen sie so empfunden zu haben: wie überhaupt jene platonische Unterscheidung und Werthabschätzung der „Idee“, im Gegensatze zum „Idol“, zum Abbild, tief im hellenischen Wesen begründet liegt. Um uns aber der Terminologie Plato’s zu bedienen, so wäre von den tragischen Gestalten der hellenischen Bühne so zu reden: der eine wahrhaft reale Dionysus erscheint in einer Vielheit der Gestalten, in der Maske eines kämpfenden Helden und gleichsam in das Netz des Einzelwillens verstrickt. So wie jetzt der erscheinende Gott redet und handelt, ähnelt er einem irrenden, strebenden, leidenden Individuum: und dass er überhaupt mit dieser epischen Bestimmtheit und Deutlichkeit erscheint, ist die Wirkung des Traumdeuters Apollo, der dem Chore seinen dionysischen Zustand durch jene gleichnissartige Erscheinung deutet. In Wahrheit aber ist jener Held der leidende Dionysus der Mysterien, jener die Leiden der Individuation an sich erduldende Gott, von dem wundervolle Mythen erzählen, wie er als Knabe von den Titanen zerstückelt worden sei und nun in diesem Zustande als Zagreus verehrt werde: wobei angedeutet wird, dass diese Zerstückelung, das eigentlich dionysische Leiden